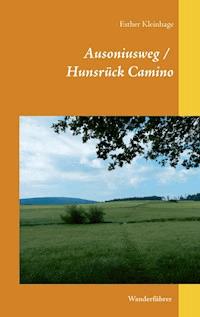Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Es gehört schon eine Portion Mut und Neugier dazu, sich als Frau allein auf einen 2.100 km langen Fussmarsch quer durch Europa zu machen. Esther Kleinhage bricht an einem Wendepunkt in ihrem Leben auf und geht zu Fuss von Lausanne in der Schweiz über viele verschiedene Jakobswege bis nach Santiago de Compostela in Spanien. Die täglichen Ungewissheiten des Weges mit Humor und Offenheit zu akzeptieren und bis zum Schluss durchzuhalten, gibt ihr neuen Lebensmut und das Selbstvertrauen, wichtige Dinge anders zu sehen und konsequenter zu handeln. Der Weg lehrt sie, scheinbar kleine Begebenheiten wieder zu geniessen, still zu werden und auf sich selbst zu lauschen. Die Autorin lässt uns hautnah teilhaben am Lebensgefühl der Pilger auf dem Weg, an den intensiven Begegnungen und auch an einer unerwarteten Unterwegs-Liebesgeschichte. Sie macht die Erfahrung, dass man nicht viel mehr braucht, als in einen Rucksack passt. Dieses mit Charme und Esprit geschriebene Reisetagebuch ist ein Muss für alle, die sich für den Jakobsweg interessieren und auch eine motivierende Lektüre für Menschen, die in einem schwierigen Lebensabschnitt neue Kraft suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke an meinen Mann, dass er mich gehen und wiederkommen ließ
Danke an meine Familie und Freunde für ihre ständige Unterstützung in Gedanken, sms, Emails und Anrufen
Danke den Personen, die während meiner Pilgerschaft und über sie hinaus bleibende Eindrücke und Einflüsse hinterlassen haben:
Jeannette Kolly
Fabien und Eric
allen Pilgerfreunden von unterwegs
den vielen privaten, kommunalen und kirchlichen Herbergsleitern und Hospitaleros
“Für Christian”
Inhalt
Vorwort
Der Schweizer Jakobsweg
Die Via Gebennensis
Die Via Podiensis
Der Küstenweg
Der Weg zum Ende der Welt
Vorwort
In vielerlei Hinsicht habe ich diesem Buch meine persönlichen Erfahrungen auf dem Jakobsweg von Lausanne in der Schweiz bis nach Santiago de Compostela und weiter zum Kap Finisterre zugrunde gelegt. Ich habe diese 2‘100 Kilometer vom 7. bis 12. Mai 2012 sowie vom 29. Mai bis 18. August 2012 auf meinen eigenen zwei Füßen und mit selbst getragenen 10 bis 15 kg Gepäck zurückgelegt.
Gleichzeitig ist es mir wichtig zu betonen, dass es sich nicht um eine Autobiografie handelt, sondern dass ich meine Eindrücke und Erlebnisse mit den (teilweise fiktiven) Erfahrungen anderer (teilweise fiktiver) Pilger und Bekanntschaften vermischt und aufgepeppt habe.
Mir ging es mehr darum, den Geist des Weges, so wie ich ihn wahrgenommen habe, wiederzugeben, als um eine detailgetreue Erzählung meiner persönlichen Erfahrungen. Auch habe ich auf landschaftsgetreue Beschreibungen des Weges nur dann zurückgegriffen, wenn diese für den Tagesablauf relevant waren.
Insofern ist dieses Buch weniger eine Beschreibung des Jakobsweges als vielmehr eine Beschreibung des Gehens auf demselben.
Was aus den Pilgern geworden ist, die ich tatsächlich kennenlernen durfte, habe ich am Ende kurz zusammengetragen, insofern ich davon etwas in Erfahrung bringen konnte._
Tag 1 bis 3
Der Schweizer Jakobsweg Lausanne – Genf
Tag X: Lausanne
Wenn alles ganz anders kommt…
So war es eben nicht geplant…
Ich wollte raus aus allem, wollte meinen Tag wieder selbst gestalten, etwas Aktives tun, das Gefühl genießen, eine Aufgabe zu haben, für die es sich lohnt aufzustehen. Mit dieser Idee war ich vor einer Woche aufgebrochen, auf den Jakobsweg. Relativ zufällig und spontan, sofern das glaubhaft ist, wenn man für mehrere Wochen auf eine Reise aufbricht.
Selbstverständlich hatte ich schon vom Jakobsweg gehört, war mit meinem Mann auf Tagesausflügen auch schon auf Teilstrecken gewandert. Das ist ganz natürlich, wenn der Jakobsweg ganz in der Nähe verläuft und man ab und an am Sonntagnachmittag wandern geht. Dass ich aber eines Tages meine Wohnungstür hinter mir schließen würde, um mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken für unbestimmte Zeit Richtung Südwesten aufzubrechen, noch dazu auf einem Pilgerweg, das schien mir bis zu diesem Zeitpunkt zu religiös und auch ein wenig zu extrem.
Aber dann hatte es nur eine in meinen Augen unfaire und unverdiente Kündigung gebraucht, einen in meinen Augen unfähigen und nicht sehr loyalen Arzt und den unvermeidlichen Ärger mit Behörden und Ämtern, um mich nach drei Monaten des Daheim-Sitzens und Auf-Besserung-Wartens, des Kämpfens und Resignierens zu der Einsicht zu bringen, dass sich in meinem Leben etwas gewaltig ändern müsste. Ich fühlte mich definitiv nicht bereit, mich auf die nächste Arbeitsstelle zu stürzen. Ich wollte eine Auszeit und hatte das Gefühl, diese nach den langen Jahren in Festanstellung auch verdient zu haben. Diese Erkenntnis bereitete mir einige schlaflose Nächte mit Fragen und Selbstzweifeln, was ich mit dieser freien Zeit anfangen sollte, wie ich sie gestalten müsste, wie ich in meinem Leben dauerhaft etwas ändern könnte und ob ich überhaupt herausfinden würde, was sich ändern müsste.
Bis zu dieser einen Nacht Ende April, in der ich mich unterwegs sah. Durch grüne Wälder und entlang eines Baches, mit einem Rucksack, einem ziemlich großen sogar, und dem Gefühl endloser Freiheit. Diese Vision dauerte an und fühlte sich im Vergleich zu anderen Ideen, wie zum Beispiel einem Meditations-Seminar mit Schweigegelübde, richtig und mir wie auf den Leib geschnitten an. Nach einer kurzen Recherche im Internet nach Wanderwegen, die tatsächlich irgendwohin führen (denn um Tagesausflüge ging es ja nicht mehr) und auf denen man als Frau mehr oder weniger bedenkenlos allein unterwegs sein kann, schloss sich der Kreis: Der Schweizer Jakobsweg führt nicht nur durch unsere Gegend, sondern wie zufällig an meiner Haustür vorbei. Die Entscheidung war getroffen.
Ich ließ diese Vorstellung einige Tage sacken, bis ich zum ersten Mal mit meiner Familie und meinem Mann sprach. Die Reaktionen waren durchweg positiv, die Unterstützung groß und einige wenige Tage später war der große Moment gekommen.
Tag X -6: Lausanne – Rolle (33 km)
Nicht dass ich an Engel glaubte – aber dieser kam genau richtig
Mein Rucksack für den Jakobsweg war gepackt. Natürlich hatte ich gelesen, dass das Gewicht maximal 10% des Eigengewichts sein sollte, idealerweise sogar nur 8%, aber ich musste davon ausgehen, dass es sich hier um Kalkulationen für normal gebaute Männer mit einem Körpergewicht von mindestens 80 Kilo handelte. Wie ich mit fünf Kilogramm Gepäck für 70 Tage Wanderung auskommen sollte, war mir schleierhaft. Ich hatte mich, soweit es irgendwie möglich war, auf das Allernötigste beschränkt. Nachdem alles optimal zusammengepresst war, stand ein enormer Rucksack mit rund 15 Kilo Gewicht vor mir.
Der Abschied am Morgen war tränenreich. Mein Mann brach zur Arbeit auf und würde am Abend wieder nach Hause zu den Katzen kommen, während ich für mehrere Wochen unterwegs sein würde. Natürlich kam die Frage an mich selbst, warum ich aufbrach. Ich konnte sie nicht genauer beantworten, nur dass ich raus musste, war mir klar.
Die ersten Schritte durch den Park, den Berg hinunter, bis zum See. Der so bekannte Weg, unzählige Male beim Joggen, auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Bushaltestelle, zurück gelegt, war nun der Anfang eines aufregenden und gleichzeitig beängstigenden Abenteuers. In den ersten Stunden kamen mir immer wieder die Tränen, auch wenn viele Textnachrichten und sogar Anrufe meiner Familie und Freunde mich aufbauten, mich anspornten und mir vor allem das Gefühl vermittelten, dass man heutzutage ja nie wirklich aus der Welt ist, selbst als Pilger unterwegs.
Den Weg des ersten Tages kannte ich auf den meisten Abschnitten, war ihn mit meinem Mann schon einmal gewandert. Er war wunderschön, meistens entlang des Sees, durch die privilegierten Ortschaften zwischen den Weinbergen und dem See, ruhig aber doch nicht verlassen.
Nur das Gewicht des Rucksacks hatte ich unterschätzt. Nicht nur dass meine Schultern schmerzten und meine Füße wehtaten, sogar die Hüfte zeigte Ermüdungserscheinungen. So richtig Spaß empfand ich bei dieser Pilgerschaft bisher nicht.
Da ich die Gegend einigermaßen kannte, plante ich meine Mittagspause nach dem Industriegebiet von Etoy, wo ich mich mit Orangensaft, einer großen Flasche Wasser, Baguettebrot und Käse versorgte. Was ich dabei nicht richtig eingeschätzt hatte, war das Extra-Gewicht dieser Verpflegung. Der Weg vom Supermarkt bis zum nächstgelegenen Rastplatz mit Bank und Tisch war unerträglich lang, nicht nur weil ich mich ausgerechnet hier zum ersten Mal verlief, sondern weil meine Energie gegen Null ging und mir alles wehtat. Die Pause im Schatten des Waldes, mit einer roten Schmusekatze, die irgendwo aus dem Nichts auftauchte und den Käse mit mir teilen wollte, war mehr als überfällig geworden und reichte dann doch nicht, um meine Energiespeicher wieder aufzufüllen.
Ich war ohne große Planung aufgebrochen, im Vertrauen darauf, dass der Jakobsweg gut genug ausgeschildert sei, dass ich in der Schweiz ja noch mein Smartphone hatte, um eventuelle Unklarheiten zu googeln und dass ich, bis ich in Frankreich sein würde, sicher alles mitbekommen hätte, was man auf dem Jakobsweg für das tägliche Überleben braucht. Frankreich sollte ich innerhalb von zwei bis drei Tagen erreichen, denn die Grenze war nur 60 Kilometer entfernt. Einen Schnitt von 30 Kilometern am Tag traute ich mir bei meiner sportlichen Kondition durchaus zu. Aber das dünne Heftchen, das mir die Touristeninformation in Lausanne als einzige Information über den Jakobsweg mitgegeben hatte, ging eher von drei Tagesetappen aus. Ich hatte bewusst auf Reservationen in Pensionen verzichtet, wollte jeden Tag meiner Laune und Energie anpassen und dadurch viel flexibler sein als in meinem regulären, sehr durchgeplanten Alltag. Aber ein Schnitt von 30 Kilometern am Tag sollte schon möglich sein.
Doch als ich an einem Wegweiser ankam, der nach Allaman 20 Minuten Laufzeit angab, zum nächstgelegenen Etappenziel Rolle aber über eine Stunde, musste ich mir eingestehen, dass ich mein Etappenziel von 33 Kilometern am ersten Tag wohl nicht erreichen würde. Also ging ich Richtung Allaman, um mir dort ein Zimmer in einer Pension zu suchen. Plötzlich, wie aus dem Nichts, standen Jeannette und ihr Begleiter Gilbert neben mir, begannen ein Gespräch mit mir, über den Jakobsweg und dass sie ihn auch schon gegangen sind, in vielen kleinen Etappen aber schlussendlich im Ganzen, von Rolle bis Santiago de Compostela. So traf ich meine ersten Engel, noch bevor ich von diesen Engeln auf dem Jakobsweg gehört hatte: Hilfsbereite Menschen, die einem genau dann unter die Arme greifen, wenn man gerade den Mut verliert. Rolle, da wohnte Jeannette und sie bot mir spontan ihr Gästezimmer an. Das sei zwar noch nicht offiziell auf der Liste der Unterkünfte für Jakobspilger eingetragen, aber sie würde sich freuen, wenn ich ihr erster Gast sein würde. Ich hätte gerne zugesagt, vor allem weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo und was ich in Allaman an Unterkunft finden würde, aber der Weg nach Rolle schien mir für diesen Tag unüberwindbar. Als Jeannette und Gilbert meine Müdigkeit und Unsicherheit bemerkten, boten sie mir an, mich in ihrem Auto mitzunehmen, das nur wenige Gehminuten entfernt stand. Sie unterbrachen tatsächlich ihren gerade begonnen Nachmittagsspaziergang, um mich müde, unerfahrene, ziemlich überforderte und vor allem total überladene Pilgerin mit nach Hause zu nehmen.
Und diese erste Unterkunft in Rolle war grandioser Luxus. Ein eigenes Zimmer, ein eigenes Bad mit Badewanne (schade, dass ich mich nicht traute, ein heißes Bad zu nehmen), eine besorgte, aber ebenfalls noch unerfahrene Gastgeberin! Nach einer heißen Dusche, bei der mir die Beine zitterten, verbrachte ich den restlichen Nachmittag in strahlendem Sonnenschein auf der Terrasse. Das Abendessen besorgte ich mir im nahegelegenen Supermarkt und aß es unterwegs, um den Tagesablauf meiner Gastgeberin nicht noch weiter zu stören. Dafür war der gemeinsame Abend bei Pfefferminztee aus Jeannettes Garten lehrreich, denn Jeannette bestand darauf, dass ich ihre Unterlagen für die Via Gebennensis mitnahm, das Teilstück des Jakobswegs von Genf bis Le Puy. Sie stammten zwar aus dem Jahr 2008 und schienen somit ziemlich überholt, waren aber letztlich doch von Nutzen.
Obwohl ich meiner freundlichen Gastgeberin wirklich dankbar war, verabschiedete ich mich, so früh es die Höflichkeit zuließ, ins Bett, wo ich in eine Art Fiebertraum fiel. Mehrmals in der Nacht wachte ich auf, nicht nur, weil am Haus Züge vorbeirasten, sondern vor allem weil mich Hitzeattacken, Schweißausbrüche und Schmerzen peinigten. Gilbert hatte mir erklärt, dass der Körper drei bis vier Tage brauche, um sich an die ungewohnte Anforderungen zu gewöhnen! Ich ging in dieser Nacht davon aus, dass ich nicht einmal diese ersten Tage schaffen würde.
Tag X -5: Rolle – Bogis Bossey (26 km)
Was machen all diese Menschen in einem ökumenischen Zentrum im Nirgendwo?
Der Tag begann mit einer von Jeannette überreichten Schmerztablette. Sie versicherte mir, dass es normal und gut sei, den Körper, wenn nötig, mit etwas Chemie zu unterstützen. Mir tat alles weh: Muskelkater in den Beinen, Schmerzen in den Schultern vom Rucksack, der ganze Körper gerädert. Ich fühlte mich leer, hatte Magenschmerzen und Übelkeit, konnte kaum Nahrung zu mir nehmen.
Jeannettei hatte mir die Adresse einer Bekannten in Commugny mit auf dem Weg gegeben, für die kommende Nacht. Es schien mit rund 30 Kilometern wieder eine ideale Etappe.
Den Tag wanderte ich entlang der Weinberge, mit Blick auf den See, durch grüne Wälder und rot blühende Wiesen. In mir wuchs die Erkenntnis, dass ich mit meinem Rucksack Freund werden musste. Er war eindeutig zu schwer, das machte die Umsetzung dieser überaus sinnvollen Idee nicht leichter. Aber es half auch nicht, sich den ganzen Tag mit den Schmerzen zu beschäftigen. Allerdings war ja auch niemand sonst da, der mich davon hätte ablenken können. So kreisten meine Gedanken um meine körperlichen Leiden oder um meinen unfairen Chef, um meine Ersparnisse und wie lange sie wohl reichen würden, und um die unendlich oft durchgeführte Rechnung, dass ich ja in 70 Tagen am Ziel sein würde, wenn ich die 2‘000 Kilometer bis Santiago in 30 Kilometer-Etappen einteilen könnte. Das wäre dann gerade rechtzeitig vor dem berüchtigten Tag des Heiligen Jakobus, an dem Santiago überfüllt sein würde, weil dann alle Pilger dort sein wollten. Aber ich empfand mich nicht als typische Pilgerin und wollte das unbedingt vermeiden. Also hatte ich sogar eine Woche Puffer eingeplant, um vor dem 25. Juli wieder aus Santiago abgereist zu sein.
Der Kontakt mit Jeannettes Bekannter kam trotz mehrfacher Anrufe nicht zustande. Als ich an dem ökumenischen Zentrum von Bogis-Bossey vorbeiging und Jeannettes Bekannte noch immer nicht reagiert hatte, entschied ich spontan, dort nach einem Zimmer zu fragen. Der Preis war zwar mein oberstes Tageslimit, aber meine Füße und Schultern waren an diesem Tag um das vorzeitige Ende dankbar, obwohl ich weniger Kilometer als vorgesehen geschafft hatte.
Nach der Dusche und einer ausgedehnten Pause in meiner Zelle mit Einzelbett, Fernsehen und Wifi fühlte ich mich wieder recht gut und musste mir eingestehen, dass es wohl sinnvoller sein würde, langsamer und mit mehr Pausen zu gehen, dafür länger und vielleicht sogar weiter. Mein bisheriger Stil, die Kilometer so schnell wie möglich abzurackern, hatte dazu geführt, dass ich in dem ökumenischen Zentrum, wo sich vor allem Gruppen aufhielten, allein zweieinhalb Stunden auf das Abendessen warten musste. Was all diese Menschen in der Abgeschiedenheit von Bogis-Bossey zu tun hatten, konnte ich nicht herausfinden – wohl aber, dass man sich vor allem unter Menschen sehr einsam fühlen kann. Ich war froh, mein Smartphone dabei zu haben. Noch besser wäre es gewesen, wenn ich auf die paar Hundert Gramm Mehrgewicht eines Buches nicht verzichtet hätte.
Tag X -4: Bogis-Bossey – Genf (27 km)
Große Lernmomente
Nicht einfach, motiviert und gut gelaunt loszugehen, wenn es morgens um acht Uhr nicht nur grau und trübe ist, sondern auch nieselt. Aber damit musste Anfang Mai in der Schweiz gerechnet werden und glücklicherweise klarte das Wetter auch recht schnell auf.
Der Weg nach Genf war mir nur möglich, weil ich die Gegend und die Richtung kannte und man eigentlich kaum falsch gehen kann, solange der See links liegt. Wegweiser suchte ich oft vergeblich und mehr als einmal musste ich umdrehen und mich neu orientieren. Dabei stellte ich allerdings fest, dass es mich immer weniger stresste, wenn ich falsch gelaufen war, dass ich es einfach hinnehmen konnte. Offenbar würde auf diesem Weg wohl nicht alles nach meinem Plan ablaufen.
In mir dämmerte die Einsicht, dass das Gehen an sich das wichtigste Element auf dieser Wanderung sein würde. Nicht das Ankommen und schon gar nicht die Zeit (bis zur nächsten Pause). Eine wichtige Erkenntnis, obwohl es in der Umsetzung noch etwas haperte. Ich ertappte mich immer wieder dabei, wie ich unkonzentriert und mit hängendem Kopf vor mich hintrottete. Als ich die Stadtgrenze von Genf endlich erreicht hatte, wollte ich mit meinem Tagespensum nur noch fertig werden.
Durch eine Stadt wie Genf zu pilgern, war aufregend. Ich erreichte die Stadtgrenze oberhalb des Zentrums und wanderte lange entlang einer Hauptverkehrsstraße Richtung See, an der amerikanischen und anderen Botschaften vorbei, an einem riesigen UNO-Gebäude, am Designmuseum und anderen imposanten Architekturen, an einer Statue von Gandhi in Buddha-Haltung und an einem Gedenkmonument gegen Landminen. Mein schwerer Rucksack und die Wanderstiefel schienen deplatziert in dieser Stadt des Geldes, aber die Reaktionen der Menschen waren von Interesse und Neugier geprägt.
Im Internet hatte ich verschiedene Übernachtungsvorschläge gefunden, unter anderem die Jugendherberge und ein „Haus für Mädchen“, das ich für meinen Status als Pilgerin irgendwie angemessen fand. Trotzdem schien mir ein kurzer Abstecher in die Touristeninfo sinnvoll. Dort wurde ich leider ziemlich kurz abgefertigt. Informationen über den Jakobsweg gäbe es dort nicht, dafür solle ich doch in eine Buchhandlung gehen. Die Liste der Übernachtungsmöglichkeiten fing bei etwa 80 CHF pro Nacht an, was mein komplettes Tagesbudget war. Man gab mir immerhin einen Stadtplan mit, der mir bestätigte, dass das „Haus für Mädchen“ neben der Kathedrale wesentlich günstiger für mich gelegen war als die Jugendherberge, zu der ich hätte zurückgehen müssen.
So pilgerte ich zur Kathedrale und betrat zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine Kirche. Ich konnte mit Religion und Gott und Glauben wenig anfangen, wollte aber auch in der Kathedrale nach Informationen über den Jakobsweg fragen. Natürlich wollte ich auch den Stempel für meinen Pilgerpass. Der Besuch der Kirche schien mir außerdem wie ein natürlicher Teil des Pilgerwegs, auf dem ich mich nun einmal befand. Entsprechend widersprüchlich waren dann meine Gefühle an diesem kühlen, widerhallenden, dunklen Ort. Die erhabene Atmosphäre des Kirchenraumes bewegte mich und ich musste die aufsteigenden Tränen unterdrücken, als ich schließlich den Kirchenmitarbeiter fand, der meinen Pilgerpass abstempelte, mir darüber hinaus aber auch nicht weiterhelfen konnte.
Das „Haus für Mädchen“ war direkt gegenüber, öffnete aber erst eine Stunde später. Glücklicherweise war mittlerweile die Sonne herausgekommen, so dass ich vor der Kathedrale auf einer Bank meinen Rucksack absetzen und die warmen Nachmittagsstrahlen genießen konnte, während ich die Touristen beobachtete, die in Scharen zur Kathedrale kamen.
Pünktlich zur Öffnungszeit stand ich am Empfang des „Hauses für Mädchen“ und ergatterte mir einen Platz im Schlafsaal. Meine erste Schlafsaal-Erfahrung! Man hatte mir das Bett Nr. 6 zugeteilt und ich war angenehm überrascht, dort ein Handtuch vorzufinden. Als erstes sehnte ich mich nach der Dusche, suchte nur das Nötigste zusammen und machte mich auf den Weg in den Keller, zu den Duschkabinen. Erst nach der heißen Dusche sandte mein Gehirn eine Warnmeldung: Gab es noch auf irgendeinem anderen Bett ein Handtuch? Ich hatte ja nicht reserviert, warum sollte man also auf meinem Bett ein Handtuch bereitlegen und auf keinem anderen? Nach genauerer Inspektion des Handtuchs war schnell klar, dass es sich nicht um ein frisches Exemplar handelte. Somit war offensichtlich, dass eine andere Person mein Bett Nr. 6 belegt und dort Sachen deponiert hatte. Folglich stand ich nackt und triefend mit dem Handtuch einer anderen in der Dusche stand. Es war zu spät etwas zu ändern, die Verwirrung war da und wohl oder übel musste ich mit diesem Handtuch eine Trockenheit erreichen, die mir erlauben würde, die Dusche zu verlassen. Zurück im Schlafsaal musste ich zugeben, dass ich ziemlich blind gewesen war. Das Bett Nr. 6 war belegt. Aber bedingt durch die Müdigkeit und meine Unerfahrenheit, was Schlafsäle betrifft, hatte ich das einfach nicht wahrgenommen. Da hatte ich wohl später einiges an Erklärung zu leisten, aber für den Moment war noch niemand anwesend. Ich fühlte mich nach der Dusche erfrischt und wollte nun doch noch in einer Buchhandlung nach neueren und genaueren Informationen über den bevorstehenden Weg suchen, als Jeannettes Heftchen hergab.
Der Energieschub hielt allerdings nicht wirklich lange an. Die Füße taten mir weh, als ob ich Blasen hätte, obwohl ich keine sehen konnte, die Schultern ebenso. Es reichte gerade für einen Abstecher in die Buchhandlung, in der ich eher zufällig und hauptsächlich wegen der deutschen Sprache nach einem gelben Buch griff, das sich später als die Bibel der deutschen Pilger herausstellte. Ein paar Meter weiter fand ich ein Pasta-Fast-Food-Restaurant, was mir sehr entgegenkam. Erstens soll sich Pasta ja in Energie für Sportler verwandeln und zweitens traute ich mich dort, alleine an einem Tisch zu sitzen und zu essen, was ich in meinem Leben bisher selten bis nie getan hatte.
Als ich zurück in den Schlafsaal kam, waren fast alle zehn Betten mit persönlichen Gegenständen belegt, anwesend waren aber nur zwei Frauen, mit denen ich schüchtern ein Gespräch versuchte. Die jüngere schien sympathisch, sie war Französin, war auf Urlaub in Genf und konnte sich nicht mehr als diesen Schlafsaal leisten. Die andere antwortete kaum, steckte sich Kopfhörer ins Ohr und wollte sich offensichtlich nicht in ein Gespräch verwickeln lassen. Umso unangenehmer, dass ausgerechnet sie in Bett Nr. 6 schlief. Einen Moment überlegte ich, ob ich nicht einfach so tun sollte, als sei nichts geschehen. Dann aber gab ich ihr ein Zeichen. Sie zog etwas widerwillig die Stöpsel aus den Ohren und hörte sich erst gelangweilt, dann mit wachsender Wut und offensichtlichem Ekel die Geschichte an, die mir passiert war. Ich bot ihr Geld für die Reinigung oder ein neues Handtuch an, entschuldigte mich unzählige Male, aber eine genervte Französin bleibt eine genervte Französin und so schien es mir eine gute Idee, früh ins Bett zu gehen, um diesen Blicken auszuweichen.
Trotz dieser Erfahrung und meinen wehen Füßen und steifen Muskeln in den Beinen ging es mir aber gut. Ich freute mich auf den nächsten Tag, fühlte mich bereit und vorbereitet für den Beginn der Via Gebennensis, den Jakobsweg von Genf nach Le Puy.
Tag 4 bis 6
Tag 1 bis 14
Die Via Gebennensis Genf – Le Puy-en-Velay
Tag X -3: Genf – Charly (32 km)
Erste Begegnungen
Beim Frühstück im „Haus für Mädchen“ traf ich die ersten Pilgerinnen seit meinem Aufbruch vor drei Tagen. Drei ältere Damen aus der Bretagne, die sogar im Schlafsaal mit mir übernachtet hatten. Da sie aber nach 20.30 Uhr vom Abendessen zurückgekommen waren, hatte ich schon geschlafen. Sie blieben allerdings noch einen Tag länger in Genf und somit war die erste Begegnung mit Pilgern schnell vorüber.
Schon auf dem Weg aus der Stadt kam mir zum ersten Mal das Pilgerbuch zur Hilfe, denn ich hatte prompt einen Wegweiser übersehen und wäre ohne die detaillierte Streckenbeschreibung schnell verloren gewesen. Überhaupt war dieser Tag vom Verlaufen geprägt. Interessanterweise ergab sich mit jeder Richtungskorrektur eine neue Begegnung. Nachdem ich durch eine falsche Textbeschreibung in die Irre gegangen war, musste ich zurück, um den letzten Wegweiser wiederzufinden und mich neu zu orientieren. Dabei traf ich ein deutsches Ehepaar, die etwas irritiert im gleichen gelben Pilgerbuch blätterten und ebenfalls die Wegbeschreibung nicht auf den tatsächlichen Weg übertragen konnten. Zu dritt wurden wir uns dann einig, der gelben Muschel auf blauem Untergrund zu folgen und uns nicht von dem sonst so hilfreichen Buch verwirren zu lassen. Ich versuchte, mit den beiden ins Gespräch zu kommen, hatte aber das Gefühl, dass die Unterhaltung eher nicht willkommen war. Außerdem waren mir die beiden eindeutig zu langsam, so dass ich mich recht schnell nach vorne absetze.
Das Überschreiten der Grenze von der Schweiz nach Frankreich war mein erster Meilenstein. Viel mehr als eine Hinweistafel gab es nicht als Grenzsymbol. Auf dieser Tafel verabschiedete die Schweiz die Pilger mit der Angabe, dass es noch 1‘865 Kilometer bis Santiago de Compostela seien. Es war weit und breit niemand zu sehen, mit dem ich meine Euphorie hätte teilen können und so überquerte ich die kleine Brücke über den Grenzfluss in eine neue Phase meines Abenteuers ganz allein.
Der Weg gefiel mir gut, denn er war abwechslungsreich. Durch Weinberge, an Feldern und Bauernhöfen vorbei, durch Ortschaften, aber auch über die Autobahn, die mir vor Augen führte, mit welcher Geschwindigkeit sich die Welt jenseits des Weges bewegte. Immer wieder begegneten mir Menschen: Wanderer, Hundebesitzer, Sportler, vor allem Frauen sprachen mich regelmäßig an. Zwar waren die Fragen immer etwa gleich - woher ich komme, wohin ich gehe, wie lange ich schon unterwegs sei, wie lange ich glaubte bis zum Ende zu brauchen usw. - aber ich war dankbar für diese kurzen persönlichen Gespräche. Außerdem war der Tag sonnig und warm, meine Stimmung und Motivation waren merklich besser.
Vor dem Kloster Chartreuse de Pomier hatte ich mich wieder verlaufen und war ganz unnötig einen Abhang hochgeklettert. Als ich hinter dem Kloster einen Brunnen mit kühlem, frischem Trinkwasser fand, gönnte ich mir eine Pause, bevor ich weiterging. Erst nach etwa zwei Kilometern bemerkte ich, dass ich meinen Fotoapparat am Brunnen vergessen hatte. Nach einem kurzen irrationalen Moment, in dem ich zwei Kilometer Fußmarsch gegen den materiellen Wert des Fotoapparates und den persönlichen Wert der Bilder abwog, trat ich den Rückweg an. Wieder brachte diese Wegkorrektur eine Begegnung, zum ersten Mal mit einem Pilger, der jünger als ich schien, mir aber nicht sagen konnte, ob meine Kamera noch am Brunnen lag. Ich fand sie aber tatsächlich noch dort und legte die zwei Kilometer erneut in die richtige Richtung zurück.
Als ich in Mont Sion ankam, war ich ziemlich am Ende und bereit, mein Tagesbudget für ein Hotelzimmer explodieren zu lassen. Aber 67 € für eine Nacht ohne Frühstück in einem Mittelklassehotel an einer Hauptstraße war ich dann doch nicht bereit zu akzeptieren und machte mich auf, um weitere 2.5 Kilometer bis zur ersten Gîte Communal meines Weges in Charly zurückzulegen.
Glücklicherweise war die Nachbarin der Gîte sehr hilfsbereit und erklärte mir, fast zu ausführlich und obwohl sie mehrfach betonte, dass sie nicht verantwortlich sei, wie die Abläufe in einer Gîte Communal funktionieren. Als ich endlich meine Matratze auf dem Boden belegt hatte und in der Dusche stand, schlotterten meine Beine nach 32 Kilometern Wegstrecke, sechs davon unnötig für Wegkorrekturen. Meine Füße taten so weh, dass jeder Schritt eine Qual war; mein rechter Fuß war im Knöchel geschwollen. Ich befürchtete, dass ich meine Schuhe zu eng geschnürt hatte und die Durchblutung beeinträchtig war. Das war mir schon einmal auf einer Tageswanderung passiert und hatte mir tagelang Probleme bereitet, aber offenbar lernte ich nur langsam aus Fehlern. Außerdem hatte ich Blasen unter den Füßen und auch ein Knie begann mir Sorgen zu machen. Trotzdem ging es mir merkwürdig gut und der Stolz über die bisher erbrachte Leistung überwog das Leiden.
Von den zehn Plätzen in der Gîte war auch um 18.30 Uhr noch kein weiterer belegt und so wechselte ich von einer schmalen Matratze auf eine Doppelmatratze und gab die Hoffnung auf, dass noch jemand zum gemeinsamen Kochen und Plaudern eintreffen würde. Immerhin hatte ich meine Pilgerlektüre gelesen und rechtzeitig vor Charly eine Tütensuppe gekauft, die ich mir jetzt zubereitete und alleine vor der Gîte auf der Bank in der Sonne löffelte.
Die Nacht alleine in einem knarrenden Haus mit zehn Plätzen, in dem man die Tür nicht abschließen konnte und der Wasserboiler stetig in einen Plastikeimer tropfte, war nur zu überstehen, weil ich so müde war, dass mich nichts mehr vom Schlafen abhalten konnte. Die Tür verbarrikadierte ich sicherheitshalber mit Stühlen.
Tag X -2: Charly – Frangy (19.5 km)
Der Camper
Entgegen jeder Erwartung fühlte ich mich am Morgen recht ausgeruht nach einer relativ guten Nacht. Ich konnte mich an einen Traum erinnern, in dem ich zu jemanden gesagt hatte:“ So wie ich jetzt als Pilgerin aussehe…“. Interessant, wie schnell sich eine solche „Statusveränderung“ ins träumende Bewusstsein umsetzte.
Die Gîte hatte in der kleinen Küche ein paar Lebensmittel auf Vorrat, so konnte ich mir einen Pulverkaffee zubereiten und fand ein paar Scheiben Zwieback. Richtig lecker und aufbauend war dieses Frühstück allerdings nicht. Außerdem waren die Schmerzen im rechten Fuß über Nacht nicht wirklich abgeklungen und so trottete ich mit hängendem Kopf los.
Der junge Pilger vom Vortag überholte mich flotten Schrittes und schien mich fast mitleidig zu grüßen. Damit reichte es mir dann und ich zwang mich, den Kopf zu heben und den wieder einmal wunderschönen, naturromantischen Weg über Wald- und Feldwege und die Ausblicke zu genießen.
Nach der ersten Proviantpause mit Banane und Müsliriegel schienen auch die Energiereserven wieder aufgefüllt. Mein Fuß war mittlerweile so schmerzhaft angeschwollen, dass ich den Schuh nur noch bis zur halben Höhe schnürte, immerhin brachte das Erleichterung. Auch hatte ich mich mit meinem Rucksack beschäftigt und die Einstellungen der Schulterriemen verändert, plötzlich schien auch das leichter zu ertragen. Als ich den jungen Pilger in seiner Mittagspause am wild rauschenden Wasserfall „Cascade de Borbannaz“ wiedertraf, plauderte ich gut gelaunt mit ihm. Er war ein Deutschschweizer, der mir den Anschein machte, sich alleine unterwegs in Frankreich nicht wirklich verständigen zu können und sich nicht wohl zu fühlen, aber physisch schien er mir bei weitem überlegen. Deshalb war ich etwas verwundert, als er mir erzählte, dass er im nahegelegenen Frangy bereits sein Tagesziel erreicht haben würde. Ich hatte geplant, noch rund sieben Kilometer bis Designy weiterzugehen.
Frangy stellte sich als angenehmer Ort mit überraschend guter Infrastruktur heraus. Nach einer längeren Organisationspause, in der ich nicht nur meine Vorräte aufstockte, sondern mir auf der Post auch eine französische SIM-Karte besorgt hatte, war die Motivation für zwei weitere Stunden Fußmarsch gegen Null gesunken. In meinem Pilgerbuch war eine günstige Übernachtungsmöglichkeit im Wohnwagen auf dem Campingplatz angegeben, das wollte ich ausprobieren. Auf der Suche nach Wegweisern zum Campingplatz fand ich die kleine Touristeninformation und schaute hinein. Eine Welle an Freundlichkeit überrollte mich geradezu: Nicht nur dass die Mitarbeiterin mehrfach versuchte, die Leiterin des Campingplatzes anzurufen, um die Verfügbarkeit des Wohnwagens abzuklären. Sie bot mir außerdem Wasser an und ließ mich meinen Rucksack absetzen, um einen Moment zu entspannen. Die Gastfreundschaft in diesem Ort ging so weit, dass sich ein zufällig vorbeikommender Prospektlieferant anbot, mich zum 900 Meter entfernten Campingplatz mitzunehmen, vor Ort die Verfügbarkeit des Wohnwagens zu erfragen und mich, falls dieser bereits reserviert sei, zum Dorf zurückzubringen. An so viel Hilfsbereitschaft war ich nicht gewöhnt und nahm das Angebot nur zögerlich an.
Der Campingplatz schien trostlos und verlassen. Das Rezeptionshäuschen war unbesetzt. Allerdings erschien ein Mann in Arbeitskleidung, mit Eimern und Tüten beladen, und versicherte uns, dass der Wohnwagen frei sei. Die Nacht würde so um die zehn Euro kosten, das müsse ich dann mit der Dame von der Rezeption abklären, die sei aber regelmäßig abwesend und anderweitig beschäftigt. Er habe sie den ganzen Tag noch nicht gesehen. Ich richtete mich also guter Hoffnung so gut es eben ging in dem ziemlich heruntergekommenen, schmuddeligen, kalten und uralten Zirkuswagen ein, den man wieder einmal nicht abschließen konnte. Die Duschgelegenheit war eine Katastrophe, nämlich ein Häuschen, in dem Dusche, Toilette und Waschbecken in einem Raum waren, sodass nach der Dusche alles nass war. Als ich herausbekam, dass auf dem Campingplatz außer mir und dem hilfsbereiten Mann 50 Saisonarbeiter untergebracht waren und alle 51 Männer und ich das Häuschen für jegliche Hygiene- und sonstigen Bedürfnisse teilen mussten, schüttelte es mich ein wenig. Die Kochgelegenheit war eine nicht minder widerliche Erfahrung, denn alles was zur Verfügung stand, war ein Gaskocher mit einem Topf und einem Holzlöffel, auf dem ich mir ohne Messbecher eine Tütensuppe zubereitete. Es kam eher rotes Wasser als eine Tomatensuppe dabei heraus, das ich aus dem Topf trank, denn es gab weder Suppenteller noch –löffel. Der größte Ekel kam im Anschluss, als ich feststellte, dass es weder Spülmittel noch –lappen gab, um den Topf zu reinigen. Ich fragte mich, wie und ob die Camper und Pilger vor mir den Topf überhaupt gereinigt hatten, aus dem ich gerade getrunken hatte.
Doch wie üblich hatte der Weg auch bei dieser Erfahrung einen lehrreichen Hintergrund für mich bereit, der sich im Gespräch mit dem hilfsbereiten Mann zeigte. Dieser Camper, so typisch, als sei er einer deutschen Vorabendserie entsprungen, war einst ein gutsituierter, gesellschaftlich angepasster Karrieremensch gewesen, der zur richtigen Zeit in der Region ein Häuschen für sich und seine Familie gekauft hatte. Nachdem seine Frau ihn verlassen hatte und der Wert des Häuschens dank der Nähe zur Schweizer Grenze und zum Arbeitsort Genf enorm gestiegen war, hatte er sich ausgerechnet, dass er bis zum Rentenalter in einem 45 qm großen Mobile Home auf dem Campingplatz gut leben könnte ohne zu arbeiten, wenn er sein Häuschen meistbietend verkaufen könnte. Er habe das nie bereut und die Tatsache, dass er am nächsten Tag zu einem Urlaub in Bali aufbrechen wollte, schien seine Kalkulation mehr als zu bestätigen. Als er mir anbot, sein Mobile Home von innen zu besichtigen, lehnte ich einem warnenden Bauchgefühl folgend allerdings dankend ab.
Am Abend verschwand ich relativ früh im Wohnwagen. Einerseits war ich sehr müde und wollte meine geschwollenen Füße hochlegen, andererseits schien es mir ratsam, mich nicht von zu vielen der Saisonarbeiter alleine vor einem nicht abschließbaren Wohnwagen sehen zu lassen.
Tag X -1: Frangy – Pont du Fier (17.5 km)
Genug ist genug
Die Nacht war kurz und kalt und nicht sehr erholsam. Es hatte ordentlich geregnet und gewittert und da es am Vorabend ziemlich heiß und stickig im Wohnwagen gewesen war, hatte ich alle Fenster geöffnet. Nachts wachte ich zitternd in meinem klammen Daunenschlafsack auf. Außerdem war ich mehrfach aus Albträumen hochgeschreckt und fühlte mich hinter dieser Plastiktür des Wohnwagens sehr verwundbar.
Also war ich früh aufgestanden und in der Morgendämmerung, wieder einmal ohne Frühstück, zurück Richtung Frangy losgegangen. Glücklicherweise fand sich im Ort eine Bäckerei: Mit einem Schokocroissant im Magen lief es sich doch gleich besser!
Der Weg nach Designy machte mir bewusst, wie unrealistisch meine Tagesplanung war, denn diese Strecke hätte ich unmöglich am Vortag schaffen können. In Designy fand ich kurz Unterschlupf im Gemeindehaus, wo ich im Waschraum versuchte, mich am Handtrockner zu wärmen und mein Langarmshirt und Regenkleidung aus dem Rucksack suchte. Kurz nach Designy holte mich der Schweizerdeutsche noch einmal ein. Während des kurzen gemeinsamen Wegstücks erzählte er, dass er auch vor sechs Tagen in Lausanne losgelaufen sei, dass es aber sein letzter Tag sei und er von Seyssel aus mit dem Zug zurückfahren würde. Im nächsten Urlaub würde er wieder eine Woche gehen. Im Nieselregel verabschiedete er sich mit einem Grinsen und den Worten: „Man fragt sich allerdings schon manchmal, warum man sich das alles antut, oder?“, nahm seinen sportlichen Schritt wieder auf und war nach der nächsten Wegbiegung verschwunden.
Ich lief mittlerweile mit permanenten Schmerzen, die im Gegensatz zu den letzten Tagen auch nach etwas Einlaufen nicht besser wurden, sondern einfach immer schlimmer. Mein rechter Fuß schien zwischenzeitlich nicht mehr beweglich. Wahrscheinlich durch die Überlastung des Ausgleichens fing im linken Fuß die Achillessehne an zu ziehen. Während ich mit größter Vorsicht und unter enormen Schmerzen einen rutschigen und steilen Steinweg im Wald hinunterkraxelte, ständig die Angst im Nacken, die Balance zu verlieren, umzuknicken oder auszurutschen und mit diesen geschwollenen und unflexiblen Füßen keine Möglichkeit zu haben, mich aufzufangen, traf ich die Entscheidung, noch bis zur nächsten Herberge zu gehen, aber keinen Schritt weiter. Die Müdigkeit der letzten Nacht und das regnerische Wetter trugen gewiss dazu bei.
Die Besitzerin der Auberge, die Übernachtung und Essen im Paket anbot, war etwas überrascht, um 13 Uhr bereits das erste Zimmer zu vergeben. Das Zimmer war klein und kühl, aber mit eigenem Bad und Fernsehen. Ich hätte mir gerne eine lange heiße Dusche gegönnt, aber ich konnte nicht mehr auf meinen Füßen stehen und verkroch mich folglich einfach unter der Bettdecke. Von dort aus rief ich meinen Mann an, um ihm missmutig meine Entscheidung mitzuteilen, am nächsten Morgen mit dem Zug zurück nach Hause zu kommen. Natürlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass er sich sofort ins Auto setzten würde. Er holte mich noch am gleichen Nachmittag ab und die Besitzerin der Auberge war nun noch überraschter, ihren ersten Gast gleich wieder abreisen zu sehen. Gerade als ich ausgecheckt hatte, kam eine stämmig gebaute Frau mittleren Alters, gut geschützt unter einem Regenumhang, die Treppen zur Auberge hoch. Auch diese Pilgerin schien nicht glücklich mit dem Wetter und der Last, die sie trug, sie wirkte auf mich aber stetig und beständig, im Gegensatz zu mir.
Die sechs Tage Wanderung, in denen ich mich oft so allein auf der Welt und fern von allem Lieben gefühlt hatte, schnurrten nun auf anderthalb Stunden Autofahrt zusammen! Ich wechselte die Perspektive und glaubte einiges gelernt zu haben. Zum Beispiel, dass ich nie wieder für eine „unbestimmte Zeit“ aufbrechen würde! Wenn überhaupt würde ich es wie der Deutschschweizer machen, schon wegen des Gepäcks. Ich Unerfahrene hatte für alle Fälle von Lausanne bis Santiago vorgeplant und sogar schon den Bikini im Gepäck, für das Bad im Atlantik. Außerdem hatte ich mich mit der Einsamkeit nicht anfreunden können, obwohl ich mir meine Unabhängigkeit unbedingt hatte beweisen wollen. Ich würde so etwas nicht mehr alleine anfangen. Vor allem aber musste ich zugeben, dass meine Kalkulation von durchschnittlich und mindestens 30 Kilometern am Tag, die ich ja selten überhaupt geschafft hatte, unmöglich durchzuhalten war und dass 20 bis maximal 25 Kilometer am Tag wahrscheinlich realistischer waren.
Tag X: Lausanne II
… und nun?
Natürlich war ich meinem Mann unendlich dankbar, dass er mich abgeholt und wieder heim gebracht hatte und dass er mir das Gefühl gab, die 160 Kilometer in sechs Tagen seien doch ein Riesenerfolg gewesen, auch wenn ich nicht so weit gekommen war, wie ich vorgehabt hatte. Vor allem war mit dieser Aktion die Frage vom Tisch, ob ich mich vielleicht wegen versteckter Probleme in meiner Ehe auf diesen Weg gemacht hatte: Die Rückkehr zu meinem Mann war trotz der widrigen Umstände ein schönes Gefühl.
Die Reaktionen in meinem Umfeld waren durchwachsen. Die meisten Bekannten gaben zu, dass sie es soweit schon nicht geschafft hätten und bewunderten mich für meinen Mut und diese Leistung. Ich hatte aber das Gefühl, dass einige Leute mir das sowieso nicht zugetraut hatten und nun eine gewisse Genugtuung empfanden.
Bezeichnend für mich war die als Aufmunterung gedachte Äußerung meines Vaters, ich solle das bloß nicht als Versagen betrachten. Zum ersten Mal wurde mein Vorhaben mit Erfolg oder eben Misserfolg in Verbindung gebracht. Wahrscheinlich war das der Moment, in dem ich beschloss, dass es so nicht enden dürfte.
Zwei Wochen lang saß ich daheim, sogar unfähig mich wenigstens mit meinem normalen Sportprogramm abzureagieren. Ich massierte mir die Fußgelenke, legte die Füße hoch, dehnte Muskeln und Sehnen und schluckte Magnesium. Das Gefühl, wieder Herrin meiner Zeit werden zu müssen, das ja schon beim ersten Mal Teil meiner Entscheidung zum Aufbruch gewesen war, überwältigte mich schier. Mir war relativ schnell klar, dass ich – entgegen meiner Einsichten aus dem ersten Teil meines Abenteuers – wieder losgehen würde, wieder alleine, aber dass ich es entspannter angehen würde.
Tag 1: Seyssel – Chanaz (21 km)
Auf ein Neues!
Ich saß im Zug, der mich von Lausanne nach Seyssel brachte, um dort wieder anzuknüpfen, wo ich aufgehört hatte. Natürlich fragte ich mich, warum ich mir das alles nochmals antat, gleichzeitig fühlte es sich richtig an. Mein Gepäck hatte ich von etwa 15 Kilo auf 12 reduzieren können, also nicht wesentlich, den Ipod hatte ich daheim gelassen, ebenso den Bikini, denn ich weigerte mich innerlich, wieder auf Wochen im Voraus zu planen. Wenn ich es bis zum Atlantik schaffen würde, könnte ich mir dort einen Bikini kaufen. Vorerst wollte ich einfach gerne Le Puy-en-Velay in einer Entfernung von rund 290 Kilometern erreichen, möglichst innerhalb von mehr oder weniger zwei Wochen, aber ich schloss auch nicht aus, wieder nach einer Woche abzubrechen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Die größte Erleichterung war, dass ich keine Angst mehr hatte, was diese Erfahrung für mein Leben bedeuten würde. Die zwei zurückliegenden Wochen mit meinem Mann waren abgesehen von dem Frust über die schmerzenden Füße harmonisch und wunderschön gewesen und ich freute mich jetzt schon, wieder heimzukommen, wann auch immer.
Ich hatte das Gefühl, aus meinem Misserfolg gelernt zu haben. Ich wusste, was ich anders machen wollte. Ich würde vor allem mehr Pausen machen, würde mir Zeit nehmen, um zu genießen, würde Bilder machen und es einfach lockerer angehen.
Schon nach den ersten Kilometern wurde ich leider daran erinnert, dass ich nicht nur mit Schmerzen in den Füßen gekämpft hatte. Die Schmerzen in den Schultern hatte ich fast vergessen! Trotzdem fühlte ich mich gut. Ich hatte ein etwas mulmiges Gefühl, als ich an der Herberge vorbeiging, in der ich vor zwei Wochen aufgegeben hatte, aber abgesehen davon war der Weg am Ufer der Rhône das reinste Vergnügen. Das Wetter war durch die zwei Wochen Zeitverschiebung wesentlich besser, sonnig und warm, am Nachmittag sogar Hitze – und es waren Pilger unterwegs! Ich begegnete einer Gruppe von drei Deutschen und einem deutschen Ehepaar so oft, dass ich mich irgendwann am liebsten versteckt hätte, um nicht noch einmal: „Ja hallo…“ sagen zu müssen.
Nach nur 21 Kilometern meldete ich mich am Campingplatz von Chanaz für die Nacht an und erhielt eine ganze Hütte mit sechs Plätzen und Küche zugewiesen. Ich fragte nach, weil ich nicht glauben konnte, dass ich diese für mich alleine haben würde. Ganz alleine war ich auch nicht, denn wieder erkannte eine Schmusekatze mein Bedürfnis nach Kontakt. Auch der Bewohner der Hütte nebenan schien auf Kontaktsuche. Aber ich konnte nicht zuordnen, ob er ebenfalls ein Pilger war, dann hätte ich mich gerne mit ihm ausgetauscht, oder ob er ein Dauercamper oder auf Urlaub hier war. Zumindest sorgte seine Art, mich ständig möglichst diskret zu beobachten, dafür, dass ich keine Lust hatte, mein Abendessen alleine in der Hütte zuzubereiten. So machte ich mich auf den Weg ins Örtchen.
Chanaz als Dorf war so süß und gepflegt wie der Campingplatz. Nur die Organisation des Abendessens gestaltete sich schwierig. Das einzige Restaurant, das abends geöffnet hatte, lag deutlich über meiner Preisklasse, die Pizzeria und ein anderes Restaurant schlossen an Wochentagen pünktlich zur Abendessenzeit. Allerdings war die Bäckerei am Abend noch geöffnet und so verpflegte ich mich nach einem Tag mit Müsliriegeln und Bananen mit einer Apfeltasche und einem Cookie. Wohl nicht das Optimale, aber ich wollte mich ja nicht mehr stressen. Morgen war ein neuer Tag.
Tag 2: Chanaz – Yenne (18 km)
Als der Spaß begann
Ich nahm mir Zeit an diesem Tag, wie ich es mir für diesen zweiten Versuch meines Abenteuers vorgenommen hatte. Ich stand spät auf, lief ruhig los, machte viele Pausen an schönen Stellen und hielt sogar an der Kapelle Saint Romain an, um die Aussicht zu genießen. Nachdem ich am Vortag dauernd die beiden anderen Pilgergruppen getroffen hatte, begegnete mir an diesem Tag nicht ein einziger Pilger.
Nach nur 18 Kilometern erreichte ich meine Tagesetappe und checkte im Hotel Le Fer à Cheval ein, das mir in Jeannettes Unterlagen schon aufgefallen war. Das Angebot „Soirée Etappe“ (Abendessen und Übernachtung in einem Paket) kam mir sehr gelegen.
Trotz des kurzen Tages tat mir wieder einmal alles weh und meine Beine waren schwer. Nun machte mir auch noch der Fußnagel vom rechten kleinen Zeh Sorgen, er war schwarz und es schien offensichtlich, dass er sich lösen würde. Trotzdem machte ich mich nach der Dusche – etwas schwankend – auf Erkundungstour durch Yenne, was trotz seiner Größe von rund 3‘000 Einwohner nichts zu bieten hatte.
Zurück im Hotel traf ich dann doch noch das deutsche Paar vom Vortag wieder. Wir verabredeten uns locker zum Abendessen im Hotel. Ich war gerne den Tag über alleine unterwegs, zog ein Einzelzimmer jedem Schlafsaal vor, aber die Zeit zwischen dem Ende der Wanderung und dem Abendessen fühlte sich alleine doch ziemlich lang und einsam an.
Als ich zum Abendessen kam, wurde ich Zeuge einer großen Diskussion zwischen einem Gast und dem Wirt. Der Gastwirt bestand darauf, dass für die Pilger drinnen gedeckt sei und jede reservierte Pilgergruppe getrennt platziert sei, der Gast hingegen war Pilger und wollte den lauen Abend auf der Terrasse genießen. Als er mich alleine eintreffen sah, regte er an, dass die Pilger doch zusammensitzen sollten, damit man sich austauschen könne. Schnell lief es darauf hinaus, dass ich mit besagtem Pilger namens Gustav und seinem Begleiter Sepp auf der Terrasse Tische zusammenschob. Es wurde mein erster Abend unter Pilgern, mit Gustav und Sepp aus dem deutschsprachigen Teil von Fribourg in der Schweiz und dem deutschen Paar Brigitte und Franz. Ich glaubte, am Nachbartisch den Campinghütten-Nachbarn vom Vortag zu erkennen, hatte aber nicht wirklich das Bedürfnis ihn einzuladen, sich zu uns zu setzen. Ich genoss den Abend mit Wein und reichhaltigem Essen, mit angeregter Unterhaltung und viel Spaß. Eine ganz neue Erfahrung! Pilgern begann, mir Spaß zu machen!
Tag 3: Yenne – St.-Genix-sur-Guiers (25.5 km)
Anpassungen und Enttäuschungen
Vor diesem Tag hatte ich ein wenig Angst. Mein Pilgerbuch zeigte, dass ein Höhenunterschied von über 700 Metern zu bewältigen war, und ich hatte Bedenken, wie mein müder Körper das schaffen sollte. So hatte ich eigentlich geplant, nach einer ganz kurzen Etappe von 16.5 Kilometern aufzuhören. Im Gespräch des Vorabends hatte ich mich aber überreden lassen, wenigstens zu versuchen, wie die anderen Pilger knapp neun Kilometer weiter zu laufen.
Ich brach mit Brigitte und Franz auf, ließ diese aber in guter Freundschaft schnell hinter mir zurück. Der Weg war trotz meiner anfänglichen Sorge – oder vielleicht gerade deshalb – eines der schönsten Teilstücke überhaupt. Das Aufwärtssteigen wurde belohnt mit weiten Ausblicken auf die Rhône und die umliegenden Berge und auf den abwechslungsreichen und wunderschönen Waldwegen war es gar nicht so anstrengend. Ich machte viele Pausen, nahm für schöne Aussichtspunkte auch mal ein paar hundert Meter Umweg in Kauf und begegnete sogar meiner ersten Schlange. Ich wurde zweimal von Brigitte und Franz eingeholt und überholte die beiden wieder.
In St-Maurice-de-Rotherens hatte ich mein geplantes Tagesziel erreicht und entschied mich an einer Kreuzung, den Jakobsweg vorübergehend zu verlassen, um bei einem kühlen Getränk in einer Bar über das Weitergehen nachzudenken. Die Aussicht, einen weiteren lustigen Abend mit den anderen Pilgern zu verbringen, ließ mich weitergehen. Gleich hinter der nächsten Straßenkreuzung hörte ich ein Pfeifen und wurde prompt von Gustav und Sepp eingeholt. Ich verbrachte die ersten Kilometer meines Weges in Begleitung und musste zugeben, dass man weniger über seine Leiden und Sorgen nachdenkt, wenn man erzählend und singend durch die Landschaft streift. Gustav war ein Original, der sich auch nicht scheute, den erstbesten Dorfbewohner mit Bierbauch anzusprechen und ihn zu fragen, ob er ihm nicht drei Bier aus seinem Keller verkaufen könne. Dieses Mal funktionierte das leider nicht, aber Gustav berichtete, dass oft interessante Gespräche entstünden und in der Regel sogar die Bezahlung abgelehnt wurde.
Im nächsten Ort hielten Gustav und Sepp an der Kirche zur Rast an und Gustav stürzte sich förmlich in die Kirche. Mir war das nicht so geheuer und schon gar nicht interessant oder wichtig und so verabschiedete ich mich für den Moment und ging alleine voraus. Ich hatte auch das Gefühl, die Gesprächsthemen mit den beiden gesetzten Herren für den Moment erschöpft zu haben, der Umgang wurde mir fast zu kokett.
In St-Genix-sur-Guiers hatte ich mich wieder einmal auf einem Campingplatz angemeldet. Man hatte mich vorgewarnt, dass ich die Hütte mit einem männlichen Pilger teilen müsse. Meine einzige Sorge war, dass es der starrende Pilger vom Camping in Chanaz sein könnte, auf jede andere neue Begegnung freute ich mich. Die Atmosphäre auf den Campingplätzen gefiel mir. Ich saß vor meiner Hütte in der Sonne, hatte die Füße hochgelegt, mein Buch ausgepackt (dieses Mal hatte ich auf die paar Hundert Gramm für den Genuss des Lesens nicht verzichtet), beobachtete die Familien und Urlauber. An der Rezeption hatte ich ein Bier gekauft und trank es aus der Flasche. Mein Wäscheständer, nur behängt mit der handgewaschenen Unterwäsche des Tages und dem noch tropfenden T-Shirt, erregte die neugierige Aufmerksamkeit der beiden jungen Männer der Nachbarhütte.
Zum Abendessen machte ich mich früh ins Ortszentrum auf. Es schien nur einen Platz mit zwei ortstypischen Restaurants und dem mittlerweile bekannten Pilgerangebot und eine zwei Straßen weiter gelegene Pizzeria zu geben. Ich machte mehrfach die Runde um den Platz und die Restaurants, aber meine Pilgerfreunde waren nicht aufzufinden. Relativ schnell hatte ich das Warten satt, gleichzeitig meldete sich der Hunger und ich hatte große Lust auf eine fettige Pizza beim Italiener, der mir allerdings wenig italienisch erschien. Als einziger früher Gast saß ich auf der Terrasse der Pizzeria, versuchte mein Bier und meine Vegetariana zu genießen und wurde mir doch nach dem Vorabend in der lustigen Gesellschaft meiner Einsamkeit umso bewusster.
Zurück in meiner Campinghütte war mein Mitbewohner noch immer nicht eingetroffen. Ich schlief mit halbem Ohr wartend ein und war nicht sicher, ob ich über das Alleine-Schlafen glücklich war oder nicht.
Tag 4: St-Genix-sur-Guiers – Valencogne (22 km)
Das erste unmoralische Angebot (wenn auch sicher nur gut gemeint)
Der Weg schien mir an diesem Tag im Vergleich zum Vortag fast langweilig und ohne Herausforderung, obwohl er Abwechslung nicht wirklich vermissen ließ. Er führte am Fluss und an Seen, an landwirtschaftlich genutzten Feldern und immer wieder an Steinkreuzen vorbei, es ging über Waldwege und durch kleine Örtchen.
Meine Gedanken beruhigten sich und kreisten weder um Kilometer noch um sonstiges. Ich merkte, dass mir das Gehen mit anderen zumindest vorübergehend immer wieder gut tat. Brigitte und Franz holten mich nach meiner zweiten Pause ein, nach meiner dritten Pause kreuzte ich zum wiederholten Male zwei Französinnen, die aber laut Gustav und Sepp keinen Kontakt zu anderen Pilgern suchten. Als ich mich im Gras niederließ, um einer Musikprobe in einem hinter einem Grashügel versteckten Château zuzuhören, holten auch Gustav und Sepp mich wieder ein. Zusammen legten wir eine ganze Strecke zurück, bis ich mein Chambre d’hôtes kurz vor Valencogne erreichte. Mit 22 Kilometern war es wieder einmal ein recht kurzer Tag gewesen und ich nahm mir vor, zukünftig mehr und vor allem längere Pausen zu machen, statt den Tag um 14.30 Uhr zu beenden.
Mein Chambre d’hôtes war großartig. Ein Zimmer für vier bis sechs Personen, ganz für mich alleine, mit einem eigenen hellen und sauberen Bad! Allerdings war auch der Preis entsprechend. Christine, meine sympathische Gastgeberin, musste zum Markt, wollte mich aber unbedingt am Abend zum Tee und Gespräch einladen. Der Nachmittag war gerade erst angebrochen und so ließ ich es mir mit den selbst gebackenen Keksen meiner Gastgeberin, ihrer schwarzweißen Katze und meinem Buch auf der Terrasse gut gehen. Die Aussicht über das Tal im strahlenden Sonnenschein war wunderbar. Brigitte und Franz kamen später vorbei und wir verabredeten uns locker in Valencogne zum Abendessen.
Relativ früh brach ich nach Valencogne auf, es lag ca. 20 Minuten Laufzeit von meinem Chambre d’hôtes entfernt. Ohne Rucksack, in Sandalen und nach dem entspannten Nachmittag war das ein lockerer Spaziergang. Nachdem es im Örtchen bis auf die Kirche nicht viel zu sehen oder zu tun gab und ich mit Kirchen nichts anfangen konnte, suchte und fand ich die kommunale Pilgerherberge, in der Brigitte und Franz reserviert hatten. Welch eine angenehme Überraschung, auch Gustav und Sepp dort zu finden, die eigentlich weit außerhalb in einer Privatunterkunft reserviert hatten. Wir begannen früh mit einem Apero und waren zum Abendessen zu einer Gruppe von sieben Pilgern angewachsen, da sich ein weiteres deutsches Ehepaar, Inge und Hans-Peter, zu uns gesellt hatte. Wir erzählten und lachten viel und ich genoss die Gesellschaft all dieser Pilger.
Es war nur schade, dass ich den Abend relativ früh abbrechen musste, da ich die 20 Minuten zurück nicht im Stockdunkeln gehen wollte. Das Angebot von Gustav, dass ich mit ihm und Sepp in ihrem Dreier-Zimmer schlafen könnte, lehnte ich ab. Einerseits konnte ich den Umgang mit den beiden immer noch nicht richtig einschätzen, andererseits wartete meine Gastgeberin auf mich. Sie würde es sicher bemerken und sich Sorgen machen, wenn ich die ganze Nacht nicht auftauchte.
Der restliche Abend bei Kräutertee aus eigenem Anbau bot mir genau die Lebenserfahrungen, nach denen ich suchte. Ich war froh, dass ich mir das Gespräch nicht hatte entgehen lassen. Christine hatte vor einigen Jahren, nach gescheiterter Ehe, ihren Bürojob und ihr Stadtleben an den Nagel gehängt, war zurück zu ihrer Mutter aufs Land gezogen, hatte dort ihr eigenes Häuschen mit Gästezimmer gebaut und lebte nun vom Ertrag ihres Gartens und ihrer Felder und vom Jakobsweg. Sie verkaufte ihr Gemüse auf Märkten und lebte nicht im Luxus, aber sie schien zufrieden und ausgeglichen.
Tag 5: Valencogne – La Frette (26 km)
Der erste Abschiedsschmerz
Obwohl ich nicht wirklich Begleitung zum Wandern suchte, konnte ich unmöglich am Morgen an der Herberge vorbeigehen, ohne kurz zu fragen, ob von den anderen gerade jemand fertig zum Abmarsch sei. Doch bereits um acht Uhr morgens war niemand mehr zu sehen.