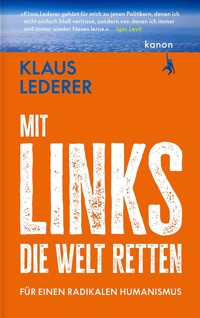
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Meine Vision für eine bessere ZukunftDie Welt ist in einer akuten Krise, doch die politische Linke tritt auf der Stelle. Ist links zu sein aus der Zeit gefallen? Oder kann uns nicht gerade die sozialistische Idee helfen, unser Land und unseren Globus progressiv zu verändern? Vielfache Krisen und Zukunftsängste beherrschen unseren Alltag. Die Beruhigungspillen der Merkel- Jahre wirken nicht mehr. Einst ist die Linke angetreten, um ein besseres Leben für Alle zu erstreiten. Heute muss sie um ihr politisches Überleben fürchten. Ein wütender Populismus und Zerstrittenheit lähmen sie. Der frühere Kulturbürgermeister Berlins und einer der beliebtesten Politiker seiner Partei denkt Linkssein radikal neu. Er befragt die Geschichte, schildert seine eigenen Umbruchserfahrungen und gibt Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit: Wie können wir unsere Welt gerechter, lebenswerter und nachhaltiger machen? Wie können wir in Freiheit und Gemeinschaft einer besseren Zukunft entgegensehen?»Klaus Lederer gehört für mich zu jenen Politikern, denen ich nicht einfach bloß vertraue, sondern von denen ich immer und immer wieder Neues lerne. Dieses Buch ist ein erneuter Beweis dafür.« Igor Levit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KLAUS LEDERER wurde 1974 in Mecklenburg geboren und wuchs in Frankfurt (Oder) auf. 2005 wurde er zum Landesvorsitzenden der LINKEN in Berlin gewählt. Von 2016 bis 2023 war er Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa in Berlin.
Vielfache Krisen und Zukunftsängste beherrschen unseren Alltag. Die Beruhigungspillen der Merkel-Jahre wirken nicht mehr. Einst ist die Linke angetreten, um ein besseres Leben für alle zu erstreiten. Heute muss sie um ihr politisches Überleben fürchten. Ein wütender Populismus und Zerstrittenheit lähmen sie. Der frühere Kulturbürgermeister Berlins und einer der beliebtesten Politiker seiner Partei denkt Linkssein radikal neu. Er befragt die Geschichte, schildert seine eigenen Umbruchserfahrungen und gibt Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit: Wie können wir unsere Welt gerechter, lebenswerter und nachhaltiger machen? Wie können wir in Freiheit und Gemeinschaft einer besseren Zukunft entgegensehen?
KLAUS LEDERER
MIT LINKS DIE WELT RETTEN
FÜR EINEN RADIKALEN HUMANISMUS
kanon verlag
ISBN 978-3-98568-110-5
eISBN 978-3-98568-111-2
1. Auflage 2024
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2024
Umschlaggestaltung: Ingo Neumann / boldfish.de
Umschlagfoto: © Ingo Neumann
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Ingo Neumann / boldfish.de
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Meinen Eltern
INHALT
VORWORT
ERSTES KAPITEL
NEUNZEHNHUNDERTNEUNUNDACHTZIG
Als der Kapitalismus übrigblieb
ZWEITES KAPITEL
KAPITALISMUS
Wie das Wachstum zum Selbstzweck wurde
DRITTES KAPITEL
SOZIALISMUS
Marx’ kategorischer Imperativ und die Kritik der halben Freiheit
VIERTES KAPITEL
ALTERNATIVLOS GEGEN DIE WAND?
Vom Goldenen Zeitalter des Kapitalismus zum antidemokratischen Neoliberalismus
FÜNFTES KAPITEL
SUCHBEWEGUNGEN
Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit und universale Demokratie
SECHSTES KAPITEL
DIE FRAGE NACH DEM WIR
Über Klassen, historische Subjekte und eine emanzipatorische Linke
ANMERKUNGEN
LITERATUR
PERSONENREGISTER
DANK
Wir leben in einer Zeit verkrampfter menschlicher Renitenz gegen das Notwendige, das als notwendig im Grunde eingesehen, aber aus einer Art von Ungezogenheit großen Stils geleugnet und umgangen wird. Meine Überzeugung ist, daß die Vernunft – nicht die der Menschen, aber die Vernunft der Dinge – sich durchsetzen wird, und man kann nur hoffen, daß das ohne allzu schwere Katastrophen vonstatten gehen möge […] – welche unbegreifliche Feindseligkeit wäre es, den Menschen eine Ordnung zu mißgönnen, die ihnen gestattete, Mensch und nicht eine furcht- und haßgequälte Kreatur zu sein!
Thomas Mann, 1935
VORWORT
»Mit links die Welt retten« ist ein persönliches Buch. Darin versuche ich mich einerseits an einer Positionsbestimmung: Woher beziehe ich meine Überzeugungen als Linker? Andererseits interessiert mich, wie praktische linke Politik unter den Bedingungen der Welt von 2024 aussehen könnte. Was sind das für Verhältnisse, in denen wir leben? Was bedeutet es in diesen Zeiten, eine linke, kritische Sicht auf die Welt zu werfen?
Dieses Buch beansprucht nicht, auf jede Frage eine eindeutige Antwort anbieten zu können. Erst recht keine in Stein gemeißelten Sätze mit großen Ausrufezeichen oder ewige Wahrheiten. Vielleicht ist es derzeit vor allem wichtig, einige Fragen möglichst genau, nüchtern und illusionslos zu stellen – zum Beispiel die Frage, was an Klassenkampf-Konzepten des 19. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert noch hilfreich und brauchbar ist und was nicht. Oder welche Antworten linke Bewegungen und Parteien auf die großen Menschheitsaufgaben dieses Jahrhunderts haben: den Klimawandel, den fortschreitenden Raubbau an natürlichen Ressourcen und die schreiende Ungleichheit weltweit.
Ich habe dieses Buch in recht kurzer Zeit und mit dem Gefühl einer gewissen Dringlichkeit geschrieben. Sonst wäre es womöglich kürzer geworden. Meiner Partei fehlen seit einiger Zeit eine kohärente Programmatik und auch der politische Kompass. Das liegt nicht nur an dem mehr als zwei Jahre lang öffentlich inszenierten Streit um die Positionen Sahra Wagenknechts. Die Probleme liegen tiefer. Bei kaum einem Thema, das in den letzten zehn Jahren die öffentliche Wahrnehmung beherrschte, war DIE LINKE mit einer überzeugenden, konsistenten linken Haltung sichtbar.
Dass »DIE LINKE gebraucht« würde, gehört zu den gern bemühten Stehsätzen vieler Spitzenleute meiner Partei, seit sie Wahlen eher verliert als gewinnt. Aber ist das so? In der Demokratie wird der Gebrauchswert von Parteien an der Zustimmung bei Wahlen gemessen. Wenn dieser Rückhalt immer weiter bröckelt, ist es höchste Zeit für eine kritische Reflexion. Formeln der Beschwörung helfen da nicht weiter. Es geht um die grundsätzlichen Fragen, und das ist durchaus schmerzhaft. Seit dem 6. Dezember 2023 ist die Linksfraktion im Bundestag Geschichte. Dass es links von SPD und Grünen nach der Bundestagswahl 2021 noch eine solche Fraktion gab, war nur drei Direktmandaten zu verdanken. Fünf Prozent aller abgegebenen Voten, die dafür eigentlich nötig waren, hatte DIE LINKE knapp verfehlt.
Angesichts dessen ein Buch mit dem Titel »Mit links die Welt retten« vorzulegen, mag verwundern, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Ist es Hybris? Kompletter Realitätsverlust? Dieses Buch soll weder ein Manifest noch eine Programmschrift und schon gar keine Wahlplattform sein. Es ist der Versuch einer Intervention, zum Auftakt einer notwendigen Debatte: Wie sorgen wir dafür, dass wir wieder gebraucht werden und mit praktischer Politik dazu beitragen, das Leben der Menschen zu verbessern? Es ist eine Einladung zum gemeinsamen Nachdenken.
Seit gut drei Jahrzehnten bin ich jetzt Mitglied erst der PDS, dann der Partei DIE LINKE. In diesen Jahren habe ich mich ehrenamtlich an der Basis und hauptberuflich in Parteiämtern und als Parlamentarier im Berliner Abgeordnetenhaus engagiert. Bis Ende April vergangenen Jahres konnte ich sechseinhalb Jahre als Kultursenator in Berlin in einer Regierungskoalition arbeiten. Ich war viele Jahre lang Politiker, mit Haushaltsberatungen, Wahlkämpfen, Koalitionsverhandlungen, mit Partei- und Parlamentsarbeit befasst und als Leiter einer Verwaltung tätig. Das war ich nicht, weil ich unbedingt Politiker, Abgeordneter oder Senator werden wollte. Mir ging es darum, linke Politik praktisch um- und durchzusetzen.
Die Arbeit an diesem Text war für mich eine Selbstverständigung, ein Prozess, um mir wieder Orientierung zu erarbeiten – nach bald zwanzig Jahren in einem engen Zeitkorsett durchgetakteter Terminkalender, das für grundsätzlichere Überlegungen nicht viel Raum gelassen hat.
Das Jahr 1989 hat mich als damals Fünfzehnjährigen politisch stark geprägt. Ich habe die Friedliche Revolution erlebt, als die DDR-Bevölkerung ihre Geschichte gemacht hat. Das war auch der Bankrott des real existierenden Sozialismus. Als ich mich 1992 für den Eintritt in die PDS entschieden habe, war für mich auch das Versprechen von sozialistischen, demokratischen Linken ausschlaggebend, mit dem Stalinismus und seinen Spätfolgen in der Diktatur der DDR ohne Wenn und Aber zu brechen und die eigene Geschichte, auch in ihren schrecklichen Aspekten, bis an die Wurzel gehend aufzuarbeiten. Das war sozusagen die Geschäftsgrundlage meiner Mitgliedschaft.
Mit bald fünfzig Lebensjahren gehöre ich inzwischen zu den Älteren in meiner Partei. Ich kann nicht einfach unterstellen, dass andere Menschen die Erfahrungen und Erlebnisse teilen, die meine Sicht beeinflusst haben. Um meine Perspektive nachvollziehbarer zu machen, erschien es mir deshalb sinnvoll, in den ersten Kapiteln dieses Buches in die Geschichte zurückzuschauen.
Die Linken – als gesellschaftliche Strömung und als Partei – stecken in einer tiefen Krise. Um wieder wirklich politik- und gestaltungsfähig zu werden, müssen wir uns streiten – nicht als Selbstzweck und bitte ohne die destruktiven Spiele eines hohl klingenden Verbalradikalismus. Im Text habe ich nicht immer trennscharf zwischen meiner Partei und der gesellschaftlichen Linken unterschieden. Es besteht ohnehin ein Wechselverhältnis zwischen beiden. Natürlich ist die linke Welt sehr bunt und vielfältig – und mehr, als die Partei DIE LINKE je abgebildet hat. Ich kann nicht mal behaupten, sie in Gänze zu kennen. Es ist meine Perspektive.
Wenn es auf den folgenden Seiten explizit um die Partei DIE LINKE geht, habe ich versucht, das deutlich zu machen. Für meine Partei ist zentral, dass wir uns sehr schnell auf ein gemeinsames Programm verständigen und politische Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit entwickeln. Im Jahr 2025 wird (spätestens) der nächste Bundestag gewählt. Auch unsere Gesellschaftskrise macht es dringlich. Wir können es uns nicht leisten, uns erst noch ein paar Jahre mit uns zu beschäftigen.
Auch die gesellschaftliche Linke steht vor der Herausforderung, sich auf ihren Wesenskern zu besinnen. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 und dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 kenne ich immer mehr Linke, die an »der Linken« verzweifeln. Gefragt ist ein linkes Denken, das befreit ist von der eigenen Dogmengeschichte, von Selbstgerechtigkeit und Selbstbezogenheit. Das attraktiv ist, weil es sich den bestehenden Verhältnissen in ihrer Widersprüchlichkeit mit dem Ziel ihrer Verbesserung zuwendet, ohne seinen Kompass zu verlieren und ohne sich nur in routinierter Empörung zu erschöpfen. Aus meiner Sicht sind Freiheit, Gleichheit und Universalismus seine Eckpfeiler und die Demokratie sein Lebensraum. In Zeiten, in denen die Demokratie und universale Menschenrechte von den unterschiedlichsten Seiten so eklatant unter Druck geraten, ist ein radikaler Humanismus wichtiger denn je.
Berlin im Dezember 2023
ERSTES KAPITEL
NEUNZEHNHUNDERTNEUNUNDACHTZIG
ALS DER KAPITALISMUS ÜBRIGBLIEB
Im Herbst 1989 war ich 15 Jahre alt, geboren in Schwerin, in Frankfurt an der Oder aufgewachsen. Mein Vater war Berufspendler, weshalb unsere Familie im Sommer 1988 schließlich nach Berlin umgezogen ist. Geistig damals ganz ein Kind der DDR, nahm ich die Verhältnisse, in die ich hineingeboren worden war, als gegeben. Ich wuchs auf in die Gewissheit, dass der Sozialismus dem Kapitalismus »gesetzmäßig überlegen« sei. Irritationen dieser Gewissheit durch die Wirklichkeit, soweit ich sie in meiner Kindheit und frühen Jugend wahrgenommen habe, sah ich nicht als Verfallserscheinungen eines sich auflösenden Systems. Sie waren für mich Ausdruck der Beschwernisse eines langen Wegs, der noch vor uns lag. Außerdem war ja da auch noch der feindliche Westen, der immer verlässlich seinen Teil beitrug, um die Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen zu torpedieren.
Mein Weltbild war orthodox und binär. Richtig und falsch, gut und schlecht waren klar definiert. Kinder brauchen vielleicht solch klare, überschaubare Weltbilder. Das begann sich erst zu verändern, nachdem wir nach Berlin gezogen waren. Und auch das nicht von einem auf den anderen Tag, tatsächlich war das ein sehr langsamer Prozess. Ich erinnere mich, zu Weihnachten 1988 von einer Freundin in meiner neuen Schulklasse eine Schwarz-Weiß-Brille geschenkt bekommen zu haben; das dürfte eine zutreffende Illustration meiner Weltsicht in diesen Tagen gewesen sein. Da wohnten wir gerade mal sechs Monate in der Hauptstadt der DDR, doch in dieser kurzen Zeit hatte ich mit jedem neuen Tag erlebt, wie die innere Spannung in der Gesellschaft zunahm und diese sich enorm politisierte. Außerdem kam ich in das Alter, in dem ich begann, die Dinge differenzierter und in ihrer Widersprüchlichkeit wahrzunehmen. Ich wurde langsam erwachsener.
Als die sowjetische Zeitschrift Sputnik, ein Gorbatschows Diktum der Offenheit verpflichteter Digest der Presse des »Bruderlandes« UdSSR in der DDR, im November 1988 verboten (im Agitprop-Sprech der SED: »nicht mehr ausgeliefert«) wurde, erlebte ich an meiner Schule sprachlose Lehrer*innen, viele von ihnen treue Parteimitglieder. Auch bei vielen von ihnen bröckelten die Gewissheiten. Egal, ob in der Familie oder im Freundeskreis, überall wurde über originär politische Fragen diskutiert, durchaus sorgenvoll mit Blick in die Zukunft, aber auch voller Hoffnung: Auf einmal war die Zukunft offen und nicht einfach die Fortsetzung einer stillgestellten Gegenwart.
Die Ostberliner Punkband Die Skeptiker spielte in der Blechturnhalle unserer Schule »DaDa in Berlin« und der Liedermacher Gerhard Schöne sang die Lieder »Alles muß klein beginnen« und »Mit dem Gesicht zum Volke«. Das war ein anderer Sound als der vom »planmäßigen Aufbau des Sozialismus«, den uns unser Klassenlehrer im Fach Staatsbürgerkunde, ein kritischer Zeit- und SED-Genosse, nicht ohne eine Spur von Ironie vermittelte. Das alles war dann auch für mich, knapp jenseits der Jugendweihe – dem von den meisten Jugendlichen in der DDR gefeierten Übergang ins Erwachsenenalter – bei Weitem nicht mehr nur eine Sache des Kopfes. Es war geradezu körperlich spürbar, dass es so nicht weitergehen konnte. Dringend musste sich etwas ändern im Lande. Wir hatten es ja bei Lenin so gelernt: Wenn die Beherrschten nicht mehr wollen und die Herrschenden nicht mehr können, entsteht eine revolutionäre Situation. All die gewohnten und langweilenden Parolen wichen einer neuen, klareren Sprache. Die »Klassiker-Zitate«, die das System bisher als Worthülsen zur Dekoration und Selbstfeier seiner Herrschaft benutzt hatte, richteten sich plötzlich gegen die Herrschenden. Diese Sätze hatten wirklich etwas mit der Welt zu tun, in der ich mich versuchte zurechtzufinden. Plötzlich war überall echte Politik.
Gleichzeitig liefen dem Land zu Zehntausenden die Leute weg. Weder Mauer noch Stacheldraht und Selbstschussanlagen konnten sie noch aufhalten. Was hätten auch bestens aufgestellte Propagandaabteilungen des Politbüros der SED daran kaschieren können? Es wurde schlicht zu einer im Alltag spürbaren, nicht mehr zu leugnenden Erscheinung: Alle konnten im Berufsleben, in der Familie, in der Kneipe oder im Garten von anderen erzählen, die plötzlich nicht mehr bei der Arbeit aufgetaucht waren. In einem Land mit knappem Wohnraum waren viele Wohnungen auf einmal »freigezogen«. Im September 1989 entlud sich die Unzufriedenheit und Wut der Hiergebliebenen in immer heftigeren Protesten – zunächst in Leipzig, bei den legendären Montagsdemonstrationen, dann bald überall, auch in der DDR-Hauptstadt. Die Eindämmungs- und Erklärungsversuche der Staatsmacht, die in gewohnter Weise »auf vom Westen gesteuerte konterrevolutionäre Umtriebe« verwies und mit zunehmender Repression antwortete, bewirkten das glatte Gegenteil.
Am 9. September kündigten Vertreter*innen verschiedener Oppositionsgruppen die Gründung des Neuen Forums als einer republikweiten Oppositionsbewegung an, die auf Grundlage der geltenden DDR-Verfassung die Zulassung als politischer Verein beanspruchte. Im Gründungsmanifest »Aufbruch 89« wurde aber nicht nur zu Dialog aufgerufen und ein Ende der staatlichen Gewalt und der Bespitzelung durch den Staatssicherheitsdienst gefordert. Es wurde ein Gestaltungsanspruch für das Land formuliert: »Auf der einen Seite wünschen wir uns eine Erweiterung des Warenangebotes und bessere Versorgung, andererseits sehen wir deren soziale und ökonomische Kosten und plädieren für die Abkehr von ungehemmtem Wachstum. Wir wollen Spielraum für wirtschaftliche Initiative, aber keine Entartung in eine Ellenbogengesellschaft. Wir wollen das Bewährte erhalten und doch Platz für Erneuerungen schaffen, um sparsamer und weniger naturfeindlich zu leben. Wir wollen geordnete Verhältnisse, aber keine Bevormundung.«
So eine Klarheit und Reflexion, so viel Mut zum offenen Denken wünsche ich mir heute manchmal von den politischen Parteien, auch von meiner eigenen. Der Ausgangspunkt waren die konkreten, unhaltbar gewordenen Missstände in der DDR. »Wir wollen ein wirksames Gesundheitswesen für jeden; aber niemand soll auf Kosten anderer krankfeiern. Wir wollen an Export und Welthandel teilhaben, aber weder zu Schuldner und Diener der führenden Industriestaaten noch zum Ausbeuter und Gläubiger der wirtschaftlich schwachen Länder werden.« Zusammengefasst hieß es: »Allen Bestrebungen, denen das NEUE FORUM Ausdruck und Stimme verleihen will, liegt der Wunsch nach Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden sowie Schutz und Bewahrung der Natur zugrunde. Es ist dieser Impuls, den wir bei der kommenden Umgestaltung der Gesellschaft in allen Bereichen lebensvoll erfüllt wissen wollen.«1
Ich nehme an, es dürfte klar sein, weshalb mir dieser Aufruf noch gut drei Jahrzehnte später sehr aktuell vorkommt. Er erfuhr in jenen Tagen eine überwältigende Resonanz. Sein Widerhall reichte weit über das Spektrum derjenigen hinaus, die bereits seit Jahren oder gar Jahrzehnten in der DDR in oppositionellen Zirkeln engagiert waren. »Dialog« wurde zum Schlüsselbegriff der Stunde. Diejenigen, die die Kirchen zu Friedensgebeten füllten, wollten meist das Land nicht verlassen. In den Betrieben, Universitäten, Schulen und Freundeskreisen gab es kaum ein anderes Thema. »Es lag schon eine gewisse Ironie darin, dass sich Oppositionsgruppen unter denen formierten, die bleiben wollten. Die immer größere Zahl der Fliehenden brachte diejenigen, die nicht bereit waren, sich selbst zu entwurzeln, dazu, Reformen zu fordern, die ihr Bleiben rechtfertigen würden.«2
Der vierzigste Geburtstag der DDR, der 7. Oktober 1989, geriet zum bizarren Sinnbild der Widersprüche, die sich innerhalb des Landes – und damals sozusagen als »real existierende innersozialistische Widersprüche«, als Widersprüche des Systems – aufgestaut hatten. Im Palast der Republik am Marx-Engels-Platz speiste die Partei- und Staatsführung und feierte sich. »Vorwärts immer, rückwärts nimmer!«, verkündete der SED-Generalsekretär Erich Honecker in seiner Festansprache in Gegenwart des KPDSU-Chefs Michail Gorbatschow. Und vor dem Haus demonstrierten die Menschen, sie riefen »Wir sind das Volk!« und »Gorbi, hilf uns!«. Gorbatschow soll den Satz »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben« ja so nie gesagt haben.3 Dass er ihm dennoch zugeschrieben wurde, hat vermutlich etwas mit der Stimmung der meisten Menschen zu tun, die an diesem Tag auf den Straßen waren, die sich Wasserwerfern aussetzten, Prügel und Verhaftung riskierten und eben auch erlitten. Viele von ihnen hat die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft motiviert, die ihre Angelegenheiten unter freien und gleichen Menschen kollektiv regeln, ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen würde. Letztlich war es doch der eigene hehre Anspruch, den die Demonstrierenden der SED-Führung entgegenhielten. Dem hatte die Diktatur der Partei nichts mehr entgegenzusetzen. Eine stets größer werdende Zahl von Leuten machte einfach nicht mehr mit. Es war der komplette moralische und politische Bankrott des alten Systems. Dass es auch Ausdruck des ökonomischen Bankrotts war, spielte in diesen Tagen zumindest in meinem Erleben tatsächlich eine eher kleine Rolle.
Am 18. Oktober 1989 trat der SED-Parteichef Erich Honecker »aus gesundheitlichen Gründen« zurück. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes, bestenfalls eine kleine Bewegung, eine Öffnung – die Möglichkeit, die Entwicklung weiterzutreiben. Aber es war ersichtlich nicht der komplette Abtritt der »alten Riege«, nicht die Übernahme von Verantwortung für die Zustände und auch nicht die ersehnte Zukunftsperspektive. Als am 4. November 1989 eine halbe Million Menschen auf dem Alexanderplatz demonstrierte, erlebte die DDR ihre erste genehmigte Demonstration, die nicht von der Parteibürokratie als Inszenierung von Zustimmung oder zur allgemeinen Erbauung organisiert war. Menschen aus der Kultur-, vor allem der Ostberliner Theaterszene hatten sich unter dem Eindruck der polizeilichen Willkür an jenem 40. Jahrestag der DDR zusammengetan, um auf weitere Veränderungen zu drängen.
Nach meinem Unterricht, der Sonnabend war seinerzeit ein regulärer Schultag, verfolgte ich in Hohenschönhausen die Übertragung der Reden im DDR-Fernsehen. Ich erinnere mich noch gut daran, welche Kraft und welcher Enthusiasmus von dieser Kundgebung ausgingen. »Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür, von amtlicher Blindheit und Taubheit. Welche Wandlung! Vor noch nicht vier Wochen: Die schön gezimmerte Tribüne hier um die Ecke, mit dem Vorbeimarsch, dem bestellten, vor den Erhabenen! Und heute? Heute ihr! Die ihr euch aus eigenem freien Willen versammelt habt, für Freiheit und Demokratie und für einen Sozialismus, der des Namens wert ist«, sprach der Schriftsteller Stephan Heym zu den Massen: »Der Sozialismus – nicht der Stalin’sche, der richtige –, den wir endlich erbauen wollen, zu unserem Nutzen und zum Nutzen ganz Deutschlands, dieser Sozialismus ist nicht denkbar ohne Demokratie.«4 Mich haben diese Worte begeistert.
Der jüdische und antifaschistische Literat Heym war nach seiner Emigration 1935 mit der US Army im Kampf gegen die Nazis zurück nach Deutschland gekommen. Er hatte sich immer gegen die Engstirnigkeit der Partei-Oberen gewehrt, gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann im November 1976 protestiert und die demokratischen, linken oppositionellen Bewegungen im Land schon in den 1980er Jahren unterstützt. Zweimal war er deshalb aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen worden. Heym gehörte zu denjenigen, die wenige Wochen später den Aufruf »Für unser Land«5 initiierten. Erarbeitet hatten ihn Persönlichkeiten aus Kultur, Betrieben und Politik, auch aus der DDR-Opposition. Sie sprachen sich für den Erhalt einer eigenständigen DDR »mit demokratischem Sozialismus« aus, in der die in der Friedlichen Revolution schon erreichten Freiheiten unter selbstbestimmten Verhältnissen erhalten und ausgebaut werden müssten. Den Aufruf unterzeichneten 1,17 Millionen Menschen. Darunter war auch der Vorsitzende der DDR-CDU, Lothar de Maizière, der einige Monate später der letzte Ministerpräsident des Landes werden würde.6 Heutzutage wäre das eine stolze Zahl für eine Petition, und seinerzeit genügte dafür nicht der schnelle Klick am mobilen digitalen Endgerät.
Der Schriftsteller und Dramatiker Heiner Müller war schon in diesen Tagen deutlich illusionsloser. Auf der Großdemonstration am 4. November hatte er einen Aufruf zur Gründung freier Gewerkschaften verlesen. Er sah die Perspektiven, die durch die Friedliche Revolution eröffnet wurden, wohl klarer als viele andere Zeitgenoss*innen. Seine Autobiografie »Krieg ohne Schlacht« legt davon Zeugnis ab.7 Auch wenn diese Rede damals nicht meinen Empfindungen entsprach: Er behielt schließlich Recht. Eigenständig würde die DDR nicht mehr lange bleiben.
Am Abend des 9. November 1989 öffnete die SED-Führung überraschend und unvorbereitet die Berliner Mauer – unter dem Druck der Straße, des Rufes nach Reisefreiheit und offenen Grenzen, der wachsenden Dringlichkeit einer politischen Lösung für die Ausreisewilligen in den bundesdeutschen Botschaften in Prag, Budapest oder Warschau und der massiven Kritik an einem wenige Tage zuvor veröffentlichten Entwurf für ein Reisegesetz. Die angeschlagene DDR-Führung erhoffte sich von ihrem versuchten Befreiungsschlag wohl, diesen Druck kontrolliert ablassen zu können. Stattdessen demonstrierte sie mit dieser Episode nur umso drastischer, wie sehr sie nur noch von der Dynamik der Ereignisse getrieben war.
Das Symbol für die jahrzehntelange Teilung der Welt wurde über Nacht eingerissen. Die Bilder dieser Nacht gingen um den Globus. Es sind letztlich diese Bilder, auf die die gesamte widersprüchliche Geschichte der Friedlichen Revolution 1989 und 1990 in unserer kollektiven Erinnerung geschrumpft ist. Mit der Maueröffnung stand sofort die »deutsche Frage« auf der Tagesordnung, die staatliche Einheit des seit 1949 in zwei feindliche Staaten geteilten Landes. Diese Frage war mit der ökonomischen Perspektive der DDR verbunden – staatliche Einheit unter den Bedingungen der Bundesrepublik bedeutete Kapitalismus.
Die Zeitung der DDR-Blockpartei CDU, die Neue Zeit, berichtete am 11. Dezember 1989, Mitarbeiter des Dresdner Forschungsinstitutes Manfred von Ardenne, Mitglieder der Staatskapelle Dresden, Solisten der Staatsoper und Kollektive Dresdener Betriebe hätten den Aufruf »Für unser Land« als »Illusion« seiner Verfasser*innen abgelehnt: »Es genügt nicht, wenn wir uns den Kopf über gerechtes Verteilen zerbrechen. Es muss zuerst effektiv und genügend produziert werden. Wir haben genug von den Utopien! Alle Versuche, die zentrale Planwirtschaft zu reparieren, sind gescheitert. Das sozialistische Wirtschaftssystem mit zentralisierter Planung ist der sozialen Marktwirtschaft Westeuropas unterlegen.« Damit war eine Schlüsselfrage des demokratischen Aufbruchs, nach der ökonomischen Grundlage für die Zukunftsgestaltung des Landes, aufgerufen. Die Autor*innen der Wortmeldung beantworteten diese Frage so: »Wir sind gegen weitere Experimente. Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist nicht für alle Zeiten ausgeschlossen. Unsere Blicke richten sich jedoch mehr nach Strasbourg als nach Bonn. Unsere Zukunft liegt in einer engen Bindung an die EG. Von der Regierung fordern wir ein Programm zur Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien.«8
Auch die rasche Maueröffnung konnte den Autoritätsverlust des SED-Staates nicht mehr aufhalten. Am 1. Dezember 1989 wurde die »führende Rolle der SED« aus der Verfassung gestrichen. Knapp eine Woche später trat der Runde Tisch der DDR unter Moderation von Kirchenvertretern erstmals zusammen, mit Vertreter*innen der Regierung, der SED und der Blockparteien sowie verschiedener Bürgerbewegungen.9 Der Runde Tisch der DDR nahm gewissermaßen parlamentarische Funktionen wahr. Denn die Volkskammer hatte dafür in den Augen der Bevölkerung jegliche Legitimation verloren. Die Beteiligten dieser neuen Institution, vor allem die mit wenig institutioneller Erfahrung ausgestatteten Bürgerbewegten, fanden sich einem Staatsapparat gegenüber, dem sie nach all ihren Erfahrungen zutiefst misstrauen mussten. Was folgte, war die Einübung einer völlig neuen Art, das Land zu regieren, und zwar nach Regeln, für die es keinerlei historisches Vorbild gab. Eine der ersten Entscheidungen des Runden Tisches war der Auftrag zur Erarbeitung einer neuen Verfassung für das Land, über deren Annahme die DDR-Bevölkerung in einer Volksabstimmung entscheiden sollte.10
Die Praxis des Runden Tisches machte im ganzen Land Schule. Überall entstanden jetzt lokale Runde Tische, die sich nach dem überregionalen Vorbild mit den politischen Angelegenheiten vor Ort befassten. Am Berliner Runden Tisch im Roten Rathaus saß plötzlich auch ich, knapp 16 Jahre alt. Vom Runden Tisch der Jugend Berlins war ich gemeinsam mit einem Mitstreiter aus der christlichen DDR-Jugendarbeit dorthin entsandt worden. Wir beide verfügten über eine Stimme, übten also unser Mandat im Konsens aus. Ich konnte hautnah erleben, wie Menschen einmal wöchentlich über alle politischen Lager hinweg konzentriert an der Lösung der drängenden Alltagsfragen der Stadt arbeiteten. Für mich war das die erste und wohl eindrücklichste Schule der Demokratie. Ich lernte, was demokratischer Austausch und Streit und die Suche nach gemeinsamen Lösungen bedeuten – auf Augenhöhe und in gegenseitigem Respekt. Ich erhielt schockierende Einblicke in die Arbeitsweise des DDR-Geheimdienstes, denn die Auflösung des MfS/AfNS Berlin war in unseren Diskussionen ein Dauerthema. Auch die Arbeit an einer neuen Berliner Verfassung gehörte zu den kontinuierlich erörterten Themen an dem in unserem Fall rechteckigen Berliner Tagungsmöbel.
Über die Zeit wurden die Bedingungen, unter denen diese neue, aus der Revolution geborene Form der politischen Interessenvermittlung stattfand, jedoch immer widersprüchlicher und auch unübersichtlicher. Der Exodus von Menschen aus der DDR ließ, allen Erfolgen der Friedlichen Revolution zum Trotz, nicht nach. Die entscheidende Frage nach einer zukunftsfähigen wirtschaftlichen Perspektive, nach der ökonomischen Entwicklungsbasis des Landes, ließ sich unter den unsicheren Verhältnissen und kurzfristig kaum überzeugend beantworten. Auch westdeutsche Politik wurde seit der Maueröffnung zwangsläufig ein immer wichtigerer Faktor – natürlich auch immer stärkerer Orientierungspunkt für die Bevölkerung, die Debatten und den Gang der Dinge im Land. Schließlich wurde die zunächst erst für Mai 1990 geplante Volkskammerwahl auf den 18. März vorgezogen.
Die »Bruderparteien« lösten sich von der SED und orientierten sich an ihren neuen Schwesterparteien in der Bundesrepublik. Einst in der »Nationalen Front« der DDR vereint? Das war Geschichte, von der man schnell nichts mehr wissen wollte. In den westdeutschen Parteien CDU und FDP nahmen umgekehrt proportional die Berührungsängste gegenüber DDR-Politfunktionär*innen rasant ab, die gerade noch von der Bevölkerung als systemtreue »Blockflöten« verspottet worden waren. Auch die SPD (Ost) und die SPD (West) bezogen sich immer stärker aufeinander. Innerhalb der verschiedenen Gruppen und Initiativen der Bürgerbewegung differenzierten sich die Vorstellungen zu allem, was die Zukunft bringen sollte, nach und nach aus. Diese zweistaatliche und doch in wachsendem Maße »innerdeutsche« Politik, die immer mehr um das zukünftige Verhältnis zwischen DDR und BRD mäanderte, hatte wiederum weltpolitische Implikationen: Die einstigen Alliierten der Anti-Hitler-Koalition hatten ja auch noch ein Wort mitzureden.
Bundeskanzler Helmut Kohl versprach für den Fall eines Wahlsiegs der unter Führung der DDR-CDU gebildeten »Allianz für Deutschland« eine schnelle Wirtschafts- und Währungsunion. Zu den Auftritten des westdeutschen Kanzlers (und erfahrenen Wahlkämpfers) in der DDR strömten in diesen Monaten hunderttausende Menschen. Er brachte eine eingängige Botschaft mit: die D-Mark. Nun hieß es nicht mehr »Wir sind das Volk!«, sondern »Wir sind ein Volk!«. Wo gerade noch eine kreative und originelle Pluralität politischer Parolen geherrscht hatte, wehten nun immer mehr Deutschlandfahnen. Das Ergebnis der Volkskammerwahl am 18. März war nicht nur eine bittere Enttäuschung für die meisten Bürgerbewegten. Es war ein Schock für alle, die auf die Chance eines eigenständigen demokratischen Reformprozesses gesetzt hatten. Zu diesen Menschen gehörte auch ich. Das Wahlergebnis zeigte, dass wir in der Minderheit waren. Helmut Kohl hatte gewonnen. Jetzt ging es nur noch um die Geschäftsbedingungen einer schnellen Vereinigung.
Aus heutiger Perspektive hätte mich der Ausgang der Volkskammerwahl 1989 eigentlich überhaupt nicht überraschen dürfen. Die Bevölkerung der DDR hatte die freie Wahl. Große Teile der DDR-Bevölkerung hatten, wie die Autor*innen des Dresdner Aufrufs, offensichtlich genug von Utopien. Sie hatten sich gegen »weitere Experimente« und für ein weitgehend geordnetes, materiellen Konsum und grundlegende Freiheiten garantierendes Gesellschaftsmodell entschieden. Das war sehr konkret. Und es war sehr viel attraktiver als alles, was in der DDR bis dahin im Angebot war. Ein Staat, der über Jahrzehnte eine Betonmauer und Schießbefehl brauchte, um die Bürger im Land zu halten, die nicht besonders feinsinnige anti-westliche Propaganda der SED, für die sich schließlich mehr und mehr Mitglieder der Partei nur noch schämten, konnten die Anziehungskraft des westlichen Gesellschaftsmodells nicht erschüttern.
Aus der Schule und von meinen damaligen Freundschaften wusste ich: Wenn die Staatspropaganda bei vielen Menschen etwas bewirkt hatte, dann wohl eher das Gegenteil, eine eigentümliche Mystifizierung der gesellschaftlichen Verhältnisse auf der anderen Seite des »Eisernen Vorhangs«. Dort gab es alles, was wir nicht hatten. Warum sollte es da nicht plausibel sein, dass Helmut Kohl »blühende Landschaften« binnen weniger Jahre11 in Aussicht stellte? Angesichts dieser Verheißungen schienen die enthusiastischen Ansprüche und Hoffnungen des Herbstes 89 nur mehr abstruse Weltverbesserei zu sein – oder der Versuch der alten Genossen, sich irgendwie an der Macht zu halten.
Für Kanzler Kohl und seine CDU-FDP-Regierungskoalition war es nicht nur verwaltungstechnisch die naheliegendste Lösung, die Abwicklung der DDR als eine Gebietsvergrößerung der Bundesrepublik zu veranstalten. Im Westen konnte alles einfach bleiben wie gewohnt. Wer sich als Sieger der Geschichte fühlen kann, macht die Regeln. Die Entwicklung in der Endphase der DDR verschaffte der Politik und auch den Menschen im Westen eine komfortable Selbstvergewisserung: Die Bundesrepublik repräsentierte die bestmögliche aller Welten, die Systemfrage schien für alle Zeit entschieden. Aus diesem Blickwinkel konnte der Bevölkerung der DDR, in ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse, nichts Besseres passieren, als Teil dieser bestmöglichen aller Welten zu werden – und zwar zu den bestehenden Konditionen. Leider produzierten die Sieger der Geschichte dabei jede Menge Verlierer*innen, die sich gefälligst anzupassen hatten, auch wenn sie auf die westdeutsche Konkurrenzgesellschaft denkbar schlecht vorbereitet waren. Für die Bevölkerung in der DDR änderte sich mit dem 3. Oktober 1990 nahezu alles.
Die Friedliche Revolution wurde mit der DDR-Konkursmasse durch den ökonomisch potenten Westen übernommen. Der Zwei-plus-Vier-Vertrag mit den einst gegen Nazideutschland verbündeten Alliierten beendete die staatliche Teilung. Deutschland war wieder ein Land, legitimiert durch demokratische Wahlen. Die Bevölkerung der DDR war damit mehrheitlich zufrieden. Die Menschen im Westen musste das nicht direkt berühren, solange sie nicht mit der Ostverwandtschaft und ihren vielleicht etwas komischen Ansichten in Berührung kamen. Der Alltag in Düsseldorf oder Passau war auch 1991 noch weitgehend derselbe wie zwei Jahre vorher. Was in der DDR stattgefunden hatte, war für die Menschen in der »alten Bundesrepublik« selten mehr als ein für einige Wochen sehr aufregendes Fernsehereignis. Ja, es gab jetzt nicht mehr elf Bundesländer und West-Berlin, sondern 16 Bundesländer.
Mittlerweile haben sich die meisten Menschen hierzulande daran gewöhnt, die Friedliche Revolution in der DDR 1989/90 von ihrem Ende her zu betrachten. Das rebellische, revolutionäre, freiheitlichdemokratische und auch subversive Moment, die kollektive Emanzipation der Menschen in der DDR von ihrer Obrigkeit trat in den Hintergrund, wurde nur noch als Zwischenstation auf dem Weg zur wiedergewonnenen nationalen Einheit gesehen. Im Sommer 1989 hatte der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama die These vom Ende der Geschichte12 postuliert, die den damals herrschenden Zeitgeist ebenso widerspiegelte wie prägte: Mit dem Zusammenbruch der UdSSR und ihrer realsozialistischen Satelliten-Regimes würde sich nunmehr Schritt für Schritt der Liberalismus mit »Demokratie und Marktwirtschaft« endgültig und überall durchsetzen.
Aber die Monate des Aufbruchs hatten der Bevölkerung der DDR eine gemeinsame Erfahrung verschafft, die die Menschen im Westen des Landes nicht machen konnten. Im Osten des Landes hatten sie erlebt, wie starre und überkommene Verhältnisse überwunden werden konnten – Verhältnisse, die gestern noch dauerhaft und zementiert erschienen waren. Die Zukunft schien plötzlich, anders als von der Obrigkeit immer behauptet, nicht mehr festgelegt und vorherbestimmt, sondern offen. Es herrschte, wenn auch nur für eine kurze Zeit, das Empfinden, dass es an uns allen läge, daraus gemeinsam etwas Neues zu machen. Wäre auch nur ein Hauch dieses frischen Winds, dieses »großen Beginnergefühls«13 der Ergebnisse des Herbstes von 1989, zu einem Teil des Selbstverständnisses des vereinigten Deutschlands geworden – wo stünden wir dann heute, im Jahr 2024?
Seit der Friedlichen Revolution in der DDR sind inzwischen mehr als drei Jahrzehnte vergangen. Ich finde es schade, ja, geradezu tragisch, dass der Anspruch auf Veränderung der Gesellschaft bestenfalls noch im Hintergrund rauscht, wenn wir auf diese Zeit zurückblicken. Gänzlich überraschend ist das nicht. Im Osten, den »neuen Bundesländern«, mussten sich die Leute in den ihnen völlig ungewohnten und neuen Verhältnissen zurechtfinden, die sich ihnen nicht nur in Gestalt westdeutscher Lehrmeister*innen in der Verwaltung und Eigentümer*innen von Unternehmen, Grundstücken und Wohnhäusern zeigten, sondern vor allem als neue und entpersonalisierte Macht, als Geld und Kaufkraft. Aus Bürger*innen wurden Marktteilnehmer*innen. Über die gebrochenen Biografien und ökonomischen Verwerfungen für Millionen neuer Bundesbürger*innen ist immer wieder gesprochen worden.
Es vergeht hierzulande keine festliche Würdigung der Jahrestage von 1989 und 1990, in der nicht »der Mut der Ostdeutschen« in offiziellen Reden beschworen wird. Verbunden ist das noch immer mit der Beteuerung, eine »gemeinsame Kraftanstrengung« werde über kurz oder lang alle Benachteiligungen des Ostens auflösen. In der DDR hatten sarkastische Geister einen Floskelgenerator gebastelt, mit dem sich zur Erbauung im Bekanntenkreis und zur subversiven Spöttelei verschiedene Varianten offizieller Reden der »Partei- und Staatsführung« für alle Gelegenheiten aus vorgegebenen Satzfragmenten zusammenstellen ließen. Sicherlich bin ich nicht der Einzige, der sich bei heutigen Reden zur Friedlichen Revolution und zum Mauerfall an den Floskelgenerator erinnert.
Ob über die sozialen Fragen gesprochen wird, über das immer noch gravierende Lohngefälle, die Rentenungerechtigkeit, die von Anfang an bestehende Ungleichheit der Eigentumsbildung in Ost und West und die damit verbundene Vererbung von Ungleichheit über Generationen oder über demokratische Defizite – der Fluchtpunkt der (Ost-West-)Debatten blieb seit 1989/90 im Kern derselbe.14 Es drehte sich um das Gelingen der »Integration der Ostdeutschen«, was (wie immer wieder auch gegenüber Migrant*innen) stets die schwer paternalistische Note der herrschenden Machtverhältnisse (und ihrer Nichthinterfragbarkeit) in sich trägt. Beschworen werden die Postulate des Grundgesetzes, vor allem das Gebot der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet.
Es ist – wie erst jüngst bei Dirk Oschmann – von der Notwendigkeit ostdeutscher Selbstverständigung die Rede und von einer Politik, die das »Vertrauen der Ostdeutschen in die Demokratie«15 erhalten, bestärken oder sichern solle. Das angestaute Unbehagen und der Unmut in Ostdeutschland werden als Ausdruck einer mehr und mehr im Vagen verharrenden »Ost-Identität« bewirtschaftet. Selbst die um ihre Relevanz kämpfende Linkspartei, als PDS die einstige »Ost«-Partei, hofft mit der Anrufung diffuser »Ostinteressen« und der Forderung, »die Politik« müsse sich »wieder um den Osten kümmern«, auf größere Resonanz. Die rechtsextreme AfD versucht das Ganze sogar zu einem Kulturkampf zu stilisieren. Sie plakatierte in Brandenburg 2019 nicht ganz erfolglos »Vollende die Wende!«.
Eigentlich ist von Ostdeutschland und über die Bürger*innen der ehemaligen DDR seit über dreißig Jahren nur aus einer Defizitperspektive die Rede. Das liegt, denke ich, auch daran, dass die Ereignisse von 1989/90 bis heute nur von ihrem Ende her – und ihn ihrem Verlauf als alternativlos – erzählt werden. Aber weder die »Treuhand« noch die Vereinigung aufgrund von Art. 23 GG a.F. waren das. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland war vom Verfassungskonvent der drei Westzonen 1948 in Herrenchiemsee nie für die Ewigkeit entworfen worden, es sollte Provisorium sein. Die Arbeitsgruppe des Runden Tisches »Neue Verfassung der DDR« hatte am 4. April 1990 den Abgeordneten der neu gewählten Volkskammer ihren einstimmig verabschiedeten Verfassungsentwurf für die DDR übermittelt. Da stand schon fest, dass die staatliche Einheit sehr bald vollzogen werden würde. Offen war allerdings noch, ob das Grundgesetz auf Dauer gestellt oder nach Art. 146 GG a.F. eine neue gesamtdeutsche Verfassung gemeinsam erarbeitet werden würde. Diese Entscheidung war keine von zwei gleichberechtigten Partnern auf Augenhöhe. Sie fiel in Bonn.
Es lohnt sich auch angesichts der heutigen Herausforderungen wieder, den Entwurf des Runden Tisches für eine DDR-Verfassung16 genau zu lesen – nicht nur für an Zeitgeschichte interessierte, sondern auch für gegenwärtig ganz akut beunruhigte Menschen. Aus der Erfahrung der Friedlichen Revolution geschöpft, enthält er eine ganze Reihe von Regelungen, die auf eine größere Partizipation der Bevölkerung und gestärkte soziale und ökonomische Rechtspositionen zielen. Auch die Runden Tische sind als Institutionen jenseits der »Linearperspektive« der herrschenden Parteipolitik für mich keine überlebten Formate. Der Bürgerrechtler Wolfgang Ullmann hat einige Monate nach ihrem Ende festgehalten, ihre Stärke habe in einer Orientierung bestanden, »die nicht mit Gewalt und Konkurrenz erzwingbar ist, sondern nur im gemeinsamen Diskurs und in gemeinsamer Entscheidung für eine realisierbare Zukunft«.17 Ist das nicht ein Bezugspunkt, der auch heute noch wichtig ist, vielleicht wichtiger als je zuvor? Dass Menschen Demokratie vor allem dann als wertvoll erfahren, wenn sie sich selbst darin als Handelnde erleben, die Einfluss auf die Gestaltung ihres täglichen Lebens nehmen können? Welche Voraussetzungen bräuchte es, damit das wieder besser gelingen kann?
Womöglich war es, trotz aller Hindernisse, Frustrationen, Enttäuschungen über nahezu vierzig Jahre, die in der DDR erlebte relative materielle Gleichheit der Menschen, die es ihnen überhaupt erst ermöglichte, die kollektive Emanzipation vom SED-Regime unter dem Motto »Wir sind das Volk!« zu bewerkstelligen. Der Soziologe Wolfgang Engler hat 2002 darauf hingewiesen, dass annähernde soziale Gleichheit die Menschen mit Wahrnehmungen, Urteilen und Gefühlen ausstatte, die selbst geringfügige Unterschiede registrierten. Missgunst und Neid würden, so Engler, diese Dynamik ebenso antreiben wie Mitgefühl und Großherzigkeit. Es hänge von der konkreten Lage eines Menschen ab, und ich meine: auch vom Hintergrundrauschen des jeweils aktuellen Zeitgeists, ob der trennende Affekt über die verbindende Emotion triumphiere oder umgekehrt.18 Vielleicht steckt in dieser Beobachtung auch ein Grund dafür, dass im Westen der Republik ein solches Unverständnis über das im Osten verbreitete Unbehagen besteht. Möglicherweise deutet das auch auf ein ungenutztes gesellschaftliches Potenzial hin, weil die Freiheit von brutaler sozialer Ungleichheit auch andere Formen der Individualität ermöglichen würde als die von Eigentum und Statussymbolen?
Die verbindende Emotion hatte sich in den Ereignissen des Herbstes 1989, mit großen Hoffnungen und Erwartungen, Bahn gebrochen. Offenbar hat ihre Erfahrung »nach der Wende«, wie es im Osten immer noch distanziert heißt, vielen Menschen bewiesen, dass sie unter den neuen Verhältnissen bestenfalls einen Teil ihrer Erwartungen realisieren können, wenn sie ihre Ansprüche als Mitglieder der nationalen Gemeinschaft geltend machen: »Wir sind ein Volk!« Die neue Lage beförderte nun eher Missgunst und Neid. Gleichheit als eine Voraussetzung für die gemeinsame Gestaltung des Gemeinwesens stand – nach dem Ende der »Experimente« – unter dem Verdacht und Geruch »sozialistischer Gleichmacherei« und »leistungsloser, überzogener Anspruchshaltungen«. Fortan war jede*r des eigenen Glückes Schmied.
Unter meinen Freund*innen hieß es im Sommer 1990, nachdem über den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik entschieden war, oft etwas trotzig: »Der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist nur übriggeblieben!« Es waren nur einige Monate gewesen in dem Gefühl, dass es möglich und vereinbar sei, einander als frei und gleich zu verstehen, individuelle und kollektive Selbstbestimmung zu leben. Noch Jahre nach 1990 war an einem ostdeutschen Funktionsbau am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte ein Graffito zu lesen: »Das Chaos ist aufgebraucht, es war die schönste Zeit.«
In der Zeit um den Herbst 1989 begann mein Nachdenken über die Welt, in der wir leben. Während andere das »Ende der Geschichte« ausriefen, fing ich an, mich dafür zu interessieren, was Geschichte ist. Als der »realexistierende Sozialismus« zusammenbrach, wurde für mich ein von Deformierungen der Diktatur befreites sozialistisches Denken interessant. Ich begann Literatur über die Erfahrungen und das Leben sozialistischer Dissident*innen zu verschlingen.19





























