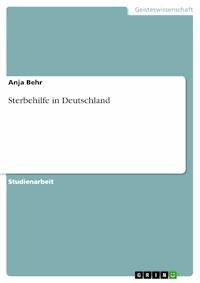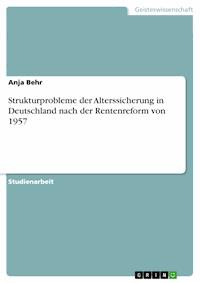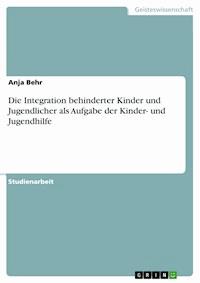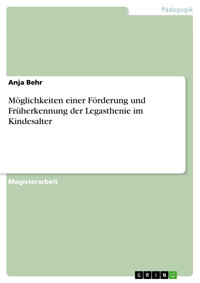
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note: 2,5, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Sprache: Deutsch, Abstract: John F. Kennedy (1917-1963) – 35. Präsident der Vereinigten Staaten, Winston Churchill (1874-1965) – ehem. Premierminister von Großbritannien und Nobepreisträger, Albert Einstein (1879-1955) – Physiker und Nobelpreisträger, Charles Darwin (1809-1882) – britischer Naturwissenschaftler, Leonardo da Vinci (1452-1519) – Maler, Bildhauer, Architekt, Walt Disney (1901-1966) – amerikanischer Filmproduzent, Jackie Stewart (geb. 1939) – ehem. britischer Rennfahrer, Cher (geb. 1946) – amerikanische Sängerin und Schauspielerin, Tom Cruise (geb. 1962) – amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent, Reinhard Mey (geb. 1942) – deutscher Liedermacher,... Immer mehr hört man heutzutage: Mein Kind hat Legasthenie! Was aber heißt das genau? Legasthenie ist keine Modeerscheinung, sondern eine medizinisch nachweisbare Teilleistungsstörung im Bereich der Sprachverarbeitung, die auch negative Auswirkungen auf das Leben des Kindes haben kann. Wie sehr einige Kinder unter der Störung leiden, zeigt die obige Strophe aus dem Lied „Der unendliche Tango der deutschen Rechtschreibung“ von Reinhard Mey, der in diesem Lied beschreibt, wie er sich damals als Kind gefühlt hat (vgl. http://www.reinhard-mey.de). Oft besitzen die Lehrer nicht die nötigen Qualifikationen, erkennen die Legasthenie zu spät oder gar nicht und stempeln die betroffenen Kinder als dumm oder faul ab, was zu schweren psychischen Schäden führen kann. Wichtig ist deshalb eine frühe Diagnose und Förderung, denn legasthene Kinder sind nicht dumm oder faul, im Gegenteil, oft sind sie sogar hochintelligent und auf ganz unterschiedlichen Gebieten sehr begabt. Haben sie ihre Ausbildung erfolgreich absolviert, findet man unter ihnen nicht selten Rechtsanwälte, Ärzte oder Ingenieure. Wie man auch bei den aufgezählten berühmten Persönlichkeiten sieht, liegen ihre Begabungen oft im sportlichen, kreativen oder technischen Bereich. Wie eine frühe Diagnostik und Förderung aussehen kann, soll im Rahmen dieser Arbeit erörtert werden. Ehe im vierten Kapitel die diagnostische Vorgehensweise und im fünften Kapitel die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten ausführlich dargestellt werden, wird im ersten Kapitel erläutert, was man genau unter Legasthenie versteht und seit wann man sich mit diesem Phänomen beschäftigt. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Möglichkeiten einer Förderung und Früherkennung
der Legasthenie im Kindesalter
vorgelegt von Anja Schellenberg
Hummeltal, den 19.07.2007
Page 3
3
5.1.2. Organisation und Gestaltung des Förderunterrichts 63
5.1.3. Selbsthilfe durch die Eltern 65
5.1.4. Die Hausaufgabensituation 67
5.2. Außerschulische Förderung 69
5.2.1. Woran erkennt man eine gute Therapie? 70
5.2.2. Beispiele für Förderprogramme 71
5.2.2.1. Der Kieler Lese- und Rechtschreibaufbau nach Dummer-Smoch und Hackethal (2002, 2001) 72
5.2.2.2. Die Lautgetreue Rechtschreibförderung nach Reuter-Liehr (1992) 82
5.2.2.3. Das Marburger Rechtschreibtraining nach Schulte-Körne und Mathwig (2001) 87 5.2.3. Computerprogramme 93
5.3. Sozialrechtliche Hilfen 96
6. Legasthenie, Gesellschaft und Schule - Prävention der Legasthenie 99
6.1. Früherkennung von Risikokindern 100
6.2. Frühförderung als Prävention 102 6.3. Zusammenfassung 104
Abbildungsverzeichnis 110
Tabellenverzeichnis 111
Abkürzungsverzeichnis 111
Page 4
1. Einleitung
JohnF. Kennedy (1917-1963) - 35. Präsident der Vereinigten Staaten, WinstonChurchill (1874-1965) - ehem. Premierminister von Großbritannien und Nobelpreisträger,
AlbertEinstein (1879-1955) - Physiker und Nobelpreisträger, CharlesDarwin (1809-1882) - britischer Naturwissenschaftler, Leonardoda Vinci (1452-1519) - Maler, Bildhauer, Architekt, WaltDisney (1901-1966) - amerikanischer Filmproduzent, JackieStewart (geb. 1939) - ehem. britischer Rennfahrer, Cher(geb. 1946) - amerikanische Sängerin und Schauspielerin, TomCruise (geb. 1962) - amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent, ReinhardMey (geb. 1942) - deutscher Liedermacher, …
Page 5
Alle diese berühmten Persönlichkeiten haben eines gemeinsam: Sie waren oder sind Legastheniker und hatten Probleme beim Erlernen des Lesens und Schreibens. Immer mehr hört man heutzutage: Mein Kind hat Legasthenie! Was aber heißt das genau? Legasthenie ist keine Modeerscheinung, sondern eine medizinisch nachweisbare Teilleistungsstörung im Bereich der Sprachverarbeitung, die auch negative Auswirkungen auf das Leben des Kindes haben kann. Wie sehr einige Kinder unter der Störung leiden, zeigt die obige Strophe aus dem Lied „Der unendliche Tango der deutschen Rechtschreibung“ von Reinhard Mey, der in diesem Lied beschreibt, wie er sich damals als Kind gefühlt hat (vgl. http://www.reinhard-mey.de).
Oft besitzen die Lehrer nicht die nötigen Qualifikationen, erkennen die Legasthenie zu spät oder gar nicht und stempeln die betroffenen Kinder als dumm oder faul ab, was zu schweren psychischen Schäden führen kann. Wichtig ist deshalb eine frühe Diagnose und Förderung, denn legasthene Kinder sind nicht dumm oder faul, im Gegenteil, oft sind sie sogar hochintelligent und auf ganz unterschiedlichen Gebieten sehr begabt. Haben sie ihre Ausbildung erfolgreich absolviert, findet man unter ihnen nicht selten Rechtsanwälte, Ärzte oder Ingenieure. Wie man auch bei den aufgezählten berühmten Persönlichkeiten sieht, liegen ihre Begabungen oft im sportlichen, kreativen oder technischen Bereich. Wie eine frühe Diagnostik und Förderung aussehen kann, soll im Rahmen dieser Arbeit erörtert werden. Ehe im vierten Kapitel die diagnostische Vorgehensweise und im fünften Kapitel die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten ausführlich dargestellt werden, wird im ersten Kapitel erläutert, was man genau unter Legasthenie versteht und seit wann man sich mit diesem Phänomen beschäftigt. Das zweite Kapitel befasst sich dann mit den unterschiedlichen Erklärungsansätzen zum Entstehen einer Legasthenie und im dritten Kapitel wird dargelegt, woran man erkennt, ob ein Kind eventuell Legasthenie hat und welche Auswirkungen die Diagnose auf das gesamte spätere Leben haben kann. Das letzte Kapitel zeigt dann, dass es Möglichkeiten gibt, Risikokinder frühzeitig zu erkennen, und dass Fördermaßnahmen bereits im Vorschulalter erfolgreich angewendet werden können.
Page 7
lein durch das Entwicklungsalter, durch Visus-Probleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wiederzuerkennen, vorzulesen und die Leistungen bei Aufgaben, für welche Lesefähigkeit benötigt wird, können sämtlich betroffen sein. Mit Lesestörungen gehen häufig Rechtschreibstörungen einher. Diese persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn im Lesen einige Fortschritte gemacht wurden. […] Zusätzlich zum schulischen Mißerfolg sind mangelhafte Teilnahme am Unterricht und soziale Anpassungsprobleme häufige Komplikationen, besonders in den späteren Hauptschul-und den Sekundärschuljahren.“ (DILLING u.a., 1993, S. 274)
Hauptmerkmal der isolierten Rechtschreibstörung ist eine umschriebene und eindeutige Beeinträchtigung in der Entwicklung von Rechtschreibfertigkeiten, ohne Auftreten einer umschriebenen Lesestörung (vgl. a.a.O., S. 276).
Auffallend ist, dass Jungen häufiger von einer Legasthenie betroffen sind als Mädchen (vgl. WARNKE u.a., 2002, S. 14).
Über die Verbreitung existieren viele unterschiedliche Meinungen. GASTEIGER-KLICPERA/KLICPERA (2004) gehen davon aus, dass 2 bis 4 % der Schüler und 5 bis 10 % der Jugendlichen und Erwachsenen betroffen sind (vgl. S. 47); WARNKE u.a. (2002) sprechen in diesem Zusammenhang von 4 bis 8 % aller Schüler (vgl. S. 9); KOPP-DULLER (2003) hingegen sagt, dass mindestens 10 % der Weltbevölkerung legasthen sind (vgl. S. 17). Hier kommt es natürlich darauf an, welche Kinder als legasthen bezeichnet und ob unterschiedliche Schweregrade unterschieden werden. KOPP-DULLER (2003) differenziert drei Schweregrade der Legasthenie: eine leichte, eine mittelschwere und eine schwere, wobei 78 % an einer leichten, 18 % an einer mittelschweren und nur 3 % an einer schweren Legasthenie leiden (vgl. S. 17).
Desweiteren wird eine verbale von einer literalen Legasthenie unterschieden. Die literale Legasthenie stellt hierbei die Schwerstform dar, bei der nicht einmal einzelne Buchstaben dauerhaft eingeprägt und unterschieden werden können. Mit dem Begriff der verbalen Legasthenie ist lediglich eine schwach ausgebildete Fähigkeit der akustischen Unterscheidung von Lauten gemeint (vgl. ebd.).
Page 8
1.2. Historischer Rückblick
Die alphabetische Schrift wurde ca. 1800 v. Chr. erfunden. Ihr Anfang wird dabei in der semitischen, syrisch-palästinensischen Konsonantenschrift gesehen. Gegen Ende des 2. Jahrtausends v. Chr. fügten dann die Griechen den Konsonanten3die Vokale4hinzu. Die Anfangsbuchstaben Alpha und Beta gaben dabei unserem Alphabet den Namen. Das Besondere daran war, dass die Schriftzeichen begrenzt wurden. Zweck der Schriftsprachentwicklung war die Nutzung zur zwischenmenschlichen Verständigung. „Funktionell läßt sich die Entstehungsgeschichte der Schriftsprache begreifen als eine Vervollkommnung menschlicherFähigkeit, sprachlich-akustische Informationen (gesprochene Worte) durch räumlich-seriell-visuelle Informationen zu verschlüsseln (Schrift) und umgekehrt visuell vorgegebene Buchstaben und Buchstabenfolgen (geschriebene Worte) einer akustisch sprachlichen Informationsverarbeitung zugänglich zu machen (Lesen).“(WARNKE, 1990, S. 1)
Um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert waren es vor allem Mediziner, die feststellten, dass bei Kindern der Schriftspracherwerb gestört sein kann. 1861 gelang es dem französischen Arzt Paul Broca, bei einem Patienten mit motorischer Sprachstörung das motorische Sprachzentrum bei Rechtshändern in der linken Hirnhälfte zu lokalisieren (heute: Broca-Sprachzentrum). Kussmaul, Neurologe und betroffener Vater, bezeichnete 1877 das Phänomen als „erworbene Wortblindheit“. Legte man Kindern und Erwachsenen Bilder vor, so konnten sie die Gegenstände eindeutig benennen. Bei Buchstaben und einfachen Wörtern hatten sie jedoch allergrößte Schwierigkeiten. 1885 bezeichnete der deutsche Arzt Berkhan schwere Grade des gestörten Schriftspracherwerbs als „Schreibstammeln“ und sprach sogar von partieller Idiotie. Er war es auch, der erste Forschungsergebnisse im deutschen Sprachraum veröffentlichte (vgl. a.a.O., S. 17).
Der englische Augenarzt Morgan sah als Ursache der Störung eine mangelhafte Entwicklung des Lesezentrums, das er im Gyrus angularis, einer Großhirnregion in der linken Hirnhälfte zwischen Schläfen- und Scheitellappen lokalisierte. Nach Morgans Ansicht führte diese Fehlentwicklung zu Schwierigkeiten bei der Verarbeitung visueller Informationen. Er prägte dafür den Begriff der kongenitalen oder angeborenen Wortblindheit, um diese Problematik von der
3Mitlaute, Geräuschlaute (vgl. WAHRIG-BURFEIND, 2001, S. 494)
4Selbstlaute (vgl. a.a.O., S. 994)
Page 9
durch Hirnverletzung oder Erkrankung erworbenen Wortblindheit abzugrenzen (vgl. a.a.O., S. 18 f.).
Den Begriff der kongenitalen Wortblindheit findet man auch heute noch in der Medizin. Der Verdienst Morgans lag vor allem in der Tatsache begründet, dass dieser ein neues Krankheitsbild schuf und so zu einer weltweiten Erforschung Anstoß gab (vgl. SCHENK-DANZINGER, 1991, S. 19).
1916 führte der Budapester Neurologe Paul Ranschburg die Bezeichnung „Legasthenie“ für den Begriff der Leseschwäche ein. In seiner 1928 erschienenen Monographie „Die Lese- und Schreibstörungen des Kindesalters“ definierte er Leseschwäche als „eine nachhaltige Rückständigkeit höheren Grades in der geistigen Entwicklung des Kindes“ (Ranschburg, 1928, S. 88, zit. nach WARNKE, 1990, S. 21). Ranschburg differenzierte als erster zwischen Leseschwachen und Leseunfähigen, wobei er Letztere für nicht therapierbar hielt. Diese Auffassung hatte zur Folge, dass lange Zeit legasthene Kinder an Hilfsschulen verwiesen wurden, auch wenn sie geistig völlig normal waren (vgl. SCHENK-DANZINGER, 1991, S. 20). Die Isolierung Deutschlands zwischen 1930 und 1945 sorgte dafür, dass in Deutschland erst in den fünfziger Jahren eine breitere Diskussion über das Phänomen der Legasthenie begann. Einen großen Anteil daran hatte die Schweizer Psychologin Maria Linder. Ihr gelang es mit ihrer Diskrepanzdefinition, die Legastheniker aus ihrer Isolierung hervorzuholen. Sie untersuchte legasthene Kinder auf deren Intelligenz und definierte Legasthenie als eine „spezielle, aus dem Rahmen der übrigen Leistungen fallende Schwäche im Erlernen des Lesens (und indirekt auch des selbständigen fehlerfreien Schreibens) bei sonst intakter oder - im Verhältnis zur Lesefähigkeit - relativ guter Intelligenz.“ (LINDER, 1975, S. 13) Die folgenden fünfziger und sechziger Jahre bezeichnet man auch als die empirisch-kasuistische Phase. In dieser Zeit wurden die unterschiedlichsten Forschungsergebnisse über das Phänomen der Legasthenie publiziert. Linders großer Verdienst und die zahlreichen veröffentlichten Fallstudien führten dazu, dass in den sechziger Jahren viele Bundesländer kultusministerielle Richtlinien herausbrachten, die zur Einrichtung von Legasthenikerkursen, -klassen und -schulen führten. Außerdem gab es besondere Maßnahmen bei der Benotung in Deutsch, bei Versetzungen, Befreiung von Klassenarbeiten und viele Arbeitsmaterialien zur Unterstützung im Unterricht. Dieser sog. Legasthenieboom führte dann in den siebziger Jah-
Page 10
ren zu einer regelrechten Anti-Legasthenie-Bewegung (vgl. KLASEN, 1995, S. 19; SCHENK-DANZINGER, 1991, S. 22).
Hauptvertreter der Anti-Legasthenie-Bewegung waren Sirch (1975) und Schlee (1974), die die Legasthenie als Unfug und wissenschaftlich nicht haltbar bezeichneten. Ihre Argumente waren:
die Auswahl der als Legastheniker bezeichneten Kinder sei willkürlich,die Diskrepanztheorie sei wissenschaftlich nicht fundiert, da es zwischen Intelligenz und Leistung immer eine Diskrepanz gäbe und
Lernbedingungen seien Schuld an den gestörten Lese-Rechtschreibleistungen (vgl. PREGL, 2000, S. 17).
SIRCH (1975) stellte die These auf, dass Legasthenie „ein teilweises oder völliges Mißlingen des Lesen- und/oder Rechtschreibenlernens aufgrund mangelhafter Motivation oder fehlender didaktischer Grundlegung der Methoden“ (S. 12) sei. Schlee (1974) ging sogar soweit zu behaupten, „Legasthenie ist eine überflüssige Leerformel. […] Das Legastheniekonzept ist nicht nur überflüssig, sondern auch pädagogisch gefährlich, da es den Schülern, die an den Unzulänglichkeiten und Widersprüchen der schulischen Lehr- und Lernverhältnisse scheitern, eine krankheitsähnliche Lernstörung zuschreibt. Es ist daher ersatzlos zu streichen. Konsequenterweise ist auch die Legasthenieforschung unverzüglich einzustellen.“ (S. 289, zit. nach SCHENK-DANZINGER, 1991, S. 27)
Dies alles hatte zur Folge, dass sich die Situation der Legastheniker in Deutschland erheblich verschlechterte. Vergünstigungen wurden gestrichen und Legasthenikerkurse gab es nur noch vom 4. Schuljahr an, wo die Störung nur noch mit viel Mühe therapiert werden kann (vgl. SCHENK-DANZINGER, 1991, S. 28). 1978 schaffte die Kultusministerkonferenz in ihren Empfehlungen für die Länder den Begriff Legasthenie vollständig ab. Damit wurden alle Fördermöglichkeiten zunichte gemacht. Stattdessen sollten jetzt alle Schüler gefördert werden, die besondere Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens haben. Diese Schwierigkeiten seien ein rein schulpädagogisches, vorübergehendes Problem, welches mit rein unterrichtlichen Maßnahmen behandelt werden kann (vgl. KLASEN, 1995, S. 72 f.).
Page 11
1984 veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Denkschrift über die „Schulische und außerschulische Förderung von Legastheniekindern“, in der sie die Grundsätze der Kultusministerkonferenz bemängelt und dazu auffordert, die Diagnose Legasthenie wieder einzuführen. Bis heute aber gelten die Grundsätze unverändert (vgl. ebd.). Da in Deutschland jedes Bundesland seine eigene Kulturhoheit mit unterschiedlichen rechtlichen Bestimmungen besitzt, können sich die Bundesländer an den Grundsätzen der Kultusministerkonferenz orientieren. Es gibt keine einheitliche Regelung, aber einige Länder, wie z.B. Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern, greifen auf das klassische Legastheniekonzept zurück (vgl. Kap. 5.1.1.; NAEGELE, 2001, S. 97).
.
Page 13
b) Zwillingsstudien
Ziel von Zwillingsstudien ist es, den Anteil der genetischen und der nicht-genetischen Varianz7eines Merkmals aufzuzeigen. Dabei werden ein- und zweieiige Zwillingspaare miteinander verglichen und überprüft, ob bei einem legasthenen Zwilling auch der zweite Zwilling eine Legasthenie hat, also ob eine Konkordanz (Übereinstimmung) diesbezüglich besteht. In früheren Untersuchungen fand sich bei eineiigen Zwillingen eine Konkordanzrate von bis zu 100 %, während sie bei zweieiigen Zwillingen nicht höher als 30 % lag. Neuere Untersuchungen gehen von einer Rate zwischen 50 und 60 % bei eineiigen Zwillingen aus (vgl. SCHULTE-KÖRNE, 2002, S. 30 f.; WARNKE, 1996, S. 30; WARNKE u.a., 2004, S. 20 f.).
c) Molekulargenetische Untersuchungen
Durch Kopplungsuntersuchungen mittels molekulargenetischer Techniken versucht man, die für eine Legasthenie relevanten Genorte zu bestimmen und deren genetische Veränderungen zu erkennen. Es gibt nicht nur ein „Legasthenie-Gen“, sondern viele verschiedene Genorte. Bisher fand man solche Genorte auf den Chromosomen 1, 2, 3, 6, 15 und 18. Vor allem die Chromosomen 6 und 15 scheinen hierbei eine wichtige Rolle zu spielen. Bisherige Untersuchungen zeigten, dass das Chromosom 6 mit dem Merkmal „phonologische Bewusstheit“ gekoppelt, also für phonologische8Prozesse relevant ist, und dass das Chromosom 15 mit dem Merkmal „Wortlesen“ gekoppelt ist und somit für die nicht-phonologischen Anteile an der Lesefähigkeit bedeutsam erscheint (vgl. SCHULTE-KÖRNE, 2002, S. 32 f.; WARNKE, 1996, S. 30 f.; WARNKE u.a., 2004, S. 21).