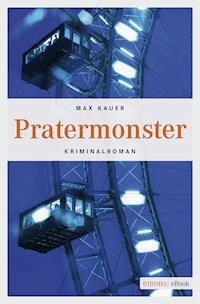Wien. Im Kunsthistorischen Museum steht statt der Saliera plötzlich ein Salzstreuer aus der Kantine in deren Hochsicherheitsvitrine. In einem verwunschenen Zen-Gärtchen im Botschaftsviertel ragt ein monolithischer Kubus aus der Erde. Im Hochstrahlbrunnen sitzt eine geköpfte Leiche in einem Blutsee. Die Sonderermittler stoßen auf wahrhaft unglaubliche Verbindungen zu ihrem letzten Fall.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Kauer
Monolith
Die coolsten Sonderermittler Wiens ermitteln weiter
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Impressum neobooks
Prolog
Vor langer Zeit ereignete sich ein Unfall. Nicht hier in der Gegend, genaugenommen ziemlich weit weg sogar. Zumindest für unsere Verhältnisse. Mehr in der Gegend des Jupiters. Eine Notlandung mit katastrophalen Folgen. Die Besatzung des Raumschiffs, eine symbiontische Wissenschaftler-Spezies, die sich „die Reisenden“ nannten, musste seine sterbenden Wirte verlassen und ging in Dauerstadien über. Mit letzter Anstrengung wurde ein Team losgeschickt, um die Gegend zu erkunden und Hilfe zu suchen. Würde die nicht kommen, würde das Volk bis in alle Ewigkeit schlafen. Das Rettungsteam machte sich mit dem, was vom ursprünglichen Schiff gerettet werden konnte, auf die Suche - vielleicht gab es ja doch intelligentes Leben in diesem Quadranten?
Sie hatten Pech, sie kamen hierher zur Erde. Es war sofort klar, dass hier nichts zu holen sein würde. Man wollte schon weiterfliegen, vielleicht hätte man auf dem hübschen grünlichen Planeten nebenan mehr Glück? Aber dann gesellte sich zu Pech noch mehr Pech. Das nicht mehr ganz zurechnungsfähige und deswegen ein wenig unaufmerksame Raumschiff wurde von einem Kometen getroffen. Wie groß wahr wohl die Wahrscheinlichkeit für so einen Mist, dachte sich die Mannschaft, als sie der hellblauen Kugel entgegen trudelte. Offensichtlich nicht Null, so viel wurde schnell klar, als Komet und Schiff gemeinsam auf der Erde einschlugen. An einem Ort, den weder der eine noch das andere jemals freiwillig besucht hätten, beziehungsweise eingeschlagen wären. Im dritten Wiener Gemeindebezirk. Der war damals noch kein Gemeindebezirk, sondern nur Vorort einer Habsburgerresidenz. Das machte die Sache jetzt aber auch nicht besser.
Das Pech der Rettungsmannschaft wurde in weiterer Folge durch Missverständnisse, Rückschläge und Glücklosigkeit zur Katastrophe abgerundet. Die Missverständnisse betrafen die Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung. Gegen alle Hoffnung und wider besseren Wissens, versuchte man eben doch mit derselben in Verbindung zu treten - mit schauerlichen Resultaten. Dem Dahindämmern ihrer äffischen Vorfahren gerade erst einen evolutiven Schritt entkommen und als Wirte deswegen vollkommen ungeeignet, entwickelten die Menschen nach der Kontaktaufnahme bizarre Verhaltensmuster. Die Kontaktaufnahme wurde in der herkömmlichen und oft erprobten Art und Weise bewerkstelligt: durch Besiedlung des Nervensystems und telepathischer Verschmelzung mit dem Wirten. Das funktionierte sonst immer, logisch, was sollte da auch schief gehen. Hier auf diesem Planeten aber nicht. Hier auf diesem Planeten funktionierte rein gar nichts. Das erstaunlich wenig entwickelte Denkzentrum der Primaten hatte nicht das geringste telepathische Potenzial, etwas das, nach Wissen der Reisenden, ansonsten im Alpha-Quadranten dieser Galaxie nur die Darmflora des zorbardautischen Säuremonsters nicht hatte. Nicht mehr hatte, muss man sagen - die Darmflora des zorbardautischen Säuremonsters wollte nämlich gar nicht so genau wissen, wo und vor allem auf welche Art und Weise das zorbardautische Säuremonster seine Nahrung so herbekam. Deswegen, um nämlich in Ruhe und ohne moralische Bedenken verwerten zu können, was im zorbardautischen Säuremonsterdarm so dahergeschwommen kam, unternahm seine Darmflora seit einigen tausend Jahren Anstrengungen, sich evolutiv zurückzuentwickeln und die telepathische Verbindung zu kappen. Mit dieser – verständlichen - Ausnahme, konnten die Reisenden aber noch mit allen Bewohnern dieses Quadranten Kontakt aufnehmen. Auch mit dem zorbardautischen Säuremonster. Letzteres wurde seitdem inbrünstig bereut, aber so war die Wissenschaft eben.
Wie schon erwähnt, funktionierte hier auf diesem Planeten rein gar nichts. Die besiedelten Menschen neigten im besten Fall zum Verfassen verworrener Manifeste, meist aber zum Wahnsinn in verschiedenen, immer wieder aufs neue erstaunlichen Formen, bis hin zum Kannibalismus. So etwas hatte man noch nicht erlebt. Die Reisenden konnten nicht vermitteln, dass sie eigentlich nur ein wenig Hilfe mit ihrem Quantenantrieb, eine Tachionenquelle und ein paar kräftige Körper brauchen würden, um das ganze zusammenzuschrauben - und weg wären sie wieder. Aber wie bitte, sollte man das kommunizieren, wenn die Gesprächspartner ständig ihre Zähne grunzend in die Eingeweide von Artgenossen versenkten?
Das Missverständnis nahm, was Missverständnisse mit Vorliebe tun, nämlich seinen unheilvollen Lauf. Ein Geheimbund wurde gegründet. Eine üble fremdenfeindliche Organisation, welche die Reisenden mit Nachdruck verfolgte und ihre vordringlichste Aufgabe darin sah, die vermeintlichen Usurpatoren auf maximal invasive Weise wieder von den so unglücklich besiedelten Wirtskörpern zu trennen, um nicht zu sagen, denselben den Kopf abzuhauen. Man entwickelte sogar spezielle Waffen, die ein Entkommen aus den Wirten unmöglich machte. Die Häupter wurden dann verbrannt oder in Säure aufgelöst. Von Willkommenskultur keine Rede! Das Rettungsteam musste sich nun also selbst retten. Es wurde zurückgedrängt. Viele wurden getötet. Verzweifelt sprangen die Reisenden von Wirt zu Wirt, ohne Erfolg. Keine der irdischen Arten schien kompatibel zu sein. Zu guter Letzt, als jedes Schiff der Hoffnung schon unter dem Horizont der Resignation versunken war, fand man eine Spezies, mit der ein halbwegs vernünftiger Gedankenaustausch möglich war. Die Betonung liegt auf halbwegs, aber immerhin konnte man ohne letale Folgen kommunizieren. Eigentlich wurden vielmehr die Reisenden von Angehörigen dieser nachtschwärmerischen Spezies gefunden, als sie auf einer ihrer Zechtouren aus Jux, Tollerei sowie wissenschaftlichem Interesse einen der abgehackten Köpfe entführten.
Die Spezies war Caprimulgus europeus, der Ziegenmelker. Angehörige dieser Art wurden nicht verrückt, wenn man ihre Neuronen ein wenig re-arrangierte, denn sie waren es bereits. Und sie freuten sich, dass hier plötzlich jemand war, mit dem sie endlich ihre, nach Selbsteinschätzung, brillianten Gedankengänge teilen konnten. Tachyonenquelle hatten sie zwar auch keine, aber die Vögel waren durchaus interessiert am Problem der Reisenden, hatten sie doch selber einige gewagte Hypothesen zur Raumzeitreise ausgearbeitet. Deren Angelpunkt, so erklärten die Nachtschwalben – Meister der Tarnung - wäre das vollkommene Verschmelzen mit Materie, wodurch - im Prinzip - eine unbeschränkte Reise durch Raum und Zeit möglich sein sollte. Und zwar durch Quantenfluktuationen virtueller Teilchen im leeren Raum zwischen den Elementarbausteinen ebendieser Materie. Eigentlich ganz logisch. So einleuchtend aber dieses Prinzip auch erscheinen mochte, zur technischen Reife konnten die Ziegenmelker ihre wissenschaftlichen Hypothesen noch nicht führen. Ein Schnabel voll Tachyonen könnte da vielleicht ganz gelegen kommen. Sie übten sich also weiter in Materienverschmelzung und immer wieder einmal kam ein etwas zerzauster Vogel von einer angeblich abenteuerlichen Reise zurück, da er zwar am Morgen noch gemütlich in einer Eiche zu Bette gegangen war, sich am nächsten Abend aber in Afrika aus der Borke eines Affenbrotbaumes geschält hätte. Diesen Berichten, so fesselnd sie auch waren, wurde im Allgemeinen nicht viel Glauben geschenkt, denn Ziegenmelker, es wurde schon angedeutet, sind irre. Und Trinker. Irre Trinker eigentlich. Sie haben ihren Namen nicht von ungefähr und vergorene Ziegenmilch ist nur eines der harmloseren Ingredienzien des über die Artgrenzen berüchtigten Capri-Shakes. Wenn also ein zerzauster übertagiger Caprimulgus daherkommt mit einer Story, die so klang, als wäre sie unter dem Einfluss halluzinogener Milchprodukte entstanden, war letzteres sehr wahrscheinlich der Fall.
So verging die Zeit. Für die Reisenden wurde es selten langweilig - Ziegenmelker konnte man beim besten Willen nicht als langweilig bezeichnen. Sie waren zuallererst Partyvögel und dann erst Wissenschaftler. Wohl ein Grund für das Missverhältnis zwischen der Zahl verwegener Theorien und konkreter Anwendungen, die sie bisher entwickelt hatten. Jahrhunderte vergingen. Die Reisenden versuchten, nicht ganz der ewigen Party der Nachtschwärmer zu erliegen, wurden aber vielleicht mit der Zeit doch ein wenig träge in den Reflexen und etwas lässig in der Abschätzung von Gefahren.
Denn sie sahen die Gefahr nicht, als sie ihr ins Antlitz blickten. Als sie ihn fanden.
Es war auf einer wissenschaftlichen Expedition zur Untersuchung des Einflusses ausgedehnter flacher Landstriche auf die Fluktuationsdichte virtueller Quantenzustände, zu der ein Team Caprimulgen in die Mongolei aufgebrochen war. In eine Gegend also, in die ein wärmeliebender Ziegenmelker nicht einfach so gereist wäre, hätte er nicht erstaunliche Berichte gehört, die sein wissenschaftliches Interesse geweckt hatten. Berichte, die zwei Spezialitäten dieses Landstriches betrafen, nämlich Kumis, die vergorene Stutenmilch und den Kamelmilchschnaps, welche von den Nomaden traditionellerweise hergestellt werden.
Dort, am Rande der Mongolei fanden sie ihn, ein Hirtenkind. Er war nicht vom Stamm der ihn aufziehenden Hirten, ein Findelkind vielleicht. Die Reisenden wussten sofort, dass der Knabe anders war als alle anderen Menschen, denen sie bis jetzt begegnet waren. Heller. Wacher. Aktiver. Sie konnten Ansätze telepathischer Fähigkeiten fühlen, wurden regelrecht von ihm angezogen. Seit Jahrhunderten mied man jeden näheren Kontakt mit Menschen. Hier aber schien ihnen das Schicksal jemanden vor den Schnabel gespielt zu haben, der ein Vielfaches des Potentials seiner Artgenossen hatte. Vielleicht war er ein Mutant, die mögliche Saat einer neuen Spezies. Man musste es probieren. Auch wenn sie sich ziemlich sicher waren, dass er keine Tachyonenquelle hatte, versuchten die Reisenden trotzdem ihr Glück. Sie konnten nicht anders. Er schien sie zu rufen.
Es war das Jahr 1994. Die Reisenden nahmen Kontakt auf.
Und er drehte den Spieß um.
1.
Der Tatort, der es so eilig hatte, sich in meinen Tag zu drängen, dass er den Morgenkaffee um mehrere Stunden auf die Ränge verwies, war das Kunsthistorische Museum in Wien. Dort, auf den Stufen zum Haupteingang, stand ein großgewachsener, schlanker und über die Maßen vornehmer Mann. Er trug einen teuren, aber unaufdringlichen grauen Anzug mit seidenem Krawattenschal und rang mit den Händen. Doch wirklich! Ich hatte noch nie jemanden mit den Händen ringen sehen, dachte, das hätte man so ungefähr nach dem Mittelalter aufgehört. Da war Händeringen ja gang und gäbe, als die Burgfräulein diese Technik benutzten, um ihren Rittern beim Zweikampf zuzusehen. Aber heutzutage? Doch das hier war eindeutiges Händeringen, klar und deutlich, kein Zweifel. Eine Hand kämpfte richtiggehend mit der anderen um die dramatische Hauptrolle auf einer Bühne, die vom Hemd des feinen Herrn in ultraweißem Weiß bestrahlte wurde. Darüber, am Kopf des Mannes wehte, wie die Fahne am Burgturm, eine grau-blonde Föhnwelle besorgt im schwachen Wind.
„Guten Morgen!“, sagte ich.
Der elegante Herr hielt in seinem Hängeringen kurz inne und setzte ein besorgtes Lächeln auf. „Es tut mir sehr leid, wir haben heute geschlossen. Etwas Schreckliches ist passiert!“ Selbst seine Stimme wirkte teuer. Oder besser exquisit, wie ein Luxusgegenstand, nicht aufdringlich, sondern höflich, ja freundlich - und tief besorgt. Dann rang er weiter.
Ich holte meinen Ausweis hervor. „Ford, Oberkommissar Carl, Sonderermittlungseinheit.“
Der Museumsgraf, wie ich ihn bereits in Gedanken getauft hatte, befreite seine Hände aus der Möbiusschleife, zu der seine großen Sorgen sie verdammt hatten und breitete die Arme aus, wie zu einem Segen. „Ach! Da sind Sie ja! Endlich! Etwas Schreckliches ist passiert!“
„Das will ich hoffen!“ Aus nudeligen Augen, deren Funktionsfähigkeit durch Schlaf- und Frühstückskaffeeentzug grob beeinträchtigt war, musterte ich den makellosen Herrn des Museums und versuchte ihn zu hassen. Aber so sehr ich mich bemühte, ich konnte es nicht. Um fünf Uhr dreißig hätte ich gerne jemanden gehasst, doch der Museumsgraf war einfach denkbar ungeeignet als Hassobjekt. Er wirkte dafür viel zu freundlich und aufrichtig. Aufrichtig freundlich. Kurz versuchte ich ihn für seine aufrichtige Freundlichkeit zu hassen, aber das wurde auch nichts. Vielleicht sollte ich die Matuschek hassen, überlegte ich, immerhin war sie es, die mich auf diese Expedition in zurecht unerforschte Zeitzonen beordert hatte. Das tat sie in letzter Zeit überhaupt gerne – uns zu Tatorten zu zitieren, die sich dann als totaler Flopp herausstellten. Auch hier, wenn es denn ein Tatort war, hatte ich meine Zweifel. Was bitte sollte das Kunsthistorische Museum der Sonderermittlungseinheit bieten können? Ich meine Tatort-technisch. Aber die Matuschek hatte befohlen, da mussten wir ran. Und hin. Um 5:30.
Wir, Phillip und ich, sind die Sonderermittlungseinheit, die Matuschek ist die Chefin der Sonderermittlungseinheit. Sie können sich die Matuschek vorstellen wie Darth Sidious im Lodenkostüm. Aus der Ferne könnten Sie die dickliche Dame mit bläulichem Haar und alpenländischen Businessoutfit noch mit einer harmlosen Besucherin von Innenstadtcafés und Organisatorin von Wohltätigkeitsbällen verwechseln. Aber nur, bis sie Ihnen ihre rasiermesserscharfe, ministerialrätliche Aufmerksamkeit zuwendet. Dann wird schnell klar: Wenn die Matuschek sagt „hopp“, dann besser hopp. Die Matuschek ist mächtig, wobei mir aber unklar ist, auf welchem ihrer zahlreichen Ämter ihre Macht eigentlich genau beruht. In letzter Zeit macht sie jedenfalls freizügig davon Gebrauch, um uns im schönen Wien herumzuscheuchen. Widerrede zwecklos. Wir reden auch nicht wider. Nicht gegen die Frau Rat. Wir sind vielleicht knallharte, hartgesottene Sonderermittler aber lebensmüde sind wir nicht! Als Hassobjekt schied sie also auch aus. Das traut sich niemand, die zu hassen. So blöd ist keiner.
Um Zeit zu sparen, war ich auf die uncoolste Art angereist, die der Menschheit bekannt ist: Mit einem City-Rad. Ein City-Rad eignet sich gut zum Hassen. Ist es doch einer dieser Werbeträger auf zwei Rädern, dessen einzige Designvorgabe war, diebstahlsicher zu sein. Dieses Ziel wurde voll und ganz erreicht. Ja man kann sagen übererfüllt, also wenn das Ziel war, im potentiellen Dieb das maximale Nichtbegehren zu erzeugen, Abscheu vielleicht sogar, die aber nicht so weit gehen durfte, in Zerstörungswut zu münden. Bei Betrachtung des Rades sollte ein ephemeres Gefühl des Unbehagens, vielleicht der Wunsch, ein schickes Designerrad zu erwerben, aber keinesfalls das Bedürfnis, spontan aufzusitzen und wegzufahren, entstehen. Das war sehr gut gelungen. Wegtragen kam auch nicht in Frage, denn ein City-Rad wiegt eine Tonne. Dessen Krönung aber ist das Körberl. Sinnreich und gewitzt vorne am Lenker angebracht, induziert das Körberl bei Beladung unerwartete Lenkmanöver und ist der Grund dafür, dass nur die härtesten der harten Ökofaschisten, und diese auch nur in großer Zeitnot, zu diesem Hoffnungsträger der Klima-Neutralbewegung auf zwei Rädern greifen. Man kann das City-Rad durchaus mit Recht sowie mit Nachdruck hassen. Leider finde ich es eigentlich ganz praktisch. Vielleicht muss ich der grausamen Wahrheit in die blauen Kinderaugen blicken und erkennen: ich bin einfach nicht so der hassende Typ. Ein wenig kann ich mich dafür selber hassen – immerhin.
„He Phillip!“, rief ich, als ich gerade den letzten Tretvorgang hinter mir hatte und Richtung City-Rad-Docking-Station ausrollte. Viele City-Räder haben nur einen Gang, weswegen man die Wahl hat, entweder mit 1 km/h dahinzueiern oder immer wieder ordentlich zu treten und dann zu rollen, bis man durch Treten wieder Kraft übertragen kann. Letztere Fortbewegungsweise erinnert frappant an den Fahrstil von Vorschulkindern und ist unter den uncoolen Fahrtechniken die Uncoolste. Insbesondere wenn der Fahrer sich während des Tretens vor Ehrgeiz auf die Zunge beißt, deren Spitze rosig aus dem Mundwinkel leuchtet.
Phillip sah sich um, erstarrte und hastete weiter. Speed-walkend und, ohne sich noch einmal umzusehen, verschwand er hinter einem kugeligen Busch im Vorpark des Museums. Ich klickte das City-Rad in seine Halterung und lief ihm hinterher. Als ich um die Ecke bog, packte mich eine Hand an der Schulter. Jahrelanges Training in Spezialeinheiten sagte mir, dass das die Hand eines Menschen war, der sich aufs Kämpfen verstand. In solchen Fällen höre ich dann immer die Stimme meines Lieben Herrn Ausbildners, des LHA, der mir sagt, was zu tun ist und das tue ich dann auch. Im Bruchteil einer Sekunde hatte ich die Hand gepackt und mich so positioniert, dass ich den Angreifer elegant von dannen werfen konnte, nicht ohne ihm vorher noch schön ein paar Rippen zu brechen. Damit hatte die Hand aber offensichtlich gerechnet und leitete ein Gegenmanöver ein. Ein Profi, ganz klar. Ich drehte mich um und sah in die wutentbrannte Fratze des Angreifers. „Was soll das Phillip? Was hast du denn überhaupt? Rennst weiter ohne Hallo zu sagen ...“
„Bist - du – glücklich - ja?“, spuckte mir Phillip jedes Wort einzeln ins Gesicht. „Stehst du in der Früh auf und fragst dich: Hm, wie könnte ich meinen Sonderermittlungspartner heute wieder bis aufs Blut blamieren? Oh! Ich weiß! Ich komme, wie der letzte Dorfdepp auf einem ... Ding ...“, er spie das letzte Wort förmlich aus, als hätte er sich den Mund daran verätzt, „... daher gefahren, das meiner Tante Annegret aus Brotterrode-Trusetal die Verbannung aus der Dorfgemeinschaft einbringen würde, würde sie damit eine Runde um den Löschteich fahren, und kompromittiere so meinen Sonderermittlungspartner, der mir regelmäßig das Leben rettet und auf meinen verzärtelten Ösi-Arsch aufpasst. Und das direkt vor den Augen seiner super-heißen Freundin, die voll darauf abfährt, dass er in einer ultracoolen Sonderermittlungseinheit arbeitet ...“
Phillip hatte offensichtlich kein solches Problem mit Hassen wie ich. Er redete sich immer mehr in Rage, schwarze Schatten bildeten sich um seine Augen. Ansonsten war er natürlich trotz der frühen Stunde wie aus dem Ei gepellt: Designerjeans in einer modischen Version von Türkisblau, ein ebenfalls blaues Jackett, das Hemd strahlend weiß, beige-graue Accessoires. Farblich erinnerte er mich an einen Traumstrand am Mittelmeer. Wirkte sicher bei den Frauen. Alles was Phillip macht, wirkt irgendwie bei Frauen. Bei den Superheißen. Dazu eine, mit gerade der richtigen Menge Gel sorgfältig in Unordnung gehaltene Trendfrisur und ein nicht minder sorgfältig gepflegter Dreitagesbart. Sie können sich Phillip vorstellen wie Johnny Depp in jüngeren Jahren. Mehr oder weniger eins-zu-eins Kopie, allerdings zwei, drei Nummern größer. Phillip konnte man sicher gut hassen, aber leider mochte ich auch ihn ganz gerne. Wenn auch aus anderen Gründen als das City-Rad.
„Azurro!“, kommentierte ich sein Outfit, als er eine Belferpause machte. „Geht’s wieder?“
„Trendfarbe Blau.“, erklärte er aggressiv. „Und du?“ Ich sah an mir hinunter. Ausgewaschene Jeans, die sich in Fußhöhe bereits auflöste, Converse, altes schwarzes T-shirt, alte Lederjacke. Immerhin war mein Dreitagesbart erst zwei Tage jung. Stellen Sie sich mich ruhig vor wie ihren Lieblingsschaupieler. Warum nicht?
„Du bist so eine Tussi.“, goss ich Öl ins Feuer. „Apropos - was für eine Freundin überhaupt?“
„Dort!“, Phillips Arm bohrte sich anklagend durch die Luft. Sein Finger zeigte auf das Heck eines sich rasch entfernenden mattschwarzen Cabrios.
„Ah ja. Sehr hübsch!“ Vielleicht konnte ich ihn ja doch ein wenig hassen. Ich kam mit dem City-Rad daher, er im Cabrio einer reichen, superheissen Tussi. Das charakterisiert uns leider ziemlich treffend.
Während Phillip weiter vor sich hin schmollte, gingen wir durch den Park zu dem monumentalen, klassizistischen Sandsteinbau mit Kuppel.
„Brotterrode-Gruseltal? Im Ernst?“, höhnte ich. Immerhin konnte ich höhnen, wenn schon nicht hassen. Phillip ist aus Thüringen, das ist in Deutschland, da gibt es schon komische Ortsnamen. Ich sah aus dem Augenwinkel, wie er die Faust ballte. „Trusetal!“, zischte er zwischen den Zähnen hindurch, dass der Speichel nur so sprühte.
„Say it don't spray it!”
Phillip kam aber nicht mehr dazu, mir eine reinzuhauen, weil wir am Museumseingang angekommen waren.
Womit wir wieder beim Museumsgrafen wären. „Leopold Palffy, ich bin der Direktor dieses Hauses.“, sagte der Direktor dieses Hauses, nachdem ich mich vorgestellt hatte. Er schüttelte uns die Hände, wobei er dem Händedruck mit der anderen Hand noch eine extra herzliche Note verlieh. Trotz seiner augenscheinlich übergroßen Sorgen, vermittelte er mir das aufrichtige und ehrliche Gefühl willkommen zu sein. Obwohl ich sonst nicht so auf Schnösel stehe, konnte ich nicht anders, als den Grafen zu mögen. Höflichkeit ist eine großartige Tugend, da hat der Herr Konfuzius schon Recht gehabt. Man sollte diesen Mann zur Befriedung in Kriegsgebiete schicken und ihn nicht seine Zeit händeringend auf Museumsstufen vergeuden lassen, dachte ich mir. Auch Oberkellner könnten sich etwas von ihm abschauen. Diese Überlegungen ließen meine Gedanken einen kleinen Abstecher Richtung versäumten Morgenkaffee nehmen.
„Eine Melange bitte!“, sagte der koffeinkranke Teil meiner Selbst schneller, als es der Rest von uns es begriff. Soviel zu Konfuzius. Der Graf zuckte mit keiner Wimper. „Das lässt sich sicher machen, Herr Oberkommissar! Sicherlich machen. Kommen Sie bitte. Sie erlauben, dass ich voraus gehe.“
„Oh entschuldigen Sie vielmals ... ich wollte nicht ... es ist nur so ... ich habe heute noch keinen ...“
„Aber bitte, Herr Oberkommissar. Wir sind alle verstört heute. So ein Unglück!“
Er nannte mich Oberkommissar! Niemand nannte mich jemals Oberkommissar! Und jetzt führte mich das Schicksal mit diesem wunderbaren Menschen zusammen, der mich Oberkommissar nannte, und ich Koffein-Junkie behandelte ihn wie einen Kellner! Ich setzte zu einem weiteren entschuldigenden Stammeln an.
„Haben Sie auch Leberkäsesemmeln?“, fragte Phillip.
Der Graf stolperte. Es war eigentlich kein Stolpern, mehr eine winzige Unebenheit in des Grafen geschmeidigen Bewegungen, ein leichtes Wanken. In weniger als dem Bruchteil einer Sekunde hatte er sich aber wieder gefangen.
„D ... Da muss ich fragen ... „
„Cool! Noch besser wäre Leberkäse-Hotdog.“
„Phillip bitte! Entschuldigen Sie, Herr Graf, äh, Herr Direktor ...“ Phillip kicherte.
Resignierend sagte ich: „Also, was ist denn passiert?“
2.
Am Abend saßen wir dann im Café Alt Wien.
“Nein, Nein, Nein und nochmals Nein, Phillip!”
Zur Abwechslung führten wir dieselbe Diskussion, die wir seit Wochen ständig führten. Immer wieder. Meist an Donnerstagen. Immer und immer wieder. Eines muss man Phillip lassen, wenn der einmal Blut gerochen hat, dann bleibt er dran an seiner Beute. Wie so ein Kampfhund, der einen Hydranten abbeißt und totschüttelt, wenn er ihm blöd kommt. Es gibt allerdings nur wenige Dinge, die Phillip ein solches Engagement entlocken. Eines dieser Dinge ist die Nahrungsaufnahme. Wenn Phillip seine Semmel will, dann will er seine Semmel. Punkt. Da wird alles andere zur Nebensache. Auch die Verbrechensbekämpfung. Die andere Sache sind Frauen. Die Tatsache, dass wir seit Wochen um die gleiche Angelegenheit stritten bedeutete, dass es nicht um Leberkäsesemmeln ging, denn obwohl mir nicht ganz wohl dabei ist, mit einem Semmelsüchtigen zusammenzuarbeiten, funktioniert Phillip eigentlich sehr gut, wenn er seinen Pegel hält. Er ist Pegelesser, kein Komaesser. Deswegen stehe ich ihm da nicht im Wege und es gibt für seine Sorte Problem in unserer Stadt auch genügend Dealer, sprich Würstelstände in ausreichender Dichte. So, jetzt denken Sie sich: Aha, wenn es also nicht um Leberkäsesemmeln im Dienst geht, geht es also um Frauen im Dienst. Nein, tut es nicht. Aber was, bitteschön, fragen Sie jetzt, habe ich, Carl Ford, Oberkommissar der Sonderermittlungseinheit, dann damit zu tun? Denn wie Phillip sich in seiner Freizeit vergnügt, kann mir doch Banane sein, wie er sagen würde. Gute Frage! Nächste Frage! Weil, das ist alles streng geheim und auch nicht einfach zu erklären. Aber soviel kann ich sagen: ich hatte eine Telefonnummer, Phillip wollte sie haben und ich hatte mir geschworen, ihm diese nicht zu geben.
„Und warum nicht?“, fragte Phillip in der Art eines Fünfjährigen, dem man erklären muss, warum er jetzt nicht den Megakrokanteisbecher mit extra Portion Schlagobers und Pommes-Frittes zum Mittagessen bestellen kann. Das heißt, Phillip kannte die Antwort genau, hatte sich aber vorgenommen, solange zu fragen, bis er die gewünschte Antwort bekommen, oder dem Befragten das Hirn zu den Ohren herausrinnen würde. Seine Taktik zeigte Wirkung, ein gewisser Innendruck machte sich an meinem rechten Trommelfell schon bemerkbar. Ich holte tief Luft, um zu meinem üblichen Sermon anzusetzen und passiv-rauchte dabei eine halbe Gauloises. „Weil sie dich auffrisst!“, rief ich. Dann wurde ich von einem Husten unterbrochen und eine Leichtigkeit stieg mir in den Kopf. Verstohlen atmete ich noch einmal tief ein.
„Du rauchst schon wieder heimlich.“, stellte Phillip fest. „Das ist armselig. Entweder Rauchen oder Nicht-Rauchen. Aber ins Kaffeehaus zu gehen, um heimlich die Zigaretten anderer Leute passiv zu rauchen ist so, als würde man sich die Reste ihrer Gläser zusammen mixen.“
„Keine Ahnung von was du da redest.“ Ich hustete noch ein wenig weiter.
Phillip rollte mit den Augen: „Also, warum nicht?“
„Gott! ... welchen Teil von Weil-sie-dich-auffrisst-mit-Haut-und-Haaren-razeputz-und-nix-überlässt verstehst du denn nicht?“, rief ich erschöpft. Ein junger Mann am Nachbartisch sah abwesend von seinem Buch auf und in unsere Richtung. Der Ober stellte meinen Kaffee und Phillips Frankfurter mit Gulaschsaft und Semmel auf den runden Marmortisch vor uns. Kaffee und Würstchenduft konkurrierten nun mit Gauloises. Leberkäsesemmeln gab es hier keine, also musste Phillip mit einer Ersatzdroge vorliebnehmen. Behende zerteilte er die Semmel in zwei Hälften, schaufelte mit dem mitgelieferten Löffel Gulaschsaft darauf, zerlegte die Würstchen in kleinere Stücke, legte sie auf eine Hälfte, presste die andere darauf und biss sogleich in die solchermaßen entstandene Frankengulasch-Semmel.
„Wienerwürstchengulaschsemmel – lecker!“, Phillip leckte sich genüsslich die Lippen.
„Mein Gott. Phillip! Das kann man doch nicht machen.“, flüsterte ich. Phillip schaffte es immer wieder, ohne jede Scham kulinarische Tabugrenzen zu überschreiten. Seine spontane Erfindung des Leberkäse-Hotdogs war mittlerweile allerdings so etwas wie ein Geheimtipp an Würstelständen im zweiten Wiener Gemeindebezirk geworden, mit Tendenzen, sich weiter auszubreiten.
„Um deine Frage zu beantworten: Keinen Teil.“
„Was?“
„Warum sollte sie mich auffressen, ist doch Blödsinn! Ich lasse mich nicht so schnell von Damen verspeisen!“, schmatzte Phillip. „Bin ja nicht du.“
„Schon vergessen, was mit Warenin passiert ist?“, fragte ich liebenswürdig.
„Der ist von einem Godzilla-Basilisken gefressen worden, nicht von einer feenhaften Russin.“
Vermutlich sind sie jetzt verwirrt. Das ist vernünftig, denn das alles war auch sehr verwirrend. Deswegen habe ich die ganze Geschichte ja aufgeschrieben und sie können sie nachlesen, sie ist unter dem Titel 'Pratermonster' an die Öffentlichkeit gelangt. Wenn Sie dann noch immer nicht durchblicken: Willkommen im Club! Aber für den Durchblick haben wir ja die Frau Ministerialrätin Matuschek. Die können Sie fragen. Nur, dass sie Ihnen nichts sagen wird. Denn die Frau Rat sagt auch uns selten etwas Nützliches. Oder finden Sie: „Meine Buben, ihr macht's das schon!“, besonders hilfreich? Genau. Wir „machen's“ dann aber eben und die Matuschek ist meist auch zufrieden. In letzter Zeit hüllt sich sie sich aber wieder in sehr intensives Schweigen. Brütendes Schweigen, wenn sie mich fragen.
„Nei ...“ Plötzlich hörte ich die Stimme meines Lieben Ausbildners. Es klang bereits ein wenig, als würde er aus einem Aquarium zu mir sprechen. Er sagte: „Wenn du denkst, das Hirn rinnt dir zu den Ohren heraus, dann tue das.“ Ich tue immer, was der Liebe Herr Ausbildner mir rät, denn es rettet mir normalerweise das Leben, also tat ich es auch dieses Mal. Ich lächelte Phillip an. Eine große Ruhe machte sich in mir breit. Der Druck an meinen Trommelfellen ließ langsam nach. Ich ließ den Blick durch das Lokal schweifen. Der junge Mann am Nachbartisch musterte mich über den Rand seines dicken Buches. Er las „Rupert Riedl: Die Fauna und Flora des Mittelmeeres.“ Also momentan las er nicht, momentan sah er mich unverwandt an. Ein Biologe. Wie schön, dachte ich mir. Ach das Mittelmeer, wie schön, dachte ich mir. Ich lächelte. Ich sah azurblaues Wasser, Kalkriffe, gemütliche Strandtavernen. Dann sah ich eine Hand. Die schnippte mir vor dem Gesicht herum. Phillips Hand. Ich lächelte die Hand an, überlegte kurz, ob ich hinein beißen sollte, nicht fest, nicht unfreundlich, nur gerade so ein bisschen, entschied mich aber dagegen. Ich atmete noch einmal tief ein und beendete die Übung, mit der mir der liebe Herr Ausbildner wieder einmal das Leben gerettet hatte.
Phillip starrte mich an: „Bist du fertig ja? Sehr erwachsen! Wirklich sehr erwachsen. Wenn dem Herrn Kommissar die Argumente ausgehen, dann steckt er sich die Finger in die Ohren. Bravo!“
„Phillip.“, sagte ich mit versöhnlicher Stimme.
„Carli.“, sagte Phillip mit verstellt-versöhnlicher Stimme. „Ist es, weil ich Deutscher bin?“
„Aber Phillip ...“
„Ja ja der Herr Kommissar darf sich mit seiner Einbrecherkönigin vergnügen, aber der Piefke muss die Goschn halten.“
Ich muss hier erwähnen, dass es gewisse Gerüchte um den professionellen Hintergrund meiner Freundin Lina, die ich während unseres letzten Falles kennengelernt habe, gibt. Nichts als haltlose Vermutungen. Lächerlich. Gut, ihr Großvater war ein Einbrecherkönig und sie selbst hat uns bei ein paar Schlössern ausgeholfen. Also bitte! Eine Familienbegabung eben. Genau!
„Einbrecher ...“, höhnte ich, einen ungläubig-lächerliche-Gerüchte-zurückweisenden Ton anschlagend.
„Königin ...“ Ich war noch nicht ganz zufrieden mit meinem ungläubig-lächerliche-Gerüchte-zurückweisenden Ton, deswegen lachte ich einmal ungläubig auf. Hörte sich an, als hätte ich Schluckauf. Um meine ungläubige Empörung weiter zu unterstreichen, sah ich mich kopfschüttelnd um Zustimmung um.
„Bei Schluckauf hilft es, die Luft anzuhalten und zwanzig Schluck Wasser zu trinken.“, meinte der Mann mit dem Meeresbuch, der uns unverhohlen beobachtete.
„Danke!“
„Bitte!“
„Haben sie nichts Besseres zu tun, als anderen Leuten bei vertraulichen Gesprächen zuzuhören?“, fragte ich.
„Eigentlich nicht.“
„He!“ Phillip schnippte wieder.
Widerstrebend wandte ich ihm wieder meine Aufmerksamkeit zu: „Lächerlich. Unhaltbare Vermutungen.“
„Ha! Deine Freundin plant Raubzüge, dass Danny Ocean alt aussieht.“
„Der ist alt ...“, gab ich zu bedenken.
„Das ist nicht der Punkt! Hast du sie eigentlich schon einmal gefragt, wie sie zu ihren Fähigkeiten gekommen ist?“
Ich schwieg.
Phillips Stimme nahm einen ungläubigen Ton an: „Herr Kommissar hat seine Freundin noch nicht gefragt, ob sie vielleicht Einbrecherin ist!“
Ich starrte an die Decke. Ein Ventilator verquirlte träge die dickeLuft und verteilte so den Rauch schön gleichmäßig im Lokal.
„Du hast sie nicht gefragt. Ich werd' verrückt!“
Ich atmete ein wenig Gauloises ein und räusperte mich: „Unsere Beziehung ist in der sensiblen Anfangsphase, es gehört sich nicht, gleich die gesamte Vergangenheit des anderen auszuleuchten. So etwas braucht Zeit und äh ...“ Mir fiel nichts mehr ein. „Und außerdem bin ich Oberkommissar, warum nennt mich hier niemand Oberkommissar?“
„Vielleicht, weil dein Ermittlertalent nicht auf Kommissar hindeutet und schon gar nicht auf Ober!“
„Sie wünschen?“, fragte der Ober.
„Ha!“ Ich machte einen Schluckauf-Lacher.
„Eine Leberkäsesemmel!“, sagte Phillip gereizt.
„In der letzten halben Stunde haben wir die Speisekarte nicht umgestellt, gnä Herr!“
Phillip stierte ihn wütend an. „Dann zwei Bier! Und eine Fränkengulaschsemmel“
„Äh“
„
Warten Sie ich zeige es ihnen.“ Phillip stand stand auf, legte dem armen Mann die Hand auf die Schulter und ging mit ihm in die Küche.
3.
Seit dieser Sache mit Malina, Warenin und einem Basilisken war es sonderermittlungstechnisch ziemlich ruhig geworden in Wien. Man konnte glauben, das Verbrechen hätte sich tatsächlich aus dieser Stadt verabschiedet, wie es Malina versprochen hatte. Trotzdem jagte uns die Matuschek ständig zu irgendwelchen Tatorten, an denen absolut nichts Besonderes zu ermitteln war.
„Wachsam bleiben!“, sagte sie in letzter Zeit oft und mit so einem seltsamen Unterton in der Stimme.
„Wachsam bleiben ...“ Die Matuschek wird vielleicht auch schon alt, dachte ich mir.
Bis heute.
Wir waren immer noch im Museum. Der Museumsgraf beauftragte einen Lakaien mit der Organisation einer Melange. Und einer Leberkäsesemmel. Das war mir zwar peinlich, aber eine Melange zu bekommen, war besser als eine Melange nicht zu bekommen, also protestierte ich nur schwach. Phillip sah keinerlei Grund zu protestieren, meinte aber, vielleicht wolle er doch eher einen Leberkäse-Hotdog, legte dem Bediensteten seine Hand auf die Schulter und ging mit ihm Richtung Küche.
Der Graf und ich sahen ihm hinterher. Mit einem Seufzer wandte ich mich an den Direktor: „Also, was ist denn passiert bitte?“
Dieser sammelte sich, holte tief Luft und sagte dann: „Die Saliera ist weg! So ein Unglück!“
„Wie weg?“
„Nun - nicht mehr da!“
„Ja, das dachte ich mir schon, da Sie sagten sie sei weg, aber - wie weg? Gestohlen, oder was?“
„Ja, also wenn Neptun und Tellus es nicht satt hatten, auf einem Salzfass herumzusitzen, und deswegen nach Hause gegangen sind, dann - ja - gestohlen, schätze ich.“ Das klang irgendwie nach Sarkasmus, obwohl nichts in der Stimme des Grafen darauf hindeutete. Die feine Klinge? Ich hatte auf jeden Fall keine Ahnung, von was er da redete.
„Von was redet der Mann? Wer sind diese Typen, Nero und Typhus, oder was? Sind die abgängig? Sind wir deswegen hier?“ Phillip hatte sich wieder zu uns gesellt.
„Ich habe keine Ahnung. Von was reden Sie da Herr Gra...af...irektor?“ Der Direktor massierte sich den Nasenrücken mit Daumen und Zeigefinger. „Sie wissen nicht, was die Saliera ist?“
„Nun ja ...“, erwiderte ich diplomatisch. „... ich weiß, dass sie unlängst schon einmal gestohlen wurde. Passen Sie eigentlich gar nicht auf ihre Sachen auf? Aber keine Ahnung, wer diese Leute sind, die Sie erwähnten.“
„Die sitzen darauf. Die Saliera ist ein Salzfass!“
Phillip sah den Direktor ungläubig an. „Ein Salzfass. Soll das ein Scherz sein? Und weil Marcel und Tamira nicht auf ihren Salzstreuer aufgepasst haben, sind wir hier? Meint er das ernst?“
Ich sah den Grafen streng an: „Meinen Sie das ernst?“
Unsicher blinzelnd erwiderte der Graf meinen Blick: „Entschuldigen Sie, ich muss mich setzen.“
Wir setzten uns auf Designer-Polstersessel, die im marmorigen Foyer des Museums etwas verloren herumstanden, vermutlich von der letzten Vernissage übergeblieben. Der Direktor sah ein wenig mitgenommen aus. Vielleicht hatte ich mich doch getäuscht, in einem Kriegsgebiet würde er wohl nicht lange durchhalten. Er massierte sich noch einmal den Nasenrücken, nahm dann einen der Kataloge, die auf dem Tisch lagen, blätterte ihn zielsicher auf Seite 56 auf und legte ihn zu uns gedreht hin. Ein spitzer, perfekt manikürter Zeigefinger tippte auf das Bild zweier zurückgelehnter goldener Figuren auf einem ovalen Podest, eine davon mit einem Dreizack, die andere mit Brüsten, wenn auch kleinen. „Neptun und Tellus.“
Wir sahen das Bild an, dann sahen wir den Direktor an.
„Aha.“, sagte ich.
„Das soll ein Salzstreuer sein? Und wo bitte kommt da das Salz heraus?“ Phillip betrachtete das Bild aus verschiedenen Winkeln und versuchte Schüttbewegungen mit der Hand.
„Das ko ... Bitte! Wollen Sie sich nicht den Tatort ansehen?!“ Die Stimme des Grafen klang jetzt flehend und resigniert. Keine Chance in einem Kriegsgebiet. Die Melange und der Leberkäse-Hotdog wurden gebracht. Ich nahm einen Schluck.
„Na gut, schauen wir uns den Tatort an.“ Ich setzte das Wort 'Tatort' mit den Fingern zwischen Anführungszeichen. Für meinen Geschmack war das hier nichts für die Sonderermittlungseinheit.
„Aber ich sage es ehrlich, ich glaube nicht, dass das ein Fall für uns ist. Wir sind die Sonderermittlungseinheit, also ermitteln wir Besonderes und nicht Dinge, die quasi alle Tage passieren. Ich meine, wie oft lassen Sie sich das Ding noch stehlen?“
„A ...“, sagte der Graf.
„Und wo ist jetzt der - 'Tatort'? In der Kantine?“, fragte Phillip schmatzend.
Der Direktor sank in sich zusammen. Er machte eine schwache Geste zu einem Adlatus, der in angemessener Entfernung bereit stand.
„Dr. Pokorny wird ihnen alles zeigen. Entschuldigen Sie, ich muss noch ein wenig sitzen bleiben.“ Kriegsbefriedungstest nicht bestanden. Schade. Da bräuchte es gute Leute. Der Museumsgraf tat mir leid, ich dachte nicht, dass er der Dieb war. Dazu war er zu gut erzogen.
„Komm Phillip! Ich glaube wir lassen den Herrn Gr...irektor besser alleine.“ Ich nahm meine Melange, Phillip seine Semmel und wir folgten Dr. Pokorny.
Er führte uns über eine breite marmorne Prunktreppe in den ersten Stock, auf ein Balustrade, in einen langen Gang, durch eine hohe breite Tür in einen großen Raum mit knarzendem Parkett und roten Kordeln, in dem große alte Schinken hingen, dann weiter in einen großen Raum mit knarzendem Parkett und roten Kordeln, in dem ebenfalls alte Schinken hingen, weiter in einen kleineren Raum mit knarzendem Parkett und roten Kordeln, in dem kleinere alte Schinken hingen. Des weiteren passierten wir: Speere, Helme, Küchenutensilien aller Art, Skulpturen aus Stein, Skulpturen aus Metall und Steine mit Hieroglyphen. Je weiter wir in das Museum vordrangen, desto staubiger roch die Luft. Schließlich gelangten wir zu einer Drehtür. Wir gingen hindurch und fanden uns in einem Wald aus hohen gläsernen Vitrinen wieder. Die meisten Vitrinen waren vier bis fünf Meter hoch, im Grundriss quadratisch oder rechteckig und standen auf unauffälligen dunklen Metallsockeln. Eine gläserne Säulenhalle. In den Glassäulen war Goldenes und Silbernes, Pokale, Bronzefiguren, Marmorköpfe, edle Schatullen und dergleichen ausgestellt.
„Die Kunstkammer.“, verkündete Pokorny knapp.
Wir umrundeten eine dünnlippige, peinlich berührt zu Boden blickende Marmordame, durchschritten eine weitere Tür, bogen vor einem Ringelrein aus vier goldenen Nackedeis scharf nach links ab und waren am Ziel.
Eine große Glasvitrine nahm den zentralen Platz des Raumes ein. Sie sah unversehrt aus. In ihrer Mitte, auf feinem blauen Stoff, stand ein Salzstreuer.
Semmelkauend betrachtete Phillip das Ausstellungsstück: „Ich dachte, der wäre gestohlen!“
Dr. Pokorny musterte ihn mit kaum verhohlener Abscheu. Semmelessen war in diesen heiligen Hallen sicher ein totales No-no. Ich nahm einen Schluck von meiner Melange. „Mein Partner scherzt.“, erklärte ich, obwohl ich mir da nicht ganz sicher war. „Also bitte, wie ist das passiert?“
„Ich kann ihnen nicht sagen, wie das passiert ist, denn ich bin nicht der Dieb!“ Sarkasmus und feine Klinge schien unter den gutgekleideten Doktoren hier ein Renner zu sein.
„Sagen Sie. Weiter. Erzählen Sie uns alles, was Sie wissen.“, schmatzte Phillip.
Dr. Pokorny war ein ganz anderer Typ als der Herr Direktor. Er war in feinste Stoffe gekleidet, wie sein Herr. Aber das Stecktuch wirkte an ihm aufgesetzt, der Maßanzug berechnend. Seine Fassade war glatt und seelenlos. Was sich dahinter verbarg, wollte ich nicht wissen. So wie man nicht wissen will, was manche Leute im Keller haben.
„Alles?“, fragte die Hyäne, „Sie meinen inklusive meiner umfangreichen Kenntnisse der Ägyptologie und Arabistik?“.
Phillip machte einen Schritt auf ihn zu: „Den Schweinskram können Sie weglassen, erzählen Sie uns nur, wie Sie Noel und Tamara hier rausgeschafft haben! Wir kriegen es sowieso raus, aber so sparen wir Zeit.“ Phillip kann ziemlich einschüchternd sein, wenn er sich vor jemandem aufbaut und einen gewissen Gesichtsausdruck zur Schau trägt. Er vermittelt dann recht klar, dass er nicht nur in der Lage ist und große Lust hat, das Gegenüber zu Kleinholz zu verarbeiten, sondern dieses Vorhaben tatsächlich auch zeitnah zur Ausführung bringen wird. Infolgedessen schluckte der schlaue Kunsthistoriker jetzt hart und trat einen Schritt zurück. Seine rotgeränderten Augen nahmen für einen Moment einen brutalen trotzigen Ausdruck an. Als würde er in Gedanken fürchterliche Rachepläne schmieden.
„Also bitte Dr. Pokorny. Würden Sie uns jetzt aufklären.“, sagte ich freundlich.
Er schluckte noch einmal. „Das Ganze ist ein Rätsel. Nach unserem Dafürhalten wurde die Vitrine nicht berührt. Die Tür wurde nicht geöffnet, keines der Alarmsysteme hat etwas gemeldet. Es kann also niemand etwas heraus genommen oder hineingestellt haben.“
„Aber trotzdem sind ihre goldenen Nackedeis weg und stattdessen steht hier ein Salzstreuer aus der Kantine.“
„So ist es.“
„Haben Sie schon in der Kantine nachgesehen?“, fragte Phillip.
Dr. Pokorny sah ihn zu gleichen Teilen hasserfüllt und unsicher an.
„Woher wissen Sie, dass die Tür nicht geöffnet wurde?“, fragte ich.
„Das lassen Sie sich besser von unserem Sicherheitschef erklären. Aber es gibt da ein mechanisches Schloss und ein elektronisches Schloss mit einem Log-File. Und dann gibt es noch Erschütterungs- und Klimasensoren im Sockel und Bewegungssensoren im Raum hier und außerdem noch eine Kamera. Und nichts von allen diesen Dingen zeigt irgendwelche Anzeichen dafür, dass irgendetwas Außergewöhnliches passiert wäre letzte Nacht.“
Und doch war die Saliera weg, mitsamt Zeus und Apollo.
Seltsam.
Aber es kam noch besser.
4.
Am Abend, im Alt Wien, redeten wir außer über den alten Fall natürlich auch auch über die Ereignisse des Tages.
„Entschuldigen Sie, das ergibt doch keinen Sinn!“
Wir drehten uns zu dem Mann um, der uns so ungeniert unterbrochen hatte. Es war der Meeresbiologe.
„Pardon?“
„Sag ich doch die ganze Zeit!“, sagte Phillip.
„Was ergibt keinen Sinn?“
„Na, was sie hier reden über Basilisken, Warenin, Malina, und jetzt noch über die Saliera und - wie war das? Ein Tor zur Hölle? - seit ...“ Der Meereskundler warf einen Blick in sein mehr als fünf Zentimeter dickes Buch. „Also ich höre ihnen zu seit 'Gnathostomulida'. Und jetzt bin ich bei 'Solenogastres'. Zwischen Gnathostomulida und Solenogastres liegen sieben bis acht Tierstämme. Wenn auch eher mikroskopische, wurmige, nicht gerade Superstars der Streichelzoos. Nichtsdestotrotz ergibt jeder dieser mikroskopischen Würmer mehr Sinn als das, was Sie hier so reden.“
Phillip hatte jetzt so einen Ausdruck in den Augen. Leute, die in diese Augen sehen, haben im Allgemeinen eine recht geringe Wartezeit bis zum nächsten Satz heißer Ohren. „Beleidigt uns der Spaßvogel?“ Phillip deutete mit dem Daumen auf den Spaßvogel.
„Ich weiß nicht. Beleidigen Sie uns - Spaßvogel?“
Der junge Mann legte sein Buch weg und zündete sich eine Zigarette an. „Aber mitnichten!“ Mit einer wegwerfenden Handbewegung verwedelte er den Rauch. „Ich meine, schauen Sie, ein berühmter Biologe sagte einmal: Nichts in der Biologie macht Sinn, es sei denn im Lichte der Evolution. Diese Würmer hier ...“, er klopfte mit dem Zeigefinger auf sein Buch, wobei ein wenig Asche auf den Einband rieselte. „Diese Würmer hier ergeben also einen Sinn. Bei ihrer Geschichte aber - kein Sinn.“
„Häh?“, sagten wir.
Der Mann nahm wieder einen Zug und rückte seinen Stuhl näher an unseren Tisch. „Ihrer Geschichte fehlt die Theorie. Irgendein Mechanismus, der erklären könnte, warum B auf A folgt. Kurz, warum das passiert ist, was passiert ist. Für diese Würmer hier ist diese Theorie die der Evolution. Sie sind entstanden durch Mutation und Selektion. Langsam, über Äonen. Bei ihrer Geschichte aber ... das ist, als würde einem Huhn von heute auf morgen ein Froschschenkel herauswachsen. Aus dem Arsch!“
Phillip hatte ein Auge zugekniffen, mit dem anderen sah er zwischen dem Biologen und mir hin und her und deutete mit dem Daumen wieder auf den Spaßvogel: „Ich weiß immer noch nicht ...“
„Ja ich auch nicht und überhaupt, haben Sie nichts Besseres zu tun, als die Gespräche anderer Leute zu belauschen?“
„Nein, sagte ich doch schon. Also gut, ich sollte dieses Buch durcharbeiten.“ Er klopfte wieder auf sein Meeresbuch. „Aber was Sie da so erzählen, ist weit spannender als Würmer, wenn ich einmal ehrlich sein darf.“
„Sie sagten doch, es würde alles keinen Sinn ergeben?“ Phillip kratze sich am Kopf.
„Ja, das macht es ja spannend! Würmer ergeben Sinn - vielleicht - so sicher bin ich mir da auch nicht bei allen. Das macht sie aber nicht wirklich abendfüllend. Also, so fern Sie nicht ein Wissenschaftler sind, der zu lange kein Tageslicht gesehen hat. Die sind halt so entstanden. Mein Gott. Schleimkram.“
„Die Würmer.“, ergänzte er nach einer Sekunde.
„Oh, ich dachte Sie sind Biologe ...“
„Aber wo! Das ist nur ein Auftrag.“ Hinter vorgehaltener Hand raunte er: „Und - unter uns - nicht der Interessanteste.“ Dann deutete er mit dem Zigarettenzeigefinger auf mich: „Aber hören Sie - ihre Geschichte - ich denke, ich könnte Ihnen helfen!“ Nach einem weiteren tiefen Zug dämpfte er die Zigarette aus.
Ich schielte zu Phillip. Der schielte zurück. Dann versuchte ich, ein wenig mehr Griff auf diese unerwartete Konversation zu bekommen, kam aber ein bisschen ins Schlittern: „Sie könnten uns ... das ist doch wirklich ... hören Sie! Sie können doch nicht einfach! Sag doch auch etwas!“, forderte ich Phillip auf.
Der sah mich an, dann den dreisten Störenfried: „Wie?“, fragte er.
Der Biologe, der keiner war, grinste und schob sich mit seinem Stuhl an unseren Tisch heran. Er war gut gekleidet. Hellgrauer Anzug, weißes Hemd, zeitlos elegant, könnte man sagen. Die fettigen halblangen Haare, Krankenkassenbrille und Aschereste auf dem Revers nahmen seinem Erscheinen aber wieder einen Gutteil der Eleganz. Er zog eine Visitenkarte aus der Brusttasche und legte sie sorgsam zwischen unsere beiden Biergläser. Wir reckten die Köpfe vor, um zu sehen, was darauf stand.
Dr. Andrej Eisenstein
Büro für Denkarbeiten aller Art
Wir starrten die Karte einige Sekunden an, dann nahmen wir einen Schluck Bier. Ich stellte mein Glas ruhig auf den Tisch zurück und studierte das Kärtchen lächelnd noch einmal. Innerlich kochte ich. Das war doch die Höhe! Dem Burschi würde ich die Leviten lesen. Bevor ich zu meiner vernichtenden Entgegnung schritt, atmete ich noch einmal ruhig durch ... zweimal.
„Ihr Kollege hat recht, Sie sollten nicht passiv rauchen, das ist schädlich. Wollen Sie eine?“ Der Denkarbeiter schüttelte eine Zigarette aus dem Päckchen und hielt es mir hin. Verdammt! Ich hatte den Faden verloren. Die Dreistigkeit dieses Typen ließ meine Leviten-les-Ambitionen abrupt auf Grund laufen.
„Machen Sie auch Sudokus?“, fragte Phillip.
„Der Kunde ist König.“
„Wie viel?“
„Zwanzig für Krone, Dreißig für Kurier, Fünfzig für Frankfurter Allgemeine. Das sind natürlich nur Richtsätze, ich mache auch andere Zeitungen, Japanische kosten Extra.“
„Ja, das macht Sinn.“, nickte Phillip ernsthaft. „Schön!“, sagte er und sah mich glücklich an.
„Äh“, schaltete ich mich ein.
„Super, ich wollte immer schon mal ein Sudoku machen.” Aufgeregt fischte Phillip eine lachsfarbene Zeitung von dem Tischchen hinter sich. „Bitteschön!”
„Jetzt gleich?”
„Natürlich jetzt gleich! Wir wollen doch ihre Qualitäten prüfen, bevor wir ihnen einen Auftrag erteilen.”
“W...? ”, gab ich zu bedenken.
„Na schön, dann bis gleich.“ Der Denkarbeiter nahm die Zeitung und zog sich an seinen Platz zurück.
„Praktisch!“ Phillip nahm zufrieden einen Schluck Bier. „Hör mal, wir könnten den Herrn doch gleich auch einmal wegen der seltsamen Dinge heute beauftragen!“
„Ähem“, testete ich meine Artikulationsfähigkeit. Funktionierte wieder. „Sag' einmal ... geht’s noch? Bist du noch bei Sinnen? Der Klugscheißer will uns doch verarschen. Denkarbeiten aller Art! Das ist doch Blödsinn! Hast du schon jemals von so etwas gehört?“
„Nö, hab ich nicht. Klingt aber vernünftig.“
„Vernünftig? Und du steckst ihm auch noch 30 Euro in den Rachen!“
„Nur, wenn er das Sudoku hinkriegt. Und das ist ein ziemlich gutes Geschäft, wenn man bedenkt, wie lange ich dafür brauchen würde. Das wäre nämlich ungefähr ...“ Phillip rollte für die Berechnung die Augen in den Schädel. „... für immer.“
„Aber ...“
„Und außerdem hat er einen Punkt.“
„Einen Punkt?“
„Na - recht.“
„Wie recht?“
„Es ergibt alles keinen Sinn. Die ganze Sache mit Warenin, dem Basilisken und jetzt mit der Saliera und ...“
„Die Matuschek sagt aber ... ich denke ...“
Phillip winkte ab.: „Die Matuschek, die Matuschek. Die benutzt uns doch nur, die Alte. Und apropos: denken. Seien wir ehrlich, wir sind nicht die allerbesten Denker. Wir sind ein bombiges Sonderermittlerteam. Action ist unser Job. Ärsche treten, Knochen brechen. Aber Denken ... hm hm“ Er machte eine wage Handbewegung. „Es macht vielleicht Sinn, das outzusourcen.“
„Was?“
„Na das Denken! An einen Profi. Heutzutage sourct man alles aus!“ Phillip war jetzt richtig Feuer und Flamme. „So, wie die Matuschek die Action an uns outsourct. Und überhaupt: mir geht‘s auf den Keks, dass der Drachen uns immer im Dunklen lässt über ihre wirklichen Pläne. OK! Sie sagt uns nichts? Gut! Dann finden wir‘s eben selber heraus! Lass' uns endlich richtige Sonderermittler sein!“
Er nahm einen Schluck Bier und sah mich herausfordernd an. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Aber mit der Matuschek hatte Phillip einen Nerv getroffen. Er hatte ein Punkt, recht eben, dachte ich, als ich die goldene Flüssigkeit vor meiner Nase im Glas schwenkte. Bei allem Respekt, mir ging die strenge Dame mit ihrer Geheimniskrämerei nämlich schön langsam auch auf die Nerven. Außerdem hatte ich so viel Engagement von Phillip, außer in Faustkämpfen oder Verfolgungsjagden, noch nie gesehen. Und es machte wirklich keinen Sinn, das alles. Aber ich wollte verstehen! Wirklich verstehen. Phillip hatte Recht ... verdammt! Ich blickte über den Rand meines Bierglases. Er fixierte mich immer noch, sah, dass ich schwankte, wusste, dass er mich an der Angel hatte. Dann nahm er sein Glas und hielt es mir mit feierlicher Geste hin. „Was ist? Ermitteln wir, Herr Oberkommissar?“
Wir stießen an.
„Ermitteln wir!“
Wir tranken einen geschichtsträchtigen Zug Bier.
„Was denkst Du ...“, begann ich dann.
„Ah“ Phillip stoppte mich mit erhobenen Zeigefinger und deutete mit dem Daumen zum Nachbartisch. „Wir lassen denken, schon vergessen?“
In dem Moment schob sich der Denker mit seinem Stuhl wieder an unseren Tisch und ließ die Zeitung auf die Marmorplatte fallen. „Sodala, das wär's! Einmal Sudoku aus dem Standard, das macht dann 30 Euro bitteschön.“ In allen Kästchen des Sudokus standen jetzt Zahlen. Es waren keine drei Minuten vergangen, seit er mit dem Rätsel begonnen hatte. „Wenn Sie sich allerdings zu einer weiteren Beauftragung entschließen, und dazu würde ich Ihnen raten ... also dann würde ich Ihnen dieses Honorar im Sinne der Geschäftsanbahnung erlassen.“ Er schenkte uns ein liebenswürdiges Lächeln.
Wir beugten uns wieder vor, um das Sudoku zu begutachten. Phillip nickte mir auffordernd zu.
„Und - stimmt's?“
„Woher soll ich das wissen? Ich mache keine Sudokus. Ich esse auch kein Sushi.“
Phillip sah den Denker an: „Woher sollen wir wissen, ob es stimmt? Wir essen kein Sushi.“
Der Mann sah zwischen uns hin und her, dann lächelte er gütig, aber ernst: „In ihrem speziellen Fall ist es mir ein Vergnügen, Ihnen mein „Rundum-Sorglos-Paket“ anzubieten.
Mein Telefon läutete.
„Carli Schatzerl!“, schrie mir meine Mutter ins Ohr. Bei ihr im Hintergrund rauschte irgendetwas. Es klang nach Meer.
„Oh Mama, Servus! Was gibt’s. Was ist das für ein Lärm?“
„Wir sind jetzt hier draußen ... das musst du dir anschauen ... das Wasser ist wunderbar! Aber ein bisserl seltsam ist das schon ...“
„Von was redest du da? Wer ist wir. Wo draußen? Welches Wasser?“ Ich nahm nicht an, vernünftige Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Meine Mutter hat es sich in den Kopf gesetzt, einen ordentlichen Alterspleen zu entwickeln und war auf einem guten Erfolgspfad.
„Bub, du mit deinen Schmähs! Du hast es uns doch selber grad gezeigt ...“
Dann brach die Verbindung ab.
Ich hatte keine Ahnung von was sie da redete.
5.
Aber zurück zu dieser Museumsgeschichte. Nachdem der widerliche Ägyptologe Dr. Pokorny uns die Vitrine gezeigt hatte - die Vitrine, in die offensichtlich nicht eingebrochen worden war, in der aber ebenso offensichtlich ein ziemlich teurer gegen einen ziemlich billigen Salzstreuer getauscht worden war - traf die Spurensicherung ein.
Wir ließen uns von Pokorny zum Sicherheitschef des Museums führen. Dessen Büro erreichten wir über zwei Hinterstiegen und einige Verbindungsgänge, die nichts von der Pracht der Ausstellungsräume hatten. Sie lagen im Verwaltungsteil des Museums, der unter den Prunkräumen lag. Das Büro des Sicherheitsmannes war ein Kabuff mit Plastikboden und billigen hellbraunen Möbeln. Der Raum hatte ein riesiges Fenster mit Ausblick über die Ringstraße, auf halber Höhe des Fensters war aber eine Zwischendecke eingezogen worden. Der dicke Mann mit fettigem spärlichem Haar hinter dem Schreibtisch wirkte nicht sonderlich beglückt, als Dr. Pokorny an seine offene Türe klopfte. Auf einem schmucklosen Schild an der Türe stand: Ing. Wolfgang Sedlar. Der Herr Doktor schien ebenfalls wenig erbaut zu sein, in diese utilitaristischen Eingeweide des Musentempels vordringen zu müssen.
„Die Herren sind von der Polizei.“, sagte er tonlos, ohne den Raum zu betreten. „Sie wollen wissen, was da schiefgelaufen ist.“ Dem Herrn Ingenieur stieg die Zornesröte ins Gesicht. Bevor er aber etwas sagen konnte, wandte Dr. Pokorny sich wieder an uns. „Sie brauchen mich dann ja nicht mehr?“ Und schon eilte er durch den zwielichtigen Gang wieder der Oberwelt entgegen. Ich war froh, dass er weg war.
„Und verlassen Sie die Stadt nicht!“, rief ihm Phillip noch hinterher. Während sich der Herr Doktor umblickte, hastig, wie auf der Flucht, lief er ums Haar in ein Abwasserrohr, das senkrecht an der Wand entlang lief. Wieder sah ich diesen Ausdruck in den Augen des Kunsthistorikers. Regelrechte Mordlust.
Wir wandten uns Herrn Ingenieur Sedlar zu.
„War er's?“, fragte er voller Hoffnung.
„Wir ermitteln in alle Richtungen.“
Der dicke Ingenieur lächelte schwach. Wir waren uns wohl in unserem Urteil über den prätentiösen Doktor alle einig.
Wir schüttelten Hände und nahmen dann vor seinem Schreibtisch Platz. Seine Miene hatte sich etwas entspannt. Das änderte sich aber wieder, als er uns schilderte, was geschehen war. Beziehungsweise nicht geschehen war, beziehungsweise nicht geschehen sein konnte.
Die Kurzversion war: Heute in der Früh um 5:07 entdeckte ein Museumswächter den Salzstreuer in der Vitrine. In der Nacht war absolut nichts Bemerkenswertes passiert. Es hatte keinerlei Alarm gegeben. Das elektronische Schloss hatte keinerlei Aktivitäten registriert und das andere Schloss war ebenfalls unversehrt. Er erläuterte dann in großem Detail die Einzelheiten des Alarmsystems und dozierte mit Hingabe über ausgeklügelte Wachpläne.
„Also ich wünsche ihren Kollegen von der Spurensicherung ja viel Glück, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendetwas zu Tage fördern. Weil da nichts ist!“, schloss der übergewichtige Mann endlich seinen Vortrag und strich sich ohne Hektik eine ölige Haarsträhne aus dem Gesicht.
„Und was ist mit den Kameras?“, fragte ich.
„Ach so, ja ...“ Sedlar wirkte leicht indigniert. „Aber das gibt es nicht!“, rief er.
„Was gibt's nicht?“
„Der ist lustig.“, raunte Phillip.
„Vollkommen unmöglich! Der Diensthabende hat in der Nacht natürlich immer wieder alle Bildschirme kontrolliert. Und alle zwei Stunden wird jeder Raum im Museum begangen. Da war nichts!“
„Was ist dann unmöglich?“, fragte ich.
„Es hat sich absolut nichts getan im Saliera-Raum. Dann in der Früh, um Fünf Uhr Sieben und Sieben Sekunden, um genau zu sein, steht plötzlich ein Salzstreuer da drinnen.“
„Das ist doch ...“
„Ja, exakt in dem Moment, als der Wächter den Raum betritt und den Blick verstellt. Zwei Sekunden später steht da der Salzstreuer!“
Phillip und ich wechselten einen Blick.
„Dann würden wir noch gerne mit dem Wächter sprechen.“
Sedlar sah uns an: „Wie soll denn der ... in ein paar Sekunden … unmöglich! Aber bitte, gehma!“ Der Sicherheitsmann stand schnaufend auf und führte uns aus seinem Büro, hinaus auf den Flur. Eine Putzfrau mit einem Wägelchen, auf dem eine große Abfalltonne und diverses Putzgerät stand, kam uns entgegen. Wir ließen sie durch, gingen den Flur hinunter und dann in einen Raum, der eine Küchenzeile, einen Tisch und eine Couch beherbergte.
„Das ist der Aufenthaltsraum.“ Sedlar schaute sich genervt um. Ich habe dem Boris doch gesagt, er soll hier warten.“ Niemand außer uns befand sich in dem Raum.
„Wo zum Teufel ...“
„Vielleicht ist er am Klo?“, half Phillip.
„Ich sehe einmal nach.“ Der Sicherheitschef eilte davon.
„Jaja.“, sagte ich abwesend. Ich hatte eine Kaffeemaschine entdeckt! Sie stand verheißungsvoll neben dem Herd. Zwar so ein Modell mit Kapseln, aber für einen zweiten Morgenkaffee warf ich gerne und ohne zurückzublicken, meine kaffeesiederischen Überzeugungen über Bord. Phillip ließ sich auf der Couch nieder, um in einer Frauenzeitschrift zu blättern.
„Schau schau“, murmelte er.
„Was Interessantes?“ Versonnen sah ich dem braunen Gold zu, wie es brummend in ein dickwandiges Glas floss. Vielleicht gibt es ja sogar einen Milchsprudler hier. Hoffnungsvoll blickte ich mich um.
„Aber Hallo!“, sagte Phillip und versank ohne weitere Erklärung wieder in seiner Lektüre. Was es auch immer war, es half ihm sicher dabei, Frauen davon zu überzeugen, er würde sich tatsächlich dafür interessieren. Wenn die wüssten! Nämlich wer ihre Zeitschriften las und zu welchem Zweck. Ich hatte gerade den Milchschaum fertig, als der Sicherheitschef wieder zu uns stieß. Er war atemlos.
„Weg! Der ist weg! Der depperte Trottel!“
„Wie - weg?“, fragte ich heute schon zum zweiten Mal. Phillip ließ die Zeitschrift sinken.
„Ich finde ihn nirgends! Es weiß auch niemand, wo er ist. Ich habe ihm doch gesagt, er soll hier warten.“ Die Zornesröte stand Sedlar im Gesicht. „Hier!“ Er stampfte mit dem Fuß auf.
In dem Moment ging ein ohrenbetäubender Alarm los.
Wir erstarrten. Ich mit der Kaffeetasse am Mund. Phillip mit der Zeitschrift in der Hand. Der Sicherheitsingenieur ungläubig seinen Fuß musternd. Sekunden verstrichen, in denen wir, passend zu dem Gebäude, in dem wir uns befanden, wie in einem Gemälde festsaßen mit dem Titel: „Drei Gestalten in einem Aufenthaltsraum, während der Alarm losgeht“ Von Hopper vielleicht.
In der nächsten Sekunde kam Leben in den Sicherheitschef. Man konnte richtiggehend sehen, wie er innerlich Schwung nahm, um seine Masse in Bewegung zu setzten. Dann setzte er seine Masse in Bewegung. Er schrie etwas, das vom Sirenenlärm gleich wieder verschluckt wurde, gestikulierte wild und rannte los. Erstaunlich flink für seine Körperfülle. Ich nahm hastig drei Schlucke Kaffee, dann folgten wir dem Ingenieur. Der rannte den Weg zurück, den wir gekommen waren, zweigte kurz nach seinem Büro ab, rannte noch zweimal um die Ecke und schon fanden wir uns im Sicherheitszentrum des Museums wieder.
Dieses war, was Sicherheitszentren angeht, nicht besonders aufregend. Ein paar Monitore an der Wand. Fünf Bildschirme auf zwei Bürotischen. Das war's. In der Mitte des Raumes, ein panisch um sich blickender Mann auf einem Drehsessel.
Sedlar eilte zu einem Pult mit Reglern und deutete uns, die Tür zuzumachen. Er drückte auf einen Knopf und mit einem Mal war das akustische Inferno beendet. Aber nur hier in diesem Raum. Von draußen konnte man immer noch das gellende Schreien des Alarmsystems vernehmen, aber sehr gedämpft. Hier drinnen wurde es durch das hysterische Blinken diverser Anzeigen ersetzt.
Sedlar machte einen konzentrierten Eindruck. Er arbeitete schnell, aber nicht hektisch. Den überforderten Mitarbeiter hatte er beiseite geschoben. Der war sichtlich froh darüber, dass jemand hier die Kontrolle übernahm und stellte sich mit verschränkten Armen in eine Ecke. Die Hände des Sicherheitschefs flogen über Tastaturen und Schaltknöpfe. Hinter der Fassade des älteren, dicklichen Bürokraten war ein Profi hervorgetreten, der offensichtlich wusste, was er tat.Die Monitore zeigten wechselnde Bilder in rascher Abfolge. Der Hauptverdächtige war schnell gefunden. Im Raum, in dem die Saliera verschwunden war, war ein größerer Tumult entstanden. Man konnte nichts Genaueres erkennen. Leute in weißen Overalls verstellten die Sicht.
Ich zeigte auf den Monitor, dann auf den in der Ecke stehenden Wachmann. „Sie! Führen Sie uns dorthin! Schnell!“
Hier konnten wir sowieso nichts ausrichten. Der Angesprochene schreckte aus seinem Schockzustand auf, sah mich an, dann den Sicherheitschef. Der wedelte ungeduldig mit der Hand. „Gemma, Gemma!“
Ich legte ihm eine Visitenkarte auf den Tisch: „Wenn es etwas Neues gibt ...“. Er nickte abwesend, dann widmete er sich wieder, ohne noch einmal aufzublicken, seinem System.
Sobald wir den Sicherheitsraum verlassen hatten, wurden wir wieder vom infernalischen Lärm der Alarmanlage begrüßt. Der Wachmann lief uns voraus, den Weg zurück, den wir mit Dr. Pokorny gekommen waren. Neben einem Tizian kamen wir durch eine unscheinbare Tür wieder in die Schauräume, wo der Lärm zwar nicht leiser, aber durch die veränderte Akustik der hohen Räume weniger klaustrophobisch war. Indignierte Blicke aus alten Schinken verfolgten uns, als wir über knarzendes Parkett liefen, das man in dem Lärm nicht knarzen hören konnte. Dann pflügten wir mit gezückten Ausweisen durch die dichter werdende Ansammlung von Polizisten, weißen Overalls und sonstigen Herumstehenden und stoppten im Raum der Saliera vor deren Vitrine.
Besser gesagt, vor dem, was von ihrer Vitrine übrig geblieben war. Vor uns stand der schwarze Sockel. Auf dem Kissen aus blauem Tuch lagen Scherben. Rund um den Sockel lagen ebenfalls Scherben. Krümelig, Sicherheitsglas. Der Rahmen der Vitrine lag hinter dem Sockel auf dem Boden. Wir traten wieder einen Schritt zurück. Phillip sah mich an und sagte etwas, das ich nicht verstand. Das Heulen der Alarmanlage fegte mit unverminderter Intensität durch die Hallen des Kunsthistorischen Museums.
„Was?“, brüllte ich.
In dem Moment verstummte das Alarmsystem abrupt und ein akustisches Vakuum entstand, in dem mein Schrei wiederhallte.
Alle sahen mich an.
Ich räusperte mich. „Ähem ... was?“, wandte ich mich, jetzt in Zimmerlautstärke, an Phillip.
Der deutete auf das Kissen: „Wo ist der Salzstreuer?“
6.
„Wer war das?“ Eine unangenehme Stimme durchschnitt das Volksgemurmel, das nach dem Sirenenlärm zögernd wieder losgepätschert war und das durch diese Stimme abrupt und nachhaltig wieder zum Verstummen gebracht wurde. Die Frage war ungeduldig, quasi fingertrommelnd vorgetragen. Die unangenehme Stimme gehörte einer Person, die das Kunststück zu Stande brachte, noch unangenehmer zu sein, als ihre Stimme. Die Person stand in der großen Flügeltür, von deren beträchtlicher Breite sie physisch nur einen kleinen Teil einnahm, einen Beistrich quasi. Der Rest wurde aber locker vom Ego der unangenehmen Person ausgefüllt und damit jegliche Fluchtmöglichkeit blockiert. Betretenes Schweigen erfüllte angstvoll den Raum. Die Spurensucher starrten beklommen auf ihre Schuhe, die Mutigeren starrten auf die Schuhe der Dame.
„Wieder einmal niemand. Gut, das werden wir ja sehen. Ich darf dann alle Anwesenden bitten aus dem Tatort zu treten.“
Weiterhin beklommen auf Schuhe starrend, sich gegenseitig schubsend und panisch tuschelnd, verließen die Profis der Spurensicherung den Raum. Wir kamen hinter ihnen, sozusagen zum Vorschein.
„Aha die Sonderermittlungseinheit. Na dann ist ja alles klar!“ Verstohlene, hämische Blicke trafen uns.
Die unangenehme Person war Oberstleutnant Schratt. Frau Oberstleutnant Mag. Leopoldine Schratt. Die Frau Magister ist der Grund dafür, warum mir Mord lieber ist als Raub. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich wünsche den wenigsten Leuten einen gewaltsamen Tod, aber bei Mord hat man es mit dem Oberst Perschinger zu tun, einem gemütlichen Wandersmann, der sehr viel lieber im Frühtau zu Berge zieht, als sich die Stimmung von Mordfällen verdüstern zu lassen. Bei Raub war aber die Schratt am Ruder. Und das gab sie nicht aus der Hand. Schon gar nicht uns.
„Grüß Gott Frau Magister!“, begrüßten wir die Frau Magister unisono.
„Jaja.“, erwiderte sie.
„Wir waren's nicht!“, jammerte Phillip.
„Pscht!“, ermahnte ich ihn.
Die Frau Magister sah sich in dem nun, bis auf uns, menschenleeren, Raum um. Krümelige Glassplitter bedeckten den gesamten Boden. Wir standen mitten im Glassplittermeer.
„