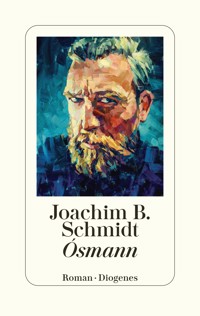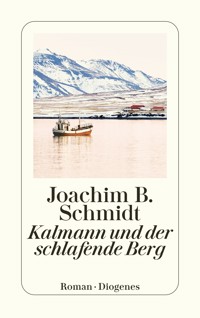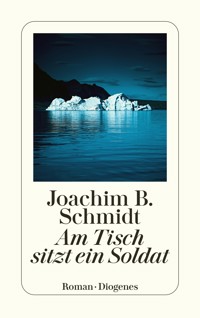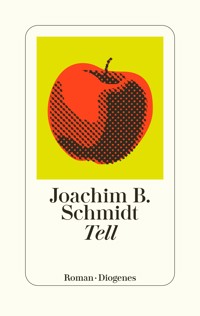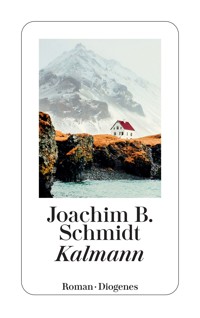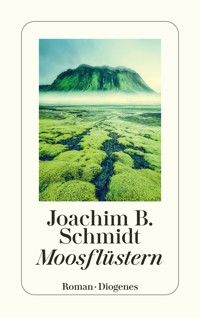
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Juni 1949 brachte der Dampfer »Esja« rund 200 Frauen aus Deutschland nach Island, wo sie sich als Dienstmädchen auf Bauernhöfen verdingten. Darunter auch Heinrich Liebers Mutter, von der er immer geglaubt hatte, sie sei nach seiner Geburt gestorben. 40 Jahre später ist Heinrich Bauingenieur, verheiratet, doch sein Leben gerät auf einmal ins Wanken. Der sonst so korrekte Mann fasst einen überstürzten Entschluss und reist nach Island, wo er sich auf die Suche nach seiner Herkunft macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Joachim B. Schmidt
Moosflüstern
Roman
Diogenes
Grüani, dä isch für di.
Kommt ein Vogel geflogen, Setzt sich nieder auf mein’ Fuß, Hat ein’ Zettel im Schnabel, Von der Mutter ein’ Gruß.Lieber Vogel, fliege weiter!Nimm ein’ Gruß mit und ein’ Kuss. Denn ich kann dich nicht begleiten, Weil ich hier bleiben muss.
Niederösterreichisches Volkslied
Prolog
Sie nennen ihn nur den Deutschen, die kartoffelnasigen Säufer vom Stammtisch. Ihre von Wind und Salzwasser zerfurchten Pranken sind fast zu klobig, um Biergläser zu heben, geschweige denn kleine, bis zum Rand gefüllte Schnapsgläser. Doch man gibt sich Mühe.
Manchmal kommt es vor, dass einer der Männer den Deutschen, ohne dass dieser darauf reagieren würde, einen Heimlichtuer nennt:
Jetzt sag uns schon deinen Namen, du vernagelter Heimlichtuer! Spuck ihn aus!
Höchste Zeit für Helga einzuschreiten. Die Arme in die Hüften gestemmt, stellt sie die ganze Bande, inklusive den Deutschen, auf die Straße, da die Säufer ohnehin die einzigen verbleibenden Gäste in der schummrigen Kneipe sind und die Zeiger der antiken Längenuhr Mitternacht weit hinter sich gelassen haben.
Man gehorcht Helga. Sie stand schon hinter dem Tresen der Bar, bevor der Deutsche auftauchte. Schon als Ronald Reagan und Michail Gorbatschow Hände schüttelten. Himmelherrgott, das war ein Trubel! Dass man überhaupt auf die Idee gekommen war, auf diesem glitschigen Felsen solch bedeutende Weltgeschichte zu schreiben. Helgas Kneipe war nicht weit davon entfernt, weshalb sie alle Hände voll zu tun hatte, um die Journalisten aus aller Welt zu bewirten. Die hatten einen Durst! Aber darum geht es hier nicht. Es geht um den Deutschen: ein waschechtes Mysterium. Er tauchte auf wie Strandgut, von irgendwoher, zerschlissen, unnütz und irgendwie deplatziert, als hätten ihn die Außerirdischen entführt und nach ausführlichen Untersuchungen auf dem falschen Flecken Erde, vielleicht sogar im falschen Jahrhundert wieder abgesetzt. Schon eine Weile her, aber Helga erinnert sich genau. Ihren Stammkunden erzählt sie die Geschichte immer wieder gern – manchmal sogar unaufgefordert. Setzt sich auch mal zu ihnen. Raucht mit ihnen.
Stumm und völlig verwahrlost sei er an einem frühen Nachmittag, die Bar eben erst geöffnet, zur Tür hereingeweht und habe sich an den Stammtisch gesetzt, genau hier, auf diesen Stuhl, wo er auch jetzt sitze, als hätte er da schon immer gesessen, als hätte er auf euch Landstreicher warten wollen! Draußen habe es Bindfäden geregnet, ein richtiges Sauwetter, und der Alte sei so durchnässt gewesen, dass sich unter seinem Stuhl bald eine Wasserlache gebildet habe; als wäre er tatsächlich wie Strandgut angeschwemmt worden! Tja, so was. Sie habe ihn gefragt, was er hier zu suchen habe, ruhig und gelassen habe sie es gefragt, sie kenne sich schließlich aus mit solchen Trollen, könne umgehen mit allerhand. Es sei ja nicht das erste Mal gewesen, dass Strandgut wie dieses angeschwemmt worden sei.
Helga klopft ihrem Sitznachbarn neckisch auf die Schulter, die Runde lacht, der Sitznachbar am lautesten, und er hält ihre Hand einen Moment mit warmem Griff auf seiner Schulter fest, er weiß schließlich, was es heißt herumzutreiben.
Der Deutsche starrt indes nur vor sich ins Glas und verzieht nicht mal den Mund. Helga fährt fort und spielt die Szene nach.
Tropfend habe der Deutsche vor sich hingestarrt, nach vorn gebeugt, etwa so, als hinge ihm eine schwere Last um den Hals, die Hände zu Fäusten geballt auf dem Tisch liegend.
Die Runde mustert den Deutschen. Helga lehnt sich im Stuhl zurück, sagt, sie sei in die Küche gegangen und habe die Beamten auf der Wache angerufen. Dann habe sie dem Verwahrlosten einen Schnaps gebracht und ihn gefragt, wie er denn heiße, wessen Sohn er sei und aus welcher Gegend er komme.
Die Runde brummt und nickt und hört artig zu, auch wenn jeder weiß, wie die Geschichte weitergeht. Schließlich sitzt der Alte bei ihnen, doch man ist sich nicht im Klaren darüber, ob er zuhört oder nicht. Ob im Oberstübchen überhaupt jemand zu Hause ist.
Er habe keine Antwort gegeben, doch den Schnaps habe er auf ex getrunken und – damit habe wirklich nicht gerechnet werden können – bezahlt! Dann seien die zwei Ordnungshüter gekommen, hätten sich vor ihm aufgebaut, und der Alte habe übers ganze Gesicht zu strahlen begonnen, habe ihnen die Hände geschüttelt, als würde er sie kennen. Sie habe geglaubt, er mache sich über die Polizisten lustig, doch es sei ihm keine Arglist anzusehen gewesen.
Die Männer am Stammtisch schütteln ungläubig die Köpfe. Arglist ist heutzutage leider fast selbstverständlich.
Am nächsten Tag sei er wieder gekommen, kaum dass sie die Kneipe geöffnet habe, erzählt Helga weiter. Sie habe den Deutschen gewähren lassen, habe ihm Schnaps serviert, ohne dass er danach gefragt hätte. Und er habe bezahlt. Viel zu viel, sodass sie im Laufe des Nachmittags zweimal nachgefüllt habe, bis der Geldschein vollends verflüssigt gewesen sei.
Er wäre nicht der Erste, den du abgefüllt hast!, sagt einer, und die Runde lacht donnernd über diesen gelungenen Scherz.
Was soll ich denn sonst mit euch anstellen!, wehrt sich Helga und lacht mit, zeigt unbekümmert ihre Lücken im Gebiss.
Eins muss man den Stammtischgenossen lassen: Unter Säufern gibt es keine Fremden. Seit seinem Auftauchen setzen sie sich zum Deutschen, als habe er schon immer dazugehört. Er stört sie nicht. Er stört niemanden.
Der Deutsche spricht indes noch immer kaum. An guten Tagen murmelt er. Er scheint seinen Stammtischbrüdern auch nicht zuzuhören, scheint einzig seinen Stimmen im Kopf Antwort zu geben. Wenn ihn einer der Männer etwas fragt oder in eine Diskussion über das Sauwetter oder die Touristenschwemme einzubinden versucht, reagiert er nicht, blickt höchstens kurz auf und lächelt freundlich. Trinkt seinen Schnaps. Im besten Fall nickt er – eine bessere Antwort ist von ihm nicht zu bekommen – und starrt durch alles hindurch, als sei er Welten entfernt. Doch manchmal scheint er das hochprozentige Gesöff nicht zu vertragen (Helga vermutet Medikamente), und dann poltert er:
Verfluchter Faschist! Und aus seinen Knöcheln weicht alles Blut. Du verfluchter Faschist! Tränen rollen ihm über die Wangen und tropfen auf seine Fäuste. Dann klopft ihm jeweils einer seiner Sitznachbarn beruhigend auf die Schulter und sagt:
Jetzt beruhig dich, Alter, hier gibts keine Faschisten, hier gibts nur Dummschwätzer und Landstreicher.
Und Kommunisten!, ruft ein anderer, und man lacht und bestellt und spricht über die Alliierten und über die deutschen Weiber, die man damals nach Island verschifft hatte, und später – die Tür ist inzwischen verschlossen und einige Stühle sind bereits auf den Tischen – setzt sich Helga wieder in die Runde, und die Augen der Männer werden wässrig beim Gedanken an die verpasste Jugend auf dem Meer, an die verlorenen Kameraden, die bei Sturm und Tragödie draußen geblieben waren, und es wird geraucht und gesoffen und Schnupftabak die Nase hochgezogen, bis die Schnauzer schwarz sind und tropfen, und auch der Holzboden ist schwarz und klebrig vom verschütteten Bier, denn die Putzerei hat Helga schon lange aufgegeben.
Erstes Kapitel
In dem Heinrich Lieber eine Neuigkeit erfährt, aber andere Sorgen hat.
Die große Neuigkeit, die Überraschung des Jahres, haute Heinrich Lieber im ersten Moment kaum um, wühlte ihn auch nicht auf, wie man es sich vielleicht vorstellen würde. Kein Drama, keine Gefühlsausbrüche. Keine Tränen. Heinrich Lieber fragte sich sogar insgeheim, wie man sich überhaupt zu fühlen hatte, wenn man erfuhr, dass sich die totgeglaubte, leibliche Mutter in einem fernen Land aufhielt. Dass sie ein zweites Leben zu leben gewählt hatte – ohne Mann und Sohn – und logischerweise nicht gefunden werden wollte. Er war weder erfreut noch wütend. Das alles ließ ihn kalt. Es war fast so, als hätte er es schon immer gewusst, als hätte er so eine Nachricht erwartet.
Schön für sie, dachte Heinrich Lieber. Soll sie doch in Island leben. Er verspürte nicht das geringste Bedürfnis, sich bei ihr zu melden, sie zu konfrontieren oder gar zu besuchen und in die Arme zu schließen oder so was. Sie hätte sich schließlich während all der Jahre bei ihm melden können – was sie aber nie getan hatte. Sie musste ihre guten Gründe dafür gehabt haben. Nicht wahr?
Es tut uns leid, dass wir es dir nicht früher gesagt haben, beteuerte sein Vater. Aber du weißt ja…
Heinrich nickte, die Stirn in Falten gelegt, schien tief in Gedanken versunken. Ansonsten blieb er völlig reglos, saß einsam auf der weißledernen Vierercouch, ganz in der Mitte, knetete die Hände unauffällig im Schoß, als bereite er sich auf einen Boxkampf vor, wobei er keine fünf Sekunden im Ring überstanden hätte. Heinrich war zwar hochgewachsen, dafür hager und unsportlich. Ein Bürogummi eben. Seine Hände hatten – es war ihnen anzusehen – noch nie zupacken müssen. Selbst seine Brille schien viel zu groß und zu schwer für sein hohlwangiges Gesicht. Von Zeit zu Zeit schubste er sie sich mit dem Zeigefinger aufs Nasenbein zurück und dachte angestrengt nach.
Und wieso habt ihr es mir nicht früher gesagt?, fragte er unerwartet barsch, sodass seine Eltern besorgte Blicke austauschten.
Heinrichs Vater, Robert Lieber, saß auf seiner neuesten Anschaffung: einem Massagestuhl, wie man ihn in den späten Achtzigern einfach haben musste, wusste man das Leben zu genießen. Den dröhnenden Rückenvibrator hatte er rücksichtsvoll ausgeschaltet, als er seinem Sohn das gutbehütete Familiengeheimnis anvertraute. Sein Gewicht drückte ihn schwer aufs Leder. Er war ein Genießer, er liebte gutes Essen und gönnte sich abends jeweils einen Whisky, gelegentlich auch mal eine Zigarre. Trotz seines Alters und seiner Laster war er erstaunlich mobil und aktiv, spielte Golf, unternahm Wanderungen und ging dreimal wöchentlich in Bad Ragaz schwimmen. Er erzählte jedem, dass sein Arzt (auch ein passionierter Golfer übrigens) befürchtete, dass er, ganz zum Leide der Menschheit, noch hundert Jahre alt werden würde. Hahaha!
Heinrichs Stiefmutter, Vreni Lieber-Danuser, saß wie immer steif und aufrecht auf einem schlichten Küchenstuhl, bereit aufzuspringen, um »ihre Buben« zu bedienen. Sie war zwar einige Jahre jünger als Robert, jedoch gesundheitlich nicht ganz so in Schuss wie er. Sie musste die nicht ernst gemeinten Befürchtungen des Arztes geteilt haben, schließlich hatte sie dafür zu sorgen, dass ihr Mann bis zu seinem hundertsten Lebensjahr ordentlich zu futtern und immer saubere Wäsche hatte. Ein Amt, das sie noch zur Strecke bringen würde. Sie hätte sich gern neben Heinrich auf die Couch gesetzt, hätte seine Hand halten wollen, um ihm zu verstehen zu geben, dass sie immer Muttergefühle für ihn empfunden hatte und noch immer empfand. Doch sie vertrug das weiche Polster ihres Rückens wegen nicht.
So saßen sie Heinrich wie bei einem Vorstellungsgespräch gegenüber. Seine Augen hinter den dicken Brillengläsern flackerten unruhig hin und her, von der Mutter zum Vater zur Tür. Das lichte Haar hatte er flüchtig über die Stirnglatze gescheitelt, er war völlig geschlaucht nach einem mörderischen Arbeitstag im Büro und eigentlich nicht in der Stimmung für solche Gutenachtgeschichten.
Wir wollten es dir sagen, als du sechzehn warst, beteuerte seine Mutter.
Aber dann fanden wir einfach nicht die Gelegenheit dazu, ergänzte sein Vater, und Vreni übernahm erneut das Wort:
Wir dachten, dass es dich nur belasten würde, du hattest es so schwer in der Kantonsschule. Das weißt du doch am besten. Das war ein richtiger Krampf.
Aha. Man war also selbst schuld. Heinrich schüttelte verständnislos den Kopf, suchte nach Worten, fragte sich, wieso heute? Wieso gerade an diesem 3. Juni 1988, vierzig Jahre nachdem er, Heinrich Lieber, geboren worden war? Wird man denn nicht üblicherweise schon in Teenagerjahren über den Verbleib eines unbekannten Elternteils informiert? Mit vierzehn beispielsweise, bei eintretender Strafmündigkeit, oder mit sechzehn, wenn man alt genug ist, um ein anständiges Mofa zu fahren?
Aber warum gerade jetzt?, fragte er. Warum gerade heute? Wieso ruft ihr mich bei der Arbeit an? Ich dachte schon, es sei etwas passiert! Wieso konnte es denn nicht bis zum Wochenende warten? Es hat schließlich vierzig Jahre gedauert, bis ihr mich eingeweiht habt!
Deine Mutter ist vor wenigen Tagen gestorben, sagte Vreni umstandslos, duckte sich unmerklich und warf ihrem Mann einen Blick zu. Der erwiderte ihn mit einem zusichernden Nicken, hob die Hand, als gebiete er um Ruhe, setzte sich ächzend auf die Vorderkante des Massagestuhles, was einen Moment dauerte, denn auf dem verflixten Leder rutschte man immer wieder zurück.
Jetzt bleiben wir alle mal schön ruhig, sagte er. Nur kein Drama. Deine Mutter ist gestorben, Heinrich. Das tut uns natürlich leid, aber, was soll ich sagen – ich habe die Nachricht heute Morgen von Charlotte erhalten.
Und wer, bitte, ist Charlotte?
Charlotte? Verzeihung, sie ist die Schwester deiner Mutter, also deine Tante. Sie ist in den Fünfzigern nach Paris ausgewandert, hat da einen Franzmann geheiratet, der ist aber schon vor einigen Jahren gestorben, soviel ich weiß …
Heinrich schüttelte verwirrt den Kopf.
Jetzt aber mal stopp!, sagte er. Meine Mutter hatte eine Schwester? Ich dachte, ihre ganze Familie sei im Krieg ums Leben gekommen.
Sein Vater nickte.
Aber ja doch. Bis auf diese eine Schwester eben. Charlotte.
Und die lebt noch?
Oh ja. Die lebt noch.
Heinrich biss sich auf die Lippen. Nun stieg doch etwas Hitze in ihm auf, etwas brodelte in ihm. Binnen weniger Minuten war seine totgeglaubte Mutter zum Leben erweckt worden – und sogleich wieder gestorben. Dafür hatte er jetzt eine Tante namens Charlotte, und die lebte in Paris.
Na prächtig!, sagte er trocken. Und du hast mir immer erzählt, dass meine Mutter damals in der Nervenklinik –
Und das ist sie auch!, fiel ihm sein Vater ins Wort, besann sich, seufzte müde und zuckte schließlich mit den Schultern. Dachte ich jedenfalls. Sie war ja plötzlich nicht mehr da. Ich erfuhr erst Jahre später, dass sie das Land verlassen hatte. Bis dahin war ich überzeugt gewesen, sie sei aus der Nervenklinik ausgebüxt und hätte sich in die Warnow gestürzt. Herrgott noch mal, sie wäre nicht die Einzige gewesen, damals! Manche wollten einfach nicht mehr weiterleben, verstehst du? Wir hatten alles verloren, alles …
Wie gut hast du sie eigentlich gekannt? Ich meine, seid ihr lange zusammen gewesen?
Wir haben kurz nach Kriegsbeginn geheiratet, uns während der Kriegsjahre aber kaum gesehen, weil ich doch 1940 in Gefangenschaft geriet, und –
Verheiratet?, unterbrach ihn Heinrich. Ihr wart verheiratet? Davon höre ich auch zum ersten Mal! Er schaute Vreni fragend an. Die zupfte verlegen an ihrem Kleid und murmelte:
Das braucht man nun gewiss nicht an die große Glocke zu hängen. Das ist ja ewig her.
Wie gesagt, beschwichtigte Robert, wir hatten uns während der Kriegsjahre kaum gesehen. Deine Mutter hatte Schreckliches erlebt, war arg bedrückt, und darum …
Bedrückt?
Na, Depressionen, Kriegstrauma oder wie man das heute nennt.
Aber der Krieg war doch zu Ende!
Zu Ende? Deutschland ist noch immer besetzt. Robert wirkte verärgert, verwarf die Hände, als mochte er nicht länger darüber sprechen. Vreni mischte sich wieder ein:
Wir hatten so ein Glück, hier in der Schweiz. Wie schrecklich das damals war, können wir uns gar nicht vorstellen.
Nein, könnt ihr nicht, bestätigte Robert, machte ein mürrisches Gesicht und suchte nach Worten. Ihre Schwester in Paris sagte mir erst viel später, dass deine Mutter nach Island ausgewandert war, aber zu dem Zeitpunkt war ich schon längst mit dir in die Schweiz gezogen und hatte meine Alpenblume geheiratet, und wir fanden, dass du bei uns am besten aufgehoben wärst, verstehst du, und dass wir die Vergangenheit begraben sollten. So.
Heinrichs Eltern blickten sich erleichtert an. Als wollte Robert einen Schlussstrich unter die leidige Diskussion ziehen, rutschte er ins Polster des Massagestuhls zurück und drückte den Vibrationsknopf. Ein tiefes Brummen erfüllte den Raum. Die Porzellantassen auf dem Glastischchen summten mit. Vreni verdrehte die Augen.
Du kannst es einfach nicht lassen, sagte sie. Muss das jetzt sein?
Ihr Mann seufzte betont genussvoll. Heinrich überlegte, seit wann er seinen Vater nicht mehr leiden konnte.
Eine Frage habe ich noch, sagte er, fast wie ein Fernsehkommissar. Sein Vater stellte den Motor ab und reckte aufmerksam den Hals.
Wo und wann soll meine Mutter denn beigesetzt werden?
Das ist sie wahrscheinlich schon, antwortete sein Vater. In Reykjavík, nehme ich an. Das ist die Hauptstadt Islands. 95000 Einwohner. Er deutete auf sein geliebtes Lexikon, das stets griffbereit auf dem Glastischchen lag. Soviel ich weiß, hat deine Mutter die Insel nie wieder verlassen.
Niemand hat von dir erwartet, dass du bei der Beerdigung erscheinst, beruhigte ihn seine Mutter.
Heinrich nickte, als gäbe er sich mit der Antwort zufrieden. Er schaute flüchtig auf seine silberne Digital-Armbanduhr und ließ die Hände auf seine Oberschenkel klatschen.
Ich muss dann mal weiter, sagte er. Katrin macht sich sonst noch Sorgen.
Du bist uns nicht böse, dass wir es dir erst jetzt gesagt haben?, fragte ihn seine Mutter scheinbar beiläufig.
Sie richtete sich auf, stellte sich Heinrich gegenüber und zupfte sein marineblaues Hemd zurecht, das am Ende eines Arbeitstages stets etwas unordentlich war.
Ist schon in Ordnung, sagte Heinrich und ließ sich zu einer kurzen Umarmung hinreißen. Es ändert sich ja nichts.
Seine Mutter lächelte beruhigt, sagte gespielt trotzig:
Richtig! Es ändert sich nichts. Ich bin deine Mutter! Ich habe dich erzogen. Du gehörst mir!
Sie war eine feine, hübsche Frau, und Heinrich wurde sich einmal mehr bewusst, warum er ihr nicht im Geringsten ähnlich sah. Sie strich ihm über die hängenden Arme, hatte Tränen in den Augen. Heinrich wollte gehen.
Wir sind sehr froh, dass du unsere Situation begreifst, sagte Robert, und Vreni wiederholte:
Du bist unser Sohn!
Ich weiß. Ich weiß. Heinrich warf sich die Jacke über und flüchtete zum Ausgang.
Bist du mit einem interessanten Projekt beschäftigt?, fragte ihn sein Vater, als er Heinrich die Hand zum Abschied schüttelte.
Nichts Besonderes, entgegnete dieser.
Hast du das von dieser Bauhalle in Thusis gehört?
Heinrich presste die Lippen zusammen und nickte.
Hab ich.
Schrecklich!, sagte seine Mutter und schüttelte betroffen den Kopf, froh darüber, das leidige Island-Thema abgeschlossen zu haben.
Weißt du, wer –
Ich muss jetzt wirklich los, fiel ihr Heinrich ins Wort. Ich habe keine Ahnung, wer da Mist gebaut hat.
Es war die ganze Woche schwül gewesen. Eine geradezu tropische Frühsommerhitze war vom Tessin über die Alpen gekrochen, hatte sich in den Tälern der Alpennordseite eingenistet und unter den Kleidern der Büroangestellten verfangen, sodass der Schweiß durch ihre Hemden drückte und auf der Brust, am Rücken und vor allem unter den Armen dunkle, runde Flecken hinterließ. Am späten Nachmittag hatten heftige Regenschauer die Alpentäler urplötzlich abgekühlt und die Wildbäche aus dem verfrühten Sommerschlaf geweckt. Das Wasser des Rheins war an manchen Stellen über die Ufer getreten. Es würde noch für mehrere apokalyptische Stunden sintflutartig regnen. Neben Baumstämmen und allerhand Abfall würden sich im Treibgutrechen des Kraftwerkes Reichenau zwei tote Kühe verfangen, was landesweit Schlagzeilen machen würde.
Heinrich schaltete die Scheinwerfer ein und drosselte das Tempo. Dicke, schwere Regentropfen zerplatzten lautauf der Windschutzscheibe. Wer bei dem Wetter hetzte, landete nur früher im Straßengraben. Heinrich war kein unbedachter Mensch. Doch jetzt schlug er die Hände aufs Steuerrad, verlor geradezu die Beherrschung, was so gar nicht seine Art war.
So ein Mist!, zischte er. Diese Dilettanten! Was kann ich denn dafür, dass dieser Vollidiot von Eigentümer zweihundert Tonnen am Dach aufhängt!
Eine Sache kümmerte Heinrich Lieber weit mehr als die Neuigkeiten aus Island. Und er erinnerte sich mindestens viermal stündlich daran: Eines seiner Gebäude war eingestürzt. Da gelang es selbst einer verschollen geglaubten, frisch verstorbenen Mutter nicht, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Das Dach und ein Teil einer Baugeschäft-Lagerhalle waren im späten April eingestürzt, als es noch einmal so richtig geschneit hatte, schweren, nassen Schnee mit kaltem Regen obendrauf; ein verheerender Cocktail. Es hatte geschneit bis auf 500 Meter hinunter, ganze Bäume, die schon in der Blüte waren, waren unter dem Gewicht einfach umgeknickt, der Schaden der Obstbauern war immens. Der Frühsommer 1988 sollte noch als Katastrophensommer in die Bündner Geschichtsbücher eingehen. Der Eigentümer der Lagerhalle musste so einiges an der Dachkonstruktion aufgehängt haben, Gestelle für Metall- und Betonrohre, was das Gebäude schließlich zum Einsturz gebracht haben musste. Zwei portugiesische Saisonarbeiter, zwei Brüder wohlgemerkt, als wäre es nicht tragisch genug gewesen, kamen dabei ums Leben, begraben unter Zementsäcken, Stahl und Schnee. Seite an Seite, ineinander verschlungen, als hätten sie sich gegenseitig beschützen wollen. Heinrich hatte die Fotos der Brüder gesehen und würde die Bilder in seinem Kopf nie wieder loswerden. In regelmäßigem Abstand flackerten sie vor seinem inneren Auge auf. Wie chronisches Magenbrennen. Doch hier half kein Medikament. Eine Zumutung überhaupt, dass ihm die Polizisten die Fotos unter die Nase gehalten hatten. Sie hatten sich wahrscheinlich erhofft, dass er weinend und um Vergebung bittend zusammenbrechen und Fehler eingestehen würde. Fall abgeschlossen. Denn er, Heinrich Lieber, der verantwortliche Ingenieur, soll Mist gebaut haben.
Doch Heinrich Lieber war nicht zusammengebrochen. Er hatte keinen Mist gebaut. Als die Beamten der Kantonspolizei wieder abmarschiert waren, hatte er sich auf die Toilette geschlichen und übergeben. Und kaum wieder am Bürotisch, bleich und beduselt, hatte zu allem Übel seine Frau angerufen und ihn gebeten, beim Metzger einen Schweinsbraten zu kaufen, was er dann prompt vergaß. Und am Abend hatten sie Streit.
Der Untersuchungsrichter hatte kurz nach dem Unglück vor den Medien eingeräumt, dass die Tragkonstruktion auf den ersten Blick nicht zu schwach dimensioniert gewesen war, doch irgendeinen Grund müsse es schließlich für die Katastrophe geben. Klar, die Schneemenge sei ungewöhnlich groß gewesen, aber schließlich habe auch auf anderen Dächern Schnee gelegen. Deshalb habe er, der Untersuchungsrichter, ein unabhängiges Ingenieurbüro damit beauftragt, eine Expertise zu erstellen.
Alles kracht irgendwann zusammen, hatte schon Professor Kurath seinerzeit an der Hochschule gepredigt. Die Kunst, so Kurath mit erhobenem Zeigefinger, bestehe darin, ein Gebäude abzureißen oder zu sanieren, bevor es den Gegebenheiten der Physik, den Naturgewalten, Erdbeben, Schneelasten, Fallböen oder dem inneren Zerfall, chemischen Reaktionen, Korrosion et cetera nicht mehr standhalten könne. Professor Kurath war ganz versessen auf die Physik, sie war seine Religion, seine Philosophie, und darum erwähnte er bei jeder Gelegenheit den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Nun erinnerte sich Heinrich daran. Vielleicht war dieser Zweite Hauptsatz zum Zuge gekommen. Ganz spontan, explosionsartig fast, so macht es den Anschein, wird Energie freigesetzt, Energie, die für einige Zeit zurückgehalten werden konnte, wie die Luft in einem Ballon, die entweicht, sobald sie die Möglichkeit dazu bekommt. Der Stich einer Nadel, der das Gebäude zu Fall bringt. Ein Objekt fällt in sich zusammen, sobald es kann. Deshalb funktioniert, ja existiert, unser Universum. Deshalb geschehen Dinge, fallen Dinge. Entropie. Maß für Unordnung. Eine Einheit für Chaos. Nichts Ungewöhnliches. Die Masse eines Planeten verdichtet sich ständig, bis es schließlich knallt. Es gibt nichts, das man dagegen tun könnte. Die Menschheit wird aussterben, und kein Hahn wird nach ihr krähen. Wie tröstend.
Heinrich Lieber versuchte sich einzureden, dass die unabhängige Expertise zu Tage bringen würde, dass der Eigentümer der Lagerhalle die Dachkonstruktion völlig überbelastet hatte – etwas anderes kam gar nicht infrage. Und überhaupt, wer machte eigentlich die Expertise? Adrian Brändli, wie man munkelte. Gut so, dachte Heinrich und beruhigte sich allmählich. Denn Brändli kannte er noch von früher. Der wusste nur zu gut, dass Lieber keine Fehler unterliefen.
Heinrich auf der Überholspur. Die Scheibenwischer liefen auf höchster Stufe. Die Autobahn war ein Fluss, die Reifen preschten wie Schnellboote durchs Regenwasser, sodass Heinrich den Autos, die er überholte, eine Dusche verabreichte. Wasser oben und unten und zu allen Seiten. Er war spät dran. Katrin, seine Frau, würde sauer sein, denn sie wollte doch wie immer zum Frauentreff, und Heinrich hatte auf die Kinder aufzupassen. Sie brauchte das Auto. Kam er zu spät, kam sie zu spät. Aber schließlich wollte sie kein Zweitauto. Wegen der Abgase. Wegen des Waldsterbens. Dabei könnten sie sich eins leisten.
Zum Kuckuck mit dem Waldsterben, murmelte Heinrich. Doch diesmal wollte er sich von seiner Frau keine Vorwürfe machen lassen. Für einmal durfte er aus gutem Grund zu spät nach Hause kommen. Man bekam ja nicht alle Tage eine solche Geschichte aufgetischt: eine frisch verstorbene Mutter. Wo bitte soll sie gelebt haben? In Island? Wieso nicht gleich in Sibirien! Huara Saich! An solchen Tagen hatte man das Recht, sich zu verspäten.
Heinrich geriet ins Grübeln und vergaß sogar die toten Portugiesen, wenn auch nur für einen Moment. Was sollte er bloß mit dieser Neuigkeit aus Island anfangen? Müsste er Trauer empfinden? Wohl kaum. Hatte er wütend zu sein? Eigentlich schon, schließlich hätte er seine Mutter unter diesen Umständen kennenlernen und sie zu ihrer Flucht aus Deutschland befragen können. Falls er denn gewollt hätte. Was vielleicht nicht der Fall gewesen wäre. Wieso auch. Brauchte man denn zwei Mütter? Eine genügte doch völlig. Besonders wenn man schon vierzig Jahre alt war.
Vierzig Jahre. Himmel. Die Jahre verpuffen wie Träume.
Heinrich strich sich die Haare über die Glatze, umfasste aber sogleich wieder mit beiden Händen das Steuer, denn das Regenwasser zog das Auto an den Straßenrand. Ein halbes Leben hatte er warten müssen, bis er erfahren durfte, dass seine Mutter nicht in einer Irrenanstalt in Deutschland zugrunde gegangen war. Wie alt war sie, als sie ihn geboren hatte? Wie alt war sie, als sie aus Deutschland geflohen war? Als sie starb? Wahrscheinlich in ihren frühen Siebzigern. War das nicht ein bisschen früh, um zu sterben? Hatte sie Krebs? Hatte sie die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und ihr Auto um einen Baum gewickelt? Gab es in Island überhaupt Bäume? Waldsterben? Hatte sie da oben einen Mann? Kinder?
Heinrich nahm den Fuß vom Gaspedal. Wieso hatte ihm sein Vater kaum etwas über die Mutter erzählt? Dieser Heimlichtuer!
Katrin wartete auf ihn vor der Einfahrt zum Einfamilienhaus, stand steif und senkrecht unter einem Schirm, ungeschminkt und in grünen Rübenhosen, die Haare offen. Das Grün passte gut zu ihren roten Haaren, doch die Hosen fand Heinrich abscheulich. Ihr Mund war zu einem Strich zusammengepresst, als hielte er tausend Vorwürfe wie wilde Pferde im Pferch. Früher, vor der ganzen Frauenbewegung, bevor Katrin Leserbriefe an Alice Schwarzer schickte, die er nicht lesen durfte, hatte sie ihm besser gefallen.
Wortlos nahm ihm Katrin den Autoschlüssel ab, überreichte ihm den Schirm, schaute ihn dabei nicht einmal richtig an, stieg ins Auto und fuhr davon. Heinrich schaute ihr zähneknirschend hinterher, den geblümten Schirm in der Hand. Sie bog rasant um die Kurve, sodass man befürchten musste, das Auto könnte ins Schleudern geraten. Heinrich schüttelte vorwurfsvoll den Kopf. Soll sie doch die Karre zu Schrott fahren! Dann hätten sie wenigstens einen Grund zum Streiten. Er schaute hoch in das von Regenwolken verschleierte Calanda-Massiv und hoffte, dass der Regen einen Brocken aus den Felsen spülen und auf ihn fallen lassen würde. Damit wäre alles auf einen Schlag erledigt. Finito. Was für eine Erleichterung.
Dann ging Heinrich ins Haus.
Hallo!, rief er, erhielt aber keine Antwort. Aus dem Wohnzimmer dröhnte der Fernseher. Seine zwei Söhne Cristian und Stefan, sowie seine Jüngste, Judith, die schon ihr Alf-Pyjama angezogen hatte, saßen dichtgedrängt auf der Couch. Judith blickte kurz auf, lächelte unschuldig, denn sie wusste genau, dass sie sich Das A-Team nicht anschauen durfte.
Komm, kleine Maus. Jetzt aber wie der Blitz!, sagte Heinrich. Du müsstest schon längst im Bett sein. Hat dir Mama schon eine Geschichte vorgelesen?
Nein, sagte Judith.
Doch, hat sie, murmelte Stefan.
Judith boxte ihrem Bruder auf den Oberarm. Der tat, als hätte er es nicht bemerkt.
Hast du die Zähne schon geputzt?
Aah!, stöhnte sie, hüpfte von der Couch und rannte wie von der Tarantel gestochen an Heinrich vorbei ins Badezimmer. Als er zu ihr ins Badezimmer wollte, um ihr die Zähne zu putzen, versperrte sie ihm den Weg. Zoll bezahlen!
Heinrich im Keller mit seiner Modelleisenbahn. Er ließ sein Krokodil Ce 6/8 Runden drehen. Drei Personenwagen in der Originalfarbe Grün hatte er ihm angehängt, doch der Zug brauste, ohne anzuhalten, durch den Bahnhof, vorbei am Emmentaler Bauernhaus mit den grasenden Kühen, tief hinein in die Berge mit dem Sessellift, durch den Tunnel, über die Brücke und hinaus aufs Flachland. Und wieder durch denselben Bahnhof.
Heinrich Lieber war kein Vitrinensammler. Jede einzelne seiner Lokomotiven funktionierte einwandfrei und kam auch mindestens einmal pro Woche zum Einsatz. In dieser Miniaturwelt, Maßstab 1:87, fühlte er sich wohler als in der realen Welt. Hier unten hatte er seine Ruhe.
Stundenlang konnte er die Lokomotiven putzen, ölen und an den Modellhäusern herumbasteln. Mindestens zweimal im Jahr besuchte er Modelleisenbahnbörsen, manchmal bis hinauf nach Deutschland oder rüber nach Österreich, begutachtete, diskutierte, verhandelte, fachsimpelte, lachte. Heinrich unter seinesgleichen. Männer unter sich. Lokführer, Maschinenbautechniker, aber auch Lehrer, Ärzte, ja sogar Offiziere und Politiker.
Die Kinder durften mit der Eisenbahn nicht spielen, selbst Berühren war verboten, was auch deutlich auf einem Schild zu lesen war, das Heinrich am Tischrand angebracht hatte. Kinder konnten die Philosophie einer Modelleisenbahn nicht erfassen. Sie war nämlich kein Spielzeug. Die ganze Anlage war eine funktionierende, friedvolle Welt, wo es nur einen Schöpfer gab. Nur seiner Tochter gewährte Heinrich regelmäßig Zutritt, hob sie auf seinen Schoß, setzte ihr die Lokführermütze auf und stellte die Weichen nach ihren Wünschen. Und sie jauchzte und blies die Trillerpfeife, wenn der Zug im Bahnhof einfuhr oder wenn er wieder abzufahren hatte.
Wenn ich groß bin, werde ich Lokomotivführerin!, verkündete sie dann, was ihren Vater zwar stolz machte, aber zu dem Hinweis veranlasste, dass sie die erste Frau wäre, die eine Lok fahren würde. Doch Kondukteurin könne sie werden. Das sei realistisch.
Heinrich im Badezimmer. Er betrachtete sich im Spiegel und glättete mit der Hand seine Haare über die sich breitmachende Stirnglatze, die man noch vor einigen Jahren wohlwollend als Geheimratsecken hatte bezeichnen können. Jetzt ergraute sein verbliebenes Haar. Nach vierzig Jahren bleichte es aus, verdorrte im gleißenden Licht der Bürolampe.
Lasst mich jetzt nicht auch noch im Stich, murmelte er.
Heinrich in der Küche. Ein Butterbrot, ein Stück Käse und ein Glas Milch reichten ihm. Kalte Fischstäbchen mochte er nicht. Er aß im Stehen und blickte nach draußen. Endlich ließ der Regen nach, die Wolken brachen auf, doch es wurde Nacht, und der Abendstern funkelte schon. Nur über dem Bannwald schimmerte noch ein wenig Tageslicht. Umso bedrohlicher wirkte der Gebirgsstock mit den Schotterhängen und den hausgroßen Felsblöcken, die darin zum Stehen gekommen waren. Heinrich fragte sich, ob es eine gute Idee gewesen war, ins Felsberger Altdorf zu ziehen. Ihr Haus grenzte direkt an die Gefahrenzone. Wer sagt denn, dass die Geologen auf den Meter genau berechnen können, wo die Felsbrocken zu liegen kommen, wenn sie denn herabstürzen? Schließlich zerfällt alles irgendwann, selbst Berge. Jeder fällt. Schwerkraft. Grundlegende Physik. Das Bild der zwei Portugiesen blitzte auf. Ihre Innereien waren außen. Heinrich warf das Butterbrot in den Kompost.
Heinrich in der Stube. Seine zwei Buben hockten noch immer wie hypnotisiert vor dem Fernseher.
Was guckt ihr euch da an?, fragte Heinrich und stemmte die Arme in die Seiten. Ein Auto überschlug sich.
Einen Film, sagte Stefan.
Einen Krimi?
Stefan seufzte. Ein Mann kroch schwer lädiert aus dem zerbeulten Auto, das auf dem Dach zu liegen gekommen war.
Ist es nicht langsam an der Zeit, Jungs?, sagte Heinrich. Ein Mann mit Schnäuzer und Sonnenbrille trat zum Verletzten am Boden, zückte einen großkalibrigen Revolver, richtete ihn direkt auf die Kamera und damit auf die Zuschauer vor dem Fernseher und sagte:
Gute Reise, Arschloch.
Die zwei Buben starrten regungslos auf den Bildschirm. Der Mann mit dem Revolver drückte ab, Blut spritzte auf seine Sonnenbrille.
Geil!, sagte Stefan. Cris nickte zustimmend.
Das ist aber ein bisschen brutal, findet ihr nicht?, sagte Heinrich und blieb noch einen Moment stehen. Schon ein bisschen brutal, oder? Also gut, noch zehn Minuten, okay?
Heinrich im Schlafzimmer. Er zog seine Armbanduhr und seine Kleider aus, faltete sie und legte sie auf den Stuhl am Bettende, die Uhr obendrauf. Der Schlafanzug lag zusammengefaltet auf dem Bett. Heinrich zog ihn an, legte sich hin und starrte an die Decke. Er setzte sich wieder auf, stellte den Wecker auf sechs Uhr fünfzehn, kroch unter die Bettdecke, starrte auf die Uhr, löschte das Licht, hörte das dumpfe Geballere aus dem Wohnzimmer. Er seufzte.
Es klopfte leise an der Tür. Sie öffnete sich einen Spalt breit.
Papa, ich kann nicht schlafen.
Heinrich knipste die Nachttischlampe an, warf die Decke beiseite, nahm seine Tochter bei der Hand und führte sie in ihr Zimmer.
Ich komme gleich. Überleg dir schon mal ein Lied. Dann ging er ins Wohnzimmer und sagte: Stellt den Fernseher jetzt ab!
Seine zwei Söhne reagierten nicht, glotzten nur gebannt auf den Bildschirm. Heinrich drehte sich um, holte weit aus und schlug die Faust auf den An-Aus-Schalter des Fernsehers. Der Kasten gab einen letzten Pieps von sich, dann wurde der Bildschirm schwarz, doch Heinrich schlug erneut zu, noch einmal und noch einmal, drosch wild geworden auf das Fernsehgerät ein, sodass die ganze Wohnwand bedenklich wackelte. Seine Söhne saßen mit weit aufgerissenen Augen steif und aufrecht auf der Couch. Heinrich fasste sich, ließ vom Fernseher ab und drehte sich um.
Jetzt aber dalli!, zischte er, der Speichel spritzte, und er jagte seine beiden Söhne mit einer drohenden Armbewegung aus dem Wohnzimmer. Er hatte sich noch nie so vergessen, weshalb die Wirkung groß war. Die zwei Buben machten einen Bogen um ihn und flüchteten Hals über Kopf ins Badezimmer. Eigentlich war Katrin fürs Schimpfen zuständig. Heinrich fragte sich, ob er dem Fernseher den Garaus gemacht hatte. Er stellte ihn an, und als der Mann mit Schnäuzer und Sonnenbrille auf der Bildfläche erschien, stellte er ihn erleichtert wieder aus.
Judith hatte den Radau gehört und sich ängstlich unter die Bettdecke zwischen ihren Plüschtieren verkrochen. Nur ihre Nasenspitze und ihre Augen lugten hervor. Heinrich setzte sich zu ihr an den Bettrand und sagte, so sanft er nur konnte:
Hast du ein Lied ausgewählt?
Wann kommt Mama?
Heinrich seufzte und rieb sich mit der Hand übers Gesicht.
Sie ist noch im Frauentreff. Sie kommt ganz spät nach Hause. Heute bringe ich dich ins Bett.
Aber muss sie nicht auch schlafen?
Die Erwachsenen müssen nicht so lange schlafen wie kleine Kinder.
Aber du gehst doch auch schon schlafen?
Ja, schon, ich bin auch sehr müde. Ich muss sehr früh wieder aufstehen. Weißt du, Mama hat es bestimmt lustig im Frauentreff. Heinrich strich ihr mit der Hand übers Haar. Judith schaute ihn traurig an.
Bin ich noch ein kleines Kind?
Heinrich lächelte.
Du bist längst nicht mehr so klein, wie du noch vor zwei Jahren warst. Wirst immer größer, mit jedem Tag, und bald brauchst du sogar ein größeres Bett!
Seine Tochter lächelte stolz und strampelte mit den Beinen. Heinrich fuhr fort:
Und weißt du, wann man am meisten wächst?
Judith schüttelte neugierig den Kopf.
Wenn man schläft, sagte Heinrich. Judith runzelte die Stirn, machte aber bald artig die Augen zu. Heinrich setzte sich auf den Boden, mit dem Rücken an ihr Bett gelehnt und blieb bei ihr sitzen, bis sie einschlief. Draußen war es ganz dunkel geworden. Heinrich blieb bei seiner Tochter, bis ihm die Gedanken ausgegangen waren – und noch länger. Er blieb sitzen, bis er seine Frau nach Hause kommen hörte. Sie warf einen Blick ins Zimmer, und Heinrich war dankbar, dass sie ihn kurz anlächelte. Als sie sich über Judith beugte und sie besser zudeckte, richtete sich Heinrich stöhnend auf, ging zurück ins Schlafzimmer und kroch unter die Bettdecke. Er war müde, wollte schlafen, doch sobald er die Augen schloss, ging das Theater los.
1. Akt. Die portugiesischen Brüder stapelten PVC-Kanalisationsrohre, Durchmesser 12.5 Zentimeter, unterhielten sich, sprachen über ihr Elternhaus an der Algarve, das sie nächsten Winter gründlich zu renovieren gedachten. Sie lästerten über den Chef, die Kälte und überhaupt, Schnee im April, als ein haarsträubendes Bersten durch die Lagerhalle fuhr. Die zwei Brüder ließen vor Schreck die Rohre fallen und sahen, wie vor ihnen Metallträger, Wellblech und Schnee auf den Boden prasselten. Die Halle ächzte verzweifelt, der Boden zitterte, Scheiben zersplitterten, die Brüder schauten sich kurz an, drehten sich dann auf den Absätzen um und wollten rennen, da stoppte eine Metallstange den einen, fällte ihn. Sein Bruder kniete sich neben ihn, wollte ihm auf die Beine helfen …
Sie waren chancenlos. Sie rochen noch den kalten Betonboden und wurden von Zementsäcken und Beton-Rohrelementen, Durchmesser 60 Zentimeter, begraben.
Dann wurde es still. Der Eigentümer, ein glatzköpfiger, verkaterter Bierwanst, kam eine halbe Stunde später angewatschelt und donnerte:
Ich möchte nicht in der Haut dieses verdammten Ingenieurs stecken!
Heinrich drehte sich auf die Seite. Katrin machte in der Küche den Abwasch.
2. Akt. Die Frauen saßen am Stammtisch. Einige rauchten, man trank auch mal Bier – aber »man« sollte man nicht sagen! »Frau« lachte laut und störte sich nicht an den Blicken der alteingesessenen Herren in der gegenüberliegenden Ecke der Wirtsstube. Egal.
Ich hatte schon seit einem Monat keinen Sex mehr!
Die Runde wieherte. Arme Katrin!
Heinrich drehte sich auf den Bauch, gab einen Knurrlaut von sich und vergrub den Kopf unterm Kissen.
3. Akt. Behutsam ließen die Herren in schwarzen Anzügen den Sarg ins bodenlose Grab. Der Priester betete und zeichnete vor sich ein unsichtbares Kreuz. Unter den Trauergästen neigte sich ein Mann kaum merklich zur Seite und flüsterte seiner Nachbarin zu:
Wusstest du, dass sie in Deutschland eine Familie hatte? Mann und Sohn. Der Sohn hat keinen blassen Schimmer, dass hier seine Mutter begraben wird!
Nein, so was! Zu komisch.
Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Heinrich knipste die Nachttischlampe an und torkelte schlaftrunken ins Badezimmer. Katrin drehte sich murrend vom Licht weg und zog sich die Decke über den Kopf. Heinrich hatte sie gar nicht kommen hören. Er war also trotz des ganzen Theaters eingeschlafen. Er erleichterte sich sitzend, sein Gesicht in den Händen vergraben, spülte und trank einen Schluck direkt aus dem Wasserhahn, betrachtete sich düster im Spiegel. Halb wach, halb schlafend, unrasiert, fahl, eine üble Erscheinung durch und durch.
Wie sie wohl ausgesehen haben mag, fragte er sich. Hoffentlich nicht wie ich. Vielleicht habe ich dieses kleine Kinn von ihr, meine magere Gestalt oder wenigstens die Augenfarbe. Einfach abgehauen, murmelte er und schüttelte den Kopf. Nach Island abgesetzt. Heinrich schlurfte zurück ins Zimmer, hellwach. Er legte sich neben seine Frau, hörte sie flach atmen, sagte:
Bist du noch wach?
Als hätte sie die Frage verstanden, begann sie leise zu schnarchen. Er schloss die Augen, und das Theater ging von vorn los.