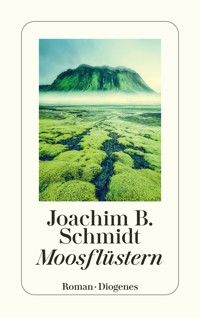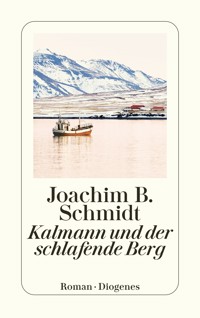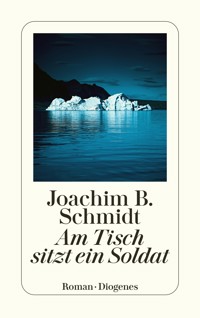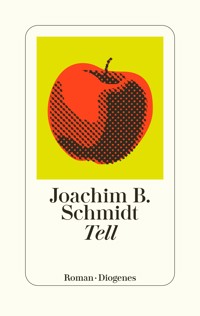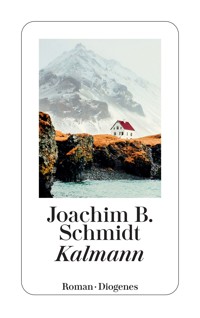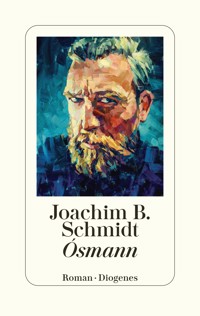
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der hohe Norden Islands um die Jahrhundertwende. Dort setzt Jón Magnússon Ósmann mit seiner Seilfähre Menschen, Tiere und Waren über die Gewässer des Skagafjords. Er ist ein Fischer und Robbenjäger, er sieht Geister und Elfen, er ist ein Menschenfreund, der Bedürftige verpflegt und beherbergt, und er ist ein gottesfürchtiger Trinker und Poet. Überlebensgroß, kräftig, gesellig und dabei versehrt vom eigenen Schicksal, sodass ihn die Fluten zu locken beginnen, die er über vierzig Jahre lang befahren hat. Eine lebenspralle und beinahe unglaubliche Geschichte nach einem wahren Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Joachim B. Schmidt
Ósmann
Roman
Diogenes
Für Ronny
Ós ['o:s] {m} – Flussmündung {f}
Dies ist eine wahre Geschichte. Jedoch, der Autor erlaubt sich erzählerische Freiheit. Es sei ihm erlaubt.
Prolog
Nackt steht Ósmann vor seiner Hütte, steht breitbeinig auf der Bühne seines Lebens, die Arme in die Hüften gestemmt, bärtig, kräftig, ja, ein schöner Mann. Vorhang auf für den Helden dieser Geschichte! Die Versuchung ist groß, ihn bis ins Detail zu beschreiben, ich will aber davon absehen, zumal es taktlos wäre. Denn ihm ist nicht bewusst, dass ich ihn beobachte. Lediglich den Grund seiner Nacktheit will ich erklären, noch ist Zeit dazu, noch hat er nicht bemerkt, dass eine Frau unten am sandigen Flussufer liegt, nackt auch sie, möglicherweise tot.
Ein neues Jahrhundert ist im Skagafjord angebrochen, kürzlich erst, doch die Hoffnungen auf bessere Zeiten, die so ein neues Jahrhundert mit sich zu bringen pflegt, sind groß. Ósmann hat 42 Winter überlebt, er steht mitten im Leben, würde man meinen, aber leider sind seine Jahre schon fast gezählt. Doch von seinem Ende will ich später berichten, muss ich berichten, im verzweifelten Versuch, seinem ganzen Leben gerecht zu werden und seinen Tod zu begreifen. Ja, vielleicht will ich versuchen, den Tod schlechthin zu verstehen. Der letzte Akt, das Ende, das bittere, ich will es hinauszögern, solange es mir möglich ist, bis der Vorhang fällt, unausweichlich, für uns alle.
Nun wird es ganz still im Theatersaal, und der nackte Mann auf der Bühne des Lebens schaut über die Köpfe hinweg, als nähme er sie nicht wahr, die Menschen in den Sitzreihen, die ihm während seiner Lebtage begegnet sind oder noch begegnen werden und nun gespannt darauf warten, dass der Fährmann sich regt, dass die Geschichte ihren Anfang nimmt.
1904
Es war ein windstiller Sommermorgen, der Himmel war gepolstert, das Licht matt. Ósmann stand nackt vor seiner Hütte an der Flussmündung der westlichen Bezirkswasser; dem West-Ós, so wird die Mündung genannt. Er wünschte seinen Nachbarn einen guten Morgen, dem nebelverhangenen Bergmassiv Tindastóll, der sagenumwobenen Insel Drangey weit draußen im Fjord, er grüßte die noch schlafenden Leute im jungen Handelsort Krók, am Ende des schwarzen, leicht geschwungenen Sanders, ein paar Meilen entfernt. Er grüßte die Eiderenten auf der Westbank und das träge dahinströmende Gletscherwasser, atmete tief ein, füllte seine Brust mit prickelnder Meeresluft, behielt sie eine Weile in den Lungen, prustete sie sodann aus sich heraus, er hustete laut und krachend, dass sich die Eiderenten erschrocken aufs Meer hinausflüchteten. Ósmann massierte sich die behaarte Brust, bis sich sein Husten endlich legte. Die Jahre des Trinkens und Rauchens und Schuftens machten sich bemerkbar, waren gekommen, um die Gebühr zu kassieren. Wohl darum stand er jetzt vor seiner Hütte, in aller Herrgottsfrühe, splitternackt, hustend und spuckend. Er würde seinen verkaterten Körper ins eiskalte Wasser des Ós tauchen, ein noch junges Ritual, es machte ihm keiner nach. Er würde ein paar Schritte in den Fluss machen, gemächlich, besonnen, bis ihm das Wasser an die Hüften reichte, würde dann die Luft ganz langsam aus den Lungen blasen und zugleich in die Knie gehen, den Blick konzentriert auf die gegenüberliegende Westbank gerichtet, bis sein Bart die Wasseroberfläche berühren würde. Er würde in der Hocke verharren, die Arme unter Wasser von sich gestreckt, unmerklich schwingend, wie die Flügel eines Seeadlers. Die anfänglich fast nicht zu ertragende Kälte würde langsam einem tauben Gefühl weichen, und sein Körper würde sich anfühlen, als läge er in der Umarmung sämtlicher Haupt- und Nebenarme der Bezirkswasser, der sich nicht aus der Umarmung lösen wollende Ós wollte ihn bei sich behalten, nicht hergeben, und der Gedanke war verlockend, sich hinzugeben. Die Haut gerötet, würde Ósmann schließlich zurück ans Ufer schreiten, bereit, den Tag zu bestreiten, bereit, die Reisenden in der Seilfähre über den Ós zu kurbeln.
Es hatte mit einer Erinnerung an die Sommertage seiner Kindheit begonnen, wie ihn sein Freund Oddvar im See ganz in der Nähe des elterlichen Bauernhofs schwimmen gelehrt hatte, wie kalt das Wasser gewesen war, eine Mutprobe allein, sich hineinzubegeben, ganz abgesehen davon, erste, ungeschickte Schwimmzüge zu wagen, nur um unterzugehen und sich japsend an die Wasseroberfläche zu strampeln. Seine Mutter hatte darauf bestanden, dass er schwimmen lernte, wie alle Kinder im Nes, ganz egal, wie kalt das Wasser war, sie mussten der Kunst des Schwimmens mächtig werden, wollten sie sich weiterhin am Seeufer herumtreiben, im Sommer zum Angeln oder im Winter zum Ballspiel auf dem Eis. Und Ósmann, nun erwachsen und verkatert, hatte sich plötzlich an damals erinnert, wie lebendig und daunenleicht er sich gefühlt hatte, als er nach ein paar energischen Schwimmzügen aus dem kalten Wasser gestiegen war, wie heiß seine Glieder plötzlich geworden waren, wie es ihm nichts ausgemacht hatte, splitternackt und kreischend über die Wiesen zu laufen und die Schafe und Uferschnepfen und Goldregenpfeifer und Ringelgänse zu verscheuchen, während ihm das Wasser des Sees noch immer aus dem nassen Haar über den Hals perlte. Er hatte geglaubt, abzuheben und fliegen zu können, wenn er nur schnell genug laufen und mit ausgestreckten Armen flügelschwingende Bewegungen machen würde!
Heute jedoch würde ihm das morgendliche Bad im Ós verwehrt bleiben, auch wenn er es nötig gehabt hätte. Sein Schädel pochte fürchterlich, aber nun, endlich, wurde Ósmann der leblosen Frau gewahr. Sie lag flussaufwärts einen Steinwurf von ihm entfernt, lag nackt am Flussufer, ein schneeweißer Körper im schwarzen Sand, in sich verschlungen, das Gesicht in den Armen vergraben, die langen braunen Haare um sich wie der Heiligenschein des Petrus auf der Altartafel in der kleinen Kirche von Ríp, einer dunklen Sonne gleich.
Es war Ende Juli, die Nächte waren wieder düsterer geworden, die Zugvögel verhielten sich nach gelungener Brutzeit nicht mehr ganz so übermütig. Noch genossen sie ein paar letzte Sommerwochen auf der Insel im Nordatlantik, um sich alsbald auf den langen Weg in den Süden zu machen.
Ósmann erschrak, als er die Frau endlich bemerkte, erstarrte und starrte auf den Körper im Sand. Unter der weißen Haut zeichneten sich die Rippen ab, das gekrümmte Rückgrat und die spitzen Hüftknochen, die Beine der Frau waren lang und mager und schlaff.
Es wäre nun wirklich nicht das erste Mal gewesen, dass Ósmann eine Leiche zu Gesicht bekommen hätte oder die nackte Haut einer Frau, dennoch fuhr ihm der Anblick bis ins Mark. Auch Geister waren hier draußen keine Seltenheit, sie waren meistens im Dämmerlicht der späten Herbsttage oder im Zwielicht bewölkter Sommernächte unterwegs, sie mochten das Halblicht, standen oder saßen am Flussufer, dem sie wahrscheinlich entstiegen waren, huschten an Ósmann vorbei, streiften ihn manchmal mit ihrer feuchten Kleidung und hauchten ihm kalten Atem in den Nacken, standen einige Schritte von ihm entfernt und starrten ihn mit leeren Blicken an. Was wollten sie von ihm? Manchmal spürte Ósmann ihre Anwesenheit, ohne sie sehen zu können, oder er bemerkte sie im Augenwinkel, nahm eine Bewegung wahr, doch wenn er sich umdrehte, waren sie meistens wie vom Erdboden verschluckt, waren davongehuscht, wie, tja, Geister eben. Und manchmal, wenn er sich im Halbschlaf auf seiner Schlafstätte herumwälzte, standen sie draußen vor der Hütte und starrten durch das kleine Fenster ins Innere.
Der tiefe, traumlose Schlaf, er war ihm während der letzten Jahre abhandengekommen. Oh, wie sehr vermisste er den unbedarften Schlaf der Jugend! Er wäre bereit gewesen, fünf oder sechs Forellen für eine einzige traumlose Nacht einzutauschen.
Die Frau zog die Beine an und grub die Finger ihrer linken Hand in den Sand – es war also keine Leiche, die da am Flussufer lag, kein Geist, nein, es war ein lebendiges Wesen, auch wenn das Lebendige lediglich an einem dünnen Faden zu hängen schien. Aber wieso war die Frau nackt? Hatte sie ihr Robbengewand abgelegt?
Ósmann löste sich aus seiner Starre und eilte zu ihr.
»Hollo!«, sagte er laut und etwas barsch, als er sich über sie beugte, sie an der Schulter berührte und sofort spürte, wie kalt und nass ihre Haut war, und wieder: »Hollo!« Aber die Frau reagierte nicht, also drehte er sie ein wenig zur Seite und hob den linken Arm von ihrem Gesicht, vielleicht würde er sie erkennen, aber er hatte sie noch nie gesehen, ganz bestimmt, denn wenn er ihr einmal begegnet wäre, hätte er sich an sie erinnert. Sie war nämlich wunderschön. Ihre Augen waren geschlossen, die Lippen dunkelblau, keine Reaktion, doch, jetzt, die Lippen! Sie hatten sich ein wenig bewegt. Ósmann beugte sich noch tiefer über sie, um zu verstehen, was die Frau zu sagen versuchte, aber er hörte nichts außer dem dumpf rauschenden Wasser der Flussmündung, den Vögeln und den Wellen draußen im Fjord.
»Es ist beschlossen, ich bringe dich an die Wärme«, sagte er, schob seine Arme unter ihren Körper und hob sie hoch. Die Frau war leicht, hing schlaff in seinen Armen, Beine und Kopf baumelten leblos, das braune Haar war so lang, dass es den Boden fast berührte, ein fürchterlich dramatisches, nahezu biblisches Bild. Wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass der Kunstmaler Sölvi Helgason mitsamt seiner Staffelei, seinen Bleistiften, Wasserfarben und Pinseln zur Stelle gewesen wäre, um dieses Bild einzufangen. Er hätte die beiden eng umschlungen in einem Meer aus Blumen gemalt, es wäre sein berühmtestes Werk geworden, zweifelsohne!
Aber leider war Sölvi Helgason vor wenigen Jahren gestorben, und berühmt wurde er, wie so viele Künstler seiner Generation, erst nach seinem Tod. Früher war er oft im Skagafjord anzutreffen gewesen, schien immer auf Achse zu sein, er war ein Vagabund und hatte für sein Vagabundieren sogar Peitschenhiebe kassiert, wiederholte Male, jeweils 27 Hiebe, und er war für drei Jahre nach Dänemark in die Besserungsanstalt geschickt worden, weil er des Diebstahls beschuldigt worden war, Bücher und Hosen soll er gestohlen haben, zudem hatte er seinen Reisepass gefälscht, um damit in andere Bezirke reisen zu können, um frei zu sein. Und wann immer er auf Hegranes herumstreunte, konnte er sich einer Unterkunft und einer Mahlzeit auf dem Bauernhof Nes sicher sein, denn Ósmanns Mutter Sigurbjörg schickte niemanden fort. Sie hatte ein Herz so groß wie ein Entenbraten. Auch andere Leute, die ein Dach über dem Kopf brauchten, waren im Nes stets willkommen, an Betten schien es nicht zu fehlen. Die in sich verschachtelten Torfbauten fassten 20 bis 30 Leute, und wenn der Platz knapp wurde, mussten die Kinder eben zu dritt oder zu viert ein Bett teilen. Nur Ósmanns Vater Magnús beschwerte sich manchmal, wenn auch verhohlen, Sölvi könne durchaus mitanpacken. Während der Heuerntezeit wurden alle Hände gebraucht, kurz waren die Sommer, viel zu kurz, und eines schönen Sommertages drückte er dem Kunstmaler eine Heugabel in die Hand und knurrte, das Gras müsse auf der Wiese verzettelt werden. Sölvi war in seinen jungen Jahren ein fleißiger Landarbeiter gewesen, sein Umgang mit Bauernwerkzeug war geübt. Magnús wusste das.
»Ich habe leider zu tun«, sagte Sölvi nachsichtig und gab die Heugabel dem Bauern zurück.
Glücklicherweise hatte Sigurbjörg mitverfolgt, wie Magnús den Kunstmaler zur Landarbeit hatte verdonnern wollen. Sie baute sich vor ihrem Mann auf, denn der war nun sichtlich wütend, sein Geduldsfaden gerissen, was nicht ganz ungefährlich war, denn er hatte ein hitziges Gemüt – und eine Heugabel.
»Unser Sölvi darf sich nicht die Hände mit einfacher Bauernarbeit kaputt machen!«, tadelte sie ihn. »Die Hände sind für den Maler das wichtigste Werkzeug!«
»Ja, aber Herrgott, er malt ja nie was!«, warf Magnús lautstark ein. »Hast du ihn irgendwann malen sehen? Er schleppt nur immer seine Staffelei durch die Gegend und malt nie was!«
Sölvi, der hinter dem breiten Rücken der Bauersfrau in Vergessenheit zu geraten drohte, reckte den Kopf hervor.
»Du verstehst nichts von Kunst, Magnús minn. Ein Kunstmaler arbeitet immer!« Er erklärte es mit erhobenem Zeigefinger, und Sigurbjörg ergänzte: »Er betrachtet, er macht sich gedankliche Skizzen, er –«, sie gestikulierte, »er saugt die Landschaften in sich auf! Und irgendwann ist er bereit, das Bild zu malen, so ist es doch, nicht wahr, Sölvi minn?«, und Sölvi nickte, während Magnús dampfte.
Wunderbare Tage müssen das gewesen sein, die jedoch unter die Räder der Zeit gekommen waren, und darum wurde der Kunstmaler Sölvi Helgason leider nicht Zeuge, wie Ósmann den schlaffen Frauenkörper durch den schwarzen Sand zu seiner Hütte trug, beide so splitternackt, wie sie der Herrgott geschaffen hatte, wie Adam und Eva, die erst kürzlich aus dem Paradies vertrieben worden waren.
Behutsam bettete er sie auf die Schlafstätte in der Hütte, deckte sie mit einer Wolldecke zu und breitete auch ein Robbenfell und schließlich seinen schweren Mantel über ihr aus. Ósmann überlegte, ob er sich zu ihr legen sollte, um sie aufzuwärmen, nackt, wie er war, aber er verwarf den Gedanken und zog sich an, entfachte das Feuer im Petroleumofen, griff nach einer Kaffeekanne und ging wieder ins Freie, füllte bei der kleinen Quelle hinter der Hütte die Kanne mit Wasser, ging zurück ins Innere und stellte sie auf den Ofen. Er hob den schweren Deckel von einem Holzfass, fischte eine Blutwurst aus der Molke und schnitt sie in kleine Stücke. Der Fährmann schien seine Erfahrung mit Unterkühlten zu haben und wusste, was zu tun war. Die Frau seufzte leise. Ósmann beugte sich über sie und legte seine Hand auf ihre noch immer kalte Stirn. Ihr Puls war kaum spürbar.
»Du musst trinken, du musst essen«, sagte er, aber die Frau schüttelte fast unmerklich den Kopf.
Ósmann richtete sich wieder auf, blieb unentschlossen stehen, fand plötzlich, dass es heute besonders lange dauerte, bis sich die Wärme des Ofens in der Hütte ausgebreitet hatte, und er fragte sich, wie er die Frau dazu bewegen sollte, etwas zu sich zu nehmen. Den Kaffee würde er ihr einfach einflößen können. Aber ob sie die Kraft hatte, die Blutwurst zu kauen, geschweige denn zu schlucken?
Er nahm die Taschenuhr zur Hand, die neben der Bibel auf dem Tisch gelegen hatte, und stellte sich näher ans Fenster, um die Zeit vom Zifferblatt ablesen zu können. In zwei bis drei Stunden würden die ersten Reisenden über den Ós wollen. Sie würden den seltsamen Fund melden können, am besten beim Bezirksarzt Sigurður Pálsson in Krók oder beim Pastor Benedikt Tómasson in Ríp, je nachdem, in welche Richtung die Reisenden unterwegs sein würden. Vielleicht würde sich die Frau bis dahin etwas erholt haben. Doch zuerst musste er Frauenkleidung auftreiben, damit die Reisenden nicht auf falsche Gedanken kämen.
Wieder beugte er sich über sie, berührte sie an der Schulter, rüttelte sie, sachte, aber bestimmt.
»Hollo, kannst du mich hören?«
Die Frau wimmerte, versuchte den Mund zu öffnen, aber ihre trockenen Lippen waren wie zugenäht.
»Wasser«, murmelte Ósmann und ging wieder nach draußen, wo er sein Taschentuch in die Quelle im Felsen tauchte. Drinnen betupfte er damit die blauen Lippen der Frau. »Trink!«, befahl er leise, und die Frau begann tatsächlich, am nassen Taschentuch zu saugen. Erleichtert wiederholte der Fährmann den Vorgang.
»Takk«, sagte sie schließlich, und Ósmann stellte fest, dass es möglich war, sich in ein Wort zu verlieben, nicht das Wort »Danke« an sich, sondern dieses eine, nur ein einziges Mal ausgesprochene Wort, das über ihre Lippen gekommen war und nur ihm galt. Es erfüllte ihn mit Hoffnung, Glück – und Liebe.
Er steckte sich einen Zigarrenstummel in den Mund und trat vor die Hütte, machte ein zufriedenes Gesicht, wie er da so stand und paffte und auf die Flussmündung blickte. Die Frau würde leben.
Eine halbe Stunde später half er ihr, sich aufzurichten. Dabei gab er acht, dass die Wolldecke nicht von ihrem nackten Körper rutschte. Ihr Kopf war der einzige Körperteil, der nicht eingepackt war. Weil er ihr ein Robbenfell um die schmalen Schultern gelegt hatte, sah sie bis auf das lange, zerzauste Haar fast aus wie eine Robbe. Gekrümmt und zitternd saß sie auf der Schlafstätte, die Augen nur halb geöffnet.
In der Hütte war es wärmer geworden, die Kaffeekanne dampfte auf dem Ofen. Ósmann führte der Frau eine bis zum Rand gefüllte Tasse Kaffee an die Lippen, sie trank mit kleinen Schlucken, und als sie genug hatte, zog sie ihren Kopf zurück.
»Es ist genug«, sagte sie und deutete sogar ein Lächeln an, wenn auch ein unsäglich müdes. Das alles muss sie viel Kraft gekostet haben, denn sie schloss nun die Augen und drohte nach hinten auf die Schlafstätte zu kippen.
»Und jetzt musst du essen!«, beeilte sich Ósmann zu sagen und hielt ihr einen Blechteller unter die Nase, auf dem er die Blutwurst in kleinere Stücke geschnitten hatte. Er schob ihr ein erstes Stück in den Mund. Sie wehrte sich nicht, kaute langsam, die Augen noch immer geschlossen, doch sie kaute. Und sie stöhnte erleichtert. Und sie schluckte. Und sie öffnete wieder den Mund, und Ósmann schob ihr ein zweites Stück zwischen die Lippen, und dann ein drittes, und dann ein viertes, bis ihre Lippen geschlossen blieben. Doch sie öffnete die Augen, schaute Ósmann an, der sich vor ihr auf einen Stuhl gesetzt hatte, den Teller mit der Wurst auf halber Höhe haltend, bereit, sie zu füttern, und sie lächelte liebevoll, dankbar.
»Jón«, sagte sie und musterte ihn.
»Kennen wir uns?«, fragte er zurück.
»Du bist der Fährmann«, sagte sie.
»Dafür gibt es Gewissheit«, bestätigte er, doch nun wollte er von ihr erfahren, wie sie heiße und wessen Tochter sie sei.
Sie lächelte, gab auf seine Fragen aber keine Antwort.
»Bringst du mich rüber? Ans andere Ufer?«, fragte sie.
»Ich –«, Ósmann zögerte. »Du musst dich zuerst ausruhen, und du brauchst Kleidung.«
Ihr Lächeln erlosch wie die Flamme einer Kerze, deren Docht im Wachs ertrinkt, sie machte die Augen zu und legte sich zurück auf die Schlafstätte, eine Träne rollte ihr über die Wange, und erneut streifte Ósmann der Gedanke, dass ihre Kleidung möglicherweise ein Robbengewand war, das sie verloren hatte, dass sie keinen gewöhnlichen Menschennamen hatte, weil sie im Grunde kein Mensch, sondern ein Wesen des Meeres war, dessen Robbenfamilie irgendwo da draußen auf sie wartete. Denn am Fabelstrand war alles möglich – so nannte der Fährmann das östliche Ufer der Flussmündung, wo auch seine Hütte stand.
»Ruh dich aus, ich komme wieder, versprochen«, sagte er, seine Gedanken abschüttelnd. »Bedien dich, wenn du hungrig oder durstig bist. Etwas anderes käme gar nicht infrage.« Er eilte aus der Hütte und schaute sich verstohlen um, als befürchte er, jemand hätte ihn bemerkt haben können, wie er eine nackte Frau in seiner Hütte versteckt hielt.
Der Himmel war zwar bewölkt, doch es würde trocken bleiben, bestimmt, die Bauern würden den zweiten Schnitt auf den mageren Wiesen wagen und darum keine Reisepläne schmieden. Allem Anschein nach stand ein ruhiger Tag am Ós bevor, aber Ósmann schien es dennoch eilig zu haben. Mit kräftigen Schritten erklomm er die scharfkantige Felsböschung hinter seiner Hütte und marschierte den Weg entlang über die mit Gras und Flechten bewachsene Ebene zum Nes, dem Bauernhof seiner Eltern, der nur eine Meile vom Fabelstrand entfernt war.
Da schliefen noch alle, schnarchten leise in ihren Betten, die Landarbeiterinnen und Landarbeiter, der Vater, die Mutter, die jüngere Schwester, der jüngere Bruder und dessen Frau Anna; sie war die Tochter der Witwe Dýrleif Gísladóttir, die in dieser Geschichte auch ihren Auftritt haben wird, später jedoch. Im Moment interessiert lediglich, ob es Ósmann gelingen wird, Frauenkleidung aus der Schlafstube zu stibitzen, ohne bemerkt zu werden. Bald würde auch im Nes der Tag beginnen, darum schlich sich Ósmann auf Zehenspitzen die Treppe hoch. Fast blieb er unbemerkt, doch als er die Kleidertruhe seiner Schwester öffnete und die Deckelscharniere quietschten, brummte jemand aus einem der Betten: »Nonni minn, was treibst du da?« Es war seine Mutter Sigurbjörg.
Ósmann hielt den Zeigefinger vor seine Lippen, und seine Mutter schwieg, doch sie beobachtete ihren Sohn, wie er Unterwäsche, ein Hemd, einen Rock, eine Strickjacke, dazu Wollstrümpfe und Schaflederschuhe aus der Truhe ramschte, den Deckel behutsam zumachte und seiner Mutter verlegen zunickte. Sie musterte ihn stirnrunzelnd, den Kopf auf ihre Hände gebettet, bis ihr die Augen wieder zufielen, langsam, der Schlaf übermannte sie, Sigurbjörg würde ihren Sohn später befragen.
Gebückt und erleichtert trat Ósmann durch die niedrige Haustür, zog sie hinter sich zu und machte sich mit dem Bündel unter dem Arm Richtung Fabelstrand davon, und noch nie schien der Name so gut gepasst zu haben wie an jenem Spätjulitag. Was da nicht alles angeschwemmt wurde! Zurück in seiner Hütte würde er die Kleidung auf den Stuhl legen und den Stuhl vor die Schlafstätte schieben, auf der die Frau noch immer unter dem Mantel und dem Robbenfell und der Wolldecke liegen und mit großer Wahrscheinlichkeit schlafen würde. Sollte er sie wecken und auf die Kleidung aufmerksam machen? Oder wäre es besser, sie einfach schlafen zu lassen und die Hütte nicht mehr zu betreten, bis sie, erholt und bekleidet, ans Tageslicht käme?
Seine Gedanken erwiesen sich als unnütz, denn die Frau lag nicht mehr auf der Schlafstätte. Sie saß auch nicht am Tisch oder stand beim Petroleumofen. Die Hütte war menschenleer. Die Wolldecke lag hübsch zusammengefaltet auf dem Stuhl, der Mantel hing am Haken neben der Tür. Nur das Robbenfell fehlte. Die Frau war auch draußen nirgends zu finden, weder bei den Felsen noch am Strand, die zwei Ruderboote lagen unberührt am Ufer, die Seilfähre trieb am Ósfelsen vertäut im Fluss, niemand hatte sich daran zu schaffen gemacht. Aber Ósmann fand Abdrücke von nackten Füßen im feuchten Sand, die Spur führte auf direktem Weg ans Wasser und von da nicht mehr zurück.
Ósmann, der sich mit dem Bündel unter dem Arm nach der Frau umgesehen hatte, blieb leicht gebückt am Wasser stehen, blieb lange stehen, wie erstarrt, und er blickte auf den Ós, als hoffe er, dass die Frau plötzlich aus dem Wasser steigen oder wenigstens eine Robbe ihren Kopf aus dem Wasser strecken würde, und man würde sich anschauen und wortlos voneinander verabschieden. Fast hätte man meinen können, Ósmann wolle mitsamt dem Bündel ins Wasser steigen, um auch da nach der Frau zu suchen, um ihr wenigstens die Kleider seiner Schwester zu überreichen. Doch nach einer geraumen Weile, die sich lange angefühlt hatte, gab er sich einen Ruck, drehte sich um und stapfte zurück zu seiner Hütte.
»Umsonst«, murmelte er mürrisch. »Alles umsonst!« Und als die ersten Reisenden an seine Tür klopften, es waren drei Bauern aus der Landgemeinde Hólar, ein Vater mit seinen zwei erwachsenen Söhnen, erschien ihnen Ósmann ausgenommen wortkarg, in sich gekehrt, was so gar nicht zu ihm passte. Der Vater und die Söhne waren sich später einig, dass er verkatert gewesen sein musste, so gerötet, wie seine Augen waren. Vielleicht habe man ihn geweckt, oder aber er habe die ganze Nacht durchgezecht, vermuteten sie.
Als die drei am Nachmittag wieder zurückkamen und von Ósmann mit der Seilfähre über den Fluss gekurbelt wurden, wirkte er tatsächlich wacher, war nicht mehr so grantig, sondern gut gelaunt und gesprächig. Während der Überfahrt trug er ihnen sogar ein Gedicht vor. Einem der Söhne gelang es, sich die Zeilen zu merken. Auf dem Nachhauseweg murmelte er sie immer wieder vor sich hin.
Wird angeschwemmt und liegt im Sand,
hat abgestreift das Robbengewand.
Zum Abschied heb’ ich hoch die Hand.
Stets willkomm’n am Fabelstrand.
Es kamen doch noch weitere Reisende an jenem Tag, in Krók wurde das Transportschiff Miaca erwartet, das mit einigen Bewohnern aus dem Skagafjord nach Nordamerika dampfen würde, und Ósmann hätte sehr wohl jemanden über den Vorfall mit der nackten Frau informieren können, hätte jemanden informieren müssen, doch er verlor kein Wort. Als er spätabends auf dem elterlichen Bauernhof erschien, nur seine Mutter Sigurbjörg war noch wach, blieb er auch ihr eine Erklärung schuldig. Er öffnete die Truhe in der Schlafstube, legte die Kleider zurück, machte die Truhe zu und drehte sich zu seiner Mutter um. Beide sagten sie nichts, schauten sich nur an. Schließlich machte Sigurbjörg das Kreuzzeichen und wandte sich ab, und Ósmann ging schlafen, war aber der Erste, der aus dem Bett stieg, resigniert, denn sein Schlaf war wiederum seicht und kurz gewesen. Wann hatte er das letzte Mal richtig gut geschlafen? Als er dieses Bett noch mit Guðný und ihrer gemeinsamen Tochter Agnes geteilt hatte, vielleicht?
Er ging die knappe Meile hinunter an den Fabelstrand und zog sich ganz aus. Es war ein wunderbarer Morgen, die Sonne flutete den Skagafjord mit silbernem Licht, ein milder Südwind brachte den Heugeruch aus den Tälern, und Ósmann schritt in den eiskalten Ós, wo das Wasser des Gletscherflusses ins Meer mündet, drei, vier Schritte, er blieb stehen, das Wasser ging ihm jetzt bis zum Bauchnabel, er machte noch ein paar Schritte, er atmete langsam aus und tauchte unter, tauchte ganz unter, verschwand so plötzlich von der Wasseroberfläche und blieb verschwunden, dass man sich fragen musste, ob man sich das alles nur eingebildet hat, den Fährmann, die Reisenden, die nackte Frau – ein Hirngespinst lediglich, eine Mär. Aber schon schnellte Ósmann in die Höhe, und das Wasser perlte in der Luft, es glitzerte und plätscherte, und der Fährmann prustete und lachte und klatschte sich Wasser ins Gesicht, und jetzt schien er zu glühen, sein Körper, seine Augen, er strahlte über das ganze Gesicht und watete mit zügigen Schritten an Land, seine Wärme und seine Lebenskraft – sogar ich glaubte sie zu spüren. Unverhofft wandte sich Ósmann mir zu und schaute mich auffordernd an, das Wasser tropfte ihm vom Bart.
»Wie neugeboren!«, verkündete er, und ich lachte verlegen und schaute weg.
1889
Auch ich begegnete Ósmann zum ersten Mal am Fabelstrand, in den noch taufrischen Morgenstunden eines Maimonats, als der Winter vom Licht der ersten Sommerwochen in die Knie gezwungen worden war, als der Schnee nur noch in den Furchen und Schluchten und schattigen Berghängen ausharrte, sulzig und schwer, die Wiesen und Pfade und Heiden so nass und sumpfig, dass jeder Schritt ein Schmatzen verursachte, als stehe der Sommer schon vor der Tür und verteile Küsse an die Überlebenden.
Damals wagte ich mich nur nachts aufs offene Gelände, tagsüber verkroch ich mich unter überhängenden Felsen, legte mich ins Moos, versteckte mich in Heuställen oder schlich mich in verlassene Bauernhöfe. Ich hatte keinen Reisepass und befürchtete, der Bezirksamtmann sei mir auf den Fersen. Die Menschen machten mir Angst, sie hatten entschieden, dass unter ihnen für mich kein Platz war, und ihre Argumente waren so überzeugend, dass sogar ich daran zu glauben begonnen hatte. Dass ich mir manchmal den Tod wünschte.
Das änderte sich an jenem Tag, als ich Ósmann begegnete, einige Jahre bevor er die nackte Frau am Ufer finden würde, bevor er sich den Namen »Ósmann« überhaupt geben würde, bevor das 19. Jahrhundert Platz machen würde für den eigentlichen Star unserer westlichen Zivilisation, das 20. Jahrhundert, in dem Boote motorisiert, Straßen und Brücken und Tunnel gebaut werden würden und das isländische Volk endlich aus seinen Torfhäusern kriechen würde, bleich, schmutzig, unterernährt – verwundert darüber, die letzten Jahrhunderte unter dem Joch der Dänen und der Winterstürme tatsächlich überlebt zu haben.
Damals fragte ich mich, ob es jemanden gibt, der entscheidet, in welchem Jahrhundert oder wo auf dieser Erdkugel man geboren wird. Ist das Leben dem Zufall überlassen, oder gibt es jemanden, der sich einen Spaß daraus gemacht hat, mich in dieser gottverlassenen Tundra abzusetzen und frieren zu lassen? Ich stolperte durch die Gegend Hegranes, die einer winterlichen Prärie glich, vor Kälte schlotternd, hungrig, dabei jeden Bauernhof in weitem Bogen umgehend, ich war auf Abwegen, da, wo keine Menschenseele unterwegs war, zudem schlief alles noch, obwohl die Sonne schon über dem östlichen Bergmassiv stand.
Ich hatte mich verirrt, zumindest mächtig getäuscht, hatte geglaubt, die Bezirkswasser schon hinter mir zu haben, und dabei nicht bemerkt, dass ich lediglich einen Seitenarm der mäandrierenden Gewässer überquert hatte, eine schmale Stelle, die ich zu furten gehofft hatte, mein klägliches Hab über dem Kopf balancierend, das eiskalte Schmelzwasser reichte mir bald bis an die Brust, und mit jedem weiteren Schritt, den ich machte, erkaltete mein Körper, und das Leben wich aus meinen Gliedern. Das andere Ufer rückte in die Ferne, erschien mir plötzlich unerreichbar, aus den letzten Armlängen wurde ein Meer, und hinter mir lag ein Ozean, ich stand an der Schwelle zwischen Leben und Tod, ich hätte wortlos ins Wasser sinken und mich, erschöpft, wie ich war, treiben lassen können, in den Himmel starrend, die letzten Momente meines Lebens auf den sanften Händen des Flusses getragen, vielleicht hätte ich es sogar genossen, still in den Tod zu gleiten.
Doch wie ich mit diesen verführerischen Gedanken rang, dabei noch einen Schritt machte und dann noch einen, hob sich der Boden unter mir wieder an, das Wasser perlte von mir ab, und ich wollte es spüren, das Land, das braune Gras, das im Morgenlicht golden schimmerte, ich wollte mich in dieses Gold legen, und wenn es meine letzte Tat wäre. Denn sterben wollte ich eigentlich nicht. Die letzten Schritte waren kein Ozean mehr, und um mich anzuspornen, erlaubte ich mir einen Schrei, ich wollte die verbleibende Kraft aus der Tiefe meines Innern einem Wikinger gleich über diese Flusslandschaft brüllen – jedoch, zum Teufel, als ich den Mund aufmachte, brachte ich keinen Ton heraus, das kalte Wasser, es hatte mir die Luft aus dem Leib gepresst und die Stimme verschlagen. Ich war dem Tod wahrscheinlich näher, als mir lieb war.
Zitternd und triefend kauerte ich auf allen vieren, rang nach Atem und fragte mich, ob ich noch lebte, und jetzt war es plötzlich nicht mehr so einladend, das taufeuchte Gras. Meine Glieder fühlten sich gewichtslos an, taub, und diese Taubheit breitete sich in meinem Körper aus wie Raureif, fraß sich hoch in meine Brust und umklammerte mein Herz. Ich musste zusehen, dass ich auf die Füße kam. Die Welt drehte sich, verwirrte mich, und darum bemerkte ich nicht, dass ich mich noch immer auf Hegranes befand. Dieser Flecken Erde ist im Grunde eine kleine Insel, die von den Bezirkswassern zu beiden Seiten umspült und umarmt wird und sich weit hinaus in den Skagafjord erstreckt.
Ich beschloss, auf schnellstem Weg nach Krók zu gelangen, bevor mich der Erschöpfungstod einholen würde oder zumindest bevor ich das Bewusstsein oder den Verstand verlöre, und wenn ich es tatsächlich bis nach Krók schaffte, würde ich um trockene Kleidung bitten, Essen, ein Bett, ganz egal, ob ich Peitschenhiebe bekommen oder in die Hauptstadt geschickt und da in den Stein geworfen werden würde. Wie ein Betrunkener stolperte ich den Weg entlang, und da konnte ich es rauschen hören, das Wasser, ich merkte allmählich, dass die Ebene, auf der ich mich befand, tatsächlich eine Insel war, umarmt von zwei Flussläufen – und Krók noch immer unerreichbar weit entfernt. Aber es war mir jetzt egal.
Als ich an der Kante einer steil abfallenden Böschung stand und auf die braune Oberfläche des Ós blickte, der Flussmündung, die sich mutig den grünen Wellen des Fjords stellte und einen Kampf mit ihnen austrug, der schon seit Jahrtausenden andauerte, bemerkte ich einen hochgewachsenen, bärtigen Mann, der unten am Flussufer neben einem Ruderboot stand und ins Wasser pinkelte. Ich wusste sofort, dass es sich um den Fährmann handeln musste, war darum erleichtert, und in mir breitete sich ein warmes Gefühl aus, denn da unten pinkelte mein Retter.
Er verrichtete sein Geschäft, drehte sich um und blieb wie versteinert stehen. Mein gekrümmter, nasser Anblick musste ihn überrascht haben. Er starrte zu mir hoch. Und ich starrte zurück, wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Wegschauen? Meine Hände vors Gesicht schlagen oder winken? Wartete er darauf, dass ich eine Regung zeigte? Vielleicht glaubte er, ich sei ein wahrhaftiger Geist. Darum hob ich die Hand zum Gruß, was mir schwerfiel, erschöpft, wie ich war, aber ich musste dem Mann doch klarmachen, dass ich kein Geist war, dass ich ihn bemerkt hatte und dass ich bemerkt hatte, dass er mich auch bemerkt hatte, doch nun wandte er sich grußlos ab und ging auf einen Felsen zu, wo, wie ich erst jetzt erkannte, eine Hütte stand, fast nicht als solche zu erkennen, weil die Steine der Hüttenwände aus dem Felsen unmittelbar dahinter stammen mussten, Torf im Gemäuer, Grassoden auf dem Dach, ein rostiges Rauchrohr, das in den Himmel ragte. In der Südwand kauerte, tief in der Steinmauer verborgen, ein kleines Fenster, und zum Fluss hin war eine niedrige, ziemlich schräge Holztür zu erkennen, über der ein dunkelgrünes Blechschild angebracht war, auf dem in großen weißen Lettern der Name EMANUEL geschrieben stand. Das Namensschild stammte von einem gestrandeten norwegischen Segelschiff, aber das erfuhr ich erst später, auch, dass Ósmann seine Hütte »Emanuel« nannte, als handle es sich um einen guten Freund. Die Tür schien kleiner zu werden, je näher der Fährmann auf sie zukam. Oder wurde er größer? Damals sah ich Jón Magnússon, später Ósmann genannt, zum ersten Mal, den Fährmann, dessen Geschichte zu erzählen ich mir zur Aufgabe gemacht habe – und wenn es das Letzte ist, was ich tun werde.
Der Fährmann machte die Tür auf, bückte sich und verschwand in der Hütte. Und ich blieb stehen und fragte mich, ob ich mich davonmachen sollte, fliehen sollte, denn vielleicht war er im Begriff, eine Axt zu holen oder, schlimmer noch, eine Schusswaffe. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass mir die bleiernen Schrotkügelchen einer Flinte um die Ohren geflogen wären; ein schreckliches Geräusch übrigens, ein gemeines, schrilles Zischen, gefolgt von einem krachenden Knall, und alles so plötzlich, dass jeder Versuch, sich zu ducken oder hinter einem Stein in Sicherheit zu bringen, lächerlich ist. Und doch wünschte ich mir manchmal eine Ladung Schrot, die meine Brust in Stücke reißen würde, denn es war bestimmt weniger schmerzhaft als der enttäuschte Blick meines Vaters, seine sich weitenden Nasenlöcher, seine zu harten Fäusten geballten Hände. Seine letzten Worte: »Für mich bist du schon gestorben. Dein Name wird hier nie wieder ausgesprochen werden.«
Ich erschrak, als der Fährmann plötzlich wieder vor seiner Hütte stand und mich zu sich winkte, unbewaffnet, wie ich erleichtert feststellte.
»Hollo!«, rief er. »Hollo, oben auf der Böschung! Auf was wartet er denn? Auf eine Kutsche mit zehn Pferden? Nur keine Furcht, bei mir gibt es die Köstlichkeiten des Fjords und, damit ist stets zu rechnen, eine Fahrt über den Ós. Ist man schon kalt?«
Und jetzt lachte ich, wie weggeblasen war sie, die Nässe, die Kälte, die Furcht, denn es waren genau diese Worte, die ich am nötigsten gehabt hatte, und darum entschied ich an Ort und Stelle, diesen Menschen zu mögen und ihm zu vertrauen. Wie schwer es mir fiel, nicht Hals über Kopf die felsige Böschung hinunterzueilen, aber ich besann mich und ging gespielt gemächlich, die Verzweiflung und Erschöpfung sollten mir nicht anzumerken sein, doch als sich der Fährmann wieder bückte und in der Hütte verschwand, konnte ich mich nicht mehr halten und lief los, beeilte mich, als befürchtete ich, dass er sich doch noch besinnen und mich zum Teufel jagen würde. Aber als ich, nun wieder gesammelt, die dunkle Hütte betrat, war der Fährmann damit beschäftigt, Feuer in einem Petroleumofen zu entfachen, ein verbeulter Topf stand schon bereit, war bis fast zum Rand mit einer Brühe gefüllt, in der Fleischstücke schwammen, und kaum breitete sich der Geruch des Ofens in der Hütte aus, richtete sich der Fährmann auf und drehte sich um, blieb aber gebückt stehen, denn der Raum war niedrig und der Fährmann einen ganzen Kopf größer als ich, mindestens. Seine Augen blitzten auf, und er strahlte mich an, als freue er sich nun über den unerwarteten Besuch.
»Es empfiehlt sich, die nassen Sachen neben dem Ofen aufzuhängen, und dich dazu, wenn es dir nichts ausmacht, dass du fortan den Geruch von gekochtem Robbenfleisch mit dir tragen wirst, wohin auch immer es dich verschlagen wird. Krók?« Der Fährmann zeigte auf eine Schlafstätte ganz hinten in der Hütte, auf die ich mich zu setzen hatte, nahe am Ofen. »Sechs Fuß!«, rief er unvermittelt, als er im Topf rührte. Ein beachtlicher Schnauzer sei das gewesen, schade, dass ich die Kegelrobbe nicht habe bestaunen können, ich hätte gestern kommen sollen, als sie noch aufgebahrt gewesen sei, dafür seien die Fleischstücke bald gar, ich sei also dennoch zu guter Zeit gekommen, als habe er geahnt, dass er einen Toten zum Leben erwecken müsse, selbst zu dieser Unstunde. Er lachte kurz und laut. Und darum grinste auch ich, wenn auch etwas verklemmt, als sei ich gefangen in einem Strudel der Flussströmung.
Wenn ich an meine erste Begegnung mit dem Fährmann in seiner Hütte Emanuel zurückdenke, überkommt mich noch heute eine Wärme, die sich vom Rumpf bis in die äußersten Spitzen meiner Finger und Zehen ausbreitet, auch wenn diese Begegnung ein ganzes Jahrhundert zurückzuliegen scheint. Sie markierte im Grunde den Beginn einer Freundschaft und war zugleich ein Abschied, ja, ein Ableben. Denn nie wieder würde ich um mein Leben fürchten. Immer würde ich auf die Gastfreundschaft des Fährmanns zählen können. Bei ihm war mir ein Dach über dem Kopf stets gewiss. Trotz meiner Lage.
Als wir uns schon auf den Weg machen wollten, Ósmann hatte mir versichert, dass er mich über den Ós rudern und kein Entgelt dafür verlangen würde, klopfte es an der Tür. Im selben Moment ging sie auf, wer auch immer da eintrat, man kannte sich. Es handelte sich um Ósmanns Vater Magnús, ein geduckter, drahtiger Kerl mit großen, von der Morgenkälte noch roten Händen. Vielleicht waren diese Hände die einzige Gemeinsamkeit, die Vater und Sohn teilten. Magnús würdigte mich keines Blickes, er war scheu, nahm ich an. Wie ich später erfahren sollte, kam Ósmann vielmehr seiner Mutter Sigurbjörg nach, die ihren Mann um ein paar Daumenbreiten überragte. Das Hünenhafte, das Standhafte; es kam von ihrem Zweig des Stammbaums.
Der Vater nannte seinen Sohn »Nonni«, weshalb ich mir ein Lächeln nicht verkneifen konnte, denn es schien mir absurd, dass dieser Hüne, der von Grettir dem Starken höchstselbst hätte abstammen können, mit einem solch niedlichen Kosenamen gerufen wurde. Der Vater schien nun kein unangenehmer Mensch zu sein, er hatte es nicht eilig und ließ es sich nicht nehmen, ein Stück Robbenfleisch aus dem Topf zu fischen und es sich zwischen die Zähne zu schieben, auch wenn er nicht mehr alle besaß, aber wer tat das schon.
»Soll ich dich wirklich nicht nach Krók begleiten?«, fragte Ósmann seinen Vater. Der schüttelte den Kopf, mampfend. Er roch nach Kuhmist, hatte wohl in aller Herrgottsfrühe Kühe gemolken.
»Ich kann dem Bezirkskomitee einen schönen Gruß ausrichten, wenn du möchtest«, sagte er.
Ósmann stemmte seine Hände in die Seite.
»Hauptsache, du kannst ihnen klarmachen, dass man die Leute nicht an der Westbank warten lassen kann, bis jemand Guðmundur hat ausfindig machen können, während ich hier an der Ostbank bereitstehe.«
»Auf Guðmundur können sie bald lange warten.«
»Will er denn wirklich auswandern?«
Magnús nickte.
»Und sein Nachfolger ist schon bestimmt, ein gewisser Jónas Jónasson auf Breiðstaðir.«