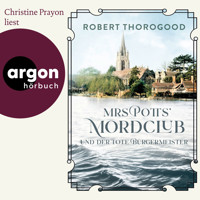9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Vom Autor von "Mrs Potts' Mordclub": Ein Fall für Detective Inspector Richard Poole! Detective Inspector Richard Poole wurde gegen seinen Willen in die Karibik versetzt. Für den Briten im Tweedanzug die Hölle! Jeden Tag kämpft er gegen die unerträgliche Hitze und die Lässigkeit seiner örtlichen Kollegen an. Nun bringt ihn auch noch ein ungewöhnlicher Mordfall ins Schwitzen: In dem spirituellen Urlaubsresort der Insel wird Guru Aslan nach seiner täglichen Tiefenentspannung tot im Teehaus aufgefunden. Die fünf Teilnehmer seines Kurses behaupten, alle tief in ihre Meditation versunken gewesen zu sein. Wer könnte ein Motiv haben, den Meister aus dem Weg zu räumen? Poole ist entschlossen, den Mörder aufzuspüren. Und folgt schon bald einer heißen Spur … "Für Liebhaber der klassischen englischen Kriminalfilme ist ‹Death in Paradise› fast schon Pflichtprogramm." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Ähnliche
Robert Thorogood
Mord im Paradies
Ein Fall für Inspector Poole
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Sabine Längsfeld
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Richard Poole – der ungewöhnlichste Ermittler unter der Sonne
Detective Inspector Richard Poole wurde gegen seinen Willen in die Karibik versetzt. Für den Briten im Tweedanzug die Hölle! Jeden Tag kämpft er gegen die unerträgliche Hitze und die Lässigkeit seiner örtlichen Kollegen an. Nun bringt ihn auch noch ein ungewöhnlicher Mordfall ins Schwitzen: In dem spirituellen Urlaubsresort der Insel wird Guru Aslan nach seiner täglichen Tiefenentspannung tot im Teehaus aufgefunden. Die fünf Teilnehmer seines Kurses behaupten, alle tief in ihre Meditation versunken gewesen zu sein. Wer könnte ein Motiv haben, den Meister aus dem Weg zu räumen? Poole ist entschlossen, den Mörder aufzuspüren. Und folgt schon bald einer heißen Spur …
Über Robert Thorogood
Robert Thorogood, geboren in Colchester, hat Geschichte in Cambridge studiert und war Präsident des Cambridge Theaterclubs Footlight. Um sich seinen Traum des Drehbuchschreibens verwirklichen zu können, schlug er sich lange Zeit mit Gelegenheitsjobs durch. 2011 gelang ihm mit der erfolgreichen BBC-Serie «Death in Paradise» um Inspektor Poole der Durchbruch. Mit «Mord im Paradies» legt Robert Thorogood nun seinen ersten Kriminalroman um seinen beliebten Ermittler vor. Der Autor lebt heute mit seiner Frau und seinen Kindern in Marlow in Buckinghamshire.
Für Katie B
Prolog
Aslan Kennedy brauchte keinen Wecker. Er wachte jeden Morgen von alleine auf, sobald die Sonne über den Horizont lugte.
Genau genommen wachte er mit der Sonne auf, seit er vor einigen Jahren beschlossen hatte, nicht mehr an Wecker zu glauben. Genauso wenig, wie er an Geld glaubte, an das Internet oder an Teebeutel. Für Aslan – Hotelbesitzer, Yogalehrer und selbsternannter spiritueller Guru – war die Armbanduhr mit ihrer willkürlichen Einteilung der Zeit in Sekunden, Minuten und Stunden lediglich ein wirksames Symbol der Versklavung. Eine Fessel der Menschheit, von all jenen freiwillig getragen, die dem sogenannten Fortschritt huldigten.
Natürlich wurden Verabredungen mit ihm dadurch ein klein wenig ermüdend. Aber das war ja nicht sein Problem.
An diesem Morgen lag Aslan also still im Bett (Mahagoni, Belle Époque), bis er spürte, dass seine Chakren sich harmonisiert hatten. Dann erst schwang er die Beine über die Bettkante, stellte die Füße auf die Teakholzbohlen (Import, Thailand) und trat vor den deckenhohen Spiegel (Goldrahmen, Regency), wo er sein Spiegelbild gründlich in Augenschein nahm. Der Mann, der ihm entgegenblickte, sah entschieden älter aus als sechsundfünfzig – wenn auch nur, weil die weißen Wallehaare, der lange Bart und das weiße Baumwollnachthemd ihm eine gewisse Jesus- bzw. Gandalf-Aura verliehen. Das wahre Wunder aber bestand eher darin, dass Aslan überhaupt noch am Leben war. Und das war in seinen Augen einzig und allein das Verdienst seiner wunderbaren Frau Rianka.
Er wandte sich um und betrachtete Rianka, die schlafend in ihrem Ehebett lag, die Laken um den Körper gewickelt. Wie friedlich sie aussieht, dachte Aslan. Wie ein Engel. Wunderschön. Und, wie er sich in den letzten fünfzehn Jahren immer wieder vorgebetet hatte, verdankte er dieser Frau alles, was es in seinem Leben an Gutem gab. Er stand auf ewig in ihrer Schuld.
Sobald Aslan sich angekleidet hatte, schwebte er über die Mahagonitreppe des Ferienresorts The Retreat hinunter, sorgsam darauf bedacht, mit dem weißen Wallegewand nicht versehentlich die kunstvoll arrangierten Folkloreobjekte von ihren Podesten zu reißen. Unten angekommen, führte sein Weg ihn in die ultramoderne Hotelküche. Zufrieden stellte er fest, dass das Tablett mit der blau gemusterten chinesischen Teekanne und den traditionellen Porzellanschälchen bereits für ihn vorbereitet war.
Aslan stellte den Wasserkocher an und sah zum Fenster hinaus. Getrimmte Rasenflächen erstreckten sich durch eine Allee hochgewachsener Palmen bis hinunter an den Hotelstrand, wo das Karibische Meer smaragdgrün und sanft an den strahlend weißen Sand anbrandete. Mit einem Lächeln registrierte Aslan, dass die für seine Sunrise-Healing-Session vorgesehenen Gäste bereits am Strand versammelt waren, um nach der frühmorgendlichen Schwimmrunde ein paar Stretchingübungen zu machen.
Bedauerlicherweise ließ sein Sehvermögen schon ein wenig zu wünschen übrig, und er musterte die fünf Leute in ihren Badesachen ein wenig genauer. Seine Stirn legte sich in Falten. Waren diese Leute tatsächlich heute Morgen zu seiner Spezial-Session eingeladen? Falls ja, dachte Aslan, dann war irgendetwas gründlich schiefgelaufen.
Der Wasserkocher schaltete sich mit einem Klicken ab. Aslan goss das Wasser in die Kanne und ließ sich vom Duft des grünen Tees beruhigen. Schließlich hatte er in seinem Leben schon ganz andere Sorgen gehabt als die Frage, wer an seinen Morgensessions teilnahm oder auch nicht.
Vielleicht war dies auch einfach nur die Selbstregulierung seines Karmas? Er konnte sich schließlich nicht ewig vor seiner Vergangenheit verstecken.
Als Aslan kurz darauf mit dem Teetablett ins Freie trat, hatte er einen Entschluss gefasst: Er würde einfach alles genauso machen wie immer. Er würde die Gäste in die Meditationshalle führen. Genau wie immer. Dann würde er die Tür schließen, gemeinsam mit ihnen eine Schale Tee trinken und schließlich mit der Healing-Session beginnen. Genau wie immer.
«Guten Morgen!», rief Aslan quer über den Rasen, um die fünf Personen unten am Strand auf sich aufmerksam zu machen. Sie drehten sich um und sahen zu ihm hoch. Einige winkten.
Ja, sagte er beschwichtigend zu sich selbst, kein Grund zur Sorge, alles in bester Ordnung.
Eine halbe Stunde später setzten die Schreie ein.
Die meisten Gäste der Ferienanlage hatten soeben auf der Restaurantterrasse ihr Frühstück beendet und waren in Erwartung der ersten Behandlung des Tages bereits in weiße Bademäntel gehüllt. Was Rianka Kennedy betraf, so saß sie auf der Veranda des Hotels, einen Weidenkorb mit Nähzeug zu ihren Füßen, und stopfte einen Socken ihres Ehemanns.
Der Schrei kam offenbar aus einem der Behandlungsräume, die über die weitläufigen Rasenflächen von The Retreat verteilt waren. Genauer gesagt, aus dem aus Holz und Papier gebauten japanischen Teehaus, das Aslan und Rianka zur «Meditationshalle» ernannt hatten.
Als dem ersten Schrei ein zweiter folgte, hatte Rianka sich bereits in Bewegung gesetzt. Sie rannte quer über den Rasen, direkt auf die Meditationshalle zu. Als sie etwa die halbe Strecke hinter sich gebracht hatte, tauchte wie aus dem Nichts neben einem dichten Bougainvillea-Busch Dominic De Vere auf, der braungebrannte wie auch ansonsten recht attraktive Hausmeister des Resorts. Wie üblich trug er lediglich eine abgeschnittene Jeans, Flip-Flops und seinen mit diversen Utensilien bestückten Werkzeuggürtel.
«Was ist denn das für ein Lärm?», fragte er überflüssigerweise, als Rianka an ihm vorbeischoss.
Rianka erreichte den Eingang zur Meditationshalle und versuchte, da es an der Außenseite keinen Türgriff gab, die Finger in die Lücke zwischen Tür und Rahmen zu zwängen, jedoch ohne Erfolg. Die Tür bewegte sich nicht – sie war von innen verschlossen.
«Was ist denn los?», rief sie über die Schreie hinweg.
Dann kam auch Dominic auf seinen Gummilatschen angeschlappt und stand zwar endlich neben Rianka, aber immer noch auf der Leitung.
«Und jetzt?», fragte er.
«Dominic, nun hilf mir doch und mach endlich die Tür auf!»
«Kann ich nicht. Die hat keinen Griff.»
«Dann nimm das Messer! Schneid das Papier durch!»
«Oh! Ach so! Klar!»
Dominic zog das Teppichmesser aus dem Etui an seinem Gürtel und schob die dreieckige Klinge heraus. Gerade als er damit die Papierbespannung der Teehauswand durchschneiden wollte, drückte sich von innen eine blutige Hand gegen das weiße Papier.
Dann ertönte eine Männerstimme, rau vor Angst: «Hilfe!»
Und dann noch eine Stimme, weiblich diesmal: «O Gott! O Gott!»
Ein metallisches Geräusch verriet, dass sich innen jemand offenbar am Riegel zu schaffen machte. Einen Moment später wurde die Tür aufgerissen, und dann stand Ben Jenkins vor ihnen, aschfahl und starr vor Schreck.
Ohne auf Ben zu achten, betrat Rianka die Meditationshalle und sah Paul Sellars auf einer Gebetsmatte liegen. Er hatte offenbar Schwierigkeiten, wach zu werden. Ann, seine Frau, kniete neben ihm und rüttelte ihn an den Schultern. Beide hatten Blutsprenkel auf ihren weißen Baumwollbademänteln. Saskia Filbee stand seitlich von ihnen, ein wenig abseits, die Hände vor den Mund geschlagen, und versuchte, den nächsten Schrei zu unterdrücken. Auch sie hatte Blut am Ärmel.
Doch Riankas Aufmerksamkeit galt der Frau in der Mitte des Raumes, Julia Higgins. Sie arbeitete seit einem halben Jahr im Retreat. In ihrer linken Hand hielt sie ein blutiges Küchenmesser.
Zu Julias Füßen lag ein Mann und rührte sich nicht. Gewänder, Bart und Haare, ehemals weiß, waren blutgetränkt, und in seinem Rücken klafften einige unschöne Stichwunden.
Aslan Kennedy – Hotelbesitzer, Yogalehrer und selbsternannter spiritueller Guru – war offenbar soeben aufs hässlichste erstochen worden.
«Ich habe ihn umgebracht», sagte Julia.
Jetzt war es an Rianka zu schreien.
Eins
Ein paar Stunden vor dem Mord an Aslan Kennedy war auch Detective Inspector Richard Poole bereits wach. Nicht weil er sich angewöhnt hatte, sich dem Sonnenaufgang eines jeden Morgens achtsam zuzuwenden. Nein, er war wach, weil er schwitzte und genervt war und nicht mehr hatte einschlafen können, nachdem ein Frosch um kurz vor vier direkt vor seinem Fenster zu quaken begonnen hatte.
Das ist mal wieder typisch, dachte Richard. Wenn ich nicht mitten in der Nacht von einem Froschkonzert geweckt werde, dann eben von sintflutartigen Regengüssen, die sich anhören, als würde ein kompletter Trupp Gene-Kelly-Klone auf meinem Blechdach Stepptanz üben; oder der heiße karibische Wind jagt ganze Sanddünen quer über meinen Holzfußboden. Genau genommen, grundsätzlich und ausnahmslos ist das Leben auf Saint-Marie die reinste Qual.
Zugegeben: Er hatte empirische Belege gesammelt, die nahelegten, dass die tropische Insel für Zehntausende Menschen tatsächlich ein beliebtes Ferienziel darstellte, aber was wussten die schon? Saint-Marie war eine Insel, auf der jede einzelne Sekunde eines jeden einzelnen Tages die Sonne schien, abgesehen von den jeweils zehn Minuten morgens und abends, an denen plötzlich wie aus dem Nichts ein Tropensturm aufzog und es wie aus Kübeln schüttete. Dann gab es da natürlich noch die dreimonatige Hurrikan-Saison, in der es aber in Wirklichkeit genauso heiß war wie in der heißen Jahreszeit, nur eben stürmischer.
Hinzu kam die konstante und erbarmungslose Luftfeuchtigkeit, welche – wie Richard zu betonen nicht müde wurde – weit über einhundert Prozent lag. (Richard wusste natürlich, dass dies vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet nicht möglich war, aber er wusste auch, dass das eine Mal, als seine Mutter ihm ein kostbares Paket mit Walkers Chips geschickt hatte, die von ihm so heißgeliebten und eigentlich herrlich krossen Chips noch in derselben Sekunde pappig geworden waren, als er eine der Tüten aufgerissen hatte und sie der schwülheißen Tropenluft ausgesetzt waren. Es kam ihm vor wie eine ganz besonders ausgeklügelte Form der Bestrafung, eigens ersonnen, um ihn zu quälen.)
Diese und andere wilde Wogen der Verzweiflung brachen sich vor Richards innerem Auge, während er hellwach im Bett lag und der Wecker auf dem Nachttisch von 04:18 auf 04:19 umsprang, zweifelsohne, wie Richard finster grübelnd konstatierte, die elendste aller Minuten des vierundzwanzigstündigen Tageslaufs.
Ein Schweißtropfen rann an seinem Hals hinunter und in den Kragen seines Marks-and-Spencer-Pyjamas hinein, und ehe er sich bremsen konnte, hatte Richard sich in eine strampelnde Kampfmaschine verwandelt. Er attackierte die Laken so lange mit wilden Tritten, bis sie zu einer knittrigen Kugel zerknüllt auf dem Fußboden landeten.
Erschöpft ließ er sich auf die alte Matratze zurücksinken und stieß einen Seufzer aus. Warum musste das Leben nur so anstrengend sein?
Es half alles nichts. Er konnte ebenso gut aufstehen.
Richard machte Licht und tappte in die winzige Küchen-Bad-Kombi, die in den Vorbau seiner Hütte hineingequetscht worden war, und zwar offensichtlich von jemandem, der die Kombüsen auf Segelbooten für verschwenderisch geräumig hielt und sich zum Ziel gesetzt hatte, noch entschieden mehr Koch- und Waschgerätschaften auf noch viel kleinerem Raum einzupferchen.
Er trat an die zwischen Kühlschrank und Eingangstüre gezwängte Spüle und stellte fest, dass er nicht der Einzige war, der danach trachtete, seinen Durst zu stillen. Das Spülbecken war bereits von einem leuchtend grünen Gecko besetzt, welcher die Tropfen einfing, die in regelmäßigem Abstand aus dem Wasserhahn fielen.
Der Gecko hieß Harry. Vielmehr, Richard hatte beschlossen, dass der Gecko männlich war, und ihn Harry getauft, als er entdeckte, dass die ihm zugewiesene Unterkunft bereits mit einem reptilischen Mitbewohner ausgestattet war. Und wie ausnahmslos jede Wohngemeinschaft, in die Richard je involviert gewesen war, hatte auch diese sich von Anfang an als Katastrophe erwiesen.
Während Harry sich wieder dem Unterfangen zuwandte, mit seiner rosaroten Zunge die Wassertropfen aufzufangen, ertappte Richard sich – nicht zum ersten Mal – bei dem Gedanken, dass er sich dieser schrecklichen Kreatur endlich entledigen sollte.
Fragte sich nur, wie.
Ein paar Stunden später saß Richard hinter seinem Schreibtisch der Honoré Police Station und durchforstete das Internet auf der Suche nach legalen und weniger legalen Methoden zur Beseitigung von Ungeziefer in Privathaushalten, als Detective Sergeant Camille Bordey mit einem Funkeln in den Augen an seinen Schreibtisch geschwebt kam.
«Also … was möchten Sie zu Mittag essen?»
Camille war klug, anmutig und eine der attraktivsten Frauen der Insel, doch als Richard den Blick von seinen Tagträumen hob – gereizt ob der Unterbrechung –, runzelte er nur die Stirn und glotzte wie eine Schleiereule, die gerade eine schlechte Nachricht erhalten hat.
«Camille! Sie sollen mich nicht unterbrechen, wenn ich arbeite.»
«Oh, tut mir leid», sagte Camille, der es kein bisschen leidtat. «Woran arbeiten Sie denn?»
«Ach, Sie wissen schon. Arbeit eben», antwortete er misstrauisch. «Was wollen Sie von mir?»
«Ich? Ich wollte lediglich Ihre Mittagsbestellung aufnehmen.»
Endlich hob Richard den Blick und sah seine Kollegin an. Sie war jung, frisch, dynamisch und stürzte sich mit einer wundersamen Unbekümmertheit ins Leben, die Richard nicht einmal im Ansatz verstand. Genau genommen war seine Partnerin ihm ein völliges Rätsel. Richard wusste natürlich, dass sein Verständnis fürs weibliche Geschlecht sich generell in Grenzen hielt, was bedingt war durch die Erziehung in einem Jungeninternat und den Umstand, dass er bis zum Alter von achtzehn Jahren kein einziges Gespräch von Bedeutung mit einer Frau geführt hatte, die nicht seine Mutter oder seine Hausmutter gewesen war. Camille jedoch erschien ihm noch unergründlicher als die meisten anderen Frauen.
Erstens war sie Französin. Zweitens war sie Französin. Und drittens, viertens und fünftens war sie Französin. Das hieß – zumindest nach Richards Verständnis –, dass sie unzuverlässig war, unfähig, sich an Anweisungen zu halten, und darüber hinaus wandelndes Pulverfass und tickende Zeitbombe in einem. In Wirklichkeit hatte Richard eine Heidenangst vor ihr. Nicht, dass er das je zugeben würde. Nicht einmal sich selbst gegenüber.
«Sie wissen, was ich zu Mittag essen möchte, Camille», sagte er gebieterisch, in dem Versuch, die Gesprächshoheit zurückzuerlangen. «Weil ich, seit ich auf dieser gottverlassenen Insel eingetroffen bin, zu Mittag noch nie etwas anderes zu mir genommen habe.»
«Aber Maman hat würzig-scharfe Yamswurzel mit Reis gemacht, und sie sagt, es reicht für uns alle. Es ist auch noch ein bisschen Ziegencurry übrig, von –»
«Vielen Dank, Camille, aber ich bleibe wirklich lieber beim Üblichen.»
Camille sah ihren Boss an, zog mit blitzenden Augen ihren Polizeiblock hervor und machte sich mit großer Geste daran, seine Mittagsbestellung aufzunehmen. «Ein … Bananen … sandwich.»
«Danke sehr, Camille.» Obwohl Richard das deutliche Gefühl hatte, dass man sich wieder einmal über ihn lustig machte, wusste er nicht genau, wie.
Camille griff nach ihrer Handtasche, tänzelte aus dem Zimmer, und Richard wartete ab, wer als Erster hinter seinem Computerbildschirm auftauchen würde, Dwayne oder Fidel.
Es war Ordinary Police Officer Dwayne Myers. Doch das war im Grunde keine Überraschung, schließlich war er der Elder Statesman des Reviers.
Richard tolerierte Dwayne – mochte ihn sogar –, doch es geschah immer wider bessere Einsicht. Dwayne war in den Fünfzigern, sah jedoch keinen Tag älter aus als dreißig und war – bis auf die nicht uniformkonformen Turnschuhe und die Perlenkette um den Hals – stets makellos herausgeputzt. In der Tat hatte Richard die Präzision in Kleiderfragen schon immer als verbindendes Element zwischen ihnen empfunden. Und obwohl Richard natürlich völlig klar war, dass Dwayne kein ausgewiesenes Interesse an Gründlichkeit, Pünktlichkeit oder der Befolgung irgendwelcher Befehle hatte, so war er, was die Beschaffung von Informationen durch «inoffizielle» Kanäle betraf, ein wahrer Zauberkünstler. Und eine kleine tropische Insel wie Saint-Marie bestand zum Großteil aus inoffiziellen Kanälen.
«Ernsthaft, Chief», sagte Dwayne. «Sie können unmöglich jeden Tag dasselbe essen.»
«Oh, Sie würden sich wundern. Ich war zehn Jahre auf dem Internat.»
Jetzt tauchte auch Sergeant Fidel Bests Kopf seitlich seines Bildschirms auf. Auf dem jungen, vertrauensseligen Gesicht lag ein verwirrter Ausdruck. Fidel war in Richards Augen ein Vollblutpolizist. Er war akribisch, eifrig, absolut unermüdlich, und, vor allen Dingen, er kannte die Vorschriften. Die einzige Schattenseite, die Fidel besaß, war vielleicht der Übereifer, der ihn dazu trieb, selbst dann noch eine Spur zu verfolgen, wenn sie schon längst eiskalt war und es angebracht wäre, sie fallenzulassen. So wie jetzt, dachte Richard, als Fidel sagte: «Aber Sir, ist es nicht irgendwann langweilig, sein Leben lang immer das gleiche Mittagessen zu sich zu nehmen?»
«Ja. Außerordentlich. Aber was soll man machen?»
«Na ja, Sir. Etwas anderes bestellen?»
«Nein. Ich denke, ich bleibe besser bei meinem Bananensandwich, falls Sie nichts dagegen haben. Bei einem Bananensandwich weiß man wenigstens, was man hat.»
«Ich weiß», sagte Dwayne, beinahe ehrfürchtig angesichts der hartnäckigen Entschlossenheit seines Chefs, nur ja niemals eine Veränderung zu akzeptieren. «Ein Brot mit Bananen.»
Das Diensttelefon klingelte beharrlich, bis Richard schließlich entnervt zu schnauben begann. «Nein, nein, schon gut, bleiben Sie ruhig sitzen, meine Herren. Ich gehe schon ran.»
Richard trat an den von der Sonne ausgeblichenen Schalter und nahm den Hörer des antiquierten Telefons ab.
«Polizeistation Honoré, Detective Inspector Richard Poole am Apparat. Was kann ich für Sie tun?»
Richard lauschte einen Augenblick, hielt die Hand vor die Sprechmuschel und wandte sich seinen Leuten zu.
«Fidel? Rufen Sie Camille an. Stornieren Sie das Bananensandwich. Wir haben einen Mord.»
Vor achtzehn Jahren hatte Rianka eine heruntergekommene Zuckerrohrplantage zu einem Spottpreis erstanden und daraus ein Ferienresort gemacht. Das Herrenhaus war damals beinahe fünfzig Jahre unbewohnt gewesen, aber es war nicht das Äußere des Hauses, das sie angesprochen hatte, sondern sein Innenleben. Natürlich war auch das in desolatem Zustand gewesen, doch Rianka hatte die noch immer wunderschönen Proportionen der Räume und deren Luftigkeit erkannt. Die Decken waren verrottet, aber hoch, die geschwungene Freitreppe war von Unkraut überwuchert und wies so einige Lücken auf, war aber trotzdem hochherrschaftlich. In Riankas Augen war das Haus eine Metapher für die Insel Saint-Marie an sich – äußerlich heruntergekommen, aber innen voller Seele –, und binnen eines Jahres hatte sie dem Haupthaus und dem umliegenden Gelände die einstige Pracht zurückgegeben und ein Luxusferienhotel namens The Plantation eröffnet.
Als Rianka dann Aslan begegnete, fingen die beiden an, das Hotel als Gesundheitsfarm der Extraklasse zu vermarkten, und es dauerte nicht lange, bis sie das komplette Unternehmen in ein Luxusspa umwandelten, und zwar unter dem Namen The Plantation Spa.
Das Geschäft lief zunehmend besser.
Dann, als Aslan sich immer mehr auch für die spirituelle Seite des Lebens öffnete, fing er an, den Hotelgästen ganzheitliche Behandlungen und Therapien anzubieten – entweder von ihm persönlich geleitet oder von anderen Lehrern, die er eigens ins Haus holte. Nicht lange, und sie gaben dem Hotel ein drittes und letztes Mal ein neues Erscheinungsbild, und von da an hieß es The Retreat.
Das Resort war nun bereits seit einigen Jahren maßgeschneidert auf die Ansprüche einer wohlhabenden, internationalen Klientel, die ebenso viel Wert auf die Heilung der Seele legte wie auf die Verwöhnung ihres Körpers. Die Gäste konnten diverse Healing-Sessions buchen, sei es nun Kristallarbeit, Reiki oder Sunrise-Healing; es gab Yoga-Kurse, natürlich sowohl Bikram als auch Hatha; und auch Meditation stand im Angebot, sei es Zazen oder TM.
Während die Polizeibeamten im Minikonvoi über die Kiesauffahrt auf das Haupthaus zufuhren, wobei die Blaulichter im strahlenden karibischen Sonnenschein ein wenig blass wirkten, konnten sie deutlich erkennen, dass es sich um das ehemalige Wohnhaus des Plantagenbesitzers handelte: Gepflegte Rasenflächen neigten sich einem Privatstrand entgegen, und über das Gelände waren mehrere leicht pseudoreligiös anmutende Gebäude verstreut, in denen Hotelgäste ein und aus gingen.
Richard, Camille und Fidel kletterten aus dem polizeieigenen Jeep Marke Landrover, und Dwayne stieg von dem einzigen weiteren Fahrzeug der Truppe, einer 1950er Harley-Davidson mit absolut unzulässigem Beiwagen. Niemand wusste, wo dieses Motorradgespann so ganz genau hergekommen war und durch welchen Trick es schließlich die offizielle Lackierung der Polizeitruppe von Saint-Marie erhalten hatte, doch der Legende nach – und die Aufzeichnungen schienen dies zu bestätigen – war das Gespann nur unwesentlich später als Dwayne zur Truppe gestoßen. Dwayne selbst schwieg zu dem Thema beharrlich.
Dominic kam aus dem Haus – zwar noch immer in Flip-Flops und abgeschnittener Jeans, aber angesichts des Ernstes der Lage inzwischen zusätzlich mit einem Unterhemd bekleidet.
«Mann, bin ich froh, Sie zu sehen!» Er fuhr sich mit der Hand durch die glänzenden Haare und schüttelte den Kopf, damit die Mähne sich wieder legen konnte.
«Aha», sagte Richard. «Und wer sind Sie?»
«Dominic De Vere. Der Hausmeister.»
Dominic war Brite, und sein affektierter Akzent verriet Richard augenblicklich den reichen Background. Diesen Typ Mann kannte Richard nur allzu gut. Selbstgefällig, begriffsstutzig, begütert, privilegiert – und deshalb in der Lage, sich durchs Leben treiben zu lassen und, just for fun, das Treiben der Arbeiterklasse zu erforschen. Eins stand fest: Sollte Dominic jemals das Geld ausgehen, rief er einfach einen seiner alten Schulkameraden an, besorgte sich einen hochdotierten Job in der City und beklagte sich dann für den Rest seines Lebens darüber, dass die «Jugend von heute» alles nichtsnutzige Gammler waren.
Es kann festgehalten werden, dass Richard Dominic auf den ersten Blick nicht ausstehen konnte.
«Wenn Sie uns bitte zu der Leiche führen würden», sagte er.
«Na klar.»
Weil Richard kein Interesse hegte, weiter Konversation mit jemandem zu betreiben, der einen Haifischzahn um den Hals trug, gingen sie schweigend bis zur Hausecke. Dort blieb Dominic plötzlich stehen und runzelte die Stirn. Richard sah ihn an.
«Gibt es ein Problem?», fragte er.
Dass dem so war, stand außer Frage, doch Dominic wusste offenbar nicht, wo er anfangen sollte.
«Erzählen Sie», sagte Camille entschieden nachsichtiger als ihr Boss.
«Also», fing Dominic an. «Es ist nur so, dass …»
Er verstummte wieder und fing an, mit den Händen Richards Konturen nachzufahren.
«Was um alles in der Welt machen Sie da?», fragte Richard empört.
«Ich hab so was noch nie gesehen!»
«Ich bin Polizist! Würden Sie also bitte unverzüglich aufhören, meine Arme zu streicheln?»
«Aber das ist unmöglich.»
Jetzt hatte er Richards ganze Aufmerksamkeit. «Was ist unmöglich?»
Dominic holte tief Luft, als müsste er eine sehr schlechte Nachricht verkünden.
«Sie haben keine Aura.»
Richard musterte Dominic einen sehr langen Augenblick.
«Ich weiß. Es gibt keine Auras. Und falls es Ihnen nichts ausmacht, es ist mir lieber, Sie rühren sich nicht vom Fleck, während wir uns die Leiche ansehen.»
«Aber die Leute aus Ihrem Team haben alle eine Aura.»
«Tatsächlich?», fragte Camille eifrig. Sie wollte offensichtlich mehr erfahren.
«Natürlich», fuhr Dominic fort und strahlte Camille lässig an. «Ihre ist gelb, golden … wie Sonnenstrahlen. Warm. Voller Leidenschaft. Offen. Sexuell experimentierfreudig.»
Camille schien entzückt über diese Analyse, während Dominic ihr sehr viel länger als notwendig in die Augen sah und Richard nicht umhinkonnte zu registrieren, dass Dominic nicht nur braun gebrannt, muskulös und mit einem heldenhaft kantigen Kinn ausgestattet war, sondern ganz allgemein extrem gut aussah. Wenn auch auf reichlich offensichtliche Weise, wie Richard in einem Nachgedanken eilig hinzufügte.
Als Nächstes wandte Dominic sich Fidel zu und musterte den leeren Raum, der ihn umgab.
«Was Sie betrifft, Ihre ist blau und grün … Herzlichkeit … Tapferkeit. Fleiß. Hey, Sie sind einer von den Guten!»
Fidel errötete. Er war offensichtlich von seiner Auralesung ebenso begeistert wie Camille von ihrer.
«Grundgütiger!», entfuhr es Richard. «Vielen Dank, Mr. De Vere, aber wie ich sehe, hat sich dort drüben» – er deutete auf das in einiger Entfernung stehende japanische Teehaus – «eine beträchtliche Menschenschar versammelt, und ich möchte eines noch einmal betonen: Meine Kollegen und ich begeben uns jetzt unverzüglich zum Tatort, und Sie bleiben hier.»
«Und was ist mit mir?», fragte Dwayne erwartungsvoll wie ein Hundewelpe. «Was ist mit meiner Aura?»
Richard schnaubte verächtlich, während Dominic sich zu Dwayne umwandte und ihn nachdenklich musterte. Doch dann umspielte seine Lippen ein wissendes Lächeln.
«Sie sind wie ich. Ein Gestaltwandler.»
Dwayne strahlte angesichts dieses für ihn offenbar unschätzbar wertvollen Kompliments.
«Ich wusste es!»
Dominic drehte sich wieder zu Richard um. «Tja, aber wenn ich Sie ansehe, wie gesagt, sehe ich … nichts.»
«Während ich da drüben einen Tatort sehe. Also, haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe. Leute, ihr kommt mit mir, und Sie: Sollten Sie sich auch nur einen einzigen Zentimeter vom Fleck bewegen» – dies war an Dominic gerichtet – «werde ich Sie wegen Verschwendung polizeilicher Dienstzeit verhaften lassen.»
Richard stolzierte quer über den Rasen davon, während seine Leute sich krampfhaft bemühten, einander nicht anzusehen, als sie vom Tatendrang ihres Chefs quasi mitgerissen wurden. Es gehörte sich nicht, kichernd am Schauplatz eines Mordes aufzukreuzen.
Allerdings gab es für Richard und sein Team, als sie das Teehaus erreichten, auch nichts mehr zu lachen, denn sie trafen dort auf sechs schockstarre Briten, welche auf dem Rasen saßen oder standen. Fünf von ihnen trugen weiße Baumwollbademäntel, die eindeutig Flecken von getrocknetem Blut aufwiesen. Die sechste Person – Rianka – saß abseits der anderen im Gras. Sie trug einen langen, indischen Rock mit winzigen, eingenähten Spiegelchen, eine leichte Tunika und Riemchensandalen.
«Nun gut. Ich bin Detective Inspector Richard Poole», sagte Richard. «Und das ist Detective Sergeant Camille Bordey. Kann mir einer von Ihnen sagen, was passiert ist?»
«Das ist ganz einfach», antwortete ein braungebrannter Mann in den Fünfzigern mit Yorkshire-Akzent und einer dicken Goldkette um den Hals. Außerdem bemerkte Richard die klobige goldene Uhr am Handgelenk. Er war offenbar recht wohlhabend.
«Ben Jenkins», stellte der Mann sich vor. «Und die Frau da drüben sagt, sie heißt Julia Higgins. Sie hat alles zugegeben, müssen Sie wissen. Sie hat Aslan Kennedy ermordet.»
Der Mann zeigte auf eine junge Frau mit blutgetränktem weißem Bademantel, die ebenfalls ein wenig abseits auf dem Rasen stand. Sie war in etwa Anfang zwanzig, trug die langen blonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und sah mit waidwundem Blick zu Richard herüber. Sie wirkte, als wäre sie über die Anschuldigung ebenso bestürzt wie alle anderen. Doch sie bestritt auch nichts.
Mit einem knappen Nicken scheuchte Richard Dwayne zu Julia hinüber, um sicherzustellen, dass sie sich nicht plötzlich aus dem Staub machte. Dwayne setzte sich in Bewegung, und Richard wandte sich wieder Ben Jenkins zu.
«Und wo befindet sich die Leiche?»
«Da drin.» Ben deutete auf das japanische Teehaus.
Richard wandte sich an die Versammelten. «Wenn Sie bitte alle hier warten wollen. Detective Sergeant Bordey und ich benötigen nur einen kurzen Moment. Camille?»
Mit Camille im Schlepptau steuerte Richard das japanische Teehaus an. Auf der Türschwelle blieb er abrupt stehen.
«Moment.» Richard gebot Camille mit erhobener Hand Einhalt. Erst jetzt, als er direkt davor stand, fiel ihm auf, dass die Wände des Gebäudes offensichtlich aus Papier bestanden.
«Was tun Sie denn?», wollte Camille wissen.
Richard überhörte die Frage und nahm sich einen Augenblick Zeit, um die Eingangstür zu inspizieren. Er registrierte, dass es außen keinerlei Türgriff gab, auf der Innenseite jedoch ein fest mit dem Holzrahmen verschraubtes Riegelschloss – sowie eine korrespondierende Falle am Türrahmen, in welche der Riegel sich automatisch schob, wenn die Tür geschlossen wurde.
Da sich jedoch auf der Außenseite kein Schlüsselloch befand, konnte die Tür offensichtlich nur von innen geschlossen und entriegelt werden. Richard speicherte diese Information zur späteren eingehenden Betrachtung ab.
Er betrat den Raum und verstand augenblicklich, weshalb sowohl die Wände als auch die Decke aus transparentem Papier gefertigt waren. Jeder einzelne Zentimeter der Wände leuchtete. Nicht nur dass es im Inneren heller war als außen, es war auch beträchtlich wärmer, so, als befände man sich im Herzen einer Supernova. Und das war mal wieder verdammt typisch, dachte Richard.
Camille gesellte sich zu Richard ins Innere des Raumes und musterte ihren Boss, den es in seinem Schurwollanzug ganz offensichtlich juckte.
«Heiß hier, oder?», fragte sie mitfühlend.
Richard beschloss abermals, seine Kollegin zu ignorieren. Lieber kniff er gegen das grelle Licht die Augen zusammen und konzentrierte sich auf die blutverklebte Männerleiche, die mitten im Raum auf dem Boden lag. In Haaren, Bart und den einst weißen Gewändern trockneten Unmengen von Blut. Auf dem Fußboden neben der Leiche lag ein blutiges Messer.
Richard nahm den Raum zwar kurz in Augenschein, doch im Grunde gab es überhaupt nichts zu sehen. Der Fußboden bestand aus polierten Holzdielen. Rund um ein Tablett mit Teegeschirr waren kreisförmig sechs geflochtene Gebetsmatten arrangiert. Außerdem lagen sechs Schlafmasken aus Stoff und sechs schnurlose Kopfhörer auf dem Boden verstreut. Doch abgesehen davon war der Raum vollkommen leer. Keine Möbel – keine Sideboards, Tische, Stühle, Statuen oder sonstiger Schnickschnack –, hinter denen man sich verbergen oder in denen man Tatwaffen verstecken könnte.
Faktisch war dieser Raum vollkommen leer.
Richard beugte sich hinunter und hob einen Kopfhörer auf. Er setzte ihn auf und runzelte die Stirn.
«Was ist das?», fragte Camille.
«Ich habe keine Ahnung.» Richard lauschte, konnte das Geräusch aber nicht identifizieren.
Seltsames Wehklagen drang an sein Ohr.
Er lauschte noch ein bisschen länger, aber soweit er das beurteilen konnte, gab es außer dem seltsamen Jaulen nichts zu hören. Als ihm plötzlich dämmerte, was er da hörte, ergriff ihn kaltes Grausen.
Schaudernd sagte er: «Singende Wale.»
Richard riss sich eilig den Kopfhörer herunter und legte ihn zurück auf den Fußboden. Dann trat er zu Camille in die Mitte des Raums, um das Opfer in Augenschein zu nehmen.
Er ging in die Hocke und identifizierte die Tatwaffe neben der Leiche als eine Art Tranchiermesser. Ausgesprochen scheußlich, in der Tat. Die Klinge war blutverschmiert, doch der Griff wirkte sauber.
«Das muss eingetütet und auf Spuren untersucht werden», sagte Richard.
Camille inspizierte die Leiche. «Keine Hinweise auf einen Kampf … weder Stoff- noch Hautpartikel unter den Fingernägeln des Opfers … und weder Schnitte an Händen noch Armen. Sieht nicht so aus, als hätte er versucht, den Angriff abzuwehren.»
Richard musterte das Tablett mit den Teeutensilien, das auf dem Boden neben der Blutlache stand, die sich um den Toten ausgebreitet hatte. Die Teekanne hatte ein chinesisches Muster. Auf dem Fußboden standen vor den Gebetsmatten sechs Porzellanschälchen, alle verkehrt herum mit dem Boden nach oben. Richard versuchte, sich vorzustellen, was geschehen war.
Ging man nach der Anzahl an Matten und Teeschalen, hatten sich in dem Raum sechs Personen befunden. Sie hatten rund um das Teetablett auf den Matten gesessen, Tee getrunken, dann ihre Schälchen umgedreht und verkehrt herum auf den Boden gestellt, wohl um zu zeigen, dass sie ausgetrunken hatten.
Doch wie passten Schlafmasken und Kopfhörer in dieses Szenario? Und wie genau war das Opfer zu Tode gekommen?
Camille untersuchte die Stichverletzungen im Rücken des Toten. «Rücken, Schultern und Nacken des Opfers weisen fünf einzelne, tiefe Stichwunden auf», sagte sie. «Zwei Wunden seitlich rechts am Nacken, drei Wunden rechts in Schulter und Rücken. Ich würde sagen, der Angreifer stand hinter dem Opfer – und war mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Rechtshänder.»
Richard erhob sich und trat zu ihr. Er konnte nachvollziehen, was Camille meinte. Die Anordnung der Stichwunden ließ darauf schließen, dass Aslan Kennedys Mörder hinter ihm gestanden und ihm mit einem mit rechts geführten Messer in Nacken und Rücken gestochen hatte.
Richard zwang sich, dem in seiner Blutlache liegenden Opfer ins Gesicht zu sehen. Wer war dieser Mann? Womit hatte er einen derart brutalen Tod provoziert?
Richard atmete aus. Genau das war sein Job. Die Geschichte vom Ende her aufzurollen: Die Leiche, der Mord, war der Anfang. Danach musste er jenen Beweis finden, der es ihm erlaubte, die Zeit so weit zurückzudrehen, bis er beweisen – kategorisch beweisen – konnte, wer über dem Opfer gestanden hatte, als es ermordet worden war; wer das Messer geführt hatte.
Richard gab «seinen» Mordopfern stets ein stummes Versprechen, und er tat es auch diesmal: Er würde den Mörder fassen. Was auch immer dazu erforderlich war. Er würde nicht eher ruhen, bis der Mörder von Aslan Kennedy hinter Gittern saß.
An der Rückwand des Raumes sah Richard plötzlich etwas aufblitzen. Er ging nachsehen, doch der winzige Lichtstrahl war genauso schnell wieder verschwunden, wie er aufgetaucht war. Richard drehte den Kopf ein winziges Stückchen nach rechts. Nein, nichts. Er drehte den Kopf zurück. Da. Da war es wieder.
Auf dem Fußboden lag etwas Glänzendes, das ihm bis jetzt nicht aufgefallen war.
«Was tun Sie denn da?», wollte Camille wissen, als Richard vor die Rückwand trat, sich auf Hände und Knie niederließ und anfing, den Boden abzusuchen.
«Was hat die denn hier zu suchen?», fragte er.
«Was ist das?» Camille trat zu ihrem Boss.
Richard musterte eine glänzende Reißzwecke, die lose auf dem Holzfußboden lag.
«Das ist eine Reißzwecke.»
«Das sehe ich. Und weshalb ist das wichtig?»
«Haben Sie die Zeugen da draußen nicht gesehen?», fragte Richard sie.
«Natürlich! Was ist mit denen?»
Richard wandte sich seiner Kollegin zu wie ein Zauberer kurz vor dem Höhepunkt eines extrem beeindruckenden Zaubertricks. «Diese Leute sind, wie Ihnen, meine liebe Camille, mit Sicherheit nicht entgangen ist, zum größten Teil barfuß.»
Camille zeigte sich absolut unbeeindruckt. «Und?»
«Und wer würde eine Reißzwecke einfach lose in einem Raum auf dem Fußboden liegen lassen, in dem die Menschen barfuß gehen?»
Camille wartete einen Augenblick, ehe sie antwortete. «Und das ist alles?»
«Was meinen Sie damit, ‹das ist alles›?», fragte Richard irritiert zurück.
«Das ist Ihre große Enthüllung? Dass sich am Tatort eine Reißzwecke befindet?»
«Nein, Camille, das habe ich nicht gesagt.»
«Aber ja doch. Ich habe Sie doch gehört.»
«Nein, haben Sie nicht. Sie haben mich sagen hören, die Reißzwecke habe lose auf dem Fußboden gelegen. Das ist der interessante Aspekt. Hätte ich beispielsweise –» er erhob sich und deutete auf die roh gezimmerten Holzstreben und Balken, aus denen das Teehaus konstruiert war, «an einem dieser Holzbalken eine Reißzwecke gefunden, wäre das weit weniger interessant gewesen. Denn das hätte lediglich zu bedeuten, dass jemand etwas an einen Balken gepinnt hat. Aber hier?» Richard zeigte auf die Reißzwecke, welche unschuldig auf dem polierten Dielenboden herumlag. «Wie ist sie dorthin gekommen? Wer hat sie fallen lassen?»
«Sie haben völlig recht», sagte Camille ausdruckslos. «Wir haben es mit einer mit Stichwunden übersäten Leiche zu tun, wir sollten uns wirklich dringend auf das winzige Metallteilchen konzentrieren, das wir am anderen Ende des Raums auf dem Fußboden gefunden haben. Ja! Ich glaube, Sie haben recht! Nicht auszudenken, wenn das Tranchiermesser, das wir neben der Leiche gefunden haben, nur der Ablenkung dient und der Mörder sein Opfer in Wirklichkeit mit einer Reißzwecke erstochen hat!»
Richard zog es vor, seine Untergebene zu ignorieren. Ohne ein weiteres Wort trat er ins Freie, zog sein Taschentuch heraus und tupfte sich die Stirn ab. Wirklich, dachte er. Sein Leben auf Saint-Marie war verpfuscht von diesem verflixten Sonnenschein. Der Hemdkragen scheuerte; der dunkle Schurwollstoff der Anzughose spannte sich dampfig klamm über seine Schenkel, und das Sakko drückte ihm glühend heiß auf Schultern und Rücken. In der Karibik einen Anzug zu tragen, war, wie in einer verflixten Hosenpresse zu leben. Aber was sollte er machen? Er musste einen Schurwollanzug tragen. Er war schließlich Detective Inspector. Und Detective Inspectors trugen nun mal dunkle Schurwollanzüge.
Richard sah, dass vor dem Haupthaus ein Krankenwagen vorgefahren war. Sanitäter luden gerade eine Trage aus.
«Nun gut, Camille», sagte er. «Ich möchte, dass Sie sich um die restlichen Zeugen kümmern, während ich mich mit der geständigen Mörderin unterhalte. Und veranlassen Sie die Sanitäter, Proben von den Zeugen zu nehmen. Blut und Urin.»
«Glauben Sie, der Tee war eventuell mit Betäubungsmittel versetzt?»
«Ich weiß es nicht. Jedenfalls war das ein ziemlich heftiger Angriff, und mich würde interessieren, ob hier irgendjemand unter dem Einfluss von irgendwas Ungewöhnlichem gestanden hat.»
Richard wandte sich dem jüngsten Mitglied seines Teams zu. «Fidel, Sie nehmen sich den Tatort vor – und stellen Sie sicher, dass Sie die Reißzwecke eintüten, die an der rückwärtigen Wand auf dem Fußboden liegt.»
Fidel sah seinen Boss an. «Sie wollen, dass ich eine Reißzwecke eintüte, Sir?»
«Ja.»
«Eine Reißzwecke, die an der rückwärtigen Wand auf dem Fußboden liegt?»
«Exakt.»
Ehe Fidel seinen Boss fragen konnte, weshalb er zur Beweissicherung eine Reißzwecke eingetütet haben wollte, wandte Richard sich ab und ging auf Julia zu, die noch immer unter Dwaynes Bewachung stand.
Im Gehen zog Richard einen kleinen Notizblock und einen kleinen silbernen Druckbleistift aus der Innentasche seines Jacketts.
Er klickte die Mine heraus und sagte: «Hallo. Ich bin Detective Inspector Richard Poole. Ich untersuche den Mord an dem Mann, den wir da drüben in dieser mit Papier bespannten Holzkonstruktion tot aufgefunden haben.»
Richard deutete auf das Teehaus, und Julia nickte langsam. Sie hatte offenbar verstanden. Richard warf Dwayne einen fragenden Blick zu, und der zuckte die Achseln, wie um zu sagen, ja, er teile Richards Einschätzung, die Zeugin sei in der Tat ein wenig langsam.
So sanft und einfühlsam er konnte, versuchte Richard herauszufinden, wer die Frau war und was geschehen war. In Wirklichkeit besaß Richard weder eine sanfte noch eine einfühlsame Seite – seine Vorstellung von derartigem Verhalten bestand darin, die Pausen zwischen den einzelnen Fragen auszudehnen –, doch wie er feststellen musste, besänftigte seine Art sich von ganz alleine, denn Julia war wunderschön. Sie brachte offenbar Richards väterliche Saite zum Klingen. Redete er sich zumindest ein. Während sie sprach, registrierte er ihre blau blitzenden Augen, registrierte den bronzenen Schimmer ihrer Haut, registrierte schließlich, wie ihre blonden Haare das karibische Sonnenlicht einzufangen und in goldenen Lichtstrahlen zu reflektieren schienen.
Der Name der jungen Frau lautete, wie sich herausstellte, Julia Higgins. Sie war dreiundzwanzig Jahre alt und hatte im Vorjahr an der Bournemouth University einen Abschluss in alternativen Heilverfahren gemacht. Seitdem war sie auf Reisen, um zu arbeiten, bis sie zu Jahresbeginn ins Retreat gekommen war, um hier Urlaub zu machen. Sie hatte ihren Aufenthalt unglaublich genossen und sich ausnehmend gut mit den Eigentümern Rianka und Aslan verstanden – so sehr, dass sie darum gebeten hatte, bleiben zu dürfen.
Julia war überrascht gewesen, als die beiden zustimmten, aber offensichtlich hätte das Timing gar nicht besser sein können. Rianka und Aslan hatten bereits seit einiger Zeit Verstärkung fürs Büro gesucht, und so boten sie Julia freie Unterkunft, ein bescheidenes Gehalt und, besonders wichtig, kostenlose Teilnahme an sämtlichen Therapien und Sessions an. Alles, was Julia im Gegenzug zu tun hatte, waren täglich ein paar Stunden Büroarbeit. Beide Seiten hatten von dieser Vereinbarung profitiert, und Julia hatte die letzten sechs Monate mit Freuden im Retreat gearbeitet.
Während Julia ihre Geschichte erzählte, versuchte Richard, sich darüber klarzuwerden, was genau ihn so verwirrte. Nach einer Weile kam er darauf. Julia stand eindeutig noch immer unter dem Schock ihrer Tat – wie hätte es auch anders sein können? –, aber sie benahm sich, als wäre sie genauso erpicht darauf, den Mörder zu überführen, wie Richard. Was reichlich seltsam war, wenn man davon ausging, dass sie die Tat begangen hatte.
«Dann sagen Sie mir bitte», bat Richard sie schließlich, weil er wusste, dass sich die Frage nicht länger aufschieben ließ, «haben Sie den Mann ermordet, den wir in jenem Gebäude dort gefunden haben?»
Julia blinzelte die Tränen weg, sah Richard tief in die Augen und sagte: «Sein Name ist Aslan Kennedy, und ich glaube schon.»
«Sie glauben es?»
Julia schluckte. Dann kam sie offenbar zu dem Schluss, dass Richard in diesem Punkt zu Recht auf Klarheit pochte. «Ich weiß es.»
«Sie wissen es?»
Julia nickte langsam und mit gerunzelter Stirn.
«Und können Sie mir erzählen, was passiert ist?»
«Das ist ja gerade der Punkt, den ich nicht verstehe. Ich weiß es nicht.»
«Sie wissen nicht, wie Sie ihn ermordet haben?» Richard tauschte einen Blick mit Dwayne. Was sollte das denn heißen?
Julia erzählte, wie sehr sie sich auf die Sunrise-Healing-Session gefreut hatte. Es war das einzige Angebot im Kursprogramm vom Retreat, das Aslan noch immer selbst anleitete.
«Wir sind also alle in die Meditationshalle gegangen», sagte sie.
«Meditationshalle?», hakte Richard nach.
Julia zeigte auf das japanische Teehaus. «So nennen Aslan und Rianka das Gebäude da.»
«Und wer ging mit Ihnen dort hinein?»
Julia dachte kurz nach. «Aslan … und vier Gäste. Saskia, Paul, Ann und Ben.»
«Sie waren also insgesamt zu sechst?»
«Genau», sagte Julia. «Als Aslan die Tür verriegelte, waren wir fünf Teilnehmer plus Aslan.»
Richard spürte Dwaynes Blick auf sich. Sie dachten beide dasselbe.
«Würden Sie das bitte wiederholen?», sagte Richard. «Er hat die Tür verriegelt?»
«Ja, genau.» Julia war verwirrt. «Die Tür hat ein Fallenschloss. Sie wissen schon, so eins, wo der Riegel von selbst ins Schloss fällt. Und Aslan hat die Tür geschlossen, ehe wir uns auf die Matten setzten. Er sagte, er wolle nicht, dass wir gestört werden.»
«Verstehe.» Richard machte sich eine Notiz. «Und was geschah dann?»
«Also», begann Julia. «Wir nahmen auf unseren Matten Platz und tranken gemeinsam eine Schale Tee. Das dient vor dem Beginn der Session der Entspannung. Dann legten wir die Schlafmasken an, setzten die Kopfhörer auf und legten uns auf die Matten. Nur Aslan bleibt während der Session meistens sitzen, im vollen Lotus. Er hat viel größere Übung, einen autogenen Zustand zu erreichen, als der Rest von uns.»
«Verstehe», sagte Richard, obwohl er kein Wort verstand. «Und was ist ein autogener Zustand?»
«Ein Zustand vollkommener Entspannung, und genau darum geht es im Sunrise Healing. Man legt sich hin, setzt Kopfhörer und Schlafmaske auf, und dann lässt man den Geist schweifen und gibt sich vollkommen den Klängen der Natur und den Sonnenstrahlen hin. Es ist, als würde man an eine Aufladestation angeschlossen. Eine halbe Stunde später kommt man wieder zu sich und ist voller Energie. Aber als ich diesmal wieder zu mir kam, stand ich über Aslans Körper gebeugt und hatte ein Messer in der Hand … Ich habe ihn umgebracht.»
Bei diesen Worten hob Julia die blutige Hand und sah sie an, als könnte sie kaum fassen, dass sie zu ihrem Körper gehörte.
Richard bemerkte, dass Julia die linke Hand erhoben hatte.
«Sagen Sie mal», fragte er so beiläufig wie möglich, «sind Sie eigentlich Linkshänderin?»
«Ja», antwortete Julia, sichtlich verwirrt über die Frage. «Warum?»
Richard lächelte vage. «Nur so.»
«Es war wie eine außerkörperliche Erfahrung. Ich sah mich selbst, das Messer in der Hand … aber wenn ich ehrlich bin, erinnere ich mich nicht an den Augenblick. Sie wissen schon, als … ich stand einfach nur da, mit dem Messer in der Hand. Und der arme Mann lag zu meinen Füßen … und regte sich nicht …!»
Überwältigt von ihren Erinnerungen, fing Julia an zu weinen. Richard warf Dwayne einen panischen Blick zu. Situationen wie diese überforderten ihn.
Dwayne sprang ihm zur Seite. «Na, na, na. Wir müssen das nicht jetzt besprechen. Wir nehmen Sie jetzt mit auf die Station und besorgen Ihnen einen Anwalt. Ihre Aussage können wir genauso gut später aufnehmen.»
Julia drehte sich mit dankbarem Blick zu Dwayne um und wischte sich die Tränen von den Wangen.
«Nein», sagte sie nach einer kleinen Weile. «Sie müssen wissen, was passiert ist. Das bin ich Aslan schuldig.»
Richard war absolut baff. Seit wann hatten geständige Mörder das Gefühl, der Person, die sie soeben ins Jenseits befördert hatten, etwas schuldig zu sein? Dwayne warf seinem Boss einen Blick zu und zuckte die Achseln, um anzudeuten, dass sie vielleicht doch mit der Befragung weitermachen sollten.
«Okay», sagte Richard. «Aber keine Sorge, es sind nur noch wenige Fragen.»
Binnen kürzester Zeit verschaffte Richard sich die restlichen Details. Julia war in der Lage, ihnen zu erklären, dass sie keinerlei Groll gegen Aslan hegte. Im Gegenteil, sie mochte ihn. Weshalb sie ja auch so erstaunt darüber war, dass sie ihn ermordet hatte. Darüber hinaus hegte sie nicht nur eine tiefe Abneigung gegen Messer im Allgemeinen, sie hatte auch keine Ahnung, woher sie das Messer hatte, mit dem sie ihn getötet hatte, oder wie es ihr gelungen war, die Waffe in den Meditationsraum hineinzuschmuggeln.
Richard kam zu dem Schluss, dass Julia, was den Mord betraf, genauso verblüfft war wie er selbst.
«Fassen wir zusammen», sagte Richard mit einem Blick auf seine Notizen. «Sie sagen, Sie haben kein Motiv. Sie haben keine Ahnung, woher das Messer kam. Sie wissen nicht, auf welchem Weg Sie es mit in den Meditationsraum genommen haben. An den Mord selbst haben Sie keinerlei Erinnerung – und trotzdem bestehen Sie darauf, den Mord an Aslan Kennedy zu gestehen?»
Julia sah Richard an. «Aber das muss ich doch. Ich bin es gewesen. Ich habe ihn umgebracht.»
Richard blickte zu Dwayne, Dwayne blickte zu Richard. Sie zuckten die Achseln. Ein Geständnis war ein Geständnis. Dwayne holte die Handschellen hervor und machte sich daran, Julias Handgelenke zu fesseln. Dabei erklärte er ihr ihre Rechte.
«Julia Higgins. Ich verhafte Sie wegen des Verdachts auf Mord an Aslan Kennedy. Sie können die Aussage verweigern. Sollten Sie bei der Vernehmung jedoch etwas verschweigen, auf das Sie sich später vor Gericht berufen wollen, kann dies gegen Sie verwendet werden. Alles, was Sie ab jetzt sagen, kann als Beweis verwendet werden.»
«Darf ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen?», sagte Richard.
«Natürlich.»
«Wissen Sie, weshalb auf dem Fußboden in der Meditationshalle eine Reißzwecke lag?»
«Was für eine Reißzwecke?»
Und damit war die Vernehmung beendet.
Während Dwayne Julia abführte, nahm Richard sich einen Augenblick Zeit, um seine Umgebung zu mustern. Das alte Herrenhaus und jetzige Hauptgebäude des Resorts stand inmitten manikürter Rasenflächen und hätte gut in das French Quarter von New Orleans gepasst. Überall schmiedeeiserne Balkönchen und weiß getünchte Holzplanken. Doch auch die übrigen über das Gelände verstreuten Bauten entgingen Richard nicht. Auf einer etwas abseits gelegenen Lichtung stand eine rotgoldene Konstruktion, die aussah wie ein Shinto-Schrein; auf einer anderen ein Wandelgang aus mit Wein überrankten korinthischen Säulen, die direkt aus dem antiken Griechenland zu kommen schienen; und auf einem Felsvorsprung hoch über dem glitzernden Meer thronte eine Art thailändischer Tempel mit dem typischen Steildach in Kupfergrün.
All das war nach Richards Empfinden ziemlich seltsam und zusammengewürfelt. Was die übrigen Hotelgäste anbetraf, so hatten sie sich offenbar in Luft aufgelöst, doch als Richard genauer hinsah, entdeckte er zumindest unten am Strand ein Grüppchen von Gästen, die zu ihm heraufsahen.
Camille kam vom Haupthaus her über den Rasen gelaufen, und er ging ihr entgegen.
«Okay», sagte sie. «Ich habe Rianka in ihr Zimmer geschickt und gesagt, ich komme, sobald ich kann. Was die anderen Zeugen betrifft, die gehen sich gerade umziehen. Ich habe ihnen gesagt, wir treffen uns danach beim Krankenwagen, um Proben zu nehmen.»
«Gute Arbeit, Camille. Danke sehr.»
«Und? Was hat Julia gesagt? Ist sie es gewesen?»
«Oh ja. Sie hat ein volles Geständnis abgelegt.»
Camille musterte ihren Chef und verlagerte das Gewicht auf eine Hüfte. Ein misstrauischer Ausdruck trat in ihre Augen. «Aber …?»
«Ich weiß nicht, sie hat einfach keine besonders gute Erklärung für den Mord liefern können.»
«Nicht?»
«Nein. Zum Beispiel konnte sie keinen einzigen Grund nennen, weshalb sie den Verstorbenen hätte umbringen sollen. Im Gegenteil. Sie hat betont, wie sehr sie ihn mochte. Und sie hat nicht nur angegeben, das Messer noch nie zuvor gesehen zu haben, mit dem sie ihn ermordete, sie hat auch keinen blassen Schimmer, wo es hergekommen ist.»
«Aber das muss sie doch sagen, wenn sie die Mörderin ist. Sie lügt.»
«Ich weiß. Aber da sie den Mord bereits gestanden hat, will mir nicht in den Sinn, weshalb sie sich noch die Mühe macht zu lügen, was Motiv, Tathergang oder Gelegenheit betrifft. «
Camille erkannte eine gewisse Logik in dem, was Richard ihr zu sagen versuchte.
«Außerdem ist sie Linkshänderin», sagte er.
«Ach so?»
«Behauptet sie zumindest.»
«Vielleicht versucht sie, Sie reinzulegen.»
«Vielleicht.»
Camille kannte ihren Boss. «Sie glauben nicht, dass sie es gewesen ist, oder?»
«Ich weiß nicht, was ich glauben soll – das passt definitiv alles nicht zusammen. Noch nicht. Nicht, solange sie uns keine triftige Vorgehensweise, kein Motiv und keine Gelegenheit nennen kann. Und da wäre noch etwas.» Richard unterbrach sich kurz und wandte den Blick zurück zu dem japanischen Teehaus. «Es geht um dieses Gebäude. Julia sagte nämlich auch noch, Aslan hätte sie und die anderen eingeschlossen, ehe sie mit der Meditation begonnen hätten.»
«Und?»
Richard musterte seine Kollegin. «Na, das liegt doch wohl auf der Hand!»
Camille konnte ihm offensichtlich nicht ganz folgen, und er war gezwungen, seinen Gedankengang zu erläutern.
«Welcher Mörder, der noch ganz bei Verstand ist, würde sich freiwillig mit vier potenziellen Zeugen in einen Raum sperren lassen, um dort einen Mord zu begehen?»
Camille machte ein nachdenkliches Gesicht. Einen Augenblick später sagte sie: «Oh. Ich verstehe, was Sie meinen.»
«Exakt. Wieso nicht nachts zur Tat schreiten? Oder wenn das Opfer allein ist?»
Richards Blick schweifte wieder zu dem japanischen Teehaus hinüber.
«Wenn Sie mich fragen, ist irgendetwas an diesem Gebäude von großer Bedeutung. Etwas, worauf wir noch nicht gekommen sind. Entweder hat es mit der Konstruktion zu tun oder mit dem Standort, jedenfalls ist das Opfer am helllichten Tag und umgeben von einem Haufen potenzieller Zeugen absichtlich dort ermordet worden. Die Frage lautet: Warum?»
Zwei
Während Fidel den Tatort untersuchte, beaufsichtigte Camille die Blutabnahme der übrigen vier Zeugen durch die Sanitäter. Richard stand im Schatten einer nahen Palme und behielt den Überblick. Was natürlich keineswegs bedeutete, dass Richard irgendwo in der Nähe der betreffenden Schatten spendenden Palme stand. Er hatte schon vor langem gelernt, dass der kerzengerade Stamm einer Kokospalme viel zu schmal war, um ausreichend Schatten und Schutz vor dem grässlich glühenden Tropensonnenschein zu spenden. Richards Technik bestand darin, dem schmalen, vom Stamm produzierten Schattenstreifen zu folgen, bis er schließlich an dem sehr viel größeren Schattenfleck angelangte, den der Palmwedelbusch am Wipfel des Baumes warf.
Weswegen jeder Beobachter dieser Szene Richard mitten auf einer vollkommen dem Sonnenlicht ausgesetzten Rasenfläche in seinem privaten Fleckchen Finsternis hätte brüten sehen. Doch er wollte die Gelegenheit nutzen und sich ein wenig Zeit nehmen, die vier übrigen Zeugen im Kontakt mit Camille zu beobachten. Schließen waren sie alle eben noch in einen Raum gesperrt gewesen, in dem ein brutaler Mord geschehen war. Wie gingen sie damit um?
Richard hatte sich vom Empfang des Resorts bereits die Gästedaten der Zeugen aushändigen lassen.
Im Augenblick sah er Camille mit einer Frau sprechen, die er als Saskia Filbee identifizierte. Laut Fotokopie ihres Reisepasses war sie zweiundvierzig Jahre alt. Und laut Meldeformular des Hotels lebte sie in Walthamstow und arbeitete als Sekretärin in London. Auch sie hatte sich inzwischen umgezogen. Richard bemerkte, dass sie sich für ein dem Anlass angemessenes dunkelblaues Kleid mit Glockenrock entschieden hatte. Außerdem verriet ihm die Art und Weise, wie Saskia Camille zuhörte, den Kopf leicht zur Seite geneigt, dass sie ein Mensch war, der sich gerne sagen ließ, wo’s langging.
Er sah Saskia nicken, dann ging sie zu den Sanitätern hinüber. Ja, dachte Richard, Saskia war die typische Sekretärin, praktisch veranlagt und vernünftig. Sie würde sich selbstverständlich freiwillig bereit erklären, eine Blutprobe abzugeben.
Richard blätterte weiter in den Meldeformularen, die er in Händen hielt, und landete als Nächstes bei Paul und Ann Sellars. Ann war laut Pass fünfundvierzig Jahre alt und in Birmingham geboren. Der Anmeldebogen verriet, dass sie Hausfrau war, und obwohl sie recht füllig wirkte, strahlte sie die Energie einer Frau in mittleren Jahren aus, die, anstatt daran zu verzweifeln, wie sehr sie sich «hatte gehen lassen», beschlossen hatte, diesen Umstand zu akzeptieren und offensiv damit umzugehen.
Um ihren Hals glitzerte eine protzige Goldkette, die Handgelenke waren gleichermaßen mit Glitzer behangen, und die leuchtend blaue Hose und goldglänzende Schläppchen schienen einem arabischen Albtraum entsprungen zu sein. Dazu trug sie eine fürchterlich fuchsiafarbene Flatterbluse. Das schrille Ensemble wurde von einem um die Schultern drapierten Seidenschal abgerundet, der offenbar sämtliche Farben der Welt in sich vereinte, die man in der Natur vergeblich suchte. Neonblaue Wirbel zogen gegen psychedelische Grüntöne zu Felde und unterlagen den erbarmungslosen Attacken von fluoreszierenden Gelbtönen.
Die Art und Weise, wie Ann mit Camille sprach – mit wilden, windmühlenartigen Gesten deutete sie vom Haus hinüber zum Meditationsraum und dann weiter zu den Sanitätern –, verriet Richard, dass Anns Persönlichkeit mindestens so grell und extrovertiert war wie ihre Kleidung.
Dann sah Richard einen Mann in hellbraunen Chinos, braunen Segelschuhen und weißem Hemd mit kurzen Ärmeln zu Ann treten. Seinen Unterlagen nach handelte es sich um Paul Sellars, Anns zweiundfünfzig Jahre alten Ehemann. Er arbeitete als Apotheker in einer Drogerie in Nottingham, wo er und Ann auch zu Hause waren. Richard sah zu, wie Paul Ann beruhigte. Dabei fiel ihm sofort auf, dass ihr Ehemann das absolute Gegenteil der schrillen Ann war.
Zuerst einmal war er spindeldürr. Außerdem beinahe vollständig kahl. Doch daran lag es nicht. Es war sein Verhalten, das so völlig anders war als ihres. Paul wirkte ausgeglichen, gewinnend. Eine Führungspersönlichkeit. Es bedurfte nur einiger Worte. Was auch immer er zu ihr gesagt hatte, Ann beruhigte sich und sah ihren Ehemann an, als würde sie auf weitere Anweisungen warten. Und genau die schien er ihr zu geben, denn als er zu den Sanitätern hinüberdeutete, begriff Ann offenbar endlich, was von ihr erwartet wurde, und begab sich widerstandslos zum Krankenwagen, um sich Blut abnehmen zu lassen.
Camille dankte Paul für seine Unterstützung, Paul lächelte flüchtig und nickte knapp. Paul war eindeutig ein ziemlich kompetenter Mensch.
Blieb nur noch ein Zeuge übrig. Ben Jenkins, mit dem Richard vorhin bereits kurz gesprochen hatte. Die Kopie des Reisepasses verriet ihm, dass Ben fünfzig Jahre alt war und aus Leeds stammte. Die aktuelle Adresse jedoch hatte er mit Vilamoura, Portugal, angegeben.