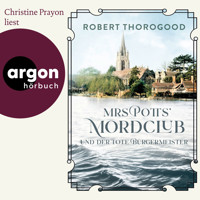9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mord ist Potts' Hobby
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein mörderisches Hobby: Judith Potts und der Marlow Murder Club ermitteln in einem rätselhaften Mordfall! Simply wonderful: Der gute alte englische Krimi ist zurück! Als die leicht exzentrische Judith Potts Zeugin eines Mordes auf dem Nachbargrundstück wird und die Polizei ihr nicht glaubt, nimmt die resolute Seniorin die Sache selbst in die Hand. Die siebenundsiebzigjährige Misses Potts lebt allein in einem verfallenen Herrenhaus im idyllischen Marlow und arbeitet als Kreuzworträtsel-Autorin. Ihr beschaulicher Alltag mit gelegentlichem Nacktschwimmen in der Themse und dem ein oder anderen Whisky wird jäh gestört, als sie Zeugin eines Verbrechens wird. Weil von der Leiche jede Spur fehlt, gründet Judith kurzerhand den »Marlow Murder Club« mit zwei Mitstreiterinnen. Als es zu einem weiteren Mord kommt, tauchen die Hobby-Detektivinnen tief in die Ermittlungen ein, um das Rätsel zu lösen. Ein humorvoller Cosy Crime voller Überraschungen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Ähnliche
Robert Thorogood
Mrs Potts’ Mordclubund der tote Nachbar
Kriminalroman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Robert Thorogood
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Robert Thorogood
Robert Thorogood ist ein englischer Drehbuchautor und Romancier. Er ist vor allem als Schöpfer der international gefeierten BBC-Krimiserie »Death in Paradise« bekannt und hat eine Reihe von Spin-Off-Romanen mit dem Detektiv DIRichard Poole geschrieben.
Ingo Herzke, geboren 1966, lebt in Hamburg und übersetzt aus dem Englischen, u.a. Alan Bennett, A.M. Homes, Bret Easton Ellis, A.L. Kennedy und Gary Shteyngart.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die siebenundsiebzigjährige Judith Potts lebt allein in einem verfallenen Herrenhaus im idyllischen Marlow und arbeitet als Kreuzworträtsel-Autorin. Sie genießt ihren beschaulichen, selbstbestimmten Alltag mit gelegentlichem Nacktschwimmen in der Themse und dem ein oder anderen Whisky. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als sie Zeugin eines Mordes auf dem Nachbargrundstück wird. Weil es aber zunächst weit und breit von der Leiche keine Spur gibt und die ansässige Polizei den Fall nicht ernst nimmt, beginnt Judith, auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei lernt sie die Hundesitterin Suzie und die neurotische Pfarrersfrau Becks kennen, die ihr fortan als »Marlow Murder Club« bei den Ermittlungen helfen. Als es zu einem weiteren Mord kommt, erscheint der Fall immer rätselhafter.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Danksagungen
Leseprobe »Mrs Potts’ Mordclub und der tote Bräutigam«
Für Katie B
Kapitel 1
Mrs Judith Potts war 77 Jahre alt und mit ihrem Leben überaus zufrieden. Sie lebte in einem alten Herrenhaus an der Themse, sie hatte einen Beruf, der sie erfüllte und der gerade genug von ihrer Zeit in Anspruch nahm, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das Beste war, dass sie ihr Leben nicht mit einem Mann teilen musste: Niemand fragte sie, was es heute zum Abendessen gab, niemand wollte wissen, wohin sie ging, wenn sie das Haus verließ, niemand stöhnte, dass sie zu viel Geld für den Whisky ausgab, von dem sie sich jeden Abend gegen 18 Uhr ein kleines Glas genehmigte.
An dem Tag, als Judiths Leben eine Wendung nahm, herrschte Hochsommer, und England litt seit Wochen unter einer Hitzewelle. Sie hatte alle Fenster geöffnet, um ein wenig von dem Lüftchen einzufangen, das durchs Tal wehte, aber der Unterschied war kaum zu spüren. Die Sonnenglut war längst in die Ziegel und Balken ihres Hauses eingedrungen, in die Treppe aus Eichenholz und die Brüstung im Obergeschoss.
Nachdem sie vor den Fernsehnachrichten ihr Abendessen eingenommen hatte, stellte sie den leeren Teller beiseite und nahm sich die neueste Ausgabe des Magazins Der Rätselfreund vor. Sie entschied sich für ein Logikrätsel und machte sich an die Lösung. Normalerweise bereitete es ihr große Freude, den Text der Hinweise auf mathematische Einsen und Nullen zu reduzieren, aber an diesem Abend war sie einfach nicht bei der Sache. Es war zu warm, um sich zu konzentrieren.
Judith griff gedankenverloren nach dem Schlüssel, den sie an einer Kette um den Hals trug, und ihr Geist schweifte in die Vergangenheit ab, in eine sehr düstere Zeit. Sie sprang auf. So nicht, sagte sie sich. Das geht ganz und gar nicht. Es gab genug andere Dinge, mit denen sie sich beschäftigen konnte. Sie brauchte bloß einen Tapetenwechsel, und sie hatte die perfekte Lösung.
Judith fing an, sich auszuziehen. Mit jedem Kleidungsstück, dessen sie sich entledigte, befreite sie sich ein bisschen mehr von den erstickenden Zwängen des Tages. Als sie nackt war, summte sie vor schelmischer Freude. Sie durchquerte die Eingangshalle, vorbei am Blüthner-Flügel, auf dem sie immer nur spielte, wenn sie sehr betrunken war, und griff nach dem dunkelgrauen wollenen Umhang, den sie stets neben der Haustür hängen hatte. Dieser Umhang war Judiths wertvollster Besitz. Sie erzählte jedem, der sie danach fragte – und das taten viele –, dass er sie im Winter warm halte, ihr im Sommer als Picknickdecke diene und sie ihn sich über den Kopf ziehen könne, falls sie im Frühling ein Regenguss überraschte.
Vor allem aber war Judith überzeugt, dass es sich um einen Tarnumhang handelte. Jeden Abend, bei Regen wie bei Sonnenschein, zog sie sich nackt aus, wickelte sich in den Umhang und verließ ihr Haus, wobei ihr ein herrlicher Schauer über den Rücken lief, weil sie etwas so Ungezogenes tat. Sie stieg in ein Paar uralte Gummistiefel und schritt durch das kniehohe Gras – wusch, wusch, wusch – zu ihrem Bootshaus. Wie der Rest von Judiths Haus war es aus Fachwerk mit rötlichen Ziegeln, an denen schon der Zahn der Zeit nagte. Judith betrat den dunklen Raum mit den vielen Spinnweben und streifte die Gummistiefel ab. Sie hängte ihren Umhang an einen alten Haken und stieg, vor der Außenwelt immer noch durch zwei alte Bootshaustüren verborgen, die steinerne Bootsrampe hinab und in die Themse hinein.
Das kalte Wasser auf ihrer Haut zu spüren war beinahe eine religiöse Erfahrung für sie, und sie atmete zischend aus, während sie sich vorbeugte und sich in die Umarmung des Flusses begab. Plötzlich war sie schwerelos, ließ sich tragen vom Wasser, das sich weich anfühlte wie feine Seide.
Sie schwamm stromaufwärts. Die Abendsonne glitzerte auf dem Wasser wie Diamanten. Judith lächelte in sich hinein. Sie lächelte immer in sich hinein, wenn sie schwamm. Sie konnte nicht anders. Schließlich konnte es gut sein, dass auf dem Thames Path gerade jemand mit seinem Hund Gassi ging, und als sie den Turm der Kirche von Marlow betrachtete und die viktorianische Hängebrücke, die die Stadt mit dem Nachbardorf Bisham verband, waren definitiv eine Menge Leute in der Nähe. Keiner von ihnen wusste, dass ganz in der Nähe eine 77-jährige Frau völlig nackt im Fluss schwamm.
Gerade als Judith dachte: Ist das ein herrliches Leben!, hörte sie einen Schrei.
Er kam vom gegenüberliegenden Flussufer, irgendwo in der Nähe des Hauses ihres Nachbarn Stefan Dunwoody. Aber hier unten vom Wasser aus konnte Judith nicht genau sehen, was vor sich ging. Von Stefans Haus war oberhalb des dichten Schilfs am Flussufer nur das Dach zu sehen.
Judith lauschte angestrengt, aber jetzt war wieder alles still. Sie beschloss, dass es ein Tier gewesen sein musste. Ein Hund oder ein Fuchs vielleicht.
Und dann hörte sie eine Männerstimme rufen: »Hey, nein!«
Was in aller Welt war da los?
»Stefan, sind Sie das?«, rief Judith vom Fluss aus, doch in ihre Worte hinein fiel ein Schuss.
»Stefan?«, rief sie noch einmal. Panik stieg in ihr auf. »Alles in Ordnung mit Ihnen?« Jetzt war es still. Aber Judith wusste, was sie gehört hatte. Jemand hatte eine Waffe abgefeuert, oder etwa nicht? Und direkt zuvor hatte Stefan etwas gerufen. Was, wenn der Schuss ihn getroffen hatte und er blutete und Hilfe benötigte?
Judith schwamm, so schnell sie konnte, in Richtung von Stefans Haus, doch als sie sich dem Flussufer näherte, wurde ihr klar, dass sie ein Problem hatte. Hinter dem Schilf hatte Stefan die Rasenkante mit Wellblech abgedeckt, um sie vor der Erosion durch den Fluss zu schützen. Judith wusste, wenn sie durch das Schilfrohr schwamm, würden die scharfen Kanten sie zerfleischen, und selbst wenn sie es bis ans Ufer schaffte, würde es ihr nicht gelingen, sich an Land zu ziehen. Sie hätte nicht die Kraft dazu.
Vor sich sah sie ein blaues Kanu, das sich im Schilf verkeilt hatte. Konnte sie das irgendwie benutzen, um ihren Körper aus dem Wasser zu hieven? Sie versuchte, ein Ende zu ergreifen, aber sie konnte es nicht richtig packen, das Kanu wippte wie ein Korken im Wasser auf und ab, und ihr wurde klar, dass sie sowieso nicht über die nötige Balance verfügte, um hineinzuklettern. Dennoch versuchte sie es ein letztes Mal, und diesmal gelang es ihr tatsächlich, sich am hinteren Ende emporzuziehen. Und dann, ganz langsam, drehte sich das Kanu um die eigene Achse, und sie verlor den Halt und plumpste mit einem unbeholfenen Platscher zurück ins Wasser.
Sie holte Luft und schüttelte sich das Wasser aus den Haaren. Das Kanu kam nicht infrage. Was konnte sie sonst tun?
Judith schwamm zurück in die Mitte des Flusses und hielt verzweifelt nach jemandem Ausschau, der helfen konnte. Wo waren die Hundebesitzer und die Liebespärchen, wenn man sie brauchte? Niemand war zu sehen. Dann gab es nur eins. Sie machte kehrt und schwamm, so schnell sie konnte, heim.
Als sie ihr Bootshaus erreichte, kletterte Judith keuchend aus dem Wasser. Nun galt es, keine Zeit zu verlieren. Sie warf ihren Umhang über, trat auf den Rasen hinaus und drehte sich um, um zu sehen, wie viel von Stefans Haus sie von hier aus überblicken konnte. Hinter der Trauerweide, die auf ihrer Seite des Flussufers unkontrolliert vor sich hin wuchs, sah man lediglich die Hälfte seines Gartens.
Sie rannte ins Haus, schnappte sich ihr Telefon und wählte 999. Während sie darauf wartete, dass die Verbindung aufgebaut wurde, ging sie zum Erkerfenster, um Stefans Grundstück im Auge zu behalten.
»Ich brauche die Polizei!«, sagte Judith, als jemand den Anruf entgegennahm. »Im Haus meines Nachbarn wurde geschossen! Schnell! Man hat auf jemanden geschossen!«
Die Telefonistin notierte Stefans Adresse und schrieb auf, was Judith gesehen hatte, teilte ihr mit, der Rettungsdienst sei unterwegs, und beendete dann das Gespräch. Judith war zutiefst frustriert. Es musste doch noch irgendetwas anderes geben, das sie tun konnte, oder jemanden, den sie anrufen konnte. Vielleicht die Küstenwache? Schließlich hatte sich der Vorfall quasi am Wasser ereignet. Oder die Seenotrettungsorganisation?
Judith spähte aus ihrem Fenster zu Stefans Grundstück hin. Es lag da wie immer, scheinbar unschuldig, in der Abendsonne.
Hätte sich in diesem Moment jemand draußen auf dem Fluss befunden und Gelegenheit gehabt, zu Judiths Villa hinaufzublicken, dann hätte er eine ziemlich kleine und dickliche Frau Ende siebzig mit zerzaustem grauem Haar gesehen, die völlig nackt an ihrem Erkerfenster stand, nur bekleidet mit einem Umhang, den sie um die Schultern trug, als wäre sie so etwas wie eine Superheldin. Was sie in vielerlei Hinsicht auch war.
Sie wusste es nur noch nicht.
Kapitel 2
Eine halbe Stunde später sah Judith, wie ein Streifenwagen auf Stefans Grundstück fuhr und ein uniformierter Polizist ausstieg. So gut es ging, hielt Judith ihr Fernglas auf ihn gerichtet, während er durch die Fenster in Stefans Haus schaute und durch den Garten schlenderte. Sie hätte den Mann am liebsten über den Fluss hinweg angebrüllt, er solle sich gefälligst etwas mehr Mühe geben, aber sie hielt sich im Zaum. Sie musste annehmen, dass er wusste, was er tat. Was auch immer dort drüben vorgefallen war, er würde Spuren davon finden.
Doch nach nur zwanzig Minuten einer Suche, die Judith bestenfalls als flüchtig bezeichnen konnte, kehrte der Polizist zu seinem Wagen zurück, stieg ein und fuhr davon.
Das war alles? Der Mann hatte kaum den Garten erkundet, ja er hatte nicht einmal Stefans Haus betreten. Vielleicht war er wieder gefahren, um Verstärkung zu holen? Also spähte sie weiterhin hinüber. Sie spähte und spähte.
Um Mitternacht fiel Judith auf, dass in der Karaffe auf dem kleinen Tisch neben ihr kein Whisky mehr war. Das war stets das Signal, ins Bett zu gehen. Während sie benommen die schwere Eichentreppe hinaufstieg, stellte sie fest, dass sie sich etwas fester als sonst an das Geländer klammern musste. Als sie oben war, bog sie nach links zu ihrem Schlafzimmer ab, obwohl es zu ihrer Rechten lag, doch sobald sie nach einer kurzen Auseinandersetzung mit einer widerspenstigen Schusterpalme ihren Kurs korrigierte, kam sie sicher ans Ziel.
Judith liebte ihr Schlafzimmer. Die Holzpaneele waren hellgrün gestrichen, davor stand ein majestätisches Himmelbett mit einem Gobelin als Baldachin, in den eine mittelalterliche Jagdszene gewebt war. Dass der Raum von getragener Kleidung, halb gegessenen Mahlzeiten und Stapeln alter Zeitungen und Zeitschriften übersät war, störte sie nicht im Geringsten. Judith fiel das Durcheinander gar nicht auf. Sie ließ sich davon auf die gleiche Weise umarmen, wie sie sich beim Schwimmen immer in die Umarmung des Flusses begab. Je unordentlicher ihr Schlafzimmer war, desto geborgener und sicherer fühlte sie sich.
Am folgenden Morgen erwachte Judith vom Klingeln des Telefons. Sie ergriff den Hörer und sah benommen, dass es gerade zehn Uhr geworden war.
»Hallo«, krächzte sie.
»Guten Morgen«, sagte eine effizient klingende Frauenstimme. »Ich bin Detective Sergeant Tanika Malik vom Polizeirevier Maidenhead. Es geht um den Vorfall auf Mr Dunwoodys Anwesen, den Sie gestern Abend gemeldet haben.«
»Ah, danke für Ihren Anruf«, sagte Judith, noch immer etwas benommen.
DS Malik erklärte, sie habe einen Constable zu Mr Dunwoody geschickt, um dessen Haus und Garten zu inspizieren. Er habe nichts Bemerkenswertes entdeckt, daher rufe sie jetzt an, um Judith mitzuteilen, dass sie sich keine Sorgen machen müsse.
»Aber ich weiß, was ich gehört habe!«, sagte Judith.
»Ja, im Bericht heißt es, Sie hätten einen Schuss gehört.«
»Nicht nur einen Schuss. Ich habe gehört, wie jemand so etwas wie ›Hey, nein!‹ rief, und dann kam der Schuss.«
»Aber wenn ich das richtig sehe, schwammen Sie in dem Moment gerade im Fluss. Sind Sie sicher, dass es tatsächlich ein Schuss war?«
Judith war jetzt hellwach und hellauf entgeistert. »Ich bin auf einer Farm aufgewachsen. Ich weiß, wie sich eine Waffe anhört.«
»Aber was, wenn es doch etwas anderes war?«
»Was denn?«
»Nun zum Beispiel die Fehlzündung eines Autos?«
Das war Judith noch gar nicht in den Sinn gekommen. Sie dachte einen Moment nach, bevor sie antwortete. »Nein. Ich bin mir sicher, ich hätte es gemerkt, wenn es ein Auto gewesen wäre. Es war ein Schuss. Ich nehme an, Ihr Constable hat berichtet, dass Stefans Auto immer noch vor seinem Haus parkt?«
»Warum erwähnen Sie das?«
»Weil ich vermute, dass Stefan nicht ans Telefon gegangen ist, als Sie ihn angerufen haben, oder etwa doch?«
»Tut mir leid, ich kann Ihrem Gedankengang nicht ganz folgen. Was für ein Anruf?«
»Sie müssen doch gestern Abend bei ihm angerufen haben.«
»Ich fürchte, solche konkreten Einzelheiten darf ich Ihnen nicht mitteilen.«
»Eine Nachbarin meldet eine Schießerei in einem Haus, da haben Sie natürlich angerufen, um nachzuforschen, was mit ihm ist. Und die Tatsache, dass Sie mir nicht erzählt haben, dass er ans Telefon gegangen ist, deutet für mich darauf hin, dass er das nicht getan hat. Da sein Auto aber immer noch in seiner Einfahrt steht, kann das für mich nur bedeuten, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Wenn man zu Hause ist, geht man schließlich ans Telefon. Wenn man fort ist, nimmt man sein Auto. Zumindest wenn man ein Auto besitzt. Ich besitze keins.«
DS Malik reagierte nicht sofort.
»Sie haben das alles wirklich gut durchdacht«, sagte sie schließlich.
»Letzten Abend konnte ich an nichts anderes denken. Ich machte mir solche Sorgen um Stefan. Was, wenn er angeschossen wurde und der Schütze geflohen ist? Was, wenn Stefan in diesem Moment blutend in einem Graben liegt?«
»Ich glaube nicht, dass er in einem Graben liegt. Ich bin mir sicher, dass es für all das eine ganz harmlose Erklärung gibt. Auf seinem Grundstück gab es keinerlei Hinweise darauf, dass etwas Ungewöhnliches passiert ist, und dass jemand sein Telefon ignoriert, ist auch nicht so selten. Wir haben Ferienzeit. Viele Leute sind verreist. Ich bin mir sicher, Mr Dunwoody wird in den nächsten Tagen wieder auftauchen. Und sobald er es tut, sage ich Ihnen Bescheid. Machen Sie sich bitte keine Sorgen.«
DS Malik dankte Judith noch dafür, dass sie so eine engagierte Nachbarin war, dann legte sie auf.
Hinterher lag Judith im Bett und wusste nicht, was sie tun sollte. Hatte DS Malik recht? Gab es tatsächlich eine ganz simple Erklärung für das, was sie am Abend zuvor gehört hatte? Denn eines wusste Judith ganz sicher: Morde gab es in Marlow schlichtweg nicht.
Sie beschloss, nicht mehr an den Vorfall zu denken und stattdessen zu erledigen, was sie sich für den Tag vorgenommen hatte.
1976 hatte Judith das Haus ihrer Großtante Betty und dazu ein Aktienportfolio geerbt, das ihr ein bescheidenes Einkommen sicherte, sodass sie nicht unbedingt für ihren Lebensunterhalt arbeiten musste. Dennoch hätte Judith für nichts und niemanden ihren Job aufgegeben, so sehr liebte sie ihn.
Judith fertigte Kreuzworträtsel für überregionale Zeitungen an. Sie schaffte zwei bis drei Stück pro Woche, und die Stunden, die sie täglich an ihren Rätseln arbeitete, waren ein willkommenes Refugium für ihren Geist. Wenn sie ein Kreuzworträtsel erstellte, überkam sie eine große Ruhe, und sie konnte eine ganze Weile abschalten, während sie im Kopf alle Varianten eines besonders befriedigenden Anagramms durchging oder sich eine elegante Phrase überlegte oder ein Wort, das sich auf mehr als eine Weise interpretieren ließ.
Judith durchquerte ihren Salon, ging zum Kartentisch am Erkerfenster und strich den grünen Filz glatt. Dann griff sie ins Regal und zog ein Blatt Karopapier heraus. Dann wählte sie einen Bleistift mit dem Härtegrad 2B aus einem Becher mit Bleistiften mit dem Härtegrad 2B und schob ihn, obwohl er bereits angespitzt war, in den metallenen Bleistiftspitzer, der auf ihrem Schreibtisch stand. Das Gerät packte das Ende, der alte Elektromotor klapperte, als sich der Mechanismus drehte, und der Bleistift, den Judith wenige Sekunden später herauszog, war weniger ein Schreibgerät als vielmehr eine tödliche Waffe.
Judith lächelte. Ein frisch gespitzter Bleistift. Die leeren Karos auf dem Papier vor ihr. Auf in den Kampf!
Sie setzte sich, nahm ihr hölzernes Lineal und markierte ein Raster von fünfzehn mal fünfzehn Kästchen. Als Nächstes schraffierte sie mehrere Kästchen links und rechts einer imaginären Mittellinie, sodass jedes dunkle Kästchen seine spiegelverkehrte Entsprechung auf der rechten Seite erhielt. Dabei folgte sie keinem bestimmten Muster, sondern ließ ihre Hand von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung leiten.
Nachdem ihr Raster fertig war, musste sie nur noch Wörter einfügen. Sie wusste, dass sie dafür etwa eine Stunde brauchen würde, und erst wenn sie zufrieden war und die Ansammlung einander überschneidender Wörter interessant genug fand, würde sie sich daranmachen, sich die verrätselten Hinweise auszudenken.
Sie vermied stets so mutwillig kryptische Hinweise, wie viele Kreuzworträtselbastler sie favorisierten und wie man sie vor allem von dem kaum lösbaren Rätsel kannte, das früher monatlich im Magazin Listener erschienen war. Sie fand es ein wenig zu »männlich«, wie diese Leute allen zeigen wollten, wie schlau sie waren. »Schau mich an«, schienen sie zu sagen, »du wirst nie darauf kommen, wie brillant ich bin.« Wie viele ihrer Kollegen orientierte sie sich lieber an den Prinzipien von Ximenes, dem legendären Rätselmacher des Observer, der die Zeitung von 1939 bis 1972 mit Kreuzworträtseln versorgt hatte. Dementsprechend mussten ihre Hinweise stets aus zwei Teilen bestehen, einer wörtlichen und einer verrätselten Hälfte, und keine der beiden Hälften durfte den Lösenden allzu sehr aufs Glatteis führen – mit einer kleinen Einschränkung: Gelegentlich war sie bereit, von ihrer Regel abzuweichen, wenn sie einen kryptischen Hinweis besonders genial oder witzig fand.
Doch an diesem Morgen wollte die Muse Judith einfach nicht küssen. Nachdem ihr Quadrat aus schraffierten und leeren Kästchen fertig war, konnte sie sich einfach nicht auf die passenden Wörter festlegen, um das Raster zu füllen. Ihr fehlte jede Entschlossenheit. Schuld war Stefan, das war ihr klar. Sie konnte sich nicht konzentrieren. Sie musste wissen, ob es ihm gut ging.
Judith griff nach ihrem Tablet. Das Gerät gefiel ihr nicht sonderlich, aber sie konnte damit ihre Kreuzworträtsel fotografieren und per E-Mail an die Zeitungen schicken, also hatte sie vor einigen Jahren ihren Frieden damit gemacht.
Sie hielt es sich vors Gesicht, aber das dumme Ding weigerte sich, sich zu öffnen, und behauptete, es würde sie nicht erkennen. Judith brummte missbilligend. Wie demütigend es war, eine alte Frau zu sein! Die moderne Welt behandelte sie, als wäre sie unsichtbar, und sogar ihr eigener verwünschter Computer tadelte sie dafür, dass sie sich selbst nicht ähnlich genug sah. Aber es hatte keinen Sinn, sich gegen die Technik aufzulehnen. Das hatte Judith vor langer Zeit am eigenen Leibe erfahren, bei einem Vorfall, in den ein iMac mit rotem Gehäuse und ein etwas zu kurz geratenes Stromkabel verwickelt gewesen waren und bei dem sie in der Notaufnahme gelandet war.
Judith holte tief Luft und sammelte sich. Sie hielt noch einmal das Tablet hoch und betrachtete es.
Nichts passierte.
Verdammtes Ding! Vor sich hin murmelnd, gab Judith ihre PIN ein und öffnete dann den Webbrowser. Ob es etwas Neues über Stefan gab?
Sie tippte »Stefan Dunwoody« in die Suchleiste ein, aber die ersten Treffer teilten ihr lediglich mit, dass er eine Kunstgalerie in Marlow namens Dunwoody Arts besaß, und das wusste sie ja längst. Aber sie wollte gründlich sein, also klickte sie sich durch die Seiten mit den Ergebnissen.
Moment, was war das? Eines der Suchergebnisse weiter hinten war ein Link zur Webseite der Lokalzeitung Bucks Free Press. Ihr Blick war an der Schlagzeile hängen geblieben: HANDGEMENGE BEI HENLEY REGATTA.
Als sie auf den Link klickte, kam eine sechs Wochen alte Klatschmeldung zum Vorschein, die zu einem ausführlicheren Artikel über die Henley Royal Regatta gehörte.
Wie wir soeben erfahren, ist der örtliche Galerist Stefan Dunwoody in der Royal Enclosure mit Elliot Howard, Besitzer des Auktionshauses Marlow, in Streit geraten. Laut unserem Vögelchen rief man die Stewards, als Mr Howard Mr Dunwoody Schläge androhte. Die beiden angetrunkenen Männer wurden mit Nachdruck hinausbefördert.
Judith legte ihr Tablet wieder hin. Offenbar war Stefan in Henley in eine Auseinandersetzung mit jemandem namens Elliot Howard geraten, und nun, wenige Wochen später, hatte es auf seinem Grundstück ebenfalls Streit gegeben.
Einen Streit, bei dem jemand eine Waffe abgefeuert hatte. Und seither war Stefan verschwunden.
Das ist doch zum Auswachsen, dachte Judith, durchquerte den Raum, schnappte sich ihren Umhang und verließ das Haus.
Sie ging hinunter zum Bootshaus, in dem ein alter Kahn halb aus dem Wasser ragte. Sie verpasste ihm mit dem Fuß einen Stoß, stieg hinten ein und griff sich das Stakholz. Das Boot prallte mit dem Bug gegen die morschen Bootshaustüren, sie sprangen auf, und das Gefährt glitt hinaus auf den Fluss.
Trotz ihres fortgeschrittenen Alters war Judith eine geschickte Stakerin. Mit einer schnellen Handbewegung stieß sie die Stange ins Flussbett, knickte in der Taille ein und drückte sich mit aller Kraft ab. Als der Kahn vorwärtsschoss, drehte sie die Stange und zog sie aus dem weichen Schlamm heraus. Schon hatte das Boot Schwung genug, um den Fluss zu überqueren.
Als sie das andere Ufer erreichte, wo der Fluss wieder flach war, war es ein Leichtes für sie, die rund fünfzig Yards bis zu Stefans Haus flussaufwärts zu staken, mit dem Bug ihres Kahns das dichte Schilf zu durchdringen, das sein Flussufer schützte, und sein Grundstück zu betreten. Sie brauchte das Boot nicht zu vertäuen. Vollkommen von Schilfrohr umgeben, konnte es nirgendwohin.
Judith sah auf die Uhr und stellte fest, dass sie noch vor etwas mehr als acht Minuten in ihrem Haus gesessen hatte, und nun war sie hier, dem mysteriösen Verschwinden ihres Nachbarn auf der Spur.
Judith war beeindruckt von Stefans Haus. Es handelte sich um eine umgebaute Wassermühle mit einem hölzernen Mühlrad, das sich noch immer träge drehte, aber das Gebäude war mit unterschiedlich großen rechteckigen Glasfenstern versehen worden. Es wirkte zugleich angenehm altmodisch und modern.
Sie sah sich Stefans Auto in der Auffahrt an. Judith kannte sich mit Autos nicht aus, im Grunde waren sie ihr vollkommen egal. Daher konnte sie lediglich feststellen, dass es grau war und dass es blitzte und blinkte, nirgendwo war ein Fleckchen Schmutz zu sehen. Sie konnte im Kies keine weiteren Reifenspuren erkennen oder irgendwelche anderen Hinweise darauf, dass Stefan mit einem anderen Fahrzeug weggefahren war.
Sie spazierte durch den Garten und versuchte nachzuvollziehen, wo der Schuss gefallen sein mochte, den sie gehört hatte, aber es fiel ihr schwer, sich zu orientieren. Immerhin hatte sie sich unten im Fluss unterhalb des Schilfs befunden. Nachdem sie ein paar Minuten umhergelaufen war und das Schilfbett am Flussufer inspiziert hatte, wurde Judith klar, dass sie gar nicht genau wusste, wonach sie suchte. Nach einem Blutstropfen an einem Grashalm? Einem Fußabdruck im Schlamm?
Judith betrachtete das Mühlrad, das sich an der Hauswand drehte, und den Mühlteich davor. Das Wasser war dunkel, und trotz der Hitze lief es Judith kalt den Rücken hinunter. Stehende Gewässer fand sie schon immer unheimlich. Doch als sie hinsah, fiel ihr auf, dass sich das Wasser ganz sacht bewegte. An der Oberfläche konnte sie eine leichte Strömung ausmachen. Doch wohin floss das Wasser?
Judith ging um den Teich herum, bis sie sah, dass er in einen etwa drei Meter breiten Bach mündete. Wo der Mühlteich endete und der Bach begann, war ein schmaler Damm aus Ziegelsteinen gebaut, über den man von einer Seite des Gartens zur anderen gelangte. Judith betrachtete den Bach jenseits des Damms. Irgendwie musste er in die Themse fließen, aber wie, konnte sie nicht erkennen, denn Stefan hatte diesen Teil des Gartens verwildern lassen, und weiter hinten war der Wasserlauf von dichten Sträuchern und Büschen überwuchert.
Judith seufzte, als ihr klar wurde, dass sie dem Bachlauf folgen musste. Schließlich wollte sie gründlich sein. Also bahnte sie sich ihren Weg durch die Sträucher. Äste peitschten ihren Körper, Spinnweben klebten ihr im Gesicht und im Haar.
Als sie sich schließlich zur anderen Seite hindurchgekämpft hatte, war Judith enttäuscht. Diese Ecke des Gartens war sogar noch verwilderter, aber das Wasser floss einfach nur durch Eisenstangen zu einem Betonwehr und ergoss sich dahinter in die Themse. Hier war nichts Interessantes zu sehen.
Doch als sie nach dem Kraftakt langsam wieder zu Atem kam, nahm sie etwas in der Luft wahr, einen fauligen Geruch, wie von einem alten Komposthaufen. War das der Fluss? Sie schaute hinab auf das Wasser, das durch das Gitter floss. Davor steckte ein alter Ast im Wasser, an dem sich Blätter aufgestaut hatten.
Doch dann wurde Judith etwas klar.
Das dort im Wasser war kein Ast.
Das war der Arm eines Menschen.
Er ragte aus dem Wasser, die Hand war weiß wie Marmor. Unterhalb des Arms konnte Judith einen leblosen Körper ausmachen.
Es war Stefan Dunwoody.
Und in der Mitte seiner Stirn klaffte ein kleines schwarzes Loch.
Ein Einschussloch.
Judith taumelte zurück und fuhr sich mit der Hand an den Nacken. Sie hatte recht gehabt.
Stefan Dunwoody, ihr Freund und Nachbar, war erschossen worden.
Kapitel 3
Eine Stunde später saß Judith auf einer Bank in Stefans Garten und wurde von Detective Sergeant Tanika Malik befragt. Die Polizistin war Anfang vierzig, trug einen schicken Hosenanzug und hatte etwas Oberlehrerhaftes an sich, das Judith schon jetzt auf die Nerven ging.
»Das verstehe ich nicht ganz, Mrs Potts«, sagte DS Malik. »Sie sagen, Sie seien zum Haus von Mr Dunwoody zurückgekehrt?«
»Ja«, sagte Judith mit trotzig erhobenem Kinn. »Das habe ich Ihnen doch schon am Telefon gesagt. Ich wusste, dass ich gestern Abend einen Schrei und einen Schuss gehört hatte. Und da Ihr Polizist sich nicht die Mühe gemacht hat, richtig nachzuschauen, dachte ich, dann erledige ich das eben selbst.«
»Hatten Sie noch einen anderen Grund, zurückzukehren?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Haben Sie damit gerechnet, eine Leiche zu finden?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Und doch haben Sie eine gefunden, oder etwa nicht?«
»Was mehr ist, als Ihr Polizeibeamter zustande gebracht hat, wie ich leider feststellen muss. Aber jetzt sagen Sie mal, wussten Sie, dass Stefan vor ein paar Wochen in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Mann namens Elliot Howard verwickelt war?«
»Wie bitte?«
Judith erzählte DS Malik von dem Klatschartikel in der Lokalzeitung, in dem es um den Streit zwischen Stefan und dem Besitzer des Marlower Auktionshauses, Elliot Howard, bei der Henley Royal Regatta ging.
»Und das war vor sechs Wochen?«
»Ganz recht.«
»Ich verstehe.«
DS Malik dachte einen Moment lang nach.
»Was ist denn?«, fragte Judith.
»Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Als Nachbarin von Mr Dunwoody?«
»Selbstverständlich.«
»Personen, die in Zeugenaussagen namentlich genannt werden, gleichen wir standardmäßig mit der Datenbank der Polizei ab. Also suchte ich nach Mr Dunwoody. Er ist nicht vorbestraft. Ihm gehört die Kunstgalerie in Marlow, er lebt allein, alles wie erwartet. Aber vor fünf Wochen hat er uns einen Einbruch gemeldet.«
»Ach, wirklich? Was wurde denn gestohlen?«
»Das ist es ja! Er sagte, er sei mit Freunden im Restaurant gewesen, und als er nach Hause kam, habe er festgestellt, dass jemand eine Scheibe eingeschlagen hatte und in sein Haus eingebrochen war. Aber als ein Polizeibeamter bei ihm eintraf, um seine Aussage aufzunehmen, war laut Mr Dunwoody gar nichts gestohlen worden.«
»Nichts war gestohlen?«
»So hat er es zu Protokoll gegeben. Und doch war ganz sicher jemand eingebrochen. Aber sein Computer war noch da. Seine Kunstsammlung. Ich kann Ihnen sagen, Mr Dunwoody besitzt eine ganze Reihe von Ölgemälden, und keines davon wurde gestohlen.«
»Das war vor fünf Wochen? Eine Woche nach Mr Dunwoodys Streit in Henley?«
»Davon gehe ich aus. Aber hat Mr Dunwoody Ihnen denn gar nichts von dem Einbruch erzählt?«
»Ich habe leider schon seit Wochen nicht mehr mit Stefan gesprochen.«
»Oder haben Sie damals etwas Verdächtiges beobachtet? Vielleicht wie jemand in der Nähe seines Grundstücks auf der Lauer lag? Oder ein fremdes Auto, das bei seinem Haus parkte?«
»Nein, tut mir leid. Ganz ehrlich. Ich habe erst bemerkt, dass etwas nicht stimmte, als ich gestern Abend mitanhören musste, wie er ermordet wurde.«
»Jetzt muss ich Sie aber wirklich bremsen, Mrs Potts. Schauen Sie, wir wissen ja gar nicht, ob jemand auf Mr Dunwoody geschossen hat.«
»Bitte?«
»Wir wissen nicht, ob Mr Dunwoody ermordet wurde.«
»Meinen Sie, das Einschussloch ist von selbst in seiner Stirn aufgetaucht?«
»Das nicht, aber wir können nicht ausschließen, dass sein Tod ein schrecklicher Unfall war. Oder dass er sich das selbst angetan hat.«
»Sie meinen, er hat Selbstmord begangen?«
»Das ist durchaus eine Möglichkeit.«
»Papperlapapp!«
DS Malik blinzelte überrascht. Wer benutzte denn heutzutage noch Wörter wie »papperlapapp«?
»Wenn er sich das Leben genommen hätte, wäre doch die Pistole irgendwo hingefallen. Bevor er in den Fluss fiel. Und ich kann Ihnen versichern, als ich nachgesehen habe, lag da nirgends eine Waffe.«
»Ich kann nachvollziehen, wieso Sie das glauben, aber vielleicht ist die Waffe in den Fluss gefallen, nachdem er sich erschossen hatte. Ich habe Taucher angewiesen, das Flussbett abzusuchen. Bis dahin sollten Sie wirklich keine voreiligen Schlüsse ziehen, Mrs Potts. Wir müssen uns von den Fakten leiten lassen, nicht von unseren Annahmen.«
Judith taxierte DS Malik. Die Frau mochte eine effiziente und vielleicht sogar fähige Polizistin sein, aber es fehlte ihr ganz eindeutig an Fantasie. Sie war der Typ »Klassensprecherin«, beschloss Judith, was nicht allzu freundlich gemeint war. Judith war von einem ziemlich vornehmen Internat geflogen, auf das man sie als Teenager geschickt hatte. Ebenso war sie von dem nicht ganz so vornehmen Internat geflogen, das sie als Nächstes besucht hatte. Und von dem danach ebenso. Es genügt wohl zu sagen, dass sie und die dortigen Klassensprecherinnen selten einer Meinung gewesen waren.
Judith seufzte in sich hinein. Nun gut, wenn die Polizei nicht glaubte, dass Stefan umgebracht worden war, dann musste sie diesen Mord eben selbst aufklären.
Nachdem Judith ihre Aussage zu Protokoll gegeben hatte, bestieg sie wieder ihren Kahn und ließ sich von der Strömung zu ihrem Haus zurücktreiben, vorbei an den Mitarbeitern der Spurensicherung in ihren Papieranzügen, die sie mit einem majestätischen Winken bedachte. Zu Hause angekommen, stieg sie auf ihr altes Fahrrad. Denn wenn sie herausfinden wollte, wer ihren Nachbarn ermordet hatte, musste sie nicht zweimal überlegen, wo sie mit den Nachforschungen beginnen sollte.
Mit dem Fahrrad brauchte sie nur fünf Minuten über den Leinpfad bis in die nahe gelegene Kleinstadt Marlow, und ausnahmsweise nahm Judith das Nicken und Winken, mit denen vollkommen Fremde sie bedachten, gar nicht zur Kenntnis, als sie so dahinsauste. Andererseits wusste sie ohnehin nicht, warum ihr immer so viele Leute zuwinkten. Es kam ihr nie in den Sinn, dass sie im Städtchen fast so etwas wie eine Prominente war. Sie fand ihr Leben überhaupt nicht interessant, aber jedes Mal, wenn sie sich lautstark über das Interesse anderer Menschen wunderte, förderte das ihren Ruf als Exzentrikerin.
Als Judith vom Leinpfad aus in einen kleinen Park mit Schaukeln und Rutschen einbog, sah sie einen Schwarm Tauben, die faul vor sich hin pickten. Drecksbiester, dachte sie, trat stärker in die Pedale und hielt mit breitem Grinsen auf sie zu. Und dann radelte sie in vollem Tempo mitten in den Schwarm hinein, rief »HINFORT, Tauben!«, und schreiend stoben die Vögel auf.
Judith mochte Marlow sehr. Ihrer Meinung nach war es genau richtig, nicht zu groß und nicht zu klein. Die perfekte Stadt für eine alte Dame wie sie. An einem Ende der High Street befanden sich eine elegante georgianische Hängebrücke und eine alte Kirche am Flussufer, am anderen stand ein prunkvoller Obelisk, und dazwischen säumten historische Gebäude aus mehreren Jahrhunderten die Straße. Über der High Street waren auf ganzer Länge rot-blaue Wimpel angebracht, die alles zu einem ästhetischen Ganzen, zu einer kleinstadttypischen Postkartenidylle zusammenfügten – ein Bild, aus dem Puzzles gemacht wurden.
Aber am meisten mochte Judith an Marlow, dass es dort noch viel mehr gab als die malerische High Street. Da war zum Beispiel der Bahnhof, der zwar nur aus einer Hütte bestand, aber von dem aus man immerhin den Zug nach London nehmen konnte. Und am Rande der Stadt gab es ein florierendes Gewerbegebiet, wo Tausende Menschen arbeiteten. Vor allem aber mochte Judith die beiden Schulen, die einen nie versiegenden Strom gut ausgebildeter Teenager hervorbrachten, die in den Supermärkten die Kasse bedienten oder in den Cafés die Bestellungen entgegennahmen. All diese jungen Leute zu sehen, die stets höflich waren und durchweg hübsch anzuschauen, und zu beobachten, wie sie ihrem Tagwerk nachgingen, am Fluss picknickten oder sogar im Skatepark beim Cricket-Pavillon herumhingen, machte Judith richtig glücklich. Wenn so die nächste Generation aussah, musste sich die Welt nicht allzu viele Sorgen machen, fand sie.
Judith war von Natur aus Optimistin, das war vielleicht ihr wesentlicher Charakterzug, aber sie versuchte auch, so ehrlich zu sein, wie sie nur konnte, und sie musste zugeben, dass Marlow, auch wenn es nach wie vor ein flottes Städtchen war, wie alle Städte Großbritanniens in den vergangenen zehn, zwölf Jahren ein wenig gelitten hatte. Wenn man als Tagestourist hierherkam, bekam man sicherlich nichts davon mit. Es gab so viele schicke Restaurants und Boutiquen, dass man gar nicht bemerkte, dass ein rundes Dutzend Geschäfte leer stand, die Fassaden geschmackvoll abgehängt, damit man nicht sah, dass im Inneren keine Waren mehr über den Ladentisch gingen. Und zu dem netten Mann auf der einen Seite der High Street, der das Big Issue verkaufte, war vor Kurzem ein Obdachloser auf der anderen Straßenseite hinzugekommen, der den ganzen Tag im Schneidersitz dasaß und vor sich eine Büchse für die Münzen stehen hatte.
Immerhin wohnen hier nach wie vor gute Menschen, sagte sie sich, als sie am oberen Ende der High Street vom Fahrrad stieg und es gegen eine Hauswand lehnte.
In dem Moment, als DS Malik ihr gesagt hatte, sie nehme zu Unrecht an, dass jemand ihren Nachbarn ermordet habe, hatte Judith ihre Entscheidung getroffen, wo sie mit ihren Ermittlungen anfangen würde: in Stefan Dunwoodys Kunstgalerie.
Kapitel 4
Judith hatte Dunwoody Arts noch nie betreten, aber sie hatte auch noch nie ein Kunstwerk kaufen müssen, schließlich hatte sie zusammen mit dem Haus ihrer Großtante auch deren Gemäldesammlung geerbt.
Als Judith eintrat, sah eine junge Angestellte von ihrem Schreibtisch auf. Sie hatte Tränen in den Augen.
»Ach«, sagte Judith. »Sie haben es schon erfahren.«
»Die Polizei hat gerade angerufen«, sagte die Frau. »Ich zittere immer noch.«
»Natürlich«, sagte Judith freundlich. Sie durchquerte die Galerie und setzte sich auf den freien Stuhl vor dem Schreibtisch der Frau. Dann kramte Judith in ihrer Handtasche, holte eine Packung Taschentücher hervor und reichte ihr eines.
»Danke«, sagte die junge Frau, bevor sie sich die Nase putzte.
»Ich sollte mich vielleicht vorstellen«, sagte Judith. »Ich heiße Judith Potts.«
»Ich weiß. Sie wohnen in diesem großen Haus am Fluss.«
»Oh. Kennen wir uns?«
»Zumindest sind wir uns schon einmal begegnet«, sagte die Frau und lächelte. »Vor ein paar Jahren wurde ich vor dem Pub von ein paar Jungs belästigt. Sie sind dazwischengegangen und haben sie vertrieben.«
»Wirklich?« Judith konnte sich überhaupt nicht daran erinnern, auch wenn es durchaus nach ihr klang. Sie konnte nicht mitansehen, wenn Männer im Rudel einer jungen Frau nachstellten, die allein unterwegs war.
»Ich bin Antonia«, sagte die Frau. »Antonia Webster. Und danke, dass Sie mir damals geholfen haben. Sie waren wirklich toll.«
»Ich bin sicher, dass Sie gar keine Hilfe brauchten. Sie sehen aus, als könnten Sie ganz gut auf sich aufpassen.« Judith kramte wieder in ihrer Tasche und holte eine altmodische Blechdose mit Fruchtbonbons hervor. »Möchten Sie ein Bonbon?«
Antonia wusste offenbar nicht recht, was sie auf die Frage antworten sollte.
»Nein?«, sagte Judith. »Stört es Sie, wenn ich eines nehme?« Judith öffnete die Dose, klaubte ein Bonbon aus dem Puderzucker, steckte es sich in den Mund und lutschte ein paar Sekunden daran. »Limette«, verkündete sie zufrieden. »Meine Lieblingssorte. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich hergekommen bin, aber wenn ich Ihnen damals geholfen habe, könnten Sie vielleicht diesmal mir helfen. Wissen Sie, ich bin Stefans Nachbarin und versuche herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Es ist so schrecklich traurig. Ich nehme an, Sie arbeiten hier?«
»Ja«, sagte Antonia. »Und natürlich helfe ich Ihnen gern. Ich bin Mr Dunwoodys Assistentin. Nur diesen Sommer über. Bevor ich zur Uni gehe.«
»Dann sind Sie also noch gar nicht lange hier?«
»Nein. Aber Mr Dunwoody war so nett! Ich kann gar nicht glauben, dass er nicht mehr da ist.«
»Da stimme ich Ihnen zu. In welcher Hinsicht war er denn nett, was würden Sie sagen?«
»Na ja, er hat sich für mich interessiert, wissen Sie? Für meine Meinung. Über Politik. Über die Umwelt. Dafür, was ich an der Uni machen wollte.«
»War er auch an Ihnen interessiert?«
»Das nicht«, sagte Antonia, die gleich gemerkt hatte, worauf Judith hinauswollte. »Er war kein Lustmolch. Er war einfach ein alter Mann. So hat er sich selbst bezeichnet. Als alten Mann. Der allein lebte, mit seiner Kunst. Ich mochte ihn.«
Diese Beschreibung stimmte mit dem wenigen überein, das Judith von Stefan mitbekommen hatte, wenn sie ihrem Nachbarn einmal alle zwei Wochen zugewinkt hatte. Er schien stets erfreut, sie zu sehen, und brüllte immer so etwas wie »So ein schöner Morgen!« oder »Schönen Tag noch!« über den Fluss. Judith lächelte traurig, als sie daran dachte.
»Ich glaube, er war ein guter Mensch«, sagte sie.
»Das war er«, stimmte Antonia ihr zu.
Die beiden Frauen saßen eine Weile in einvernehmlichem Schweigen da, während Judith zufrieden an ihrem Bonbon lutschte.
»Und irgendjemand hat ihn ermordet«, sagte sie.
Antonia machte große Augen. »Wie bitte?«
»Das wussten Sie gar nicht?«
»Nein. Der Typ am Telefon sagte, er hätte einen Unfall gehabt.«
Judiths Handtasche auf ihrem Schoß stand immer noch offen, und als sie sie schloss, rastete mit einem lauten Knacken der Verschluss ein. »Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das stimmt nicht. Er wurde erschossen.«
»Sind Sie sicher?«
»O ja, ganz sicher. Also schlage ich vor, ich helfe Ihnen, den Laden zu schließen. Nach so einem Schock kann man unmöglich den ganzen Tag arbeiten.«
»Meinen Sie wirklich?«
»Natürlich.«
»Und Sie würden mir helfen?«
»Ich habe sonst gerade nichts vor. Wie geht das denn nun vor sich?«
Antonia holte ein Schlüsselbund, erklärte Judith, wie die Alarmanlage funktionierte, und gemeinsam schlossen die beiden Frauen die Galerie ab und drehten das Schild an der Eingangstür um, das nun »Geschlossen« verkündete. Wie Judith vermutet hatte, erlaubte Antonia der simple Akt einer körperlichen Tätigkeit, das Geschehene zu verarbeiten.
Judith wählte mit Bedacht den passenden Moment aus.
»Nun ja, perfekt wird er nicht gewesen sein«, sagte sie, als sei ihr der Gedanke gerade eben gekommen.
»Wie bitte?«
»Mr Dunwoody. Die Logik legt nahe, dass er entweder nicht so tadellos war, wie er schien, oder dass er mindestens einen Freund oder Bekannten hatte, der ein ganz übler Bursche war. Denn irgendjemand muss ihm das ja angetan haben.«
»Oh. Ich verstehe, was Sie meinen. Aber das kann nicht sein. Er war wirklich ein feiner Kerl. Und er gab sich auch nicht mit üblen Leuten ab.«
Judith sah, wie Antonia die Stirn runzelte. »Was ist?«, fragte sie.
Antonia gab keine Antwort.
»Na, kommen Sie«, sagte Judith leutselig. »Raus mit der Sprache.« Und dann wartete sie ab. Sie wusste, dass Schweigen manchmal die beste Methode war, jemanden zum Reden zu bringen.
»Na ja, es ist nur«, sagte Antonia schließlich, »als Sie meinten, in seinem Umfeld müsse es einen üblen Burschen gegeben haben, da ist mir sofort jemand eingefallen. Das ist alles.«
»Und wer ist dieser Jemand?«
»Keine Ahnung. Ich weiß seinen Namen nicht.«
»Warum erzählen Sie mir dann nicht von ihm? Vielleicht finden wir es gemeinsam heraus.«
»Das ist ein älterer Herr. Mit grauem Haar. Oder eher silbernem. Das ging ihm bis auf die Schultern. Er war ziemlich groß und stattlich.«
»Und das war ein Freund von Mr Dunwoody?«
»Ich glaube eher nicht. Er kam letzte Woche in die Galerie.«
»An welchem Tag?«
»Montag.«
»Gut, also dieser Mann kam letzten Montag in die Galerie.«
»Genau. Und wer auch immer er war, Mr Dunwoody nahm ihn direkt mit in sein Büro. Es wirkte fast, als wäre es ihm peinlich, dass dieser Typ zu Besuch kam.«
»Ich verstehe. Das ist überaus interessant. Was geschah dann?«
»Na ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie gingen in Mr Dunwoodys Büro. Und kurz darauf fingen sie lautstark an, sich zu streiten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wissen Sie, es gehört zu meinen Aufgaben, Mr Dunwoody Kaffee zu kochen, wenn er Gäste hat, und ich war in heller Panik. Ich wusste nicht, ob ich den beiden jetzt einen Kaffee machen sollte oder nicht.«
»Haben Sie gehört, worüber die zwei sich stritten?«
»Vor der Bürotür nicht, aber am Ende nahm ich allen Mut zusammen, klopfte an und fragte, ob sie einen Kaffee wollten. Die Stimmung war angespannt. Der große Mann, der silberhaarige Mann, wollte nichts und wedelte auf ziemlich unhöfliche Weise mit der Hand, dass ich verschwinden sollte.«
Antonia verfiel in nachdenkliches Schweigen.
»Wie interessant«, sagte Judith. »Aber Sie sagten, Sie hätten vor der Bürotür nicht gehört, was gesprochen wurde?«
Antonia konnte Judiths Argumentation nicht folgen. »Was meinen Sie?«
»Sie sagten, vor der Bürotür hätten Sie nicht gehört, was gesagt wurde. Das deutet für mich darauf hin, dass Sie etwas gehört haben, als Sie dann drinnen waren.«
»O ja, natürlich. Tut mir leid. Nachdem der silberhaarige Gentleman mich fortgewedelt hatte, ging ich, und als ich die Tür hinter mir zumachte, hörte ich noch, wie Mr Dunwoody zu ihm sagte: ›Ich könnte jetzt gleich zur Polizei gehen.‹«
»Und was hat der Silberhaarige dazu gesagt?«
»Weiß ich nicht. Ich war weg, bevor ich seine Antwort hören konnte.«
»Ich verstehe. Aber Mr Dunwoody hat definitiv gesagt, er könne ›jetzt gleich zur Polizei gehen‹?«
»Ja.«
»Und Sie haben keine Ahnung, was er damit gemeint hat?«
»Überhaupt keine. Es tut mir so leid.«
»Haben Sie Mr Dunwoody vielleicht später noch einmal darauf angesprochen?«
»Nein. Aber jetzt, wo Sie es erwähnen, fällt mir noch etwas ein: Als wir abends zusperrten, entschuldigte sich Mr Dunwoody dafür, dass ich den Streit miterleben musste.«
»Was haben Sie dazu gesagt?«
»Na ja, ich habe gemerkt, dass ihm das alles ziemlich unangenehm war, also habe ich nur gesagt, dass es schon in Ordnung sei, ich hätte ja eigentlich gar nichts gesehen oder gehört. Und dann sagte er etwas ganz Seltsames. Er sagte: ›Verzweiflung treibt die Menschen zu den größten Torheiten.‹«
»Was in aller Welt könnte er damit gemeint haben?«
»Keine Ahnung. Aber das hat er gesagt.«
Judith spürte ihr Herz klopfen. Wer war bloß der silberhaarige Mann, der sich mit Stefan gestritten hatte? Da fiel ihr ein, dass Stefan bei der Henley Regatta mit einem gewissen Elliot Howard in Streit geraten war, und ihr kam eine Idee.
»Ist Ihr Computer mit dem Internet verbunden?«, fragte sie.
Antonia nickte.
»Können Sie kurz für mich nach etwas suchen?«
»Natürlich. Was wollen Sie denn wissen?«
»Könnten Sie bitte den Namen Elliot Howard eingeben?«
»Glauben Sie, das ist der Mann, der hier drinnen war?«
»Gut möglich. Schauen wir doch einmal, ob wir online ein Foto von ihm finden.«
»Okay«, sagte Antonia, ging zu ihrem Schreibtisch und startete den Browser ihres Computers. Sie tippte »Elliot Howard« in das Suchfeld ein.
»Da haben wir ihn ja«, sagte Judith und zeigte auf den Top-Treffer. Antonia klickte auf den Link, und die Webseite des Auktionshauses Marlow öffnete sich. Sie klickte auf »Wer wir sind«, und schon erschienen die Namen und Fotos der wichtigsten Mitarbeiter.
Gleich das erste Bild zeigte einen gut aussehenden Mann Ende fünfzig mit schulterlangem, silbernem Haar. Die Bildunterschrift wies ihn als Elliot Howard aus, Leiter des Auktionshauses.
»Das ist er!«, sagte Antonia überrascht. »Das ist der Mann, der letzten Montag hier war.«
Judith beugte sich hinunter zum Bildschirm, damit sie das Foto besser sehen konnte.
»Hab ich dich!«, flüsterte sie dem Mann auf dem Bildschirm zu.
Kapitel 5
Ein paar Minuten nach ihrem Zusammentreffen mit Antonia lehnte Judith ihr Fahrrad gegen die Hauswand des Auktionshauses Marlow. Das Gebäude mit seinem knarrenden Fachwerk erinnerte sie immer an die alten Scheunen, in denen sie als kleines Mädchen gespielt hatte, als sie auf der Farm ihrer Eltern auf der Isle of Wight aufgewachsen war: voller Spinnweben, mit knackenden Dielen und feuchten Heuballen, die leicht vermodert rochen.
Während sie den Umhang auf ihren Schultern glatt strich, wurde Judith klar, dass sie gar keinen konkreten Plan hatte, was sie als Nächstes tun sollte. Sie wusste lediglich, dass sie einen Blick auf Elliot Howard werfen musste. Sie wollte wissen, was er für ein Typ war.
Ob es klug war, einem Mann gegenüberzutreten, der vielleicht ein Mörder war? Sie beschloss, alle derartigen Bedenken zu ignorieren. Schließlich kannte sie den Mann gar nicht, was sollte sie also davon abhalten, ihn an seinem Arbeitsplatz aufzusuchen? Sie konnte ja so tun, als wolle sie ein Gemälde verkaufen. Oder sie dachte sich eine andere List aus. Irgendetwas würde ihr schon einfallen.
Als Judith das Gebäude betrat, sah sie eine Frau an einem Schreibtisch sitzen, die an einem Computer arbeitete. Sie war Mitte fünfzig, hatte dunkles, welliges Haar und trug knallroten Lippenstift, ihre Augen strahlten.
»Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte die Frau mit einem freundlichen irischen Akzent.
»Guten Morgen«, sagte Judith aufgeräumt. »Haben Sie geöffnet?«
»Es tut mir leid, aber die nächste Vorbesichtigung ist erst morgen.«
»Ach so?«
»Darf ich Ihnen einen Katalog mitgeben? Diese Woche werden Münzen, Medaillen und Orden angeboten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie deshalb hier sind. Da kommen hauptsächlich Männer, die öfter an die frische Luft sollten.« Sie lächelte verschwörerisch. »Aber bitte verraten Sie Elliot nicht, dass ich das gesagt habe. Ende des Monats haben wir eine Kunstauktion. Das könnte wohl eher zu Ihnen passen.«
»Ich hatte eigentlich gehofft, mit Mr Howard persönlich sprechen zu können.«
»Mit Mr Howard?«
»Ganz recht.«
»Darf ich fragen, in welcher Angelegenheit?«
»Das ist eine sehr gute Frage.«
Judith wollte sich gerade irgendetwas ausdenken, als sie direkt hinter sich eine Männerstimme hörte.
»Ja, warum möchten Sie mit mir sprechen?«
Judith erschrak dermaßen, dass ihr Kopf augenblicklich leer war. Um Zeit zu gewinnen, drehte sie sich um und sah den Mann vom Foto im Internet lässig im Türrahmen lehnen. Er war Ende fünfzig und hatte schulterlanges, wallendes graues Haar. Er trug Budapester, eine hellbraune Cordhose und ein altes Karohemd unter einer zerschlissenen grauen Strickjacke.
Es war Elliot Howard.
Er strahlte eine lockere, beinahe schon belustigte Überlegenheit aus, und Judith kam plötzlich die Erkenntnis, dass Elliot bestimmt übertrieben stolz darauf war, in seinem Alter noch so volles Haar zu haben, was sicherlich auch der Grund dafür war, dass er es so lang trug. Und obwohl Elliot entspannt wirkte, hatte er irgendetwas an sich, das Judith ein wenig beunruhigte.
»Na, das möchten Sie sicher nur allzu gerne wissen«, sagte Judith, da sie nicht wusste, was sie sonst sagen sollte.
»Deshalb habe ich Sie ja gefragt. Worüber möchten Sie mit mir sprechen?«
»Aha!«
Judith wand sich innerlich. Aha? Hatte sie nichts Besseres auf Lager?
Die Frau am Computer kam ihr zu Hilfe. »Warum gehst du nicht mit der Dame in dein Büro? Da kann man sich ganz ungestört unterhalten.«
»Okay, Liebling«, sagte Elliot lächelnd zu der Frau und fügte hinzu: »Du bist der Boss«, auch wenn aus seinem Patrizierton deutlich wurde, dass sie das ganz sicher nicht war.
Elliot führte Judith in sein Büro, und sie hatte keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Im Geiste suchte sie fieberhaft nach etwas, das sie sagen konnte, irgendetwas.
»Das ist Daisy«, erklärte Elliot, als er hinter einem großen Schreibtisch Platz nahm. »Eine wundervolle Frau. Meine Gattin. Keine Ahnung, wie sie es mit mir aushält. Egal, wie kann ich Ihnen helfen?«
Judiths Kopf war noch immer leer, aber sie hatte eine ganze Reihe gerahmte Fotos an der Wand entdeckt, also ging sie hinüber, um sie sich anzusehen. Sie waren so alt, dass die Farben bereits verblassten, und zeigten hauptsächlich Teenager, die auf dem Fluss ruderten oder Blazer tragend verschiedene Silberpokale und Medaillen hochhielten. Über jedem der Fotos war das Emblem einer örtlichen Schule angebracht, Sir William Borlase’s Grammar School, und jede der handschriftlichen Listen der Namen darunter enthielt einen »E. Howard«.
»Oh, Sie sind ein Ruderer?«, fragte Judith, um die peinliche Stille zu füllen. Aber als sie sich die Fotos ansah, kam ihr endlich der rettende Gedanke.
»Sie schulden mir Geld!«, platzte sie plötzlich heraus.
»Wie bitte?«
»Ja, ich hätte es früher sagen sollen. Mein Name ist Mrs Judith Potts, und Sie schulden mir Geld. Von der Henley Regatta. Wo Sie sich ganz schön danebenbenommen haben.«
Das weckte Elliots Aufmerksamkeit.
»Wovon in aller Welt reden Sie?«, fragte er, aber Judith hatte den Eindruck, dass ihre Anschuldigung ihn einigermaßen beunruhigt hatte.
»Ich finde, Sie haben sich wirklich schändlich verhalten. In der Royal Enclosure. Wie Sie sich mit diesem Mann gestritten haben.«
»Welcher Mann soll das gewesen sein?«
»Stefan Soundso. Er leitet die Kunstgalerie in Marlow. Ich fand, dass Sie ziemlich unhöflich zu ihm waren. Aber dann haben Sie sich auf dem Weg hinaus an mir vorbeigedrängelt, und ich habe meinen Rotwein über mein Kleid geschüttet. Die chemische Reinigung hat über siebzig Pfund gekostet, und ich erwarte, dass Sie die Rechnung bezahlen.«
Elliot sah Judith lange an.
»Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendjemandes Getränk verschüttet habe«, sagte er.
»Aber Sie leugnen nicht, dass Sie sich gestritten haben, oder?«
»Es stimmt schon, Mr Dunwoody und ich hatten an diesem Tag eine Meinungsverschiedenheit. Aber an Sie kann ich mich überhaupt nicht erinnern.«
»Das wundert mich nicht. Sie waren so außer sich, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Sie sich an gar nichts mehr erinnern, was an dem Tag vorfiel. Der arme Mann, den Sie angeschrien haben, er hatte doch nichts Böses getan.«
»Oh, der hat allerhand Böses getan.«
»Aber doch sicherlich nichts, das es wert gewesen wäre, darüber dermaßen die Beherrschung zu verlieren.«
»Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden.«
»Das mag sein, aber trotzdem –«
»Er war ein Betrüger«, unterbrach Elliot sie.
»Wie bitte?«
»Ich würde sogar noch weiter gehen. Stefan Dunwoody war ein Betrüger und ein Lügner. Ein Schwindler und ein Gauner. Nun, falls es Ihnen nichts ausmacht, ich bin ein viel beschäftigter Mann. Bitte gehen Sie jetzt.«
Mit einem kalten Lächeln, das bedeutete, dass ihre Unterhaltung beendet war, griff sich Elliot einige Papiere, die auf dem Schreibtisch lagen, und begann zu lesen.
»Und was ist mit meinem Kleid?«, stammelte Judith.
»Wenn Sie mich fragen«, sagte Elliot, ohne aufzusehen, »haben Sie das Ganze erfunden. Gott weiß, warum. Denn ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis für Gesichter, und wir sind uns ganz sicher noch nie begegnet. Außerdem habe ich in Henley definitiv keinen Wein auf irgendjemandes Kleid verschüttet. Und wenn ich das getan hätte, hätte diese Person wohl kaum fast zwei Monate gewartet, bevor sie mich kontaktiert hätte. Und jetzt muss ich Sie leider bitten, mein Büro zu verlassen.«
Judith öffnete ein paarmal den Mund, ordnete den Griff ihrer Handtasche und merkte schließlich, dass ihr immer noch nichts einfiel, was sie erwidern konnte.
Sie drehte sich um, um zu gehen, doch als sie gerade die Tür öffnen wollte, hielt sie inne.
»Was meinen Sie damit, er ›war‹ ein Betrüger?«, fragte sie.
»Sind Sie immer noch da?«, fragte Elliot und seufzte, als er wieder aufsah.
»Ja, und ich möchte wissen, warum Sie von Stefan in der Vergangenheitsform reden.«
Elliot zuckte die Achseln, als ginge ihn das alles nichts an. »Ist das nicht offensichtlich?«, fragte er. »Er ist doch tot, oder etwa nicht?«
»Aber woher wissen Sie das?«
»Heute Morgen gab es hier im Haus kaum ein anderes Thema. Dass Stefan Dunwoody, der Grandseigneur der Kunstwelt, einen tragischen Unfall hatte und der Herr ihn zu sich genommen hat. Aber wenn ich jetzt zur Abwechslung mal Ihnen eine Frage stellen darf: Woher wissen Sie davon?«
»Woher weiß ich davon?«
»Ja. Hier im Auktionshaus kennt jeder Stefan. Aber in welcher Verbindung stehen Sie zu ihm?«
»Das ist eine reichlich unverschämte Frage.«
»Das finde ich angesichts der Umstände ganz und gar nicht«, sagte Elliot, lehnte sich zurück und sah Judith unverwandt an.
Und wieder konnte Judith Elliots Verhalten nicht ganz einordnen. An irgendetwas erinnerte er sie, aber was war das?
»Also, in welcher Verbindung stehen Sie zu ihm?«, fragte er noch einmal.
»Zufällig bin ich seine Nachbarin«, sagte Judith, die sich nicht länger verstellen konnte. »Die Polizei hat mich heute Morgen befragt, und wenn Sie mich fragen, war es kein Unfall, jemand hat ihn ermordet.«
»Oh, ich verstehe!«, sagte Elliot und grinste breit.
»Entschuldigung?«
»Glauben Sie wirklich, dass ihn jemand ermordet hat?«
»Erschossen. Ja.«
»Wie interessant. Es ging also gar nicht um Ihr Kleid, oder?«
Elliot lächelte nach wie vor, aber das Strahlen in seinen Augen schien zu erlöschen, und Judith hatte das Gefühl, als würde alle Luft aus dem Zimmer gesaugt. »Natürlich ging es um das Kleid«, sagte sie, obwohl ihr klar war, dass Elliot ihre Lüge durchschaute.
»Das nehme ich Ihnen nicht ab. Wissen Sie, was ich glaube? Sie sind eine neugierige Nachbarin. Eine ganz neugierige Nachbarin, die sich für eine Amateurdetektivin hält und glaubt, hier herumschnüffeln zu können, nur weil ich mich vor ein paar Wochen in Henley mit Stefan gestritten habe und er jetzt tot ist. Habe ich recht?«
»Nichts dergleichen.«
»Sehr gut, dann können Sie mir vielleicht mitteilen, wann genau Mr Dunwoody gestorben ist?«
Judith war von der Frage überrumpelt. Wie konnte Elliot einfach so über irgendwelche Todeszeitpunkte plaudern? Auch das war Teil seiner Haltung, die sie nicht ganz einordnen konnte.
»Gestern Abend gegen acht«, sagte sie. »Vielleicht zehn nach acht.«
»So ein Zufall, dann habe ich ja ein Alibi.«
»Ach ja?«
»Gestern Abend um acht war ich in der All Saints’ Church. Wissen Sie, ich singe im Kirchenchor. Seit Jahren. Und jeden Donnerstagabend zwischen sieben und neun haben wir Chorprobe. Da war ich, und zufälligerweise habe ich direkt vor dem Pfarrer gestanden. Der Küster und mehrere Mitglieder des Kirchenvorstands waren auch da. Und der Bürgermeister von Marlow.«
Elliot lächelte, und Judith wurde plötzlich klar, was sie an ihm so beunruhigte. Er schien ihr Gespräch zu genießen. Wie eine Katze, die mit einer Maus spielt.
»Keine Sorge«, fuhr er fort, »ich werde nicht auf die Rechnung für Ihr Kleid warten. Wir wissen beide, dass Sie das erfunden haben, oder? Und jetzt verpissen Sie sich, bevor ich die Polizei rufe und Sie festnehmen lasse.«
Judith wusste darauf nichts zu erwidern. Zum ersten Mal seit Jahren fehlten ihr die Worte.
Kapitel 6
Während Judith zurück nach Marlow radelte, ging sie im Kopf noch einmal ihre Unterhaltung mit Elliot durch. Was um alles in der Welt hatte sie sich bloß dabei gedacht? Sie hatte gerade am helllichten Tag einen Mann herausgefordert, der vielleicht ein Mörder war! Bei dem Gedanken daran empfand sie unwillkürlich einen köstlichen Nervenkitzel. Immerhin hatte ihr die Begegnung einige wichtige Erkenntnisse gebracht, nicht zuletzt, dass Elliot glaubte, Stefan Dunwoody sei ein Lügner, Betrüger, Schwindler und Gauner gewesen. Das war eine ganze Liste schwerer Vergehen. Sie konnte nicht fassen, dass jemand ihrem reizenden Nachbarn Stefan, den auch seine Assistentin Antonia für einen perfekten Gentleman hielt, so etwas zutraute.
Judith war ganz in Gedanken versunken, als sie die High Street entlangradelte. Sie bemerkte nicht, wie sich die Einheimischen gegenseitig mit dem Ellbogen anstupsten und ihr belustigt hinterdreinschauten, als sie vorbeifuhr. Ihr dunkelgrauer Umhang flatterte hinter ihr, und ihre Beine traten, so fest sie konnten, in die Pedale. Bevor sie die Hängebrücke erreichte, hob sie die Füße von den Pedalen und ließ sich den Weg hinunterrollen, der durch den Friedhof und bis zum Eingang der All Saints’ Church führte.
Judith lehnte ihr Fahrrad gegen die Wand und versuchte ihre Gedanken zu ordnen. Ihr unmittelbares Anliegen war ganz simpel. Sie hatte die Theorie, dass Elliot etwas mit Stefans Tod zu tun hatte. Und falls dem so war, konnte er kaum gestern Abend bei der Chorprobe gewesen sein, oder? Eine Stippvisite in der All Saints’ Church sollte Klarheit bringen.
Judith