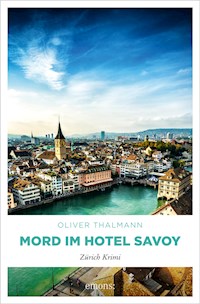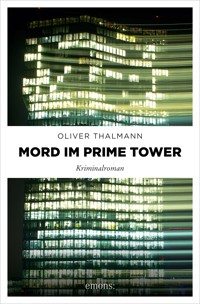
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Monti
- Sprache: Deutsch
Ein Serienmörder versetzt die Schweiz in Aufruhr. Kurz nach den Feierlichkeiten am 1. Mai wird Zürich von einer bizarren Mordserie heimgesucht. Der Täter hinterlässt an jedem Tatort eine Schachfigur, eine Buchseite und eine Grabkerze. Kommissar Monti begibt sich mit seinem Kollegen Urech auf die Jagd nach einem Phantom, das ihnen immer einen Zug voraus zu sein scheint. Die Spur führt ihn bis in sein eigenes Umfeld, und die Frage nach der Wahrheit wird zu einer persönlichen Zerreissprobe …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Thalmann landete mit seinem Debütroman «Mord im Hotel Savoy» gleich in den Top Ten der Schweizer Taschenbuch-Bestsellerliste. Er wurde 1975 geboren und wuchs in Hergiswil bei Willisau im Kanton Luzern auf. Er lebt mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern im Kanton Zürich.
www.oliverthalmann.ch
Instagram: oliverthalmann.ch
Facebook: oliverthalmann.ch
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/SilvanBachmann
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-037-2
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmässig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Wer anderen die Freiheit verweigert,
verdient sie nicht für sich selbst.
1
Monti starrte den Teufel an.
Der Satan spielte mit dem Menschen eine Partie Schach um dessen Seele, während im Hintergrund ein Engel wachte, jedoch vom Geschehen auf dem karierten Brett gelangweilt und schliesslich eingeschlafen war.
Monti wandte seinen Blick vom Gemälde an der Wand ab.
Er musste eine Entscheidung treffen, und zwar rasch.
Die Uhr tickte, und ihm verblieben nur noch fünf Minuten.
Es fühlte sich an, als hätte jemand die Frequenz des Zeitzählers erhöht.
Die Stille im Raum war nicht zum Aushalten. Er spürte das Adrenalin in seinen Adern pumpen, sein Herzschlag hatte sich erhöht, und seine Hände waren feucht.
Heute musste es funktionieren.
Ein zweites Mal würde er einen Gegner nicht entwischen lassen. Die Erinnerung an den letzten Misserfolg brannte in seinem Gedächtnis. Der Flüchtigkeitsfehler, der ihm damals unterlaufen war, hatte ihm eine schlaflose Nacht beschert und ihn noch Tage verfolgt. Selbst das Einreden von Kollegen, dass alle einmal einen Fehler machten und es nicht das Ende der Welt sei, half ihm nicht, denn er war selbst sein grösster und härtester Kritiker. Die anschliessende Analyse hatte ihm das Missgeschick aufgezeigt: schwarz auf weiss, gedruckt auf einem A4-Blatt und mit einem dicken Fragezeichen versehen.
Er hatte die Optionen seines Kontrahenten nur oberflächlich, nicht sorgfältig genug evaluiert. Man musste konzentriert bleiben bis zum Schluss. Nur ein einziger Fehler, eine kleine Unachtsamkeit, eine Prise Nachlässigkeit und das Spiel drehte sich um hundertachtzig Grad.
Schach war brutal.
Es war klar, dass er eine gute Stellung erreicht hatte. Seine schwarzen Figuren waren weit ins gegnerische Lager vorgerückt. Der Raumvorteil sollte ausreichen, sein Gegner war eingeengt, den einzigen Fluchtweg hatte er dieses Mal zugestellt, trotzdem machte sein Gegenüber keine Anstalten zu resignieren.
Monti musste den richtigen Moment abwarten, um zuzuschlagen und die Schlinge festzuziehen. Von aussen betrachtet erschien es immer so einfach, eine vorteilhafte Stellung in einen Gewinn zu verwandeln, die praktische Umsetzung, wenn man selbst die Entscheidungen treffen und verantworten musste, gestaltete sich oft schwieriger, was er bereits mehrfach am eigenen Leib hatte erfahren müssen.
Jetzt durfte er den Plan nur nicht zu stark hinterfragen, sonst sah man plötzlich Geister, die einem Gefahren weismachten, die es gar nicht gab, und die einen so vom Gewinnweg abbrachten.
Monti atmete dreimal – ganz langsam – tief ein und aus. Er streckte die rechte Hand aus, nahm den weissen Bauer vom Brett und setzte seinen schwarzen Springer auf das frei gewordene Feld.
Sein Widersacher blickte mit weit geöffneten Augen auf das Brett, gefolgt von einem Seufzer, bevor er Monti anstarrte, der den gespielten Zug auf seinem Partieformular notierte.
Eine Ablehnung des Opfers kam nicht in Frage, ansonsten würde Weiss einen Turm verlieren, und sein König würde einen wichtigen Verteidiger einbüssen.
Weiss stand auf Verlust, aber sein Gegenüber gab nicht auf. Der Herr war zäh wie sieben Tage altes Brot und schlug den Springer mit seinem Bauern und drückte auf die Uhr.
Weiss hatte vierzig Minuten Restbedenkzeit, das war das Einzige, was für das Weiterspielen sprach.
Monti schaute sich die neue Stellung an, führte eine letzte Kontrollrechnung in seinem Kopf durch und setzte dann seinen Bauern auf das Feld c1, griff nach der Dame neben dem Brett, ersetzte den Bauern durch diese und betätigte die Uhr.
Bevor er den Zug auf seinem Formular notiert hatte, hielt der Gegner die Schachuhr an und reichte ihm schweigend die Hand.
Game over.
2
Hans Notter hatte die dreizügige Kombination gesehen, die Monti vorbereitet hatte und zwei Züge zuvor in zwanzig Minuten in seinem Kopf zigmal auf mögliche Fehler und Schlupflöcher durchgegangen war. Montis Gegenüber gönnte ihm die Ausführung der «Petite Combinaison» nicht, wie sie von seinem grossen Vorbild José Raúl Capablanca genannt wurde. Sie hätte zum Matt geführt, und das vor allen Kiebitzen, nicht zuletzt den eigenen Mannschaftskollegen, die sich rund ums Schachbrett im Spielsaal der Schachgesellschaft Zürich an der Olivengasse 8 versammelt hatten.
Zum zweiten Mal hatte Monti in seiner langen Schachkarriere Notter, den vierfachen Zürcher Stadtmeister, besiegt, und das in nur neunundzwanzig Zügen.
Notter nahm seine Hornbrille ab und rieb sich die Augen. Er hatte merklich zugenommen, seit sie das letzte Mal gegeneinander gespielt hatten, fiel Monti auf. Der Bauchansatz war noch nicht da gewesen.
Notter fluchte über seine passive Spielweise. Erst jetzt bemerkte Monti die Schweissperlen auf dessen hoher Stirn, das schüttere braune Haar, das wie bei einem Hahn in der Mitte zu einem Kamm frisiert leicht aufstand.
Monti war erleichtert, denn bei seiner letzten Partie vor zwei Wochen gegen einen weniger starken Spieler hatte er sich mit einem Remis begnügen müssen, obwohl er, wie ihm seine Kollegen, die sich wie Geier, die nach Beute Ausschau hielten, ums Brett versammelt hatten, im Anschluss mitgeteilt hatten, «eine technisch gewonnene Stellung» hatte und «klar auf Gewinn stand». Sein Kontrahent hatte ihn mit unfairen Aktionen etwas aus dem Konzept gebracht. Andauernd hatte dieser «J’adoube» gesagt und die Figuren auf dem Brett zurechtgerückt, und zweimal hatte er die Züge nicht mitgeschrieben und dann Montis Partieformular, wo die Züge notiert werden mussten, von ihm verlangt, während er am Zug gewesen war und seine Zeit lief. Alles Sachen, die gegen das Etikett im Schach verstiessen, was Monti immer ärgerte. Am liebsten hätte Monti ihn vierundzwanzig Stunden in eine Zelle auf dem Polizeiposten geschmissen.
Notter und Monti stellten die Figuren wieder auf ihre Anfangsstellung zurück und gingen die Partie noch einmal Zug für Zug durch, um nach besseren Zügen für Weiss und Schwarz Ausschau zu halten. Dieses Ritual am Ende einer Schachpartie gefiel Monti, egal, ob er als Sieger oder als Verlierer vom Brett ging, es zeugte von gegenseitigem Respekt. Und vier Augen sahen mehr als zwei, das war auch im Schachsport so.
Es war die letzte Partie. An den anderen fünf Tischen hatten die Spiele schon geendet. Notter öffnete ein Fenster hinter sich, um der abgestandenen Luft den Garaus zu machen. Die Mannschaftskollegen stellten sich um den Tisch und verfolgten die Analyse anfänglich mit Zurückhaltung, aber dann kamen immer mehr Einfälle für vermeintlich bessere Züge von ihnen.
Die besten Vorschläge kamen von Charles A. Tanguy, der seit zehn Jahren als Präsident der Schachgesellschaft Zürich amtete. «Bobby Fischer gewann eine schöne Partie mit der gleichen Eröffnung, aber der spielte an dieser Stelle einen aggressiveren Zug als du, Fabio.»
«Was hatte Fischer im neunten Zug gespielt, das noch besser war?», fragte Monti und schaute Tanguy an.
«Ich glaube, er hat den Damenspringer entwickelt und gar nicht rochiert. Aber lass mich im Fischer-Buch nachschauen. Vielleicht täuscht mich mein Gedächtnis.»
Nein, Tanguy hatte ein Gedächtnis wie ein Elefant. Mit Fischer-Buch meinte er das Werk «My 60 Memorable Games» des ehemaligen US-amerikanischen Weltmeisters Bobby Fischer. Tanguy war ein Fan von Fischers Schachspiel und hatte eine dreihundertseitige Biografie über Fischer verfasst, die regen Anklang in der Schachszene fand.
Tanguy drehte sich um und schaute zum Bücherregal, das sich gleich neben ihnen befand. «Hat ein Junior es wieder falsch eingeordnet?» Er suchte die Büchersammlung von oben nach unten und von links nach rechts mit seiner rechten Hand ab, als hielte er einen Scanner zwischen den Fingern, bis er konsterniert feststellte: «Das ist doch nicht möglich. Es ist nicht da.»
«Ausgeliehen?», fragte Monti.
«Nein, das müsste mir gemeldet werden. Das darf nicht sein.»
«Das Buch wurde –»
Tanguy wartete nicht, bis Monti es ausgesprochen hatte. «Merde! Das Fischer-Buch war von der ersten Auflage mit der alten, deskriptiven Notation. Das kannst du heute gar nicht mehr kaufen.»
Es geschah nicht oft, dass Monti Tanguy nervös oder schockiert sah, aber heute war so ein Tag. Selbst in Zeitnot während einer Schachpartie verlor Monsieur Le Président nie die Ruhe, als hätte er Nerven aus Stahl. Der sonst immer gut aufgelegte französisch-schweizerische Doppelbürger schien seine Contenance zu verlieren und zupfte an seiner Fliege herum. Sein Markenzeichen, das er bei jedem Schachspiel anhatte. Heute trug er ein burgunderrotes Exemplar, das zu seinem weissen Hemd passte. Seine Fliegensammlung umfasste mehr als zweihundert Stücke, wie er Monti einmal erzählt hatte.
«Keine Panik auf der Titanic.» Notter nahm sein Telefon aus seiner Jacke und tippte kurz auf das Display. «Ich habe die Partie gefunden. Keres gegen Fischer, 1959 am Kandidatenturnier in Bled, Jugoslawien.»
«Oui. Das ist die Partie.»
Notter lud die Partie in seine Schach-App auf dem Smartphone, und sie spielten sie nach. Im neunten Zug spielte Fischer tatsächlich den Springer nach d7.
«Und wann hat er rochiert?», fragte Monti ungläubig. Er hatte im neunten Zug mit der kleinen Rochade seinen König in Sicherheit gebracht.
Notter starrte Monti an. «Er verzichtete auf die Rochade und griff am Damenflügel an. Mit der kleinen Rochade läufst du geradewegs in meinen Angriff am Königsflügel rein.»
«Den ich in der Partie aber ohne Probleme abwehren konnte.»
«Ich war zu wenig konsequent, sonst hätte ich deinen König zerlegt.»
Tanguy stimmte anerkennend zu. «Fischer war ein Genie. Wenn er Blut leckte, dann konnten die Gegner die Segel streichen.»
Sie spielten die nächsten Züge der Fischer-Partie durch und bemerkten, dass dieser im Gegensatz zur Fortsetzung, die Monti gewählt hatte, eine noch bessere Stellung besass, alle seine Figuren standen auf guten Feldern und übten gewaltigen Druck auf den Gegner aus.
«Das nächste Mal wähle ich auch die Fortsetzung von Fischer», sagte Monti.
«Und ich werde eine andere Eröffnung spielen.» Notter stand auf, streifte sich die Lederjacke über und verliess das Spiellokal, umringt von seinen Mannschaftskollegen, die alle dreinblickten, als stände der Weltuntergang bevor.
Sie hatten doch lediglich den Wettkampf gegen die Schachgesellschaft Zürich verloren.
Als Monti beabsichtigte, die Tür zu schliessen, drehte sich Notter auf der Türschwelle um. «Das war das letzte Mal, dass du mich besiegt hast!»
3
Keine fünf Minuten nachdem die gegnerische Mannschaft das Clublokal mit gesenktem Haupt verlassen hatte, sassen Max Staub, der Kassier der Schachgesellschaft, Tanguy und Monti im «Bohemia» am Kreuzplatz.
«Simply the Best» dröhnte aus den Lautsprechern, als ob sie es beim DJ gewünscht hätten. Es roch nach Käse und Pommes frites. Das Restaurant war gut besucht, der Aussenbereich war dank des milden und sonnigen Frühlingswetters voll besetzt, weshalb sie sich im Inneren neben der Bar auf der ledernen Ecksitzbank niedergelassen hatten. Die Leute unterhielten sich ausgelassen und genehmigten sich ein Bier, ein Glas Wein oder ein Cüpli. Einige kamen sicherlich von der 1.-Mai-Demonstration, die weitgehend friedlich verlaufen war und keine Nachdemonstrationen nach sich gezogen hatte, wie Monti aus der Teletext-App auf seinem Smartphone erfahren hatte. Jetzt konnten sie alle den Tag der Arbeit, der dieses Jahr auf einen Samstag fiel, gebührend feiern.
Eine Flasche Château Les Gravières des Jahrgangs 2015, die Tanguy spendiert hatte, stand vor ihnen auf dem runden roten Tisch. Sie prosteten sich zu.
Freude herrschte.
«Ein feiner Tropfen. Gute Wahl!» Der Rotwein schmeckte fruchtig nach Kirsche und Brombeere, am Gaumen etwas trocken, wahrscheinlich vom hohen Tanningehalt. Monti merkte, wie sich sein Körper nach den Adrenalinschüben am Schluss der Partie nach und nach wieder einem normalen Niveau anpasste, der Wein trug seinen Anteil dazu bei.
«Nicht nur die Toskaner produzieren guten Wein.» Tanguy grinste.
Endlich war die Durststrecke zu Ende. Vier zu zwei für die Schachgesellschaft Zürich. Es war der erste Sieg in der diesjährigen Schweizer Mannschaftsmeisterschaft, kurz SMM genannt. Ein wichtiger Sieg, drohte ihnen doch der Abstieg aus der Nationalliga B in die erste Liga.
Tanguy legte das Wettkampfformular, auf dem die Resultate der einzelnen Partien standen, in die Mitte des Tisches, als ob es eine Trophäe wäre, die es zu bestaunen galt. Er sass immer am ersten Brett bei den Wettkämpfen, da er der Spielstärkste im Team war. Er war eine lebende Legende in der Schachszene, jeder kannte und schätzte ihn. Er ordnete alles dem Schach unter. Wenn er zu einem Meisterturnier einlud, kam die ganze Weltelite in die Limmatstadt, nicht wegen des Preisgeldes, das floss nicht mehr so reichlich wie früher, sondern wegen des attraktiven Rahmenprogramms und der ausgezeichneten Spielbedingungen, die er den Grossmeistern offerierte.
«Merveilleux! Ein schönes Figurenopfer. Das hatte Notter übersehen, und es hat ihm den Rest gegeben.»
Tanguy klopfte Monti auf die Schulter.
«Mein Freibauer war einfach zu stark», sagte Monti.
«Das fuchst ihn. Der brennt auf die Revanche. Hast du seinen Blick gesehen, als er das Lokal verliess?»
«Dem möchte ich heute Nacht nicht begegnen», mischte sich Staub ein.
«Auf die Revanche muss er jetzt ein Jahr warten.» Monti nahm das Weinglas in die Hand und toastete seinen Kollegen erneut zu.
«Vielleicht trefft ihr beim Bundesturnier aufeinander», sagte Tanguy.
«Leider kann ich daran nicht teilnehmen. Ich habe den Pikettdienst von Urech übernommen über Auffahrt. Der will unbedingt zum Eidgenössischen Schützenfest in Luzern, das nur alle fünf Jahre stattfindet.»
«Was? Als Offizier hast du Pikettdienst?», fragte Staub.
Monti seufzte.
«Eigentlich schön, dass es noch so Leute gibt wie Urech, die Traditionen hochhalten und die Wurzeln der Eidgenossenschaft kennen», sagte Tanguy.
«Urech ist Eidgenosse durch und durch», ergänzte Monti.
Staub räusperte sich. «Ich will keine Spassbremse sein, aber ich muss euch etwas weniger Schönes mitteilen.»
Monti und Tanguy schauten ihn fragend an.
«Es hat sich ein Diebstahl im Clublokal ereignet», begann Staub.
«Was? Was wurde gestohlen?», fragte Tanguy.
«Jemand hat die Kasse geplündert.»
Die rote, metallene Geldkassette lag immer neben der Kaffeemaschine. Sie war klein, viel zu klein, weshalb sich Monti schon häufig aufgeregt hatte. Der Schlitz für den Münzeinwurf war winzig. Mit viel Mühe gelang es einem, eine Zehn- oder Zwanzigernote reinzustossen, aber Wechselgeld konnte man nicht rausnehmen, da nur Staub einen Schlüssel hatte. Vielleicht war das ein Mitgrund dafür, dass der ein oder andere Spieler «vergass», den Kaffee zu bezahlen, dachte Monti.
Tanguy rümpfte die Nase. «Wer macht denn so etwas?»
«Jemand, der Geld braucht», sagte Staub mit ruhiger Stimme.
«Aber die Schatulle ist doch verschlossen, und du hast den einzigen Schlüssel», sagte Tanguy und schaute Staub an.
«Ein Kindergärtner könnte dieses Zwanzig-Franken-Kässeli aufbrechen. Auf YouTube findest du eine Anleitung, wie du sie mit einer Stecknadel aufbringst.»
«So einfach?», fragte Tanguy.
«Es war bereits das zweite Mal, dass ich eine leere Kasse vorfand.»
«Wer hat alles einen Schlüssel zum Lokal?», fragte Monti.
«Wir haben sieben Kopien. Die Putzfrau hat einen, Max, ich und Vázquez und …», sagte Tanguy. «Ich habe die Liste mit den Schlüsselbesitzern zu Hause.»
«Wer könnte so was anstellen, Max?», fragte Monti.
«Ich vermute, der alte Britschgi bereichert sich auf unsere Kosten.»
«Hat der immer noch einen Schlüssel? Er spielt doch seit Jahren nicht mehr», fragte Monti.
Tanguy nickte.
Staub erzählte, dass er Britschgi am letzten Samstag, als er die Uhren und Bretter für ein Jugendturnier holen wollte, im Spiellokal schlafend auf einer der Holzbänke entdeckt hatte. «Britschgi nützt das Lokal als Schlafgelegenheit. Es hat nach Alkohol und Rauch gerochen. Ich habe drei leere Weinflaschen entsorgen müssen. Er hat so tief geschlafen, dass er gar nicht gemerkt hat, dass ich im Lokal war.»
«Ich spreche mit ihm. Das muss aufhören», sagte Tanguy.
«Und nimm ihm gleich den Schlüssel ab, bevor er wieder ein Saufgelage veranstaltet», sagte Staub bestimmt.
«Glaubst du, er hat auch das Fischer-Buch gestohlen?», fragte Tanguy.
«Der klaut alles, was nicht niet- und nagelfest ist.»
Hanspeter Britschgi war bis vor fünf Jahren der Materialverwalter der Schachgesellschaft gewesen, bis er aus dem Vorstand geschmissen worden war. Britschgi hatte eine lange Liste von Verfehlungen. Das Fass zum Überlaufen hatte gebracht, dass er an der Schweizermeisterschaft einem Gegner mit schwarzer Hautfarbe den obligatorischen Handschlag vor der Partie verwehrt hatte. Das hatte eine Forfait-Niederlage mit sich gezogen und seinen Ruf in der Schachszene ruiniert. Seit seinem Rausschmiss aus dem Vorstand hatte er keine Partie mehr für die Schachgesellschaft gespielt. Tanguy liess ihn zwar als einfaches Mitglied im Club bleiben, die Schachgesellschaft sei auf jeden einzelnen Mitgliedsbeitrag angewiesen, meinte er dazumal, aber zu den offiziellen Wettkämpfen und Turnieren wurde Britschgi nicht mehr aufgeboten. Er kam einzig noch zum jährlichen Blitzturnier am Stephanstag, weniger des Schachs wegen, wie Monti vermutete, hatten dessen Leistungen am Brett in der Zwischenzeit doch merklich nachgelassen. Der wahre Grund dürften die üppigen Fleisch- und Käseplatten und die feinen Weine sein, die der Vorstand seinen Mitgliedern dann jeweils offerierte.
Staub konnte Britschgi noch nie ausstehen, vor allem seit dieser in den letzten Jahren den Mitgliedsbeitrag nicht mehr oder nur nach mehreren Mahnungen bezahlt hatte. An einem der Blitzturniere waren sie aneinandergeraten. Der sonst so ruhige Staub, der keiner Maus etwas zuleide tun konnte, hatte Britschgi einen Turm an den Kopf geworfen, was zu einem Handgemenge geführt hatte, bevor Monti die Streithähne trennte. Sie waren so gegensätzlich wie ein Elefant und eine Maus.
Staub, der Ordentliche, Ruhige und Saubere, der seine Brötchen als Steuerkommissär bei der Steuerverwaltung des Kantons Zürich verdiente, stand Britschgi gegenüber, der stets etwas verwahrlost auf Monti gewirkt hatte, sich nicht um sein Erscheinungsbild kümmerte und keinem Wortgefecht aus dem Wege ging. Die Alkoholsucht und dass er häufig arbeitslos war und die Stellen, wenn er solche innehatte, wohl häufiger wechselte als seine Unterwäsche, rundeten das Profil ab.
«Wollen wir eine Kamera oberhalb des Putzschranks aufstellen?», fragte Tanguy.
«Für die Installation einer Überwachungskamera müssten wir zuerst das Einverständnis des Vermieters haben und streng genommen unsere Mitglieder darüber informieren. Persönlichkeits- und Datenschutz, meine Herren», erwiderte Staub und schaute Monti an.
«Kein Problem. Machen wir so. Dann hört das Klauen auf», sagte Tanguy und beendete den Exkurs. Er hob sein Weinglas. «Auf die Schachgesellschaft! Den ältesten und erfolgreichsten Schachclub der Welt.»
Staub und Monti hoben die Gläser ebenfalls, sie prosteten sich zu, und ihre Gespräche drehten sich wieder um ihre gespielten Partien, Eröffnungen und Endspiele.
«Die Herren lassen es sich gut gehen», sagte eine Frau, die sich von hinten an Monti angeschlichen hatte und ihm ihre beiden Hände auf die Schultern legte, was ihn zusammenzucken liess.
«Chère Nicole, du siehst aber toll aus. Setz dich und trink ein Glas Wein mit uns.» Tanguy küsste galant ihre Hand und rutschte zur Seite. Sie liess sich nicht zweimal bitten.
In der Tat sah Montis Verlobte bezaubernd aus. Ihre braunen, offen getragenen Haare glänzten. Sie trug ein einteiliges schwarzes Kleid mit langen Ärmeln, das kurz genug war, um ihre schönen Beine zu betonen.
«Wir haben gewonnen.» Monti gab ihr einen Begrüssungskuss.
«Das sieht ein Blinder.» Sie lachte. «Das war aber auch mal Zeit. Ihr hättet bald einen Komplex gehabt, wenn ihr ans Schachbrett treten müsst. Nicht wahr, Fabio?»
Monti nickte. Es war wie verhext. Je härter man versuchte, gut zu spielen, umso schlechter lief es.
«Dein Mann spielte wie Bobby Fischer. Er hat den Notter nach Strich und Faden zerlegt. Das hättest du sehen sollen, comme un grand maître. Magnifique!» Tanguy hob die Stimme.
«Jetzt reicht es mit Selbstbeweihräucherung, ihr Grossmeister in spe.»
Schachgrossmeister waren sie alle nicht, würden sie auch nie werden, aber heute fühlte sich Monti wie einer.
Tanguy erzählte Nicole, ohne ein Detail auszulassen, wie die Partien verlaufen waren, obwohl sie von Schach nicht sehr viel Ahnung hatte.
Während die Gesprächsthemen sich vom Schach hin zur Politik und zum Wetter bewegten, schlich sich Monti zum Bartresen, wo er eine zweite Flasche Château Les Gravières bestellte, bezahlte und zum Tisch brachte. Für Staub und Tanguy.
Nicole und er verabschiedeten sich von ihnen. Sie marschierten Hand in Hand in Richtung Niederdorf, wo sie im Nägelihof «Mère Catherine» einen Tisch reserviert hatten, um danach im Kino einen Dokumentarfilm über eine amerikanische Schriftstellerin anzuschauen.
«Tanguy war in Festlaune, als ob ihr gerade die Meisterschaft gewonnen hättet», sagte Nicole.
Er schlang seinen Arm um ihre Schultern. «Die vierundsechzig Felder auf dem Schachbrett bedeuten die Welt für ihn.»
«Er hat gestrahlt wie ein Maikäfer.»
«Schach macht glücklich.»
Sein Handy klingelte.
Widerwillig nahm er den Anruf entgegen, als er das Display betrachtet hatte, wo ein Gesicht mit schneeweissem Bart aufleuchtete.
«Wir haben eine Leiche», sagte Peter Urech, sein Polizeikollege von der Ermittlungsabteilung Gewaltkriminalität, mit tiefer und heiserer Stimme, die ihren Ursprung bestimmt in einer durchzechten Nacht im Schützenhaus hatte.
«Wo?» War der 1. Mai doch nicht so friedlich verlaufen?
«Ein Securitas-Mitarbeiter hat einen toten Geschäftsmann im Keller des Prime Towers entdeckt – mit einem Loch im Kopf …»
Nicole schaute ihn kritisch an, ihre Schultern hingen tief.
Monti unterbrach ihn. «Danke für die Information. Ich gehe jetzt mit Nicole nachtessen und danach ins Kino. Wenn du den Einsatzplan lesen würdest, wüsstest du, dass ich nicht Pikettdienst habe. Sucht euch einen anderen.»
«Leider braucht es dich. Die Umstände erfordern es.»
«Welche Umstände?»
«Dein Schachwissen ist gefragt, sonst hätte ich einen anderen aufgeboten. Das darfst du mir glauben.» Urech erzählte von seinen ersten Eindrücken vom Tatort, und Monti gab seinen Widerstand auf.
«Wer ist alles vor Ort?»
«Das ganze Orchester: Müller, die Spurensicherung und die Rechtsmedizin.»
Schlimmer konnte es nicht mehr kommen. Sein Samstagabend war ruiniert: Statt den Tag mit einem feinen Coq au Vin und einem Dokumentarfilm über Patricia Highsmith ausklingen zu lassen, drohten ihm der Anblick einer Leiche und, was nicht minder schlimm war, die Zusammenarbeit mit Staatsanwalt Dr. Hans Müller.
Seit Anfang des Jahres hatte es das Schicksal gut mit ihm gemeint, und die Wege von Müller und ihm hatten sich nicht gekreuzt.
Er beendete den Anruf.
Nicole, die Vollblutjournalistin, die beim Schweizer Fernsehen arbeitete, war die flexiblen Arbeitszeiten von ihm gewohnt, aber er sah die Enttäuschung in ihrem Gesicht.
«Es tut mir leid, Nicole. Ich muss ausrücken. Wir haben einen Mordfall.»
«Verdammt! Muss das sein? Am 1. Mai?»
«Mörder kennen keine Feiertage.»
4
Die Luft war feucht, am Horizont zogen dunkelgraue Wolken auf, und das Thermometer zeigte fünfzehn Grad an, als Monti aus der S7 am Bahnhof Hardbrücke stieg. Es stand ein Sturm bevor, hatte ihn seine Wetter-App gewarnt. Er musste sich durch die Menschenmenge auf dem Perron kämpfen. Laute Musik dröhnte aus tragbaren Boxen, und einige Männer prosteten sich mit Bierdosen zu. Die SBB-Uhr zeigte sechs Uhr einundfünfzig an.
Während er durch die Unterführung schritt, die neuerdings von einer zwanzig Meter langen elektronischen Videowand gesäumt war, die die Plakatwand abgelöst hatte, lief dort ein Spot von Schweiz Tourismus. Er sah das Ende des Films mit der Botschaft: «When you need vacation without drama. You need Switzerland.»
Das hätte er sich auch gewünscht – weniger Drama in seinem Leben. Einfach mal etwas Ruhe, eine Auszeit vom Jagen von Mördern, ein bisschen «chillen» würde Daniela Lüscher, die junge Cyberspezialistin in seinem Team, sagen.
Als Monti vor dem Prime Tower stand, fühlte er sich winzig klein. Die Glasfassade des Wolkenkratzers mit seinen sechsunddreissig Stockwerken, die auf hundertsechsundzwanzig Meter verteilt waren, beeindruckte ihn immer wieder aufs Neue. Auf den obersten Etagen ragte die Fensterfront heraus wie ein Würfel.
Über dem Dach zog ein Adler seine Kreise und hielt nach Beute Ausschau. Das Hochhaus beheimatete Anwaltskanzleien, Banken, Dienstleistungskonzerne, das Hotel Rivington & Sons und das Restaurant Clouds, dessen Essen und Traumblick über die Stadt und den Zürichsee Nicole und er am letzten Valentinstag, den er ausnahmsweise nicht vergessen hatte, geniessen konnten.
Monti ging durch eine der beiden gläsernen Karusselltüren. Im Entree am Haupteingang erwarteten ihn Kollege Urech und ein Wachmann, der sich als Revierbewachungsspezialist Tobias Fischli auswies, so nannte die Securitas ihre Wachmänner heutzutage.
«Die anderen sind bereits unten.» Urech lief voraus.
Sie schritten am Empfangsbereich vorbei, der grosszügig bemessen war. Es war ruhig an diesem Ort, wo sich sonst Geschäftsleute und Anwälte mit eiligen Schritten kreuzten, es schienen nicht viele Leute an diesem Samstagabend im grössten Hochhaus in Zürich zu arbeiten. Sie liefen an einem Herrn im schwarzen Anzug vorbei, der sie freundlich von seinem Pult hinter der Rezeption grüsste. Fischli schleuste sie mit seinem Badge durch die Schiebetüren. Alles im Gebäude war auf Hochglanz poliert: der graue Boden, die Spiegelwandfront und die Marmorwand neben den Liften. Fischli drückte eine Taste auf dem Steuerungsinstrument, das neben einem der acht Lifte stand. Der Lift mit dem Buchstaben H kam fast geräuschlos, und die Türen glitten auf. Neben dem G-Lift befand sich die grüne Notausgangstür.
«Wann haben Sie die Leiche entdeckt?», fragte Monti, als sie den Lift betraten.
Fischli schaute auf die Uhr. «Vor zwei Stunden. Mir ist aufgefallen, dass das Licht im Untergeschoss nicht funktionierte, und da bin ich zum Schaltkasten der Elektroverteilung gegangen. Die Sicherungen waren rausgeflogen. Da habe ich einen Kontrollgang gemacht und die Leiche gefunden.»
Als sie im Untergeschoss aus dem Fahrstuhl stiegen, liefen sie einen langen, schmalen Gang entlang. Es roch nach Zitrusfrucht, wahrscheinlich vom Putzmittel. Es gab keine Fenster, nur künstliches Licht, das aber dank den LED-Lampen ganz angenehm war. Fischli führte sie zur Tür am Ende des Flurs. Er schloss sie mit seinem Badge auf. «Ich habe nichts angefasst, nichts verändert, nichts geöffnet.»
Der Raum hatte eine rechteckige Form, war mit einem Steinboden versehen und verfügte über keine Fenster, dafür über eingebaute Spotlampen. Selbst hier im Technikraum hatte der Architekt nicht gespart. Es gab zwei Regale. Das eine war mit Kabeln, Bildschirmen und Tastaturen belegt, das andere mit Brandschutzutensilien und Werkzeugen für den Hauswart bestückt.
Fischli teilte ihnen mit, dass alle Badge-Inhaber Zutritt zu diesem Raum hätten. Jeder Mitarbeiter, der im Prime Tower arbeitete, konnte sich also Zugang zum Keller verschaffen.
Es trat ihnen ein stechender und aufdringlicher Geruch entgegen, als sie eintraten. Monti zog seine Augen zusammen und musste niesen.
«Desinfektionsmittel, Ethanol, schätze ich», sagte der Mann im weissen Schutzanzug, als er einen Plastikbeutel in seinen Spurensicherungskoffer legte.
«Habt ihr etwas gefunden?», fragte Monti, der den Mann unter dem Ganzkörperanzug erst beim zweiten Hinsehen erkannte. Es war Michael Hafner vom Forensischen Institut, der seine Haare neuerdings ganz kurz trug. Neben ihm waren noch zwei weitere Forensiker vor Ort.
«Wir haben das Projektil dort hinten gefunden.» Hafner streckte seinen rechten Arm aus.
«Welches Kaliber? Welche Waffe?»
«Das müssen wir im Labor prüfen. Die Kugel scheint mir einen Geschossdurchmesser von 0,4 oder 0,45 Zoll aufzuweisen. Zur Tatwaffe kann ich noch nicht viel sagen, ausser dass es sich um eine Handfeuerwaffe handelt.»
«Habt ihr verwertbare DNA-Spuren gefunden?»
Hafner zeigte auf die Klebetaps, die sie benutzten, um Hautschuppen sicherzustellen. «Wir haben Schuppenspuren gefunden, aber die können natürlich auch von den Leuten stammen, die sich sonst hier im Technikraum aufhalten.»
Jeder Mensch verlor pro Stunde Hunderte von Hautschuppen. Diese stammten aus Zellen mit einem Zellkern, der die Erbsubstanz DNA enthielt. Unter günstigen Bedingungen konnte eine winzige Schuppe den Forensikern respektive den Rechtsmedizinern bereits ausreichen, um die DNA eindeutig zu bestimmen. Es war für einen Täter in der heutigen Zeit unmöglich, einen Tatort zu verlassen, ohne dass Schuppen zurückblieben.
Das Hauptproblem der Forensiker war nicht die Sicherstellung der Schuppen, um das DNA-Profil zu erstellen, sondern dass zu viele Leute am Tatort herumliefen und so Spuren unfreiwillig verwischten.
«Wie sieht es mit Fingerabdrücken aus?»
«Das Fedpol wird einiges zu tun haben mit dem Füttern des AFIS.»
«Viel Spass bei der Auswertung.»
«Ich erhoffe mir mehr von den daktyloskopischen Spuren als von den DNA-Profilen im vorliegenden Fall, wenn ich ganz ehrlich bin», sagte Hafner.
Monti verstand ihn. Während DNA-Spuren am Tatort auch von einer anderen Person – absichtlich oder unabsichtlich – mitgebracht werden konnten, bestand beim Fingerabdruck kein Zweifel, dass die dazugehörige Person sich dort aufgehalten hatte. Mit dem automatisierten Fingerabdruck-Identifikations-System, AFIS, konnte die Polizei eine eindeutige Personenidentifikation innert weniger Minuten durchführen.
Die Leiche lag hinten an der Wand am Boden, mit krummem Rücken und zusammengeschrumpft wie ein Sack Mehl, der von der Wand gerutscht war.
Als Monti sich ihr näherte, nahm er Uringestank wahr. Der Täter hatte das Opfer nicht einmal auf die Toilette gehen lassen. Sie blieben einen Moment ehrfürchtig und bedächtig vor dem toten Mann stehen, als ob sie ihn gekannt hätten.
«Volltreffer eines Verrrückten!», stiess Urech aus.
Monti schauderte, weniger vom Anblick der Leiche, sondern vielmehr von der Kälte, die er fühlte.
Das Opfer lag in einer Blutlache, die von dem Einschuss in der Mitte der Stirn herrührte und über das Hemd auf den Plattenboden gelangt war; sonst war relativ wenig Blut an die Wand gespritzt. Das Blut am Kopf war bereits trocken und eher schwarz als rot. Eine Binde ragte aus dem aufgesperrten Mund, aus dem Speichelfäden runterhingen. Der Mann trug einen Massanzug. Die Hose wies neben den Blutspritzern einen Urinfleck auf.
Im Schritt des Mannes war eine gelbe Kerze eingeklemmt, die fast vollständig heruntergebrannt war. Sie war in einem roten Plastikbehälter, der einen goldenen Deckel mit gestanzten Löchern in Form von Kreuzen und Kreisen besass. Eine Grabkerze.
«Was zum Teufel soll das?» Urech zeigte auf die Kerze.
Monti kniete nieder und nahm den Docht zwischen Daumen und Zeigefinger. Er war kalt. «Die Kerze muss eine Bedeutung haben.»
Urech schaute ihn verdutzt an, streckte seinen Zeigefinger hoch und bewegte ihn rauf und runter. «Vielleicht ein Streit unter Schwulen.»
Monti zog die Schultern hoch. «Es könnte auch eine religiöse Bedeutung haben. Aber spekulieren wir nicht, sondern machen erst unsere Hausaufgaben.»
«Es sind immer Beziehungsdelikte.» Urech starrte weiterhin auf die Kerze.
«Falsch. Nur in neunzig Prozent der Fälle.»
Urech lachte. «Mit Betonung auf ‹nur›.»
Jetzt sah Monti das Loch in der Wand hinter dem Kopf der Leiche, wo Hafner das Projektil gefunden hatte. Die Tatwaffe fehlte. Deshalb mussten sie ein paar Leute aufbieten, um nach ihr in Abfalleimern innerhalb sowie ausserhalb des Gebäudes zu suchen, obwohl sie sich bewusst waren, dass es unwahrscheinlich war, dass der Täter die Waffe in der nahen Umgebung entsorgt hatte.
Und dann sah Monti etwas, das seinen Puls erhöhte.
Eine Schachfigur – ein schwarzer Bauer aus Holz. Standardgrösse: fünf Zentimeter hoch, der Sockel hatte einen Durchmesser von zweieinhalb Zentimetern. Der Bauer stand rechts neben den Füssen des toten Mannes, so weit weg, dass, falls sich die Beine der Leiche drehten, er von ihnen nicht berührt würde. Monti streifte sich Plastikhandschuhe über und kniete sich zum Opfer. Er nahm die Figur in die Hand und drehte sie in alle Himmelsrichtungen.
Je länger er auf sie blickte, umso mehr wuchs ein Unbehagen in ihm. Was sollte das?
«Hat der Täter noch Schach mit seinem Opfer gespielt und den Bauer vergessen mitzunehmen?», fragte Urech.
«Das glaube ich nicht. Mit gefesselten Händen und zugepflastertem Mund lässt sich schlecht Schach spielen.»
Urech schaute hinter den Rücken des Opfers. «Das ist ein Kletterseil, mit dem die Handgelenke gefesselt sind.»
Monti fotografierte die Leiche und die Gegenstände mit seinem Smartphone aus allen Richtungen. Obwohl die Spurensicherung für die Fotos zuständig war, hatte er sich angewöhnt, immer selbst auch Fotos zu schiessen. Es half ihm, die Details besser in seinem Gedächtnis zu behalten.
Monti hielt Urech den schwarzen Bauer vor die Nase. «Das ist edles Holz. Keine Billigware, die du im Supermarkt kaufst.»
Müller platzte dazwischen. «Schauen Sie sich das an.»
Er kniete auf der anderen Seite des Opfers nieder und zeigte mit seinem Finger auf das Blatt Papier, das auf dem Bauch der Leiche lag. Die Seite sah alt und benutzt aus, war vergilbt, und die Ecken hatten Faltspuren.
Montis Körper versteifte sich. Er spürte, wie sein Blut aus dem Gesicht wich. Er hob die Seite auf, und als er sie in Sichtweite hatte, zuckte er mit dem Kopf zurück, wie wenn ein elektrischer Stoss ihm durch den Körper fahren würde. Er starrte auf das Blatt.
Dio mio. Das durfte nicht wahr sein.
«Das ist die vierzehnte Partie aus ‹My 60 Memorable Games›.»
Müller und Urech schauten ihn verwundert an.
«Sie kennen das Buch?», fragte Müller.
«‹Meine 60 denkwürdigen Partien› ist ein Buch von Bobby Fischer, dem wohl berühmtesten Schachspieler aller Zeiten.»
«Fischer. War das nicht der amerikanische Schachspieler, der die Sowjets während des Kalten Kriegs ärgerte?»
«Ja, er war der elfte Schachweltmeister, der 1972 die Weltmeisterschaft in Island gegen Boris Spassky gewann und die Dominanz der sowjetischen Spieler durchbrach.»
«Der gute Westen gewann gegen den bösen Osten», murmelte Urech.
«Die Partien wurden live im Fernsehen übertragen.»
«Was hat es mit diesem Buch auf sich?», fragte Müller.
«Das Buch ist ein Klassiker der Schachliteratur. Bobby Fischer hatte seine eindrücklichsten Schachpartien in einem Buch niedergeschrieben und mit Anekdoten, Analysen und Kommentaren zu den einzelnen Zügen versehen. Diese Seite muss aus einer Ausgabe der ersten Auflage stammen, Anfang der siebziger Jahre oder so.»
Monti hatte zu Hause eine neuere Ausgabe davon, was er ebenso unerwähnt liess wie das verschwundene Buch aus der Bibliothek der Schachgesellschaft.
«Das bedeutet, dass wir es mit einem älteren Täter zu tun haben», sagte Urech.
«Gut möglich. Falls der Täter das Buch damals im Alter von zehn Jahren erhalten hat, wäre er jetzt um die sechzig», sagte Monti.
«Das muss nicht zwingend sein. Der Täter kann das Buch in einem Antiquariat erworben haben», sagte Müller.
Monti las laut vor:
«14Keres [U.S.S.R] – Fischer
Candidates Tournament 1959
Sicilian Defense
Too many cooks»
Darunter folgten in kleinerer Schrift zwei Abschnitte mit Text, wo der Autor über Gambits, Initiative und Damenopfer fachsimpelte.
«Was bedeuten diese Zahlen und Buchstaben?» Urech zeigte auf den dritten Abschnitt, der zentriert eine Abfolge von Ziffern, Zeichen und Buchstaben aufwies.
1 P – K4
P – QB4
2 N – KB3
P – Q3
3 P – Q4
P x P
«Das sind die gespielten Züge der Partie. Wir nennen es die Notation – die Partienotation.»
«Die Notation mit den Buchstaben und Ziffern ist die Sprache unter euch Schachspielern?», fragte Urech.
«So kann jeder die Partie nachspielen und analysieren. Es gibt verschiedene Notationen, verschiedene Sprachen. Dieses hier ist die beschreibende Notation, die heute nicht mehr verbreitet ist. Heute herrscht die algebraische vor, die der Weltschachverband FIDE vorschreibt.»
«Was bedeutet 1 P – K4?», fragte Müller.
«Die 1 steht für den ersten Zug. P steht für Pawn, Bauer. K für King, König. 4 steht für die 4. Reihe. Weiss zieht mit dem ersten Zug den Königsbauer zwei Felder voran von der zweiten auf die vierte Reihe. Bei der beschreibenden Notation werden die Reihen des Schachbrettes von eins bis acht aus Sicht des jeweiligen Spielers gezählt, während bei der algebraischen jedes Feld des Schachbretts von Weiss aus betrachtet wird und jedes Feld eine eindeutige Koordinate besitzt.»
«Hat der schwarze Bauer etwas mit der Buchseite zu tun?», fragte Müller.
«Gut möglich. Vielleicht ist es eine Botschaft des Mörders», erwiderte Monti.
Urech zwinkerte Monti zu. «Schach ist ein Kriegsspiel. Verdammt gefährlich. Jetzt töten die Schachspieler sogar schon abseits des Brettes. Nimm dich in Acht, wenn du das nächste Mal am Brett spielst. Aus Spiel wird Ernst.»
Monti wandte sich ab, er hatte sich über die Jahre an die Sprüche und den Humor seines Kollegen gewöhnt, während Müller diesen zurechtwies und etwas mehr Pietät vor dem Opfer verlangte.
«Wer ist Keres?», fragte Müller.
«Paul Keres war ein estnischer Grossmeister. Ein starker Spieler, der für die Sowjetunion spielte, der es aber nie zum Weltmeister gebracht hat.»
«Wieder Osten gegen Westen», sagte Müller nachdenklich.
«Der Text ist auf Englisch. Gibt es das Buch auch auf Deutsch?», fragte Urech.
«Möchtest du in deinem zarten Alter noch eine Schachkarriere starten?», fragte Monti mit einem Lächeln im Gesicht.
«Nein, keine Angst. Ich mache dir keine Konkurrenz. Meine Frage war rein dienstlich.»
«Ich denke, es gibt eine deutsche Übersetzung, bin mir aber nicht ganz sicher.» In seiner Bibliothek zu Hause lag auch eine Ausgabe in englischer Sprache.
«Weshalb hat der Mörder eine englische Version benutzt?», fragte Urech.
«Vielleicht kann er kein Deutsch», intervenierte Müller.
Urech zog sich ein Paar Plastikhandschuhe über, beugte sich über den toten Mann und griff in die Innentasche des Sakkos, wo er ein Portemonnaie fand. In der Brieftasche waren dreihundertfünfzig Franken in Noten, etwas Wechselgeld, drei Kredit-, zwei Bankkarten, der AHV-Ausweis und die Identitätskarte.
«Goldman, Emanuel Jakob, geboren am 15. Mai 1959», sagte Urech, drehte den Ausweis und fuhr fort: «Hundertfünfundsiebzig Zentimeter gross, Heimatort Zürich.»
Der Name sagte keinem etwas.
Was hatten das Opfer und der Täter an einem Wochenende im Prime Tower gemacht?
Hafner zog die Nase hoch. «Jemand hat wie wild mit Ethanol um sich gespritzt.»
Monti schaute zum Rechtsmediziner Bruno Zeiter runter, der sich über den Toten beugte. «Können Sie etwas zum Todeszeitpunkt sagen?»
Zeiter blickte zu Monti auf. «Der Mann ist seit mehr als sechs Stunden tot.» Er zeigte auf die leicht bläulichen Hände des Opfers. «Und auch die getrockneten Blutflecke im Gesicht deuten darauf hin, dass die Tat am Vormittag begangen wurde.» Im Gegensatz zu seinem Vorgesetzten, Professor Oberholzer, schien er keine Angst vor schnell geäusserten Hypothesen zu haben, was ihn sympathisch machte.
Monti hasste es, wenn sogenannte Experten sich hinter dem Konjunktiv versteckten, einen Haftungsausschluss setzten, um dem Gegenüber keine Angriffsfläche zu bieten. Im Schachspiel gab es auch immer verschiedene Möglichkeiten, viele Züge, die zur Auswahl standen, aber als Spieler am Brett musste man sich für einen Zug entscheiden und diesen ausführen. Das Schach hatte ihn gelehrt, entscheidungsfreudig und pragmatisch zu sein. Eigenschaften, die auch in seinem Metier gefragt waren, die aber immer weniger Menschen besassen, wie er fand.
Müller besprach mit dem Rechtsmediziner Zeiter dessen Auftrag, er wollte von der Obduktion und den Blutanalysen wissen, ob Alkohol, Gift oder Drogen im Spiel waren und ob der Mann betäubt oder gefoltert worden war.
Monti lief zu Fischli, der wie angegossen bei der Tür stehen geblieben war, ihm schien die ganze Situation unangenehm zu sein, als ob er sie selbst verschuldet hätte. «Gibt es noch einen anderen Weg, um von oben zu diesem Raum zu gelangen?»
«Es gibt eine Treppe, die als Notausgang dient», sagte Fischli und führte ihn zu den Stufen, die sich hinter dem Lift befanden. Hier benötigte man keinen Badge, wohl eine feuerpolizeiliche Vorschrift, dachte Monti. Sie kamen im Erdgeschoss bei einer grünen Türe hinaus und gingen in das kleine Büro der Securitas, das sich gleich neben dem Empfang befand.
«Können Sie mir die Liste aller Personen ausdrucken, die einen Badge besitzen?», fragte Monti.
Fischli setzte sich an den Computer, und der Laserdrucker in der Ecke spuckte zig Seiten aus, die er Monti aushändigte.
«Und wäre es möglich, nach Nachnamen alphabetisch zu sortieren?»
Fischli schnaufte laut. Wenig später hatte Monti die Liste in der gewünschten Form in der Hand. Neben den Namen befand sich in der dritten Spalte der Name der Gesellschaft, für die der Badge-Inhaber arbeitete. Auf der zehnten Seite fand er Goldman. Er arbeitete für die Helvetiacom, einen Schweizer Telekommunikationskonzern, bei dem auch Monti als treuer Kunde für Mobiltelefon, Internet und Fernsehen figurierte. Einen Festnetzanschluss hatten sie zu Hause schon lange nicht mehr.
Wenig später verliessen Müller, Urech und Monti das Hochhaus. Müller verabschiedete sich und stieg in seinen BMW, den er direkt vor dem Prime Tower auf dem Parkplatz einer Anwaltskanzlei parkiert hatte.
Monti blieb stehen.
«An was denkst du?», fragte Urech, als sie zum Bahnhof Hardbrücke liefen, um die nächste S-Bahn zu nehmen.
«Ein Mann im Anzug, der für einen grossen Konzern arbeitet, wird im Keller des höchsten Gebäudes von Zürich, dem Epizentrum der Geschäftswelt und des Kapitalismus, am 1. Mai – dem Tag der Arbeit – erschossen. Ist das Zufall?»
5
«Ich bin schwanger!»
Nicole stand mit Slip und T-Shirt bekleidet in der Küche und hielt einen weissen Stift mit rosaroter Spitze in die Höhe, als ob sie mit der Fackel das olympische Feuer entzünden dürfte.
Monti, der zur Tür hereinspaziert kam, legte den Brotbeutel auf den Küchentisch und blieb für einen Moment stehen, bevor er auf sie zuging und sie umarmte. Eine Träne rutschte über ihre Wimpern, die immer noch mit violetter Mascara vom Ausgang vom Vorabend gefärbt waren. Er tupfte sie mit seiner Hand ab, als sie ihre Wange herunterlief.
Sie holte sich ein Taschentuch, während er sich an den Tisch setzte und tief durchatmete. Er spürte, dass sein Puls anstieg.
«Das ging aber schnell», sagte er und gab ihr einen Kuss auf die Stirn, als sie auf ihn zukam.
Sie zwinkerte ihm zu. «Übung macht den Meister.»
«Das kannst du laut sagen. Ich habe mich gefühlt wie ein Zuchtstier.» Er versuchte die Nachricht, die ihn etwas durcheinandergebracht hatte, mit Humor zu überdecken.
«Oh, du armer Mann. Du tust mir so leid.»
Sie streichelte ihm durch seine Haare. Nicoles Laune hatte sich mit dem Ergebnis des Schwangerschaftstests um hundertachtzig Grad gedreht. Er konnte sich entspannen.
Als er gestern Abend vom Tatort heimgekehrt war, liess Nicole ihrer Wut freien Lauf. Er hatte sie versetzt. Versetzen müssen, wie er fand. Ihr ging nicht in den Kopf, weshalb kein anderer Ermittler der Kriminalpolizei ausrücken konnte. Die Polizei hatte einen Einsatzplan, der die Dienstzeiten einen Monat im Voraus regelte und Notfalleinsätze nur bei krankheitsbedingten Ausfällen von Kollegen nötig machte. Er hätte sich stärker zur Wehr setzen sollen, hatte sie ihm vorgeworfen. Seinen Einwand, dass es sich bei den Schachgegenständen am Tatort um eine spezielle Konstellation handelte, die seinen Einsatz unabdingbar machte, zerpflückte sie. Nur weil die Ermittler am Tatort eine Schachfigur vorgefunden hatten, musste doch nicht zwingend er – als Hobby-Schachspieler – den Fall übernehmen.
«Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch eine Schokoladentorte bei Frau Baumberger gekauft.»
Nicole konnte den süssen Versuchungen nicht widerstehen, und auch er hätte nun etwas Zucker vertragen können. Es war weniger die überraschende Nachricht von der Schwangerschaft als die Tatsache, dass er zu wenig geschlafen hatte und noch nicht Betriebstemperatur erreicht hatte.
Monti griff nach der Papiertüte mit dem Logo der Bäckerei Walter Buchmann – das einen Knaben zeigte, der das Brot fest umschlungen unter den Armen hielt – und leerte den Inhalt ins Brotkörbchen. Der Duft von Croissants, Wiedikergipfeln und Brioches breitete sich in der Küche aus. Er schätzte das gemeinsame und ausgiebige Frühstück mit Nicole an den Sonntagen. Die warmen Backwaren, der frisch gepresste Orangensaft und ein Glas Prosecco waren für sie beide der perfekte gemütliche Start in den freien Tag.
«Den Prosecco heben wir uns für ein anderes Mal auf», sagte Monti.
«Ein Glas macht doch nichts.»
Monti ignorierte sie, nahm die Flasche aus dem Champagnerkühler und stellte sie in den Kühlschrank zurück. «Wir stossen mit frisch gepresstem Orangensaft an. Die Vitamine kannst du … Ich meine, ihr beide könnt die Vitaminspritze gut gebrauchen.»
«Das tönt gut, Herr Ernährungsberater. Ich gehe mich anziehen, während du den Saft presst, und dann feiern wir das im würdigen Rahmen.»
Sie lief beschwingt, fast schon tanzend davon. Ihr Glück war nicht zu übersehen.
Monti ging zum Fenster und schaute auf die Strasse hinunter. In seinem Beruf beschäftigte er sich eingehend mit dem Tod, den Toten und ihrem Umfeld. Er liebte seinen Job, es war für ihn fast wie eine Sucht – eine Rätselsucht. Jeder Fall liess ihn nicht los, bis er ihn gelöst hatte. Alles andere trat in den Hintergrund. In Kürze würde er mit neuem Leben, einem neuen Geschöpf konfrontiert werden. Hier würden andere Fähigkeiten gefragt sein, die er erst noch entwickeln musste.
6
Am Montagmorgen tat Monti, was er wochentags immer tat, bevor er seinen Dienst bei der Kriminalpolizei antrat. Er füllte seine Koffeinreserven im La Stanza auf. Das Café am Bleicherweg platzte auch an diesem Morgen aus allen Nähten. Giuseppe, Montis Lieblingskellner, hatte ihm den letzten verbliebenen Stuhl am Bartresen reserviert, indem er einen Karton mit Kaffeebohnenbeuteln darauf abgestellt hatte.
Giuseppe servierte ihm einen Espresso, und Monti öffnete die runde Vitrine der Etagere, die auf einem goldenen Sockel stand, und entnahm ihr ein Cornetto con marmellata. Die vor ihm liegende Zeitung überflog er kurz. Der Mordfall im Prime Tower wurde im Lokalteil in einer Randspalte erwähnt. Er hatte Mühe, sich auf den Inhalt zu konzentrieren, wechselte noch ein paar Worte mit einem anderen Stammgast an der Bar, bevor er sich auf den Weg machte.
Monti eilte zur Kasernenstrasse 29, wo er mit seinem Team die nächsten Schritte im Mordfall Goldman besprechen wollte. Demnächst würde er sein Büro mit Blick auf die Sihl räumen müssen, stand doch der Umzug ins Polizei- und Justizzentrum an die Güterstrasse 33 bevor. Es graute ihm davor, in diesen Bunker ziehen zu müssen. «Alle unter einem Dach» war das Motto. Forensiker, Kriminalpolizei und Staatsanwälte würden ihre Arbeitsplätze an einem zentralen Ort in Zürich haben. An und für sich eine gute Idee, aber der Umstand, dass Müller nur ein paar Schritte von ihm entfernt sein Büro aufschlagen würde, gefiel ihm nicht.
«Donnerwetter!» Urech tippte wild auf seiner Tastatur herum, als Monti in das Gemeinschaftsbüro im zweiten Stock eintrat.
«Was ist los?» Daniela Lüscher schaute hinter ihren Monitoren hervor.
«Nichts ist los. Eben nichts ist los. Netzausfall. Kein Internet, kein Festnetz, alles ausser Betrieb.» Urech stand auf und trat wütend gegen den Stuhl.
«Das scheint sich zu häufen. Schon der zweite in diesem Jahr. Normalerweise haben wir höchstens einen pro Jahr.»