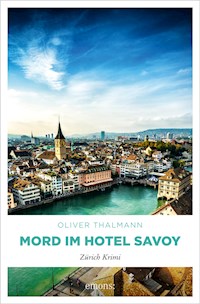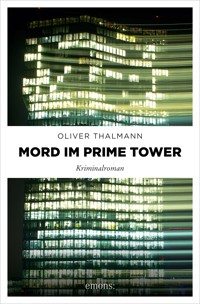Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissar Monti
- Sprache: Deutsch
Auf Mörderjagd in der Zürcher Kunstszene – rasant, packend und ein Kommissar mit Charakter. Kommissar Fabio Monti erhält von seinem zukünftigen Schwiegervater den Auftrag, den Eigentümer eines wertvollen Gemäldes ausfindig zu machen. Doch wenige Tage später verschwindet nicht nur das Kunstwerk aus dem Zürcher Landesmuseum, sondern auch dessen Kurator. Das Einzige, was auftaucht, ist die Leiche der verschwiegenen Besitzerin des Bildes, die es dem Museum geliehen hatte. Monti begibt sich auf die Suche nach dem Täter – und damit tief in die dunkle Vergangenheit seines Schwiegervaters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Thalmann wurde 1975 geboren und wuchs in Hergiswil bei Willisau im Kanton Luzern auf. Sein Debütroman »Mord im Hotel Savoy« und »Mord im Prime Tower« landeten auf Anhieb in den Top Ten der Schweizer Bestsellerliste. Er lebt mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern im Kanton Zürich.
www.oliverthalmann.ch
Instagram: oliverthalmann.ch
Facebook: oliverthalmann.ch
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: picture alliance/Zoonar | Falke
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-158-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Drei können ein Geheimnis für sich behalten,
wenn zwei von ihnen tot sind.
1
Monti machte etwas, das er noch nie in seinem Leben getan hatte.
Er schwänzte den Polizeidienst.
Die Auftragslage bei der Kriminalpolizei Zürich sprach nicht gegen seine Abwesenheit, redete er sich ein. Kein Gewaltverbrechen, kein Tötungsdelikt und auch kein Mordfall lagen auf seinem Tisch. Lediglich ein Aktenberg mit Formularen zu alten Fällen, der auf seine Abarbeitung wartete, türmte sich darauf. Diesen wollte er sich eigentlich vorknöpfen, aber dann kam der Anruf, der alles durcheinanderbrachte.
Heute Morgen hatte ihn Huber höchstpersönlich kontaktiert. Das allein irritierte Monti und nährte die Ungewissheit für das Bevorstehende bei ihm. Rätseln konnte er nicht widerstehen. Er war sich seiner Schwäche bewusst, und auch sein Umfeld kannte diese.
Und wenn sein Beistand gefragt war, musste er ihn leisten. Auch für Huber. Gerade für Huber.
Denn dieser hatte von einer glücklichen Fügung, einem Zufall und einem Problem gesprochen, und das alles müsse Monti mit eigenen Augen sehen, damit er es verstehen könne. Huber bat ihn um Hilfe, da alle anderen Versuche gescheitert seien. Mehr wollte er am Telefon nicht sagen, die Situation geböte ein Treffen unter vier Augen. In dessen Stimme hatte Monti eine Dringlichkeit vernommen. Bei einer anderen Person hätte er an eine Übertreibung in einem emotionalen Moment gedacht oder an einen Scherz, den sich diese mit ihm als Polizeibeamten erlaubte. Diese Art von Salamitaktik mochte er nicht. Wer ihm ein Problem nicht klipp und klar kommunizieren konnte oder wollte, war bei ihm an den Falschen gelangt. Hier aber lag die Sache anders, handelte es sich nun einmal um Huber, seinen Huber. Ihn durfte er nicht verärgern. Vor allem nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
Monti hatte abgewogen, ob er der spontanen Einladung ins Museum folgen oder pflichtgemäß seiner Arbeit nachgehen sollte. Er hörte auf seine Intuition und hatte sich entschlossen, sich des Falls anzunehmen.
Er blickte auf den Steinbau, der imposant vor ihm stand. Der Zahn der Zeit hatte an den Mauern genagt, gerade das verlieh dem Bau Authentizität, Beständigkeit und Unerschütterlichkeit. Die Architektur war einzigartig. Jedes Mal wenn er das Gebäude betrachtete, erinnerte es ihn an ein Märchenschloss. Der Turm, der gen Himmel strebte, hatte die Form eines Hexenhuts. Der Eingang bestand aus drei großen Rundbögen mit Glastüren, die die Besucher ins Innere einluden.
Das Landesmuseum lag inmitten der Stadt. Keine fünfzig Meter vom Eingang entfernt, gelangte man durch die Unterführung ins Untergeschoss des Hauptbahnhofs und verschwand in der Masse der Reisenden.
Monti lief zum Empfang, wo ihn Huber begrüßte und ihm ein Eintrittsticket in die Hand drückte. Huber schritt zielgerichtet wie ein Militäroffizier vor ihm los. Das Alter ging auch an Huber nicht spurlos vorüber. Der nicht mehr ganz so geschmeidige Gang war der Arthritis geschuldet, wie Monti von seiner Verlobten Nicole wusste.
Sie stiegen die breiten Treppen hinauf, und Monti schaute durch die tiefen, runden Fenster in den Innenhof. Als sie im ersten Stock ankamen, blickten sie auf die Tafel. »Märchen & Sagen« lautete der Titel der Ausstellung, die sie betraten.
Das dumpfe Licht sorgte für eine düstere und gespenstische Atmosphäre, welche die Märchenwelt widerspiegelte, in die sie als Besucher eintauchten. Der Kurator hatte die Objekte und Kunstwerke den Überlieferungen und Mythen zugeordnet. Zu Beginn des jeweiligen Märchens gab eine Plakette, auf der ein Auszug aus der Erzählung und seine Einordnung in die Geschichte zu lesen waren. Die Exponate reichten von Besen und Goldmünzen über Skulpturen bis zu Gemälden. Sie schritten von einem Kunstwerk zum nächsten, würdigten sie, kurz und flüchtig, überflogen den Begleittext, der neben den Werken auf Tablets dargestellt wurde. Sie sprachen kein Wort miteinander, nicht einmal ihre Blicke trafen sich. Es fühlte sich an, als würden sie einander nicht kennen, aber fremd waren sie sich auch nicht.
Museen erinnerten Monti an Kirchen. Ein Raum voller Stille und Andacht. Niemand sprach. Niemand störte einen. Niemand hatte Stress. Man bewegte sich bedächtig. Man hörte die eigenen Atemzüge. Man versank in Gedanken, denn man hatte und nahm sich Zeit dafür.
Vor einem Gemälde blieb Christian Huber stehen und nickte Monti zu.
Das musste es sein.
Reglos starrte Huber auf das Gemälde an der Wand. Alles um ihn herum schien er zu vergessen. Er war in eine andere Welt abgetaucht und hielt inne. Das Kunstwerk vereinnahmte ihn. Hubers Brustkorb bewegte sich. Er atmete langsamer und lauter.
Monti, der ihn von der Seite betrachtete, zitterte für einen Moment wie bei einem Schüttelfrost. So hatte er Huber noch nie gesehen. Die Situation war Monti unangenehm. Aus Mitleid mit seinem Gegenüber begann auch er, tief zu atmen. Er spürte, wie sein Puls unregelmäßig schlug.
Das Mädchen auf dem Bild blickte dem Betrachter mit trister Miene entgegen, als wüsste es, was ihm bevorstand. Es befand sich am Waldrand und trug einen Trägerrock, darunter ein Leibchen mit aufgerollten Ärmeln und darüber eine Schürze mit blauen Streifen. Eine rote Kappe zierte den Kopf, eine Art Baskenmütze. Das Kind hatte sie umgekehrt angezogen, so wie sie die Soldaten im Ausgang trugen. Das Rot der Mütze stach aus dem Bild heraus. Es war der Blickfang des Gemäldes. Das Kind hielt einen Laib Brot und einen Krug in den Händen. Die Anordnung der Streifen auf dem Kleid, das Schachbrettmuster auf dem Brot und die dünnen Baumstämme im Hintergrund gaben dem Betrachter Halt. Der Himmel war grau.
Neben dem Kunstwerk klebte eine Plakette aus Metall mit eingraviertem Text: »Albert Anker, Rotkäppchen, 1883, 85 x 62 cm, Öl auf Leinwand, Privatleihgabe«.
Cappuccetto Rosso. Natürlich kannte Monti das Märchen der Gebrüder Grimm. Seine Mutter hatte es ihm vorgelesen. Die Geschichte vom Mädchen, das vom Weg abkam, obwohl seine Mutter es davor gewarnt hatte, und dann dem bösen Wolf begegnete.
Was wollte Anker mit diesem Kunstwerk ausdrücken? Das Rotkäppchen im Märchen kam ihm unbeschwerter vor als das Mädchen auf dem Gemälde.
Eine gefühlte Ewigkeit blieben sie wie angewurzelt vor dem Rotkäppchen stehen. Je länger Monti es betrachtete, desto niedergeschlagener schien das Mädchen ihn anzuschauen. Zu Beginn hatte es ihm einen abwesenden Eindruck gemacht, es blickte ins Leere, die Lippen zusammengezogen. Man fühlte die Melancholie des Kindes. Dem Maler gelang es ohne Umschweife, den Betrachter in den Bann zu ziehen und ihm die schwere Zeit zu vermitteln, in der das Mädchen gelebt haben musste: das harte Leben auf dem Land im 19. Jahrhundert. Das Kind lebte in einer Zeit der Entbehrungen.
Obwohl nichts geschah oder gerade deswegen, erhöhte sich die Spannung in Monti, die dringend entladen werden musste.
Was hatte es mit dem Gemälde auf sich?
Weshalb faszinierte es Huber so sehr?
Und was hatte er – Monti – damit zu tun?
Endlich. Huber drehte sich um, und sie verließen die Ausstellung. Gemächlich. Gedankenversunken. Wortlos.
Huber nahm ein Taschentuch hervor und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.
2
Es gab nichts Ehrlicheres als eine Träne im Gesicht eines Menschen. Worte gaben dem Empfänger einen Freiraum für Interpretationen. Tränen logen nicht.
Draußen setzten sich Huber und Monti an den letzten freien Tisch im Restaurant »Spitz«. Unter dem Schirm fanden sie Schutz vor der Sonne.
Nun hatte er es mit eigenen Augen gesehen – das Rotkäppchen, über das sich Huber den Kopf zerbrach. Angesichts der Gefühlslage von Huber, die er im Museum wahrgenommen hatte, sah sich Monti bestätigt: Er lag richtig mit seinem Bauchgefühl. Das Anliegen von Huber, was immer es sein mochte, musste er ernst nehmen. Eine Bagatelle konnte es auf keinen Fall sein. Denn dafür würde ein ehemaliger Major der Schweizer Armee nicht in so einen Zustand verfallen. Zudem fühlte Monti sich geehrt. Huber hatte sich ihm anvertraut. Das war eine Art Ritterschlag.
Im September stand die Hochzeit von Nicole und Monti an, und im Winter würde ihr erstes Kind auf die Welt kommen. Vielleicht war es für Monti an der Zeit, seinen Schwiegervater etwas besser kennenzulernen? Und Probleme und Krisen schweißten einen zusammen, vor allem wenn man sie mit Erfolg überwinden konnte.
Monti mochte Huber. Was ihn am meisten an ihm beeindruckte, war dessen Kleiderordnung und mit welcher Konsistenz er sie befolgte. Selbst an Sonntagen, wenn Nicole und er bei seinen Schwiegereltern zu Besuch vorbeigingen, trug Huber einen Anzug mit Hemd und Krawatte. Nicole witzelte, ihr Vater habe gar keine anderen Kleider im Schrank. Auch an diesem Hitzetag trug er einen dunkelblauen Maßanzug mit roter Krawatte und passendem Einstecktuch.
Huber maß fast zwei Meter, hatte einen schlanken Körperbau, einen lang gezogenen Hals, und seine grauen, kurz geschnittenen Haare hatte er zu einem Seitenscheitel gekämmt. Die Augenbrauen waren markant, leicht buschig und dunkler als die Kopfhaare. Die Ohren waren proportional zu groß für das Gesicht, in Bezug auf die ganze Körpergröße fiel das aber nicht auf. Für sein Alter wies er relativ wenige Furchen im Gesicht auf.
Im Kopf war der Mann, der letztes Jahr seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert hatte, hellwach. Wo andere längst ihren Ruhestand genossen, arbeitete er immer noch aktiv mit in der von ihm gegründeten Anwaltskanzlei »Huber & Suter«, die er zu einer der führenden im Bereich des Wirtschaftsrechts in der Schweiz aufgebaut hatte. Er übte zwar nur wenige Mandate aus, verpasste jedoch keine Sitzung in den Aufsichtsgremien bei den Stiftungen und Unternehmen, wo er Einsatz nahm. Perfekt vorbereitet oder detailversessen, wie ihm Nicole zu berichten wusste. Trotz seines Erfolges war Huber bescheiden geblieben. Er protzte nicht mit teuren Autos, Luxusbooten und Ferienhäusern, obwohl er solche besaß. Huber wirkte auf Monti wie ein Gentleman der alten Schule: zurückhaltend und unaufdringlich. Nie hatte er beim Anwalt auch nur einen Anflug von Hochmut in dessen Aussagen ausgemacht.
Huber hatte sich erholt, wirkte jedoch müde und niedergeschlagen.
»Das Museum ist ein schöner Ort, in dem Artefakte an den Wänden hängen und in dessen Räumen wir Besucher in eine andere, mystische Welt abtauchen. In einer zunehmend posthumanen und postsozialen Welt, in der das Leben sich nur um das Individuum dreht, kommt der Kunst mit ihrer reinigenden Kraft eine besondere Bedeutung zu.« Huber blickte zu Monti. »Ein Gemälde muss zu seinem Besitzer passen wie eine Garderobe, die authentisch wirkt.« Er genehmigte sich einen Schluck Mineralwasser.
Das Gemälde barg ein Geheimnis. Eines, das man mit bloßen Augen nicht sah. Sonst hätte Monti es entdeckt, davon war er überzeugt. Er rührte den Zucker in seine Espressotasse, während er fragte: »Was hat es mit dem Rotkäppchen auf sich?«
»Es ist eine glückliche Fügung. Ich habe es endlich wiedergefunden. Gott sei Dank!« Auf einmal strahlte Huber nur so vor Glück. »Das Rotkäppchen ist mein Lieblingsbild.«
»Warum ist das Rotkäppchen auf dem Bild so traurig? Es ist doch dem Wolf noch nicht begegnet.«
»Du siehst das Gemälde durch die Brille des Detektivs, der nur das sieht, was sich vor seinen Augen befindet, chronologisch Sachverhalte aneinanderreiht und seine Schlüsse daraus zieht. Die Kunst funktioniert anders: Der Maler drückt mit dem Bild eine Gemütslage aus. Der Maler malt nicht bloß das, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich fühlt. Anker zeigt in seinen Werken Alltagsszenen – das einfache Leben –, die ergreifend auf uns wirken. Man muss die Geschichte und das Umfeld des Malers kennen, um die Impressionen zu verstehen. Neben seinen Stillleben hatte er viele Kinderbilder gemalt, vor allem Landkinder, die oft keine Schulen besuchen konnten. Die obligatorische Schulpflicht wurde in der Schweiz erst 1874 eingeführt. Das Bild zeigt eine Mischung aus Nüchternheit und Unversehrtheit, die auf dem Land zu dieser Zeit vorherrschte. Man spricht bei Anker auch gerne vom selektiven Realismus. Er vermittelte vom Landleben bloß einen Ausschnitt. Er legte Wert auf Familie, Bildung und Arbeitsamkeit.«
Monti hatte das Bild anders, dunkler interpretiert. Eine Diskussion mit Huber, in der er intellektuell unterlegen war, wollte er nicht vom Zaun brechen. Ihm gefielen die Kunst und die damit verbundenen Geschichten. In seinem Büro hingen zwei Reproduktionen von Claude Monet. Sein Interesse galt im Moment aber weder den Interpretationen der Kunstliebhaber noch dem, was Anker mit dem Gemälde ausdrücken wollte, sondern der Frage, wo die Verbindung zu Hubers Problem lag. Er konnte sich nicht mehr zurückhalten, Huber hatte es auf die Spitze getrieben. Schwiegervater hin oder her. »Wie kann ich dir helfen?«
Huber schaute sich um und lehnte sich über den Tisch zu ihm. Monti konnte das Parfum riechen, das eine holzige Note mit einem Hauch Zimt aufwies.
»Die Sache ist die …«, holte Huber aus und schaute an Monti vorbei. »Es handelt sich um eine persönliche Angelegenheit, die mir sehr am Herzen liegt. Bevor ich mit der Geschichte beginne, muss ich sicher sein, dass ich dir vertrauen kann. Ich verlange absolute Verschwiegenheit in dieser Angelegenheit. Nicht einmal Nicole und schon gar nicht Anna dürfen davon erfahren. Kann ich mich auf dich verlassen?«
»Certo. Das ist Ehrensache. Ich bin verschwiegen wie ein Grab.«
Der Anwalt schlug sein rechtes Bein über das linke. »Ich muss ein wenig ausholen, damit du den Kontext verstehst und du mich nicht für komplett verrückt hältst.«
»Du bist die letzte Person auf dem Planeten, die ich für verrückt halte.«
Huber atmete tief ein und aus. Es schien ihm nicht leichtzufallen, über die Sache zu sprechen. »Die Geschichte begann in den siebziger Jahren. Ich ging 1970 nach Los Angeles, um meine juristische Ausbildung abzuschließen. Und, was für die Sache von wesentlicher Bedeutung ist, ich traf Anna im Februar 1974 während einer Vernissage in einer Kunstgalerie in Pasadena.«
Im Familienkreis sprach Huber nur über allgemeine Dinge wie die Wirtschaft, die Politik und die Kunst. Nie hatte Monti ihn über seine Fälle oder Klienten sprechen hören, geschweige denn über private Erlebnisse. Selbst wenn er ihn mit einer Fangfrage aus der Reserve locken wollte, erkannte er nur Selbstbeherrschung und Unerschütterlichkeit in dessen Gesicht. So gestalteten sich die Familientreffen bei den Hubers häufig etwas steif für Montis Geschmack, denn es fehlte an Überraschungen. Man traf sich, näher kennenlernen tat man sich nicht.
Monti nickte, und Huber fuhrt fort: »Wir verliebten uns und entschieden, ohne groß nachzudenken, zu heiraten. Wir waren jung und unbeschwert. Anna arbeitete damals als Kunsthistorikerin in einem Museum in Los Angeles und schrieb ihre Doktorarbeit über Albert Anker, die übrigens mit summa cum laude ausgezeichnet wurde.«
Huber schwärmte vom Stil des Berner Malers, der immer authentisch gewesen sei. Die gemalten Personen würden zeigen, wie die Menschen in dieser Zeit gelebt hätten. Ankers Kinderporträts hätten Anna in den Bann gezogen. Sie habe alles über Albert Anker gesammelt. Ihre Faszination für den Maler habe bis heute nicht nachgelassen. »Als die Hochzeit näher rückte, kam ich auf die glorreiche Idee, meiner zukünftigen Frau ihr absolutes Lieblingsgemälde von Albert Anker – das Rotkäppchen – zu schenken. Das war der Anfang des Problems.«
Monti horchte auf. »Das Bild kostete sicherlich ein Vermögen. Wie konntest du dir das leisten, du hattest doch gerade erst das Studium beendet?«
»Das war eine Herkulesaufgabe. Der Kaufpreis überstieg meine Ersparnisse. Mit Unterstützung meines Umfelds und einem Darlehen gelang es mir, das Werk einem Kunsthändler abzukaufen. Zum Glück interessierten sich zu dieser Zeit nur wenige Sammler für Schweizer Künstler. Der Erwerbsprozess des Rotkäppchens spielt keine Rolle. Wichtig ist nur die Geschichte selbst, besser gesagt die Geschichte danach.«
»Kein Wunder, hat dich Anna geheiratet«, sagte Monti und bedauerte seinen Scherz umgehend.
Huber ignorierte ihn. »Am 6. September 1975 fand die Hochzeit statt, in einem kleinen Rahmen. Wir konnten uns nicht mehr leisten. Du hättest Annas Gesicht sehen sollen, als sie das Werk in ihren Händen hielt. Sie war hin und weg. Nachdem sie sich gefasst hatte, fragte sie mich, ob ich das Gemälde gestohlen hätte.«
Die Hubers hatten über die Jahre eine Sammlung an Kunstwerken erworben, die sich sehen lassen konnte. Monti sah Bilder von Ferdinand Hodler, Angelika Kauffmann und Albert Anker vor sich. Das Rotkäppchen hatte er noch nie gesehen, wenn er im Hause Huber zu Besuch war. Vielleicht hing es im Schlafzimmer, dorthin hatte er sich nicht vorgewagt.
»Ich hoffe, du erwartest nicht von mir, dass ich Nicole mit einem ähnlichen Geschenk bei der Hochzeit beglücke.«
»Du solltest mich kennen. Ich mische mich aus Prinzip nicht in die Angelegenheiten anderer Leute ein, wenn es sich vermeiden lässt.«
»Das ist eine gute Angewohnheit, die merke ich mir.«
Huber trank einen Schluck Wasser.
»Der Kauf des Rotkäppchens war ein Meisterstück, wie es nur dir gelingen kann.«
»Ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Manchmal braucht es ein wenig Glück im Leben.«
»Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.« Monti zitierte Demokrit.
»Über Mut verfügte ich tatsächlich, das Glück war uns am Ende leider nicht hold. Die Geschichte mit dem Rotkäppchen endete nicht so gut, wie sie begonnen hatte.«
»Was geschah?«
»Im Jahr darauf musste ich das Rotkäppchen veräußern. Am Dienstag, 13. Januar 1976, um genau zu sein. Es war der schlimmste Tag in meinem Leben.«
»Was? Du hast das Bild, das du Anna zur Hochzeit geschenkt hast, verkauft?«
Fast im Zeitlupentempo nickte Huber schuldbewusst. »Ich hatte einen dummen Fehler begangen.«
Monti schaute ihn gespannt an und blieb sprachlos.
»Ich habe mich verspekuliert und verschuldet. Es gab einen Börsencrash, die Aktienpreise brachen ein, und der größte Teil unseres Vermögens ging verloren. Wir brauchten Barmittel, um unsere Heimkehr in die Schweiz zu finanzieren, deshalb haben wir uns schweren Herzens vom Rotkäppchen trennen müssen.«
Monti stutzte. Das hätte er von seinem Schwiegervater in spe nicht erwartet, hatte er doch ein anderes Menschenbild von ihm. Huber war ein besonnener, ausgeglichener und vorsichtiger Mann: Der Gemäldekauf und die damit verbundene Verschuldung passten nicht zu ihm. Als Unternehmer, und das war Huber zweifelsfrei, musste man Wagnisse eingehen: Kapital und Zeit in die eigenen Ideen investieren. Die Risiken mussten jedoch überschaubar und kalkulierbar bleiben. Gefahren mied sein Schwiegervater. Mehr als einmal hatte er Nicole ans Herz gelegt, ihn – Monti – doch von einem Abteilungswechsel bei der Kantonspolizei zu überzeugen, sich mehr in Richtung Administrationskarriere weiterzuentwickeln, anstatt sich an der Front mit Schwerverbrechern rumzuschlagen. Mit Mitte fünfzig müsste man doch die Frontkämpfe der jüngeren Garde überlassen, argumentierte Huber. Wahrscheinlich machte er sich Sorgen, sein Schwiegersohn würde eines Tages in einen Unfall, eine Schießerei oder noch Schlimmeres verwickelt. Leben hatte man bekanntlich nur eines.
»Das tut mir leid.«
Seit er die Hubers kannte, hatte er sie nie über Schwierigkeiten und schon gar nicht Geldprobleme sprechen hören, als existierten solche nicht auf dieser Welt. Die Hubers waren wohlhabend, das war ihm bewusst, aber dass dieser Wohlstand nicht seit jeher da gewesen war und sie schlechte Zeiten durchlaufen hatten, war ihm nicht bekannt.
»Nachdem sich unsere Lebenssituation verbessert hatte, versuchte ich das Rotkäppchen wiederzubeschaffen. Leider war der Kunsthändler verstorben, dem ich es verkauft hatte. Er war ein Typ vom alten Schlag, der für die Kunst lebte, die Administration war nicht sein Ding gewesen. Sein Nachfolger war zwar hilfsbereit, fand allerdings keine Dokumente, an wen die Galerie das Gemälde verkauft hatte. Zu diesen Zeiten herrschte keine Dokumentationspflicht. Viele Geschäfte liefen unter der Hand mit Barzahlung und ohne schriftliche Verträge. Die Verbindung zum Rotkäppchen war gekappt.«
»Führen die Auktionshäuser nicht Datenbanken mit so wichtigen Bildern?«
»Ich habe sie alle besucht. Galerien, Museen und Auktionshäuser habe ich durchleuchtet, nie ist es irgendwo aufgetaucht. Weg und für immer verschwunden oder versteckt, als handelte es sich um einen Schatz, den mir jemand vorenthält, dachte ich.«
»Und wie hat Anna das Ganze verdaut?«
»Anna hat sich irgendeinmal mit dem Verlust abgefunden. Ich weiß nicht, weshalb ich es nicht konnte. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das Bild ist hier in Zürich – in meiner Heimatstadt. Das ist ein Zeichen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und es restituieren.«
Restituieren.
Sich zurückholen, was einem einmal gehört hat und was man in einer Notsituation verkaufen musste. Monti kannte den Begriff der Restitution, der sonst im Zusammenhang mit Raubkunst während des Naziregimes oder in Verbindung mit Raubzügen durch Kolonialmächte stand. Im Gegensatz dazu musste Huber das Bild zwar aus einer Notsituation verkaufen, aber diese war von ihm selbst verschuldet. Er hatte sich in seinen jungen Jahren finanziell übernommen.
»Anna feiert dieses Jahr ihren siebzigsten Geburtstag, und ich möchte Sie mit dem Gemälde als Geschenk überraschen. Deshalb die Geheimtuerei.«
Monti nickte, Geheimnisse für sich zu behalten war eine Stärke von ihm, dachte er.
So weit konnte er alles nachvollziehen. Sein Schwiegervater, der altehrwürdige Gentleman und Kunstliebhaber, wollte eine alte Scharte bei seiner Ehefrau auswetzen. Was Monti nicht nachvollziehen konnte, war, welche Rolle er dabei einnehmen sollte.
»Und wozu genau brauchst du mich? Finanziell kann ich dir nicht unter die Arme greifen. Meine Hochzeit steht vor der Tür und verschlingt meine Ersparnisse«, sagte Monti.
»Geld ist nicht das Problem. Experten, mit denen ich gesprochen habe, schätzen den Wert des Bildes auf rund fünfhunderttausend Franken. Als Liebhaber wäre ich bereit, sogar den doppelten Preis zu bezahlen. Und das war das Angebot, das ich abgegeben habe.«
Der Betrag entlockte Huber keine Regung in seinem Gesicht.
»Wo liegt denn das Problem?«
»Die Eigentümerin des Gemäldes ist verkaufsunwillig.«
Pause. Stille.
»Wem gehört es?«
»Ich kenne die Frau nicht. Sie will anonym bleiben.«
»Wie konntest du ein Angebot abgeben, wenn du die Besitzerin nicht kennst?«
»Der Kurator des Landesmuseums, Dr. Deuber, kennt sie, und ihn habe ich als Vermittler engagiert. Nur will er ihren Namen nicht nennen. Diskretion ist das Wichtigste im Kunstmarkt. Vermittler sind verpflichtet, die Identität der Käufer und Verkäufer nicht bekannt zu geben. Alle bleiben inkognito.«
Monti vernahm einen Hauch Frustration in Hubers Stimme. »Wenn du dein Angebot erhöhst und von deiner lobenswerten Absicht, deiner Frau ein hübsches Geschenk zu machen, erzählst, wird sie vielleicht umschwenken.«
Huber schüttelte den Kopf. »Da täuschst du dich leider. Das habe ich bereits versucht. Ich habe einen Brief mit der Geschichte geschrieben, den ich Dr. Deuber mitgegeben habe, und ein sehr großzügiges revidiertes Angebot platziert. Leider kam der Kurator auch dieses Mal mit leeren Händen zurück.«
Selbst ein gut betuchter Mann wie Huber konnte nicht alles haben, was er wollte. Es gab noch Leute, die an Gegenständen hingen, die sie für kein Geld auf der Welt verkaufen wollten. Das war an und für sich eine schöne Sache, halt nicht für Huber in diesem Fall.
»Du bist meine letzte Hoffnung, Fabio. Kannst du mir helfen?«
Monti musterte Huber. Ein guter Verhandlungspartner, und das war Anwalt Huber sicher, übte im richtigen Moment sanften emotionalen Druck auf sein Gegenüber aus. Das hatte oft eine größere Wirkung als rationale Argumente.
»Gerne, aber wie?«
»Du hast etwas, was ich nicht habe.«
»Und das wäre?«
»Eine Spürnase.«
Monti lachte. Ein guter Verhandler musste auch ein guter Schmeichler sein, hatte ihm seine Nonna einst als Rat mitgegeben. Huber kannte das Abc der Verhandlungsführung, er war ein Vollprofi.
Huber insistierte. »Ich möchte dich als Privatdetektiv beauftragen. Du findest die Identität der Frau heraus, dann kann ich mit der Eigentümerin direkt verhandeln.«
»Privatdetektiv?« Es war nicht das erste Mal, dass ihn jemand für eine Nachforschung engagieren wollte. Früher gingen solche Gefälligkeiten für einen Bekannten bei der Polizei als Kavaliersdelikt durch. In den letzten Jahren hatte sich das geändert. Polizisten erhielten eine Suspendierung oder gar die Entlassung, wenn solche Nebenjobs aufflogen.
»Ich werde einen Vertrag aufsetzen, damit alles seine Richtigkeit hat. Was schlägst du als Honorar vor?«
»Geld interessiert mich nicht«, sagte Monti wahrheitsgemäß. Was ihn interessierte, war, die verschwiegene Kunstsammlerin aufzuspüren und das Bild wieder in den Besitz der Familie zu bringen, in deren Kreis er in wenigen Wochen aufgenommen würde. »Ich werde mich einmal umhören. Vertrag brauchen wir keinen. Das gibt nur Ärger.«
Hubers Miene hellte sich auf. »Ich werde dir ewig dankbar dafür sein.«
3
Drei Tage später, es war Freitag, der 2. Juli, wachte Monti mit Kopfschmerzen auf. Er hatte wenig und schlecht geschlafen. Dafür machte er zwei Ursachen verantwortlich. Erstens überstieg sein Rotweinkonsum am Vorabend das Toleranzniveau für sein Alter um drei Gläser, und zweitens kreisten seine Gedanken die ganze Nacht um das Rotkäppchen.
Huber hatte ihn in den letzten Tagen gefühlte hundert Mal angerufen und gefragt, ob er die Eigentümerin des Rotkäppchens bereits ausfindig machen konnte. Jedes Mal wenn Monti seinem Schwiegervater die gleiche negative Antwort überbrachte, bemerkte er, wie sich dessen Enttäuschung und Frust steigerten.
Obwohl Monti alles nachvollziehen konnte – Huber hatte vor fast fünfzig Jahren einen Fehler begangen, den er wiedergutmachen wollte –, so leuchtete ihm doch nicht ein, wieso er sich so sehr auf das Rotkäppchen-Bild fixiert hatte. Anna würde sich sicher auch über ein anderes Gemälde von Albert Anker freuen. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann hatte sie den Verlust des Kunstwerkes anscheinend überwunden. Vielleicht handelte es sich um eine unübliche Situation für den Anwalt, der erfolgsverwöhnt war und sich fast jeglichen Wunsch erfüllen konnte. Der Machtlosigkeit, der er bei seinem Unterfangen mit dem Rotkäppchen ausgeliefert war, musste ihn zermürben.
Als Monti unter der Dusche stand, fragte er sich, ob Huber möglicherweise an einer Neurose litt. Schließlich war er über die Jahre sichtbar gebrechlicher geworden. Die Arthritis zwang ihn, starke Medikamente einzunehmen, wie ihm Nicole erzählt hatte. Der Konsum von Arzneimitteln könnte zu einer Wahrnehmungsverzerrung in seinem Gehirn führen, hatte Monti einmal in einer Fernsehsendung erklärt bekommen. Obwohl er in den Gesprächen mit Huber keinen Ansatzpunkt dafür gesehen hatte, durfte er dies nicht ausschließen.
Das Unterfangen glich einem Himmelfahrtskommando. Huber klammerte sich an einen Strohhalm. Selbst wenn er den Namen der Eigentümerin des Rotkäppchens ausfindig machen könnte, würde es Monti überraschen, wenn diese Hubers oder seinem Charme erliegen und ihnen das Gemälde einfach so aushändigen würde. Wenn er den Worten von Huber trauen durfte, und daran zweifelte er keinen Moment, klang es so, als ob die Besitzerin einen Verkauf kategorisch ausschloss. Kunstsammlerinnen und -sammler, die Bilder von diesem Wert bei sich zu Hause hängen hatten, waren in der Regel nicht auf Geld angewiesen, außer in einer Notsituation, wie sie Huber selbst in den siebziger Jahren durchlebt hatte.
Gegenüber Nicole verschwieg er das Treffen mit ihrem Vater, galt es doch, das Geheimnis der Wiederbeschaffungsaktion des Rotkäppchen-Bildes zu bewahren. In einer Ehe sollte man keine Geheimnisse haben, hatte ihn einst seine Mutter gelehrt. Zum Glück hatte er noch zwei Monate Zeit, sich zu ändern, bevor Nicole und er den Bund fürs Leben schlossen.
Monti entschied sich, zu Fuß an die Arbeit zu gehen. Das würde seinen Kreislauf und seine Phantasie anregen, und vielleicht käme er so auf eine Idee, wie er Huber helfen könnte.
Wie immer legte er einen Zwischenhalt ein. Als er das La Stanza am Bleicherweg betrat, herrschte dort ein Tohuwabohu. Es war halb neun, und die meisten Gäste hielten Champagnergläser in der Hand.
Giuseppe, sein Lieblingskellner, kam auf ihn zu und reichte auch ihm eines. »Ein Stammkunde hat einen Architekturwettbewerb gewonnen und spendiert eine Runde Champagner.«
Monti nahm das Glas und setzte sich an den Bartresen, wo ihm Giuseppe wenig später einen Espresso servierte. Den Champagner leerte er mit einem Schluck runter, damit er seinen Kaffee genießen konnte. Vergeblich suchte er nach einer Zeitung, so nahm er sein Smartphone hervor und las die Onlineversion des »Zürcher Volksblatts«. Sein Blick blieb bereits auf der Titelseite hängen. Fast wäre der Champagner schneller aus seinem Magen hochgekommen, als er runtergegangen war.
Kunstraub im Landesmuseum
Ein wertvolles Gemälde ist gestern Abend aus dem Landesmuseum verschwunden. Das Bild stammte aus der Ausstellung »Märchen & Sagen«, die noch bis Ende Juli läuft. Das Museum hat Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Kantonspolizei Zürich hat Ermittlungen aufgenommen, wollte sich aber nicht zu den genauen Umständen und Hintergründen äußern.
Um welches Bild es sich handelt, ließ Elly Berchtold auf Anfrage offen. Die sonst gar nicht wortkarge Direktorin des Landesmuseums meinte lediglich, es sei nun Sache der Ermittlungsbehörden, dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
Ein ehemaliger Museumsdirektor, der anonym bleiben möchte, meinte, die Polizei würde ihren Fokus bei den Ermittlungen sofort auf die »Insider« legen. Neben den Mitarbeitern müsse die Polizei auch gewisse Handwerker unter die Lupe nehmen, da gerade eine umfassende Sanierung des Museums abgeschlossen worden sei, wo täglich Elektriker, Sanitäre und Maler Zutritt zu den Räumlichkeiten des Museums hatten.
Jede Medaille hatte zwei Seiten. Die positive für ihn war, der Diebstahl öffnete den Fächer für seine Mission, das Museum zu kontaktieren und so die unbekannte Gemäldebesitzerin ausfindig zu machen. Monti hatte nun zwei Optionen.
Die erste wäre, in den Polizeiakten zum Kunstraubfall zu wühlen. Obwohl das gegen die Weisung verstieß, die es allen Polizisten untersagte, sich Informationen zu Fällen zu beschaffen, an denen sie nicht arbeiteten.
Die zweite Möglichkeit wäre, direkt an den Kurator heranzutreten. Dieser hatte sich gegenüber Huber geweigert, die Identität der Besitzerin preiszugeben, lediglich das Geschlecht war ihm rausgerutscht. Monti musste den Kurator sprechen, und vielleicht würde dieser ihm mehr verraten als einem Anwalt. Unter welchem Vorwand würde er ihn treffen? Eine polizeiliche Untersuchung vorgaukeln wäre beruflicher Selbstmord, könnte schnell einmal eine Anzeige wegen Amtsmissbrauches nach sich ziehen. Er musste subtiler vorgehen, er wusste nur nicht, wie.
Monti bemerkte, wie ihm sein Sitznachbar neugierig über die Schulter auf sein Smartphone schaute. Patrick Seiler, Bankier mit Leib und Seele, war wie er Stammgast im La Stanza. Sie kannten sich seit Jahren, trotzdem siezten sie sich immer noch, und das passte so für beide. Seiler erklärte ihm häufig und unverblümt, wie die Finanzwelt funktionierte, was wenig lehrreich für ihn war, aber sich meist ganz amüsant anhörte.
»Arbeiten Sie an diesem Fall, Herr Monti?«
»Nein, ich bin für die harten Sachen wie Mord und Totschlag zuständig.«
»Schade, sonst hätte ich Ihnen einen Tipp geben können.«
Monti verschluckte sich, als er an seinem Espresso nippte.
»Wenn Sie mich fragen, steckt die Direktorin hinter dem Raub.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Als Bankier hat man so seine Beziehungen. Und ich kann eins und eins zusammenzählen. Die junge Frau führt ein ausschweifendes Leben, das nicht ganz günstig ist. Jedes Mal wenn ich im ›Kaufleuten‹ bin, trinkt die Frau ein Cüpli nach dem anderen. Einmal habe ich sie sogar auf der Toilette gesehen, wie sie eine Linie reingezogen hat.«
Monti verdrehte die Augen. »Was machen Sie auf der Damentoilette, Herr Seiler?«
»Sie leben in einer anderen Welt. Es handelt sich um eine genderneutrale Toilette, wie sie nun auch an den Zürcher Schulen eingeführt werden.«
»Wirklich? Und die Direktorin muss ein Gemälde stehlen, um ihren Lastern frönen zu können? Eines muss man Ihnen lassen, Phantasie besitzen Sie mehr als genug.«
»Sie hat sich gerade eine Luxuswohnung an bester Lage am Hamburger Hafen gekauft, wie ich aus erster Hand weiß. Wie kann sie sich das leisten mit ihrem Gehalt?«
Verletzung des Bankgeheimnisses. War das nicht strafbar? Egal. Montis Abteilung war nicht für solche Fälle zuständig.
»Erbschaft? Lottogewinn?«
»Sie verfügt über ein gutes Netzwerk in der Wirtschaftswelt und beste Kontakte in der Kunstszene, um das Gemälde an einen Sugardaddy zu verhökern.«
»Haben Sie Ihren Kaffee heute mit Schnaps gestreckt, Herr Seiler?«
»Die einfachsten Erklärungen sind meistens die besten und richtigen. Vergessen Sie das nie!«
»Ich bin froh, dass diese Weisheit auch bei Ihnen in der Finanzwelt angekommen ist.«
»Aufgepasst! Die Finanzwelt hat einen schlechten Ruf, völlig zu Unrecht. Und sie wird zu wenig geschätzt. Viele Prinzipien, die dort gelten, kann man im täglichen Leben anwenden. Gerade auf den Kunstraubfall zum Beispiel. Elly Berchtold hätte auf das Orakel von Omaha hören sollen: ›Spare nicht, was nach dem Ausgeben übrig bleibt, sondern gib aus, was nach dem Sparen übrig bleibt.‹«
»Wer ist das Orakel von Omaha?«
Seiler schaute ihn verdutzt an. »Jetzt bin ich enttäuscht von Ihnen. Wo leben Sie denn, Herr Monti? Warren Buffett natürlich.«
»Ach ja, den kenn sogar ich.«
Sie tranken noch eine Runde Kaffee zusammen, bevor sie gemeinsam das Lokal verließen.
Als Monti in die Talstraße einbog, klingelte sein Smartphone. Seit dem vergangenen Dienstag hatte er diese Nummer nun unter seinen Favoriten gespeichert.
Es war Huber. »Ich kann es nicht fassen. Das Rotkäppchen ist weg. Fort. Verschwunden. Gestohlen.«
Monti horchte auf. »Das Rotkäppchen? Woher weißt du das?« Im Online-Artikel wurde der Name des Gemäldes nicht genannt.
»Frau Berchtold hat es mir mitgeteilt. Die Dame ist ganz außer sich. Sie kann sich nicht erklären, wie das geschehen konnte. Das schadet dem Renommee des Museums ungemein.«
»Das tun Kunstdiebstähle immer.«
»Das Landesmuseum hat eines der besten Sicherheitssysteme der Welt. Sie haben erst Anfang Jahr ein neues in Betrieb genommen. Über zwei Millionen Franken hat die Anschaffung gekostet.«
»Eine Investition, die sich nicht gelohnt hat, wie mir scheint.«
»Die Diebe sind der Technik einen Schritt voraus.«
»Wenigstens geht uns Polizisten so die Arbeit nicht aus.«
»Wir müssen handeln. Wir müssen das Gemälde finden, bevor die Diebe über alle Berge sind.« Hubers sonst so bedächtige und ruhige Stimme war einem bestimmten, fast schon militärischen Befehlston gewichen.
»Meine Kollegen der Abteilung Strukturkriminalität sind die Besten ihres Fachs. Mach dir keine Sorgen. Die werden sich um den Fall kümmern. Die haben auch schon die Bührle-Bilder wiedergefunden und unversehrt zurückgebracht.«
»Fabio, kannst du mal reinhorchen bei euch?«
Monti war ein alter und erfahrener Hase bei der Kriminalpolizei, aber für Gewaltverbrechen und nicht für Diebstähle und schon gar nicht für Kunstraub zuständig und ausgebildet. Das wusste auch Huber.
»Ich darf mich nicht in die Fälle von anderen Abteilungen einmischen, sonst kriege ich wieder Ärger mit der Kommandantin.«
Und das war das Letzte, was Monti wollte. Die Polizeikommandantin ließ ihm zwar den einen oder anderen Fehler durchgehen. Eine Einmischung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches, das würde zu viel Wirbel machen.
»Das verstehe ich. Vielleicht kannst du den Kollegen ein wenig über die Schulter schauen und ihnen assistieren.«
»Das hassen sie wie die Pest. Wir Polizisten sind Alphatiere.« Er selbst mochte es nicht einmal, wenn die Vorgesetzten ständig bei ihm über den Stand der Ermittlungen nachfragten.
»Der Raub bringt auch etwas Gutes mit sich.«
»Und das wäre?«
»Die Identität der Eigentümerin wird gelüftet. Deine Polizeikollegen kennen ihren Namen. Du kannst bestimmt mal einen Blick in die Akten werfen.«
Monti schwieg. Es war seine Art der Zustimmung.
Kunstdiebstähle wie der Raub des Rotkäppchens hatten Seltenheitswert im Vergleich zu Tötungsdelikten und erregten großes Interesse bei der Presse und der Bevölkerung.
Und sie ließen auch Monti nicht kalt, obwohl er beruflich nie damit zu tun gehabt hatte. Einerseits verabscheute er jegliche kriminelle Aktivität, weswegen er sich dem Polizeikorps überhaupt angeschlossen hatte. Andererseits, musste er sich eingestehen, lösten diese Diebstähle, bei denen keine Menschen zu körperlichen Schäden kamen, auch eine Faszination in ihm aus. Nicht nur das Rätseln über den Täter, das jeden Kriminalpolizisten antrieb, sondern vor allem dessen Vorgehen interessierte ihn. Es war der Kampf Mensch gegen Maschine. David gegen Goliath. Die Räuber überlisteten die modernen, teuren, computergesteuerten Überwachungssysteme mit ihrem menschlichen Verstand.
Bevor er die Sihlbrücke überquerte, sah er ein Werbeplakat der Verkehrsbetriebe Zürich, der VBZ: »Befördern Sie mehr Leute als jede Führungskraft: Wir suchen Trampilot*innen«. Weniger die Schreibweise der Personalrekrutierung mit dem Sternchen in der Wortmitte erregte seine Aufmerksamkeit, sondern dass die VBZ von Piloten anstatt Fahrern redete. War es eine von einem schlauen Werbefachmann induzierte Analogie zu den Formel-1-Piloten, um den Job attraktiver darzustellen? Die Geschwindigkeit der Gefährte unterschied sich zwar deutlich, das Nervenkostüm einer Tramfahrerin oder Trampilotin in Zürich musste dem eines Formel-1-Piloten hingegen ebenbürtig sein. Bewegten sich Jung und Alt doch nonchalant, meist mit Kopfhörern auf den Ohren, um mit optimaler Geräuschunterdrückung über die Straßen zu schweben und die Gefahren des öffentlichen Verkehrs auszublenden. An Ressourcenengpässen, wie sie anscheinend bei der VBZ herrschten, hatte Huber nicht zu leiden. Natürlich hatte dieser als passionierter Kunstsammler einen direkten Draht zu allen Museumsdirektorinnen und -direktoren in der Schweiz. Die Direktorin des Landesmuseums durfte Informationen, welche die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen vor der Öffentlichkeit geheim hielt, nicht preisgeben. Bestimmt würde Max Schmid, der Leiter der Abteilung Strukturkriminalität, in dessen Zuständigkeitsbereich der Diebstahl fiel, der Direktorin die Leviten lesen, wenn er davon Kenntnis bekam. Monti konnte es ihm nicht verdenken.
Als er seinen Arbeitsplatz im dritten Stock an der Kasernenstraße erreicht hatte und sich in seinen Bürostuhl fallen ließ, überflog er kurz seine E-Mails, bevor er aufstand und seine Tür schloss.
Nun beging er den gleichen Fehler wie das Rotkäppchen im Märchen der Brüder Grimm: Er kam vom Weg ab.
Das war die Ironie des Schicksals, wie er sich amüsiert einredete. Er konnte es sich nicht verkneifen, das POLIS aufzurufen, wo die Polizei ihre Akten zu den Fällen abspeicherte.
Umgehend fand er den ersten Rapport zum gestohlenen Rotkäppchen-Gemälde. Eine Angestellte vom Sicherheitsdienst hatte den Diebstahl der Polizei gestern Donnerstag um dreiundzwanzig Uhr dreizehn gemeldet.
Die Ausstellung »Märchen & Sagen«, in der sich das Gemälde befand, hatte Anfang April ihre Tore geöffnet und sollte bis Ende Juli dauern. Die Kollegen der Abteilung Strukturkriminalität fanden im Landesmuseum keine Einbruchsspuren, die Alarmanlage wurde nicht ausgelöst, und die Bilder der Videokamera, die den Eingang und Ausgang zum Raum filmten, zeigten nichts als eine geschlossene Tür, die nur vom Sicherheitsdienst, der patrouillierte, geöffnet und geschlossen wurde.
In den Ermittlungsakten hielt der Beamte fest, der Sicherheitsdirektor des Landesmuseums, Rick Wenger, vermutete, die Diebe hätten die Stromversorgung beim Transformator außerhalb des Gebäudes lahmgelegt, um die Sicherheitssysteme zu umgehen. Auf Nachfrage, warum das Back-up-System nicht angefahren sei, habe er keine überzeugende Antwort geben können. Die im Zeitungsartikel erwähnte Sanierung der Ausstellungsräume, bei der sich viele Handwerker in den Räumlichkeiten tummelten und so Zugang zu den Kunstwerken hatten, wurde nur kurz und beiläufig erwähnt.
Die Diebe hätten nur ein und nicht einmal das wertvollste Kunstwerk der Ausstellung mitgenommen. Eine Skulptur, die angeblich fünf Millionen Franken wert sei, hätten sie unberührt gelassen, vielleicht sei sie zu unhandlich für den Raub gewesen, wie die Polizei vermutete. Bei anderen Kunstüberfällen seien mindestens drei Objekte abhandengekommen.
Vergeblich suchte Monti den Bericht der Spurensicherung. Wahrscheinlich würde dieser in den nächsten Tagen hochgeladen. Hastig klickte und scrollte er durch die weiteren Dokumente. Endlich fand er in einem Besprechungsprotokoll die Frage, die ihn und Huber interessierte: Wem gehörte das Rotkäppchen?
Zu seinem großen Erstaunen stand nichts darüber in den Akten. Entweder hatten seine Kollegen schlampig gearbeitet, oder sie wussten es effektiv nicht.
Dann fand er eine Notiz, die sein Interesse weckte.
Die Ermittler konnten den Kurator des Landesmuseums, René C. Deuber, weder am Arbeitsplatz noch an seinem Wohnsitz erreichen. Er sei verschwunden, antworte auch nicht auf Telefonanrufe.
Max Schmid, den Monti als entscheidungsfreudigen Polizisten kannte und schätzte, zögerte nicht lange und hatte den Kurator umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Museumsmitarbeiter, der sich nach dem Kunstraub aus dem Staub machte, das erweckte Verdacht bei jedem Ermittler.
So löste sich Montis zweite Option – den Kurator zu kontaktieren – in Luft auf. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als Schmid zu kontaktieren, wenn er den Namen der Gemäldebesitzerin enthüllen wollte.
Schmid leitete die Abteilung Strukturkriminalität seit über einem Jahrzehnt und kannte sich in der Kunstszene bestens aus. Nicht nur kannte er die Direktionsmitglieder aller Zürcher Museen persönlich, er verkehrte auch privat als Kunstliebhaber in diesen Kreisen, wenn auch – mangels tieferen Vermögens – nicht in der Liga von Huber.
Sie begrüßten sich herzlich am Telefon, und Schmid fragte nach, weshalb Monti am Dienstag nicht an der Abteilungsleitersitzung teilgenommen habe. Er habe ihn vermisst.
»Ich musste einen privaten Termin wahrnehmen, der Priorität hatte«, antwortete Monti.
»Was kann ich für dich tun?«
»Du kennst dich doch in der Kunstszene aus …«
»Gehört zum Job. Was willst du wissen?«
»Ein Freund von mir möchte wissen, wer die Besitzerin des Rotkäppchens sei.«
Schmid antwortete nicht sofort, überlegte, wie er seine Worte wählte. Die Schweizer Kunstszene sei überschaubar, und viele Kunstsammler agierten äußerst diskret. Dann schien ihm das Ganze zu dumm. »Weshalb mischst du dich in unseren Fall ein? Ist dir langweilig?«
»Ehrlich gesagt ja. Wir durchleben ein Sommerloch.«
»Beklag dich doch nicht. Bei dieser Affenhitze ist das nicht schlimm. Eine Pause tut dir nach dem Serienmordfall im Frühling gut.«
»So gesehen hat die Klimaerwärmung wenigstens für uns eine positive Nebenwirkung. Denn je höher die Temperaturen ansteigen, desto weniger schwere Gewaltdelikte registrieren wir«, sagte Monti. Eine Statistik, die das erhärtete oder widerlegte, existierte zwar nicht. Er glaubte einfach an diese Kausalität, hatte er sie doch selbst erfunden.
Die Meteorologen prophezeiten einen heißen Sommer.
Ihm sollte es recht sein.
Schmid blieb stur und gab nichts preis. Am Ende verabschiedete er sich. »Pass auf! Ich würde an deiner Stelle die Nase nicht in andere Angelegenheiten stecken. Du kennst dich auf diesem Gebiet nicht aus.«
4
Nachdenklich öffnete Monti das Fenster in seinem Büro und steckte sich eine Davidoff an. Ein trockener, heißer Luftstrom schoss ihm ins Gesicht. Ungewöhnlich hoch fühlten sich die Temperaturen in diesem Juli in Zürich nicht an, aber sonst herrschte um diese Jahreszeit eine hohe Luftfeuchtigkeit vor, die sich nicht selten in Blitz und Donner entlud. Die Sihl plätscherte dahin und führte nur wenig Wasser. Das bestätigte ihm, was der Meteorologe am Morgen im Radio erzählt hatte. Die feuchte Luft würde einen Bogen um Zentraleuropa machen, und die Hitzeperiode in der Schweiz würde anhalten. Und wenn es nicht bald einmal zu regnen begann, müssten die Behörden die beliebten 1.-August-Feuerwerke dieses Jahr verbieten.
Auf einmal hörte er zwei Stimmen im Büro nebenan. Die eine kannte er. Sie gehörte Frau Weber, seiner Sekretärin. Die andere war ihm unbekannt. Die beiden Personen hoben ihre Stimmen, und der Takt des Wortgefechtes erhöhte sich, bis es sich nach einer Handgreiflichkeit anhörte. Frau Weber konnte bestimmt auftreten, um ihre Meinung auszudrücken. Von ihrer lauten Seite hatte er sie noch nie gehört. Das passte nicht zu ihr, die sich stets kontrolliert gab.
Monti drückte seine Zigarette aus und wollte nach dem Rechten sehen. Als er vor der Türschwelle stand, schlug ihm die Tür entgegen, und eine Frau prallte mit dem Kopf an seinem Brustkorb ab. Er konnte sich knapp auf den Beinen halten, die Frau fiel und schlug mit dem Hinterkopf auf den Parkettboden. Frau Weber schritt mit rotem Kopf zur Kollisionsstelle.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?« Monti half der Frau wieder auf die Beine, die ihn mit schmerzverzerrtem Gesicht anschaute, aber nicht mehr sprach. Der Zusammenstoß hatte sie kurz mundtot gemacht. Die Dame musste so um die sechzig Jahre alt sein, maß keine hundertsechzig Zentimeter, verfügte über eine rundliche Statur und trug reichlich Schminke, die der Sommerhitze trotzte. Die Fingernägel waren mit roter Farbe gestrichen, und Monti roch das Haarspray, das die Dauerwelle ihres kastanienbraunen Haares im Lot hielt. Dunkle Augenringe, die auch die Schminke nicht mehr kaschieren konnte, bedeckten ihr Gesicht. Alles in allem eine gepflegte ältere Dame.
Die Frau hatte wieder Luft und schrie: »Er ist weg! Einfach weg! Entführt! Sie müssen mir helfen, Herr Kommissar.«
»Beruhigen Sie sich!«
»Bitte helfen Sie mir. Es geht um Leben und Tod.«
»Setzen Sie sich doch, bitte. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser.«
Die Frau weigerte sich und blieb stehen.
Monti reichte ihr das Glas, das sie umgehend auf dem Tisch absetzte.
Frau Weber stellte sich zwischen die beiden. »Ich habe versucht, die Frau aufzuhalten, und ihr erklärt, sie brauche einen Termin.«
Monti dankte ihr, er würde sich des Anliegens der Frau annehmen. Seine Sekretärin verließ kopfschüttelnd den Raum.
»Wer sind Sie? Wer ist weg? Was ist los?«
»Mein Name ist Deuber. Sie müssen mir helfen. Es ist etwas Schreckliches passiert.«
Frau Deuber schmiegte sich an Monti wie eine Katze, die Geborgenheit sucht. Er hörte ihre Atemzüge. Die Frau würde nächstens einen Nervenzusammenbruch erleiden, befürchtete er, weshalb er sich gegen die Zuneigung nicht wehrte.
»Was ist denn geschehen?«