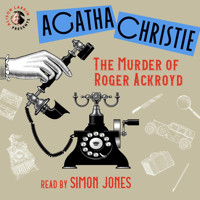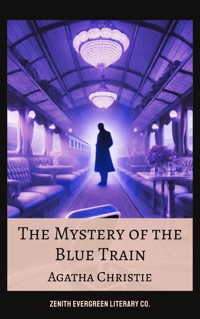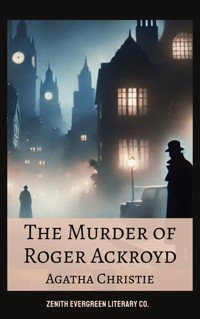9,99 €
Mehr erfahren.
Die Ausgrabungen des erfolgreichen Archäologen Dr. Eric Leidner im Irak werden von den Wahnvorstellungen seiner Frau Louise überschattet. Die Krankenschwester Amy Leatheran erklärt sich bereit, Louise zu betreuen, doch sie ahnt noch nicht, worauf sie sich einlässt. Als ein Mord geschieht, stellt sich die Frage, was tatsächlich hinter Louises angeblichen Wahnvorstellungen steckt. Welche dunklen Geheimnisse liegen in ihrer Vergangenheit begraben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Agatha Christie
Mord in Mesopotamien
Ein Fall für Poirot
Roman
Aus dem Englischen von Michael Mundhenk
Atlantik
Meinen vielen Archäologenfreunden im Irak und in Syrien gewidmet
Vorwortvon Dr. med. Giles Reilly
Die hier geschilderten Begebenheiten ereigneten sich vor rund vier Jahren. Die Umstände haben es meiner Ansicht nach erforderlich gemacht, der Öffentlichkeit offen und ehrlich Bericht darüber zu erstatten. Schließlich kursieren die wildesten, lächerlichsten Gerüchte darüber, dass wichtige Beweise unterschlagen wurden, und ähnlicher Unsinn mehr. Diese Falschmeldungen wurden insbesondere in der amerikanischen Presse verbreitet.
Aus naheliegenden Gründen schien es angezeigt, dass dieser Bericht nicht aus der Feder eines der Expeditionsteilnehmer fließt, da diese allesamt als voreingenommen gelten durften.
Daher schlug ich Miss Amy Leatheran für diese Aufgabe vor. Sie war eindeutig die Richtige dafür. Sie war hochprofessionell, frei von Vorurteilen, da sie in keinerlei Verbindung zu der von der University of Pittstown organisierten Expedition in den Irak gestanden hatte, und eine aufmerksame, kluge Augenzeugin.
Es war jedoch nicht gerade leicht, Miss Leatheran dazu zu überreden, diese Aufgabe zu übernehmen – genau genommen war es sogar eine der größten Herausforderungen meiner gesamten beruflichen Laufbahn –, und selbst als sie mit ihrer Arbeit fertig war, zeigte sie mir das Manuskript seltsamerweise nur sehr widerwillig. Wie ich feststellte, lag der Grund für diese Zurückhaltung zum Teil darin, dass sie dort einige kritische Bemerkungen über meine Tochter Sheila gemacht hatte. Ich tat die Sache schnell ab und versicherte ihr, dass heutzutage, wo Kinder ihre Eltern freimütig öffentlich kritisieren, Eltern hocherfreut sind, wenn ihre Sprösslinge auch einmal ihren Teil an Verunglimpfungen abbekommen! Ihr anderer Vorbehalt speiste sich aus einer extremen Unsicherheit hinsichtlich ihres literarischen Stils. Sie hoffte, ich würde »die Grammatik und diesen ganzen Kram korrigieren«. Allerdings habe ich mich, ganz im Gegenteil, geweigert, auch nur ein einziges Wort zu ändern. Für meine Begriffe ist Miss Leatherans Stil kraftvoll, persönlich und absolut passend. Wenn sie Hercule Poirot in einem Absatz »Poirot« nennt und im nächsten »Mr Poirot«, dann sind das nicht nur interessante, sondern auch vielsagende Varianten. Bald besinnt sie sich sozusagen auf »ihre gute Kinderstube« (und Krankenschwestern sind hyperkorrekte Menschen), bald zeigt sie an dem, wovon sie erzählt, ein so starkes, rein menschliches Interesse, dass sie ihre Haube und ihre Manschetten völlig vergisst!
Die einzige Freiheit, die ich mir nahm, war es, ein Eingangskapitel zu schreiben – anhand eines Briefes, den mir eine von Miss Leatherans Freundinnen liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt hatte. Es soll als eine Art Frontispiz dienen, das heißt, es skizziert in groben Zügen die Erzählerin.
1
Frontispiz
Im Foyer des Hotels Tigris Palace in Bagdad beendete eine Krankenschwester gerade einen Brief. Ihr Füllfederhalter flog über das Papier.
… So, meine Liebe, das war jetzt wohl alles, was ich an Neuem zu berichten habe. Sicher ist es schön, etwas von der Welt zu sehen, aber für mich geht doch nichts über England. Der Dreck und das Chaos hier in Bagdad – einfach unglaublich und überhaupt nicht so romantisch, wie man nach der Lektüre von Tausendundeine Nacht meinen könnte! Direkt am Fluss ist es natürlich ganz hübsch, aber die Stadt selbst ist einfach fürchterlich. Und kein einziges richtiges Geschäft! Major Kelsey hat mich durch die Basare geführt – malerisch sind sie natürlich schon, das lässt sich nicht bestreiten, aber was für ein Haufen Plunder, und überall wird auf Kupferzeug herumgehämmert, bis man Kopfschmerzen bekommt, und ich würde sowieso nichts davon benutzen, solange ich nicht genau wüsste, wie man es reinigt. Bei Kochgeschirr aus Kupfer muss man ja wegen des Grünspans furchtbar aufpassen.
Wenn aus der Stellung, von der Dr. Reilly gesprochen hat, etwas wird, schreibe ich Dir Genaueres. Er meinte, dieser Amerikaner sei gerade in Bagdad und werde mich wohl heute Nachmittag aufsuchen. Er brauche jemanden für seine Frau. Laut Dr. Reilly leidet sie an »Einbildungen«, und man weiß natürlich, meine Liebe, was das in der Regel bedeutet (aber ich hoffe doch, zumindest kein ausgewachsenes Delirium tremens). Gesagt hat Dr. Reilly nichts dergleichen, aber er hat so ein Gesicht gemacht – Du weißt schon, was ich meine. Dieser Dr. Leidner ist Archäologe und leitet für ein amerikanisches Museum Ausgrabungen an einem Siedlungshügel irgendwo draußen in der Wüste.
Meine Liebe, ich schließe jetzt. Was Du mir von der kleinen Stubbins erzählt hast, ist ja urkomisch! Was hat denn die Oberschwester dazu gesagt?
Jetzt aber wirklich Schluss.
Es grüßt Dich Deine
Amy Leatheran
Sie steckte den Brief in einen Umschlag und adressierte ihn an Schwester Curshaw, St. Christopher’s Hospital, London.
Als sie die Kappe auf den Füllfederhalter schraubte, erschien ein arabischer Hotelboy.
»Da ist ein Herr für Sie. Dr. Leidner.«
Schwester Leatheran wandte sich um und erblickte einen mittelgroßen Mann mit leicht gebeugten Schultern, braunem Bart und freundlichen, müden Augen.
Dr. Leidner seinerseits sah eine Frau von Anfang dreißig mit aufrechter, selbstbewusster Haltung vor sich. Sie hatte ein gutmütiges Gesicht mit leicht vorquellenden blauen Augen und glänzend braunem Haar und sah genauso aus, fand er, wie eine Pflegerin für eine Nervenkranke aussehen sollte. Fröhlich, robust, gescheit und rational.
Schwester Leatheran, dachte er, war sicher die Richtige.
2
Ich darf mich vorstellen: Amy Leatheran
Ich will gar nicht so tun, als ob ich Schriftstellerin wäre oder irgendetwas vom Schreiben verstünde. Ich mache das hier nur, weil Dr. Reilly mich darum gebeten hat und man Dr. Reilly irgendwie nur schwer etwas abschlagen kann.
»Aber, Doctor«, sagte ich, »ich kann mich doch gar nicht gebildet ausdrücken, überhaupt nicht.«
»Unsinn!«, sagte er. »Formulieren Sie es einfach wie eine Fallgeschichte.«
Na ja, so kann man es natürlich auch sehen.
Dr. Reilly ließ nicht locker. Ein schlichter, ungeschönter Bericht über die Geschehnisse in Tell Yarimjah, sagte er, sei dringend erforderlich.
»Wenn ihn einer der unmittelbar Betroffenen verfasst, ist er nicht überzeugend. Dann wird es heißen, er sei parteiisch.«
Auch das stimmte natürlich. Ich war dabei gewesen und trotzdem in gewisser Weise eine Außenstehende.
»Warum schreiben Sie ihn nicht selbst, Dr. Reilly?«, fragte ich.
»Ich war nicht vor Ort – Sie schon. Außerdem«, setzte er seufzend hinzu, »würde es meine Tochter nicht erlauben.«
Es ist wirklich eine Schande, dass er so unter der Fuchtel dieses jungen Dings steht. Ich hätte es fast laut ausgesprochen, doch dann sah ich sein Zwinkern. Das ist das Schlimmste an Dr. Reilly. Man weiß nie, ob er einen Scherz macht oder nicht. Er sagt alles auf die gleiche langsame, schwermütige Art, aber in der Hälfte aller Fälle mit einem Augenzwinkern.
»Na ja«, sagte ich skeptisch, »vielleicht schaffe ich’s irgendwie.«
»Natürlich schaffen Sie’s.«
»Ich weiß nur nicht so recht, wie ich es angehen soll.«
»Dafür gibt es eine bewährte Regel: Mit dem Anfang anfangen, weitermachen bis zum Schluss und dann aufhören.«
»Ich weiß nicht einmal genau, wo und wann es angefangen hat«, sagte ich zweifelnd.
»Glauben Sie mir, Schwester, einen Anfang zu finden ist nichts, verglichen mit den Schwierigkeiten, wieder aufzuhören. So geht es mir jedenfalls, wenn ich einen Vortrag halten soll. Jemand muss mich dann an den Rockschößen packen und vom Podium zerren.«
»Ach, das sagen Sie doch nur im Scherz, Doctor.«
»Es ist mein voller Ernst. Also, was ist?«
Doch noch etwas machte mir Sorgen. Nach kurzem Zögern bekannte ich: »Ich fürchte, Dr. Reilly, ich könnte … manchmal ein bisschen persönlich werden.«
»Du meine Güte, Schwester, je persönlicher, desto besser! Hier geht es um Menschen, nicht um Schaufensterpuppen! Seien Sie persönlich, seien Sie voreingenommen, seien Sie gehässig, seien Sie, was Sie wollen! Schreiben Sie das Ding auf Ihre Art. Die Stellen, die unter üble Nachrede fallen, können wir später immer noch streichen! Machen Sie einfach! Sie sind doch eine vernünftige Person und werden die ganze Sache mit gesundem Menschenverstand angehen.«
Damit war auch das erledigt, und ich versprach, mein Bestes zu tun.
Und jetzt sitze ich hier und fange an, aber wie ich schon zu Dr. Reilly sagte: Es ist schwer zu entscheiden, wo genau man anfangen soll.
Vielleicht sage ich erst einmal ein paar Worte über mich. Ich bin zweiunddreißig und heiße Amy Leatheran. Ich habe meine Schwesternausbildung im St. Christopher’s Hospital gemacht und danach zwei Jahre auf der Wöchnerinnenstation gearbeitet. Ich war verschiedentlich als Privatpflegerin und vier Jahre in Miss Bendix’ Pflegeheim am Devonshire Place tätig. In den Irak kam ich mit einer gewissen Mrs Kelsey. Ich hatte sie betreut, als ihr Kind zur Welt kam. Sie ging mit ihrem Mann nach Bagdad, wo sie bereits ein Kindermädchen engagiert hatte, das dort schon mehrere Jahre bei Freunden von ihr arbeitete. Die Kinder dieser Freunde würden demnächst nach England zurückkehren, um auf ein Internat zu gehen, und das Kindermädchen hatte zugesagt, dann bei Mrs Kelsey zu arbeiten. Mrs Kelsey war zart, und der Gedanke, die Reise mit einem so kleinen Kind anzutreten, ängstigte sie, weshalb Major Kelsey veranlasst hatte, dass ich mitfahren und mich um sie und das Baby kümmern sollte. Und falls wir niemanden fänden, der auf der Heimreise eine Pflegerin brauchte, würden sie mir auch die Schiffspassage zurück nach England bezahlen.
Die Kelseys näher zu beschreiben ist wohl nicht nötig. Das Baby war ein kleiner Schatz und Mrs Kelsey ganz nett, wenn auch eher von der überbesorgten Sorte. Die Fahrt genoss ich sehr. Ich hatte bis dato noch nie eine so lange Schiffsreise gemacht.
An Bord war auch Dr. Reilly. Er hatte schwarze Haare und ein lang gezogenes Gesicht und sagte die lustigsten Dinge mit tiefer, trauriger Stimme. Ich glaube, es machte ihm Spaß, mich aufzuziehen, die abwegigsten Behauptungen aufzustellen und zu sehen, ob ich sie schlucken würde. Er war Zivilarzt in einem Ort namens Hassanieh, anderthalb Tagesreisen von Bagdad entfernt.
Etwa eine Woche nach meiner Ankunft in Bagdad lief ich ihm zufällig über den Weg, und er fragte mich, wann ich bei den Kelseys aufhören würde. Komisch, dass er das frage, sagte ich, denn tatsächlich führen die Wrights (die bereits erwähnte andere Familie) schon eine Woche früher als geplant nach England zurück, und ihr Kindermädchen könne sofort bei den Kelseys anfangen.
Er sagte, das mit den Wrights habe er gehört, deshalb habe er ja gefragt.
»Ich hätte nämlich eine mögliche Stelle für Sie, Schwester.«
»Einen Pflegefall?«
Er runzelte die Stirn, als dächte er nach.
»Einen Pflegefall kann man es wohl nicht nennen. Es ist einfach nur eine Frau mit … nun, nennen wir’s Einbildungen.«
»Oh!«, sagte ich.
(Man weiß ja, was das gewöhnlich heißt – Alkohol oder Drogen!)
Dr. Reilly führte es nicht näher aus. Er war sehr diskret. »Ja«, sagte er. »Eine gewisse Mrs Leidner. Ihr Mann ist Amerikaner, Schwedisch-Amerikaner, genauer gesagt. Er leitet eine amerikanische Ausgrabung.«
Er erklärte mir, dass die Expedition Grabungen an einer Stätte durchführe, wo einst eine große assyrische Stadt gelegen habe, so ähnlich wie Ninive. Das Quartier der Expeditionsteilnehmer sei nicht weit von Hassanieh, aber sehr einsam gelegen, und Dr. Leidner mache sich schon seit einiger Zeit Sorgen wegen des Gesundheitszustands seiner Frau.
»Genaueres sagt er nicht, aber offenbar hat sie wiederkehrende Angstzustände.«
»Ist sie den ganzen Tag allein unter Einheimischen?«, fragte ich.
»O nein, sie sind dort eine ganze Gruppe, zu siebt oder acht. Ich glaube nicht, dass diese Frau je allein zu Hause ist. Aber es steht wohl außer Zweifel, dass sie sich in einen sonderbaren Zustand hineingesteigert hat. Leidner hat jede Menge Arbeit, aber er vergöttert seine Frau, und es beunruhigt ihn, sie in dieser Verfassung zu wissen. Er meint, er würde sich wohler fühlen, wenn eine verantwortungsbewusste, kompetente Person ein Auge auf sie hätte.«
»Und wie denkt Mrs Leidner selbst darüber?«
»Mrs Leidner ist eine sehr charmante Frau«, antwortete Dr. Reilly ernst. »Allerdings ändert sie ihre Meinung zu allem und jedem praktisch täglich. Im Ganzen findet sie die Idee jedoch gut.«
Er setzte hinzu: »Sie ist eine seltsame Frau. Ein Ausbund an Liebenswürdigkeit und, wenn Sie mich fragen, eine begnadete Lügnerin – aber Leidner scheint wirklich zu glauben, dass ihr irgendetwas furchtbare Angst macht.«
»Was hat sie Ihnen denn gesagt, Doctor?«
»Oh, sie hat mich nicht konsultiert! Sie kann mich nicht leiden, aus verschiedenen Gründen. Leidner war bei mir und hat mir diesen Plan unterbreitet. Also, Schwester, was halten Sie davon? Sie würden ein bisschen vom Land sehen, bevor sie wieder nach Hause fahren – die Ausgrabungsarbeiten dauern noch zwei Monate. Und so etwas ist ziemlich interessant.«
Ich überlegte ein Weilchen. »Na ja«, sagte ich schließlich, »ich glaube, ich würde es gern versuchen.«
»Großartig«, sagte Dr. Reilly und erhob sich. »Leidner ist gerade in Bagdad. Ich werde ihm sagen, er soll bei Ihnen vorbeischauen und sehen, ob er sich mit Ihnen einig wird.«
Dr. Leidner kam noch am selben Tag ins Hotel, ein Mann mittleren Alters von nervösem, zögerlichem Auftreten, der etwas Sanftes, Gütiges und ziemlich Hilfloses ausstrahlte.
Er schien seine Frau wirklich zu vergöttern, äußerte sich aber nur sehr vage darüber, was ihr fehlte.
»Verstehen Sie«, sagte er und zupfte verlegen an seinem Bart, was, wie ich später herausfinden sollte, typisch für ihn war, »meine Frau ist wirklich sehr mit den Nerven herunter. Ich … ich mache mir Sorgen um sie.«
»Ist sie denn körperlich gesund?«, fragte ich.
»Ja. O ja, ich glaube schon. Nein, körperlich fehlt ihr wohl nichts. Aber sie, nun ja, sie bildet sich Dinge ein, verstehen Sie?«
»Was für Dinge?«, fragte ich.
Wieder scheute er vor einer klaren Antwort zurück und murmelte nur verlegen: »Sie regt sich wegen nichts und wieder nichts auf … Ich halte diese Angst für absolut unbegründet.«
»Angst wovor, Dr. Leidner?«
Vage erwiderte er: »Ach, einfach … nervöse Angstzustände, weiter nichts.«
Zehn zu eins, dachte ich, dass es Drogen sind. Und er weiß nichts davon! Wie so viele Ehemänner. Sie wundern sich immer nur, dass ihre Frauen so nervös sind und so extreme Stimmungsschwankungen haben.
Ich fragte, ob Mrs Leidner selbst denn wolle, dass ich käme.
Sein Gesicht hellte sich auf.
»Ja. Ich war überrascht. Positiv überrascht. Sie hielt es für eine sehr gute Idee. Sie meinte, dann würde sie sich wesentlich sicherer fühlen.«
Das machte mich stutzig. Sicherer! Welch seltsames Wort in einem solchen Zusammenhang. Mir begann zu schwanen, dass Mrs Leidner doch geisteskrank sein könnte.
Mit jungenhaftem Eifer fuhr er fort: »Sie beide werden sich bestimmt gut verstehen. Sie ist wirklich eine bezaubernde Frau.« Er lächelte entwaffnend. »Sie glaubt, dass Sie ihr eine große Hilfe sein werden. Und ich hatte sofort, als ich Sie sah, das gleiche Gefühl. Sie wirken, wenn ich das sagen darf, so wunderbar gesund und vernünftig. Ich bin mir sicher, Sie sind genau die Richtige für Louise.«
»Nun, versuchen wir es halt, Dr. Leidner«, sagte ich munter. »Ich hoffe sehr, dass ich Ihrer Frau eine Hilfe sein kann. Vielleicht hat sie ja Angst vor den Einheimischen?«
»Du liebe Güte, nein.« Amüsiert schüttelte er den Kopf. »Meine Frau mag die Araber – sie schätzt ihre Einfachheit und ihren Humor. Sie ist zwar erst das zweite Mal hier – wir sind noch nicht ganz zwei Jahre verheiratet –, spricht aber schon ganz gut Arabisch.«
Ich schwieg kurz und versuchte es dann noch einmal.
»Können Sie mir denn gar nicht sagen, wovor Ihre Frau Angst hat, Dr. Leidner?«
Er zögerte. Dann sagte er langsam: »Ich hoffe … ich glaube, das wird sie Ihnen selbst sagen.«
Mehr bekam ich nicht aus ihm heraus.
3
Klatsch
Wir vereinbarten, dass ich in der folgenden Woche nach Tell Yarimjah übersiedeln würde.
Mrs Kelsey richtete sich inzwischen in ihrem Haus in Alwiyah ein, und ich war froh, ihr noch einiges abnehmen zu können.
Während dieser Zeit hörte ich ein paar Andeutungen über die Leidner-Expedition. Ein Freund von Mrs Kelsey, ein junger Staffelführer bei den Fliegern, formte mit den Lippen ein überraschtes O und rief dann aus: »Die Schöne Louise. Das ist also ihre jüngste Marotte!« Zu mir gewandt, sagte er: »So nennen wir sie hier, Schwester. Sie läuft überall unter dem Spitznamen ›Schöne Louise‹.«
»Ist sie denn so hübsch?«, fragte ich.
»Das basiert auf ihrer Selbsteinschätzung: Sie hält sich dafür!«
»Ach, seien Sie nicht so boshaft, John«, sagte Mrs Kelsey. »Sie wissen genau, dass nicht nur sie sich für schön hält. Viele Leute finden sie absolut bezaubernd.«
»Da mögen Sie recht haben. Sie ist zwar nicht mehr die Jüngste, aber eine gewisse Attraktivität kann man ihr nicht absprechen.«
»Sie waren doch selbst völlig hingerissen«, sagte Mrs Kelsey lachend.
Der Staffelführer errötete und gab beschämt zu: »Na ja, sie hat schon was. Leidner selbst würde ja am liebsten den Boden küssen, auf dem sie wandelt – und die übrigen Expeditionsteilnehmer haben sie gefälligst auch zu verehren! Es wird von ihnen regelrecht erwartet.«
»Wie viele sind es denn insgesamt?«, fragte ich.
»Ein ganzes Sammelsurium verschiedenster Nationalitäten, Schwester«, erwiderte der Staffelführer vergnügt. »Ein englischer Architekt, ein französischer Pater aus Karthago. Letzterer ist für die Inschriften zuständig, Tafeln und dergleichen. Dann ist da Miss Johnson, ebenfalls Engländerin und so eine Art Mädchen für alles. Und ein kleiner Dicker, der fotografiert – ein Amerikaner. Und die Mercados. Weiß der Himmel, woher die sind – irgendwelche Südländer! Sie ist noch ziemlich jung, hat etwas von einer Schlange. Und ich kann Ihnen sagen, sie hasst die Schöne Louise! Dazu noch zwei junge Männer, und das wär’s dann. Alles ziemlich komische Vögel, aber ganz nett, finden Sie nicht auch, Pennyman?«
Die Frage galt einem älteren Mann, der versonnen mit seinem Kneifer spielte.
Der Angesprochene fuhr zusammen und sah auf.
»Ja, doch, doch, sehr nett. Einzeln genommen jedenfalls. Wobei, Mercado ist schon ein ziemlich seltsamer Kauz …«
»Er hat einen wirklich komischen Bart«, warf Mrs Kelsey ein. »So saft- und kraftlos.«
Major Pennyman sprach weiter, ohne ihren Einwurf zu beachten.
»Die jungen Burschen sind beide nett. Der Amerikaner ist ziemlich still, der Engländer redet etwas zu viel. Komisch, normalerweise ist es umgekehrt. Leidner selbst ist ein reizender Kerl, so zurückhaltend und bescheiden. Ja, einzeln genommen sind es lauter angenehme Menschen. Aber irgendwie, es mag ja Einbildung sein, aber als ich das letzte Mal dort war, hatte ich so ein komisches Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich weiß nicht genau, was es war … Alle wirkten irgendwie gekünstelt. Es lag eine seltsame Spannung in der Luft. Am besten kann ich es so beschreiben: Jeder reichte dem anderen die Butter eine Spur zu beflissen.«
Weil ich meine Meinung nicht so gern zum Besten gebe, errötete ich ein wenig, als ich sagte: »Wenn Leute zu eng zusammengepfercht sind, strapaziert es ihre Nerven. Das kenne ich aus dem Krankenhaus.«
»Stimmt«, meinte Major Kelsey, »aber die Grabungsperiode hat gerade erst angefangen, da ist es unwahrscheinlich, dass sich diese Art Koller bereits eingestellt hat.«
»So eine Expedition ist doch wohl wie unser Leben hier, nur im Miniaturformat«, sagte Major Pennyman. »Da gibt es Cliquen, Rivalitäten und Eifersüchteleien.«
»Es scheint, als hätten sie dieses Jahr ziemlich viele Neue dabei«, sagte Major Kelsey.
»Mal sehen.« Der Staffelführer zählte die Personen an den Fingern ab: »Der junge Coleman ist neu und Reiter auch. Emmott war schon letztes Jahr dabei und die Mercados ebenfalls. Pater Lavigny ist neu. Er ist für Dr. Byrd gekommen, der krankheitshalber verhindert war. Carey ist natürlich ein alter Hase. Er ist von Anfang an dabei, also seit fünf Jahren. Und Miss Johnson gehört fast genauso lange dazu wie Richard Carey.«
»Ich fand immer, dass sich in Tell Yarimjah alle sehr gut verstanden haben«, sagte Major Kelsey. »Sie wirkten wie eine glückliche Familie, was in Anbetracht der menschlichen Natur wirklich erstaunlich ist! Schwester Leatheran wird mir da sicher recht geben.«
»O ja«, pflichtete ich ihm bei, »da kann ich Ihnen nicht widersprechen! Was habe ich im Krankenhaus schon alles für Streitereien erlebt! Und oft ging es anfangs um nichts weiter als eine Kanne Tee.«
»Ja, wenn man eng aufeinanderhockt, wird man leicht kleinlich«, sagte Major Pennyman. »Trotzdem, ich glaube, in diesem Fall muss mehr dahinterstecken. Leidner ist so ein sanftmütiger Mensch, kein bisschen anmaßend und von bemerkenswertem Feingefühl. Er hat es immer geschafft, seine Expedition bei Laune zu halten und dafür zu sorgen, dass die Teilnehmer gut miteinander auskommen. Und doch ist mir neulich diese gespannte Atmosphäre aufgefallen.«
Mrs Kelsey lachte.
»Und den Grund können Sie sich nicht denken? Dabei springt er doch ins Auge!«
»Was meinen Sie?«
»Mrs Leidner natürlich.«
»Ach komm, Mary«, sagte ihr Mann, »sie ist eine reizende Frau und kein bisschen streitsüchtig.«
»Ich habe ja nicht behauptet, dass sie streitsüchtig ist – sie stiftet Streit.«
»Wie denn? Und warum sollte sie?«
»Warum? Warum? Weil sie sich langweilt. Sie ist keine Archäologin, lediglich die Frau eines Archäologen. Sie ist von allem, was spannend ist, ausgeschlossen, also sorgt sie selbst für ihre Unterhaltung. Sie amüsiert sich damit, andere gegeneinander aufzuwiegeln.«
»Ach, Mary, das weißt du doch überhaupt nicht. Das denkst du dir doch nur aus.«
»Natürlich denke ich es mir aus! Aber du wirst erkennen, dass ich recht habe. Die Schöne Louise sieht nicht umsonst aus wie die Mona Lisa! Sie mag nichts Böses im Sinn haben, aber sie will sehen, was passiert.«
»Sie liebt Leidner.«
»Oh! Ich unterstelle ihr ja keine amourösen Machenschaften, aber diese Frau ist eine allumeuse.«
»Frauen sind ja so was von reizend zueinander«, sagte Major Kelsey.
»Ich weiß. Katzen, die sich gegenseitig die Augen auskratzen, sagt ihr Männer immer. Aber in der Regel haben wir recht mit der Beurteilung unserer Geschlechtsgenossinnen.«
»Trotzdem«, warf Major Pennyman nachdenklich ein, »selbst wenn wir einmal annehmen, dass Mrs Kelseys harsche Vermutungen zutreffen, erklärt das immer noch nicht diese sonderbare Spannung in der Luft – ungefähr so wie vor einem Gewitter. Ich hatte das starke Gefühl, dass das Unwetter jeden Moment losbrechen könnte.«
»Jetzt machen Sie der Schwester doch keine Angst«, sagte Mrs Kelsey. »In drei Tagen fährt sie dorthin, und Sie erzählen ihr derart abschreckende Dinge.«
»Ach, mir machen Sie keine Angst«, hielt ich lachend dagegen.
Dennoch dachte ich viel über das Gesagte nach. Immer wieder kam mir Dr. Leidners merkwürdiges Wort sicherer in den Sinn. Wirkte sich die geheimnisvolle Angst seiner Frau – untergründig oder vielleicht auch unmittelbar – auf die übrige Gruppe aus? Oder griff umgekehrt die vorhandene Spannung beziehungsweise deren unbekannte Ursache Mrs Leidners Nerven an?
Ich schlug den Begriff allumeuse, den Mrs Kelsey benutzt hatte, im Wörterbuch nach, fand aber nichts, was einen Sinn ergab.
Nun gut, dachte ich, dann muss ich wohl abwarten, bis ich mir selbst ein Bild machen kann.
4
Ich treffe in Hassanieh ein
Drei Tage später verließ ich Bagdad.
Es war kein leichter Abschied von Mrs Kelsey und dem goldigen Baby, das prächtig gedieh und jede Woche erwartungsgemäß zunahm. Major Kelsey fuhr mich zum Bahnhof und begleitete mich zum Zug. Am nächsten Morgen sollte ich in Kirkuk ankommen, wo mich jemand abholen würde.
Ich schlief schlecht, weil ich im Zug nie gut schlafe, und träumte unruhig. Doch der Blick am Morgen aus dem Fenster verhieß einen herrlichen Tag, und ich war gespannt auf die Leute, die ich in Kürze kennenlernen würde.
Als ich dann auf dem Bahnsteig stand und mich suchend umblickte, kam ein junger Mann auf mich zu. Er hatte ein rundes, rosiges Gesicht – mir war in meinem ganzen Leben wirklich noch niemand begegnet, der so sehr wie ein Jüngling aus einem der humoristischen Bücher von Mr P.G. Wodehouse aussah.
»Hallihallo!«, sagte er. »Sind Sie Schwester Leatheran? Ach was, Sie müssen es sein, sieht man ja. Haha! Mein Name ist Coleman. Dr. Leidner schickt mich. Wie geht es Ihnen? Scheußliche Reise, was? Oh, ich kenne diese Züge! Na ja, jetzt sind Sie hier – schon gefrühstückt? Ist das Ihr ganzes Gepäck? Sehr bescheiden, muss ich sagen. Mrs Leidner hatte vier Reisekoffer und einen Schrankkoffer, mal abgesehen von der Hutschachtel und ihrem persönlichen Kopfkissen und dann noch diesem und jenem. Rede ich zu viel? Kommen Sie, auf zu unserem alten Bus!«
Draußen stand ein Vehikel, das sich, wie ich später erfuhr, Kombiwagen nannte. Es war wie eine Kreuzung aus Wagonette, Lastwagen und Auto. Mr Coleman half mir beim Einsteigen und riet mir, mich neben den Chauffeur zu setzen, weil ich da nicht so durchgerüttelt würde.
Durchgerüttelt! Mich wundert immer noch, dass nicht das ganze Gefährt auseinandergefallen ist! Und die Straße war gar keine, nur eine Art Feldweg voller Wagenspuren und Schlaglöcher. Prächtiger Orient, ha! Beim Gedanken an unsere großartigen Fernstraßen in England überkam mich Heimweh.
Mr Coleman, der hinter mir saß, beugte sich einen Gutteil der Zeit vor und schrie mir ins Ohr.
»Die Piste ist in ziemlich gutem Zustand«, brüllte er, als wir gerade fast bis ans Dach emporgeschleudert worden waren.
Was er offenbar vollkommen ernst meinte.
»Sehr gesund, bringt die Leber auf Trab«, sagte er. »Das dürfte Ihnen ja bekannt sein, Schwester.«
»Eine stimulierte Leber nützt mir nicht viel, wenn ich mir den Schädel einschlage«, bemerkte ich spitz.
»Sie müssten hier mal langfahren, wenn es geregnet hat! Dann ist es sagenhaft rutschig. Die meiste Zeit schliddert man seitwärts.«
Darauf sagte ich gar nichts.
Bald schon kamen wir an den Fluss und überquerten ihn mit der aberwitzigsten Fähre, die man sich vorstellen kann. Es war ein Wunder, dass wir es überhaupt hinüberschafften, aber alle schienen es völlig normal zu finden.
Nach etwa vier Stunden erreichten wir Hassanieh, das zu meiner Überraschung ziemlich groß war. Und von unserer Flussseite aus auch ganz hübsch aussah, weiß und märchenhaft mit seinen Minaretten. Wenn man dann die Brücke überquert hatte und hineinfuhr, stellte es sich allerdings etwas anders dar. Was für ein Gestank, und alles marode und halb verfallen und überall Schlamm und Unrat.
Mr Coleman brachte mich zu Dr. Reillys Haus, wo mich, wie er sagte, der Arzt zum Mittagessen erwartete.
Dr. Reilly war nett wie immer, und sein Haus war ebenfalls nett: Es hatte ein Badezimmer, und alles war tipptopp sauber. Ich nahm ein schönes Bad, und als ich meine Tracht wieder anhatte und hinunterging, fühlte ich mich ganz erholt.
Das Essen war just in diesem Augenblick fertig, und wir setzten uns zu Tisch, wobei sich Dr. Reilly für seine Tochter entschuldigte, die immer zu spät komme. Wir hatten gerade ausgezeichnete pochierte Eier in Tomantensauce verzehrt, da erschien ein junges Mädchen, und er sagte: »Schwester, das ist meine Tochter Sheila.«
Sie gab mir die Hand, meinte, sie hoffe, ich hätte eine gute Reise gehabt, warf ihren Hut beiseite, nickte Mr Coleman kühl zu und setzte sich.
»Und, Bill?«, sagte sie. »Wie steht’s?«
Er begann ihr von irgendeiner Party zu erzählen, die im Club stattfinden sollte, was mir Zeit gab, sie zu studieren.
Sie gefiel mir nicht sonderlich. Eine Idee zu kühl für meinen Geschmack. Ein sehr saloppes junges Ding, aber hübsch. Schwarzes Haar und blaue Augen, blasses Gesicht und der übliche Lippenstiftmund. Ihre lässige, sarkastische Art ging mir gegen den Strich. Ich hatte einmal so eine Lernschwester unter mir gehabt, ein tüchtiges Mädchen, zugegeben, aber ihr Benehmen hatte mich immer geärgert.
Mr Coleman schien in sie verschossen zu sein. Er geriet ins Stammeln und redete noch mehr Unsinn als vorher, soweit das überhaupt möglich war! Er erinnerte mich an einen großen dummen Hund, der mit dem Schwanz wedelt und unbedingt gefallen will.
Nach dem Mittagessen fuhr Dr. Reilly ins Krankenhaus, und Mr Coleman hatte Besorgungen zu machen. Miss Reilly fragte mich, ob ich etwas von der Stadt sehen oder lieber im Haus bleiben wolle. Mr Coleman werde mich in ungefähr einer Stunde abholen.
»Gibt es denn etwas zu sehen?«, fragte ich.
»Es gibt schon ein paar malerische Winkel«, sagte Miss Reilly. »Aber ich weiß nicht, ob sie Ihnen gefallen würden. Es ist dort sehr dreckig.«
Die Art, wie sie es sagte, fuchste mich. Ich habe noch nie verstanden, wieso malerisch eine Entschuldigung für Dreck sein soll.
Schließlich nahm sie mich mit in den Club, wo es, mit Blick auf den Fluss, recht ansprechend war und wo englische Zeitungen und Zeitschriften auslagen.
Als wir zum Haus zurückkehrten, war Mr Coleman noch nicht wieder da, also setzten wir uns hin und unterhielten uns ein wenig, was allerdings gar nicht so einfach war.
Sie fragte mich, ob ich Mrs Leidner bereits kennengelernt hätte.
»Nein«, sagte ich. »Nur ihren Mann.«
»Oh«, sagte sie. »Ich bin gespannt, wie Sie sie finden.«
Als ich darauf nichts erwiderte, fuhr sie fort: »Dr. Leidner mag ich sehr. Alle mögen ihn.«
Mit anderen Worten, dachte ich, seine Frau magst du nicht.
Ich sagte aber immer noch nichts, und im nächsten Moment fragte sie unvermittelt: »Was hat sie eigentlich? Hat Dr. Leidner es Ihnen erzählt?«
Da es für mich überhaupt nicht in Frage kam, über eine Patientin zu tratschen, die ich noch nicht einmal kennengelernt hatte, erwiderte ich ausweichend: »So wie ich es verstanden habe, ist sie ein bisschen angegriffen und möchte, dass sich jemand um sie kümmert.«
Sie lachte – ein boshaftes Lachen, hart und brüsk.
»Guter Gott«, sagte sie. »Reicht es denn nicht, dass sich neun Leute um sie kümmern?«
»Die haben wahrscheinlich alle ihre Arbeit zu tun«, sagte ich.
»Arbeit? Natürlich haben sie ihre Arbeit zu tun. Aber Louise geht vor – dafür sorgt sie schon.«
Nein, dachte ich, du kannst sie wirklich nicht leiden.
»Jedenfalls«, fuhr Miss Reilly fort, »verstehe ich nicht, was sie mit einer professionellen Krankenschwester will. Ich hätte gedacht, eine Laienhilfe läge eher auf ihrer Linie, nicht jemand, der ihr ein Thermometer in den Mund steckt und den Puls fühlt und alles auf die nackten Tatsachen reduziert.«
Ich muss zugeben, jetzt war ich doch neugierig.
»Sie glauben, ihr fehlt eigentlich gar nichts?«
»Natürlich fehlt ihr nichts! Diese Frau hat eine Rossnatur. ›Die arme Louise konnte nicht schlafen. Sie hat Ringe unter den Augen.‹ Natürlich – mit blauem Farbstift hingemalt! Alles nur, um Aufmerksamkeit zu erregen, um zu erreichen, dass alle sie umsorgen und betütern!«
Das war natürlich nicht ganz abwegig. Ich hatte (wie wohl jede Krankenschwester) etliche Hypochonder erlebt, deren größtes Vergnügen es war, einen ganzen Haushalt um sich herumturnen zu lassen. Und wenn dann ein Arzt oder eine Schwester sagte: »Ihnen fehlt nicht das Geringste!«, wollten sie es erst einmal nicht glauben und waren aufrichtig empört.
Natürlich konnte es sein, dass Mrs Leidner auch ein solcher Fall war. Der Ehemann wäre der Erste, der sich täuschen lassen würde. Ehemänner sind, was Krankheiten angeht, meiner Erfahrung nach absolut leichtgläubig. Aber es passte nicht recht zu dem, was ich gehört hatte. Zum Beispiel passte es nicht zu dem Wort sicherer.
Komisch, wie sich dieses Wort in meinem Kopf festgesetzt hatte.
Meinen Gedanken nachhängend, fragte ich: »Ist Mrs Leidner eine ängstliche Frau? Ängstigt es sie beispielsweise, so abgeschieden dort draußen zu leben?«
»Was sollte sie daran ängstigen? Lieber Himmel, sie sind doch zu zehnt! Und Wachleute haben sie auch, wegen der antiken Fundstücke. O nein, sie ist nicht ängstlich, jedenfalls …«
Ihr schien etwas eingefallen zu sein, denn sie unterbrach sich und sagte nach einem Weilchen zögernd: »Komisch, dass Sie das fragen.«
»Wieso?«
»Fliegerleutnant Jervis und ich sind neulich hinausgeritten. Es war Vormittag, fast alle waren auf der Ausgrabung. Sie saß da und schrieb einen Brief und hatte uns wohl nicht kommen hören. Der Boy, der einen sonst immer meldet, war ausnahmsweise nicht da, also sind wir direkt auf die Veranda gegangen. Anscheinend sah sie Leutnant Jervis’ Schatten an der Wand – sie schrie regelrecht auf! Entschuldigte sich dann natürlich. Sie habe geglaubt, es sei ein Fremder. Schon ein bisschen seltsam. Ich meine, selbst wenn es ein Fremder gewesen wäre, warum gleich solch ein Muffensausen kriegen?«
Ich nickte nachdenklich.
Miss Reilly schwieg, dann platzte es aus ihr heraus: »Ich weiß nicht, was dieses Jahr mit denen los ist. Sie sind alle seltsam. Die Johnson ist so mürrisch, dass sie den Mund nicht aufkriegt. David sagt nie mehr als unbedingt nötig. Bill redet natürlich ununterbrochen, und irgendwie scheint sein Geschnatter die anderen erst recht in ihre merkwürdige Stimmung hineinzutreiben. Carey sieht aus, als wäre er nahe am Zerreißpunkt. Und alle beobachten sich gegenseitig, als ob, als ob … Ach, ich weiß auch nicht, aber es ist schon komisch.«
Eigenartig, dachte ich, dass zwei so verschiedene Menschen wie Miss Reilly und Major Pennyman das gleiche Gefühl gehabt hatten.
In dem Moment kam Mr Coleman hereingetollt. Tollen ist genau das richtige Wort. Wenn er gehechelt hätte und ihm plötzlich ein Hundeschwanz gewachsen wäre, mit dem er hätte wedeln können, wäre man nicht erstaunt gewesen.
»Hallihallo«, sagte er. »Vor Ihnen steht – der mit Abstand beste Einkäufer der Welt. Haben Sie der Schwester die Schönheiten des Ortes gezeigt?«
»Sie war nicht beeindruckt«, sagte Miss Reilly trocken.
»Kann ich ihr nicht verdenken«, erwiderte Mr Coleman lebhaft. »Was für ein heruntergekommenes Kaff!«
»Sie haben es wohl nicht so mit dem Altertümlichen und Malerischen, was, Bill? Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie Archäologe sind.«
»Dafür kann ich nichts. Das geht aufs Konto meines Vormunds – ein gelehrter Vogel, Fellow an einem College, einer von denen, die in Pantoffeln zwischen Bücherregalen herumgeistern. Schon ein ganz schöner Schock für ihn, ein Mündel wie mich zu haben.«
»Ich finde es furchtbar dumm von Ihnen, sich zu einem Beruf zwingen zu lassen, der Ihnen gar nicht gefällt«, sagte das Mädchen scharf.
»Nicht zwingen, Sheila, meine Gute, nicht zwingen. Der Alte hat mich gefragt, ob ich einen bestimmten Beruf im Sinn hätte, und ich habe gesagt, nein, hätte ich nicht. Also hat er es so gedeichselt, dass man mich hier für eine Grabungsperiode genommen hat.«
»Aber haben Sie denn wirklich überhaupt keine Vorstellung davon, was Sie gern machen würden? Irgendeine Idee müssen Sie doch haben!«
»Habe ich ja auch. Meine Idee wäre es, ganz aufs Arbeiten zu verzichten. Was ich gern machen würde, wäre, viel Geld zu haben und mich dem Motorsport zu widmen.«
»Sie sind unmöglich!«, sagte Miss Reilly.
Es klang ziemlich ärgerlich.
»Oh, mir ist schon klar, dass daraus nichts wird«, sagte Mr Coleman fröhlich. »Wenn ich schon arbeiten muss, ist es mir ziemlich egal, was, solange ich nicht den ganzen Tag in einem Büro hocken muss. Ein bisschen was von der Welt zu sehen, fand ich gar nicht schlecht. Dann mal los, habe ich mir gesagt, und jetzt bin ich hier.«
»Und bestimmt eine enorme Hilfe!«
»Täuschen Sie sich nicht. Ich kann mich so gut wie jeder andere auf der Ausgrabung hinstellen und ›Yallah‹ rufen! Und außerdem bin ich im Zeichnen gar nicht so schlecht. Handschriften nachzumachen war in der Schule meine Spezialität. Ich hätte einen erstklassigen Fälscher abgegeben. Obwohl, vielleicht komme ich ja noch darauf zurück. Wenn Sie mal an der Bushaltestelle stehen und mein Rolls Royce Sie mit Dreck bespritzt, wissen Sie, dass ich mich dem Verbrechen zugewandt habe.«
»Meinen Sie nicht«, sagte Miss Reilly kühl, »Sie sollten jetzt langsam mal losfahren, statt hier endlose Reden zu schwingen?«
»Die Gastfreundlichkeit in Person, was, Schwester?«
»Ich bin mir sicher, Schwester Leatheran würde sich gern endlich ein wenig häuslich einrichten.«
»Sie sind sich immer in allem sicher«, konterte Mr Coleman grinsend.
Das stimmt allerdings, dachte ich. Besserwisserisches kleines Biest.
Ich sagte nur: »Wir sollten vielleicht wirklich fahren, Mr Coleman.«
»Wo Sie recht haben, haben Sie recht, Schwester.«
Ich gab Miss Reilly die Hand und bedankte mich, und wir brachen auf.
»Verdammt attraktives Mädchen, diese Sheila«, sagte Mr Coleman. »Muss einen aber ständig anpfeifen.«
Wir fuhren aus dem Ort hinaus und befanden uns bald auf einem schmalen Weg zwischen grünen Feldern. Er war extrem holprig und ausgefahren.
Nach einer halben Stunde etwa zeigte Mr Coleman auf einen großen Hügel nahe am Flussufer vor uns und meinte: »Tell Yarimjah.«
Kleine schwarze Gestalten krabbelten auf dem Hügel herum wie Ameisen. Plötzlich rannten alle den Hang hinab.
»Dressierte Hündchen«, sagte Mr Coleman. »Feierabend. Wir machen immer eine Stunde vor Sonnenuntergang Feierabend.«
Das Grabungshaus lag etwas vom Flussufer zurückgesetzt.
Der Wagen fuhr um eine Ecke, holperte durch einen äußerst schmalen Torbogen, und wir waren am Ziel.
Das Haus war um einen Innenhof herumgebaut. Ursprünglich bestand es nur aus dem Südtrakt sowie ein paar unbedeutenden Nebengebäuden auf der Ostseite. Die Expedition hatte dann auch noch die beiden anderen Flügel bauen lassen. Da der Gebäudegrundriss später von Bedeutung sein wird, füge ich hier eine grobe Skizze bei:
Alle Räume hatten Türen zum Innenhof, und die meisten Fenster gingen auch dort hinaus; nur im Südtrakt, dem ursprünglichen Gebäude, gab es auch Fenster zum freien Gelände hin. Die waren allerdings vergittert. In der Südwestecke führte eine Treppe auf ein langes Flachdach mit einer Brüstung. Es erstreckte sich über die gesamte Länge des Südtrakts, der höher war als der Rest des Gebäudes.
Mr Coleman ging mit mir auf der Ostseite um den Hof herum zu einer großen offenen Veranda in der Mitte des Südtrakts. Er drückte eine Seitentür auf, und wir betraten einen Raum, in dem mehrere Personen um einen gedeckten Teetisch saßen.
»Traritrara!«, sagte Mr Coleman. »Florence Nightingale ist da.«
Die Frau am Kopfende stand auf und kam mich begrüßen.
Zum ersten Mal erblickte ich Louise Leidner.
5
Tell Yarimjah
Ich gebe zu, meine erste Reaktion auf Mrs Leidner war schiere Überraschung. Einen Menschen, über den man so einiges gehört hat, stellt man sich ja doch irgendwie vor. In meinem Kopf war Mrs Leidner eine finstere, missmutige Erscheinung. Nervös und gereizt. Und, um es unverblümt zu sagen, auch ein bisschen vulgär.
Diesem Bild entsprach sie jedoch überhaupt nicht! Schon deshalb nicht, weil sie der sehr helle Typ war. Sie war zwar nicht schwedischer Abstammung wie ihr Mann, hätte es aber vom Äußeren her durchaus sein können. Sie hatte dieses skandinavisch blonde Haar, das man nicht so häufig findet. Jung war sie nicht mehr, irgendwo zwischen dreißig und vierzig, würde ich sagen. Ihr Gesicht war ziemlich abgespannt, und in das Blond mischte sich bereits etwas Grau. Ihre Augen aber waren wunderschön, Augen, wie ich sie noch nie gesehen hatte, von einer Farbe, die man mit Fug und Recht Veilchenblau nennen kann. Sie waren sehr groß, mit leichten Ringen darunter. Mrs Leidner war extrem dünn und zart, und wenn ich sage, dass sie sehr müde und gleichzeitig sehr lebendig anmutete, mag es unsinnig klingen, aber genau diesen Eindruck machte sie auf mich. Und sie wirkte auf mich wie eine echte Dame. Und das ist etwas wert, auch heutzutage noch.
Lächelnd streckte sie mir die Hand entgegen. Sie hatte eine leise, sanfte Stimme und einen amerikanischen Akzent.
»Ich bin ja so froh, dass Sie da sind, Schwester. Trinken Sie eine Tasse Tee mit uns? Oder möchten Sie zuerst Ihr Zimmer beziehen?«
Ich erwiderte, Tee wäre mir sehr recht, und sie machte mich mit den Leuten am Tisch bekannt.
»Das ist Miss Johnson. Mr Reiter. Mrs Mercado. Mr Emmott. Pater Lavigny. Mein Mann kommt auch gleich. Setzen Sie sich doch hier zwischen Pater Lavigny und Miss Johnson.«
Ich tat, wie mir geheißen, und Miss Johnson fragte mich, ob ich eine gute Reise gehabt hätte und dergleichen.
Sie war mir sympathisch, wohl auch, weil sie mich an eine Oberschwester aus meiner Lernzeit erinnerte, die wir alle bewundert und für die wir uns alle sehr angestrengt hatten.
Miss Johnson ging wohl auf die fünfzig zu und war äußerlich eher maskulin, mit sehr kurz geschnittenem stahlgrauem Haar. Ihre Sprechweise war brüsk, ihre Stimme aber angenehm und ziemlich tief. Sie hatte ein wahrlich nicht schön zu nennendes, faltiges Gesicht mit einer fast schon ulkigen Stupsnase, die sie unwirsch zu reiben pflegte, wenn sie irgendetwas beunruhigte oder irritierte. Ihr Tweedkostüm war ebenfalls recht maskulin geschnitten. Sie erzählte mir sogleich, dass sie aus Yorkshire stamme.
Pater Lavigny fand ich ein wenig beängstigend. Er war groß, mit einem mächtigen schwarzen Bart und einem Kneifer. Ich hatte ja schon von Mrs Kelsey gehört, dass ein französischer Ordensgeistlicher hier sei, und jetzt sah ich, dass Pater Lavigny eine Mönchskutte aus weißem Wollstoff trug. Das erstaunte mich, denn ich war immer davon ausgegangen, dass Mönche, wenn sie einmal im Kloster waren, nicht mehr herauskamen.
Mrs Leidner unterhielt sich hauptsächlich auf Französisch mit ihm, aber mit mir sprach er ein recht gutes Englisch. Mir