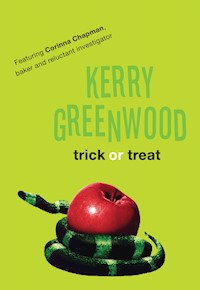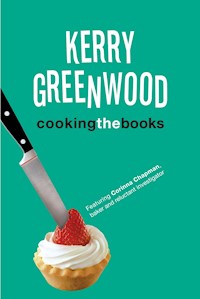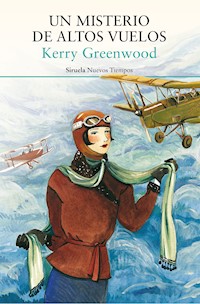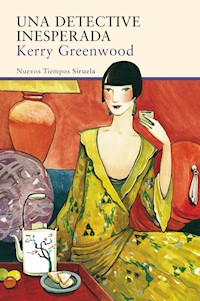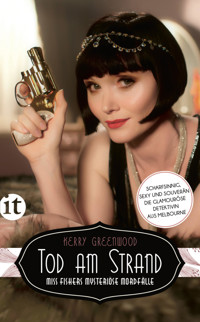10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Miss-Fisher-Krimis
- Sprache: Deutsch
Wenn Monsieur Anatole die gewitzte Detektivin Phryne Fisher in sein Restaurant einlädt, ist von vorherein klar, dass er ihr nicht nur seine köstliche Zwiebelsuppe vorsetzen wird, sondern auch einen Fall für sie hat: Seine Verlobte ist verschwunden, und Phryne soll herausfinden, wer sie entführt hat.
Phrynes Cleverness ist gefragt. Alle Spuren führen nach Paris – und Phryne zurück in ihre eigene Vergangenheit zwischen Spanischer Grippe, Rive Gauche und großen Gefühlen ….
Glamourös, klug und unabhängig, eine moderne Frau und eine gewitzte Detektivin – das ist Miss Phryne Fisher. Die wohlhabende englische Aristokratin lässt sich in den wilden 1920er Jahren in Melbourne nieder, wo sie ihr Single-Dasein in vollen Zügen genießt – und nebenbei einen Mordfall nach dem anderen löst. Nicht immer zur Freude der örtlichen Polizei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Kerry Greenwood
Mord in Montparnasse
Miss Fishers mysteriöse Mordfälle
Roman
Aus dem australischen Englisch von Regina Rawlinson und Sabine Lohmann
Insel Verlag
Paris ist ein Fest fürs Leben
Ernest Hemingway
Paris – Ein Fest fürs Leben
1
Unsere überaus aktive Lebensweise
lässt uns nicht die Muße, uns ausreichend
um unser Leibeswohl zu kümmern.
Auguste Escoffier
Ma Cuisine
In den Schaufenstern der Fitzroy Street spiegelte sich die Sonne, und der sandige Wind brannte in den Augen. Es war kalt und sonnig zugleich, eine durch und durch unerquickliche Kombination, wie man sie sonst nur in den weniger mondänen Wintersportorten antrifft.
Blinzelnd wischte sich die Ehrenwerte Phryne Fisher die Tränen aus den Augen. Warum bloß hatte sie keine Sonnenbrille dabei? Sie schlang den Zobel enger um ihren schlanken Körper. Mit dem Pelzmantel, der Pelzmütze und den russischen Lederstiefeln sah sie aus wie ein etwas zu klein geratenes Mitglied der Zarengarde, das kurz davor stand, die Beherrschung zu verlieren und einem Leibeigenen die Knute überzuziehen.
Während sie, durchgefroren und halb blind, still vor sich hin wütete, dass sie sich für den Versuch, das Hausnummernsystem in St Kilda zu ergründen, definitiv den falschen Tag oder womöglich sogar den falschen Planeten ausgesucht hatte, entdeckte sie das Café Anatole doch noch, und zwar im selben Augenblick, als ein gutgekleideter Mann es im hohen Bogen verließ – durchs geschlossene Fenster.
Phryne machte ihm höflich Platz, um seiner Landung nicht im Wege zu stehen. Dumpf schlug er auf dem Bürgersteig auf und blieb reglos liegen. Während Phryne noch kurz mit sich rang, ob sie, wie es die moralische Pflicht verlangte, einem Mitmenschen beistehen sollte, der durch eine Scheibe geflogen war – ohne Rücksicht auf Verluste, beziehungsweise auf Blutflecke an ihrem wunderschönen, sündhaft teuren Zobel –, wälzte sich der Mann auf die andere Seite, rappelte sich unter einigem Stöhnen auf und stolperte davon. Womit sich ihr Problem von selbst gelöst hatte.
Möglicherweise war das Café Anatole doch um einiges interessanter als sein Ruf. Glasscherben mit den Resten der goldenen Beschriftung knirschten unter ihren Blockabsätzen, als sie die Tür aufdrückte und eintrat.
Der Brief war am Vortag gekommen, eine Einladung zu einem besonderen Lunch in tadellosem, gestelztem Französisch, geschrieben von Anatole Bertrand persönlich. Phryne hatte von seinen Kochkünsten gehört und war, weil sie es von ihrem Haus an der Esplanade nicht weit hatte, zu Fuß herübergewandert.
Wie hatte sie diesen Entschluss noch vor wenigen Sekunden bereut! Doch nun? Betörte ihr ein himmlisches Aroma die Sinne, für das sie gern auch doppelt so weit gelaufen wäre – und über Schlimmeres als Scherben.
Der Duft versetzte sie geradewegs aus dem Melbourne des Jahres 1928 in das Paris von 1918 zurück. Zwiebelsuppe. Echte französische Zwiebelsuppe mit Cognac und einer Scheibe Baguette mit geschmolzenem Gruyère darauf. Phryne schenkte dem schlanken, attraktiven Mann mit der Schürze, der auf sie zugetänzelt kam, um sie zu begrüßen, ein derart glückseliges Lächeln, dass er regelrecht zurückprallte.
»Miss Fisher«, stellte sie sich vor.
»Es ist uns eine Ehre, Mam'selle«, antwortete der Kellner, während er der kleinen Frau mit dem schwarzen Pagenkopf, dem blassen Teint, den leuchtend grünen Augen und dem hinreißenden Lächeln Mantel und Mütze abnahm. Unter der Last der Garderobe leicht in die Knie gehend, hängte er die Sachen sorgfältig hinter der Theke auf und geleitete Phryne in den hinteren Teil des Bistros, an einen Tisch, der für eine Person eingedeckt war.
»Der Patron wird gewiss untröstlich sein, dass eine reizende Dame wie Sie eine derart unschöne Szene mit ansehen musste«, fuhr der Kellner bedauernd fort. Phryne winkte ab.
»Bringen Sie mir einen Pastis«, sagte sie. »Werden noch andere Gäste erwartet?«
»Nein, Mam'selle. Sie sind die einzige.« Der Kellner gab der jungen Frau hinter der Theke ein Zeichen. Draußen waren bereits zwei Männer damit beschäftigt, eine Plane vor das zerbrochene Fenster zu hängen. Aus der Küche hallte lautes Gebrüll, eine Stimme wie von einem brunftigen Chefkoch. Phryne bedeutete dem Kellner mit einem Kopfnicken, dass sie ihn nicht mehr benötigte. Er machte sich grinsend von dannen.
Der Pastis ließ nicht lange auf sich warten. Phryne nippte an ihrem Glas und ließ den Blick durch das Café Anatole schweifen. Es sah so aus, als hätte ein Gourmettornado ein Pariser Bistro bis ans andere Ende der Welt gewirbelt und kurzerhand in St Kilda abgesetzt, als ihm die Luft ausging. Alles war genau so, wie es sich gehörte: die Zinktheke mit der kessen Bedienung dahinter, die Barhocker für die Laufkundschaft, der Spiegel mit der Batterie Flaschen davor, von Chartreuse bis Armagnac. Die Tischchen mit den weißen Decken, die von einer Lage Wachspapier geschützt wurden. Die schmiedeeisernen Stühle. Die Künstler, die Zeichnungen aufs Papier warfen und erregt über den Modernismus diskutierten. Die biederen Bürger, die sich, leicht pikiert wegen des Klamauks, wieder über ihren Lunch beugten, eine Mahlzeit, der man mit dem gebührenden Ernst zusprach. Und alle sprachen Französisch. Phryne kam sich vor wie damals im Au chien qui fume in Montparnasse, mit den Mädchen in Hosen aus dem Quartier Latin plaudernd, Pastis schlürfend und Gauloises qualmend.
Sie schnupperte. Jemand rauchte tatsächlich eine Gauloise. Und ihre soupe à l'oignon oder ein anderes von einem Meisterkoch zubereitetes Gericht würde sicher auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Phryne lehnte sich zurück und genoss die Vorfreude.
Bevor sie sich auch nur in Ansätzen langweilen konnte, brachte ihr der Kellner einen Teller quenelles vom Fasan in delikater Brühe und schenkte ihr ein Glas fruchtigen Weißwein ein.
»Speist der Patron nicht mit mir?«, fragte sie erstaunt.
»Er ist untröstlich, Mam'selle. Ein Notfall in der Küche. Er wird sich beim Kaffee zu Ihnen gesellen.«
Phryne zuckte mit den Achseln. Die quenelles, mit dem Löffel abgestochene kleine Nocken, schmeckten vorzüglich. Der Hauptgang bestand aus einem poulet royale mit Buschbohnen, dazu ebenfalls ein Glas Wein. Sie ließ sich Zeit beim Essen. Jeder Bissen forderte die Geschmacksknospen mit immer neuen Aromen heraus. Estragon vielleicht – oder doch Petersilie?
Aus der Küche gellte ein Verzweiflungsschrei, gefolgt von einem »Plus de crème!« Wahrscheinlich wollte die Sauce nicht binden. Deshalb das Allheilmittel der französischen Küche: »Mehr Sahne!«
Zum krönenden Abschluss bekam Phryne ein winziges Vanillesoufflé, ein Glas Cognac, eine Tasse Kaffee und M'sieur Anatole.
Er gehörte zur Sorte der hageren, sehnigen und bärbeißigen Köche. Selbst in einem mit Regen vollgesogenen Militärwintermantel hätte er wohl kaum mehr als sechzig Kilo auf die Waage gebracht. Die unnatürlich schwarz glänzenden Haare trug er nach hinten gekämmt, weg von der zerfurchten Stirn, der man die jahrelange Konzentration auf das Anrühren von sauce béchamel, royale, crème oder suprême ansah. Seine hellgrauen Augen verrieten, dass er zu oft in einen heißen Backofen geschaut hatte, und auch an seinen Händen waren die unzähligen Zubereitungen von roux,garnitures und hors d'œuvres nicht spurlos vorübergegangen.
Von Natur aus war Phryne eher den Köchen der rundlichen, rotwangigen und leutseligen Art zugeneigt, aber der hervorragende Lunch hatte sie der gesamten Menschheit gegenüber wohlwollend gestimmt, daran konnte auch die Tatsache nichts ändern, dass ihr Gegenüber sie an einen zerrupften Geier erinnerte, dem gerade ein Rivale den letzten Bissen Gnu unter dem Schnabel weggeschnappt hatte. M'sieur Anatole begrüßte sie mit einem Handkuss.
»Ich danke Ihnen für das köstliche Essen«, sagte sie. »Die Nocken waren vortrefflich. Das Hühnchen würde jeder Palastküche zur Ehre gereichen, und das Soufflé zerging auf der Zunge.«
Phryne hielt nichts davon, mit Komplimenten zu knausern. Das Geiergesicht hellte sich auf.
»Eine schöne Dame erfreut man gern«, entgegnete er und setzte im Befehlston hinzu: »Jean-Paul, noch einen Cognac!«
Der Kellner, der die Ausbildung zum kecken französischen Garçon offensichtlich mit Bravour absolviert hatte, verzog missbilligend das Gesicht. Man sah ihm seine Meinung an: Ein Koch, der noch das Abendessen vorzubereiten hatte, sollte sich mittags lieber keinen Weinbrand hinter die Binde gießen. Er knallte ein zweites Glas und die Flasche auf den Tisch und rauschte pikiert davon.
»Der Sohn meiner Schwester«, erklärte M'sieur Anatole. Phryne nickte. Ein französisches Bistro war für gewöhnlich ein Familienbetrieb. Sie mochte nicht fragen, welche Fügungen des Schicksals einen waschechten Bewohner von Paris, diesem Zentrum der Kultur und Zivilisiertheit, bis an den Rand des australischen Kontinents verschlagen hatten. Erst einmal musste sie herausfinden, welchem Umstand sie die Einladung zum Lunch verdankte.
»Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Mam'selle«, sagte der Patron. »M'sieur le Comte d'Aguillon«.
»Ach.« Der Graf von Aguillon war ein ebenso hochbetagtes wie hochangesehenes Mitglied der Alliance française. Phryne hatte ihn im Zuge ihrer Nachforschungen über den Verbleib des vermissten Kätzchens des spanischen Botschaftersohns kennengelernt und ein angeregtes Plauderstündchen zu irgendeinem künstlerischen Thema mit ihm verbracht.
»Als ich ihm mein Problem anvertraut habe, hat er mir geraten, in dieser delikaten Angelegenheit …«
»… weibliche Hilfe in Anspruch zu nehmen?«, fragte Phryne.
»Genau.«
Die ersten Lunch-Gäste erhoben sich von den Tischen. Jean-Paul begleitete sie zur Tür. Der Patron beugte sich vor. Phryne konnte ihn kaum verstehen, so leise sprach er. Außerdem war ihr Französisch etwas eingerostet.
»Ich bin nach dem Krieg ins Land gekommen. Es waren damals schwere Zeiten für einen Koch, aber wir haben uns der Herausforderung gestellt. Es gab nichts zum Kochen! Keine Zutaten! Der große Escoffier soll während des Krieges tote Elefanten und sogar Seelöwen aus dem Zoo gekocht haben. Was hätte ich nicht alles für ein Seelöwen-Entrecôte gegeben! Nach dem Krieg war mein Paris eine graue, traurige Stadt, in der Provinz war alles verwüstet. Und mein einziger Sohn ist im Feld geblieben. Deshalb bin ich nach Melbourne ausgewandert, so weit weg wie nur möglich. Sicher, Australien ist ein Land der Barbaren, aber auf eine seltsame Weise auch ein Land der Unschuld. Nach und nach folgte mir der Rest meiner Familie. Meine Schwester Berthe, ihre Söhne und meine Cousins Louis und Henri.«
M'sieur Anatole leerte sein Cognacglas in einem Zug und goss sich nach.
Phryne gab eine aufmunternde Bemerkung von sich. Den Koch umgab eine derart dichte Wolke aus Gewürz- und Kräuterdüften, dass sie befürchtete, niesen zu müssen.
»Alles lief bestens. Mein kleines Café ist nicht nur bei Franzosen beliebt, sondern auch bei Australiern, die die feine Küche schätzen. Es geht uns gut. Meine Cousins haben Australierinnen geheiratet – sehr fleißig diese australischen Frauen! Die Frau meines Cousins Henri steht hinter der Theke. Fesch, eh?«
»Sehr fesch.« Phryne fragte sich, wohin seine Erzählungen wohl führen würden. Bestand vielleicht ein Zusammenhang mit dem Herrn, dessen jähen Abgang durch das Fenster sie mitbekommen hatte? Die dunkelhaarige junge Frau hinter der Theke fing Phrynes Blick auf, zwinkerte ihr zu und rückte ihre beachtliche Oberweite zurecht. Der Patron seufzte.
»Was für ein Busen! Meine Cousins können sich glücklich schätzen.«
»M'sieur Anatole«, sagte Phryne sanft und legte ihm die Hand auf den Arm. »Um was für eine delikate Angelegenheit handelt es sich? Sie dürfen mir vertrauen.«
»Es begann vor drei Monaten«, sagte der Koch, dessen Miene immer mehr der eines mutlosen Geiers glich. Sogar sein Schnurrbart hing kraftlos herunter. »Drei Männer. Sie verlangten Geld von mir, anderenfalls würde es in meinem Lokal zu unschönen Zwischenfällen kommen. Eine typische Drohung der Unterwelt, nicht wahr? Aber wir sind hier nicht in Paris. Empört habe ich sie vor die Tür gesetzt.«
»Und dann?« Phryne wollte endlich zur Sache kommen. »Kam es zu Zwischenfällen?«
»Ja. Es wurde eine Mülltonne in Brand gesteckt. Jean-Paul hat das Feuer entdeckt und gelöscht, bevor es sich ausbreiten konnte. Als Nächstes kam ein Backstein durchs Fenster geflogen. Und dann – jetzt machte ich mir ernsthaft Sorgen – wurde ein ganzer Würfel Butter mit Terpentin vergiftet. In meiner eigenen Küche! Jemand muss sich hereingeschlichen haben, als die Tür offen stand. Ich habe den Familienrat einberufen. Nach Geschäftsschluss haben wir uns hier zusammengesetzt – Jean-Paul und Jean-Jacques, die Söhne meiner Schwester, meine Schwester Berthe, meine Cousins und ihre Frauen. Was sollten wir machen? Die Forderung der Verbrecher war nicht hoch, wir hätten uns leicht von weiteren Sabotageakten freikaufen können. Aber wir schickten sie in die Wüste. Nachdem eine Woche alles ruhig geblieben war, sind sie heute wiedergekommen, und wir haben sie ein zweites Mal zurückgewiesen.«
»Recht nachdrücklich?«, fragte Phryne. »Durchs Fenster?«
»Ja.« M'sieur Anatole kippte den nächsten Cognac. »Henri war wütend, und er ist bärenstark. Die Erpresser werden sich rächen wollen.«
»Warum um alles in der Welt gehen Sie nicht zur Polizei?«, wollte Phryne wissen.
»Wir haben Angst, dass sie uns dann töten.«
»Aber wir sind hier in Australien«, sagte Phryne. »So etwas gibt es bei uns nicht.«
Der Koch zuckte mit den Schultern. Jean-Paul stellte ihm vielsagend eine Tasse Kaffee hin und nahm die Flasche mit. Diesmal hätte sein Abgang eine Sechs auf der Richterskala verdient gehabt.
»Wenn Sie ein paar schwere Jungs anheuern, die Ihr Lokal rund um die Uhr bewachen, können Sie ihnen vielleicht die Stirn bieten«, sagte Phryne. »Aber ich verstehe immer noch nicht, was ich damit zu tun habe. Schutzgelderpresser lassen sich von den Waffen einer Frau nicht so leicht beeindrucken, Patron.«
»Aber nein, Mam'selle, das ist nicht das Problem, das ich Ihnen ans Herz legen wollte«, sagte M'sieur Anatole bestürzt. »Nein. Es geht um eine Dame.«
»Verstehe.«
»Nach dem Tod meiner Frau wollte ich nie mehr heiraten. Sie war eine Heilige, meine Marie. Aber mit den Jahren wächst die Einsamkeit. Ich habe einen Freund hier im Land, meinen allerersten australischen Freund. Einen Mann von Geschmack und Vermögen, wenngleich nicht sehr kultiviert. Seine Tochter erschien mir als die perfekte Wahl. Ich habe meine Familie zu Rate gezogen. Sie hatten Vorbehalte, die ich ausräumen konnte. Danach habe ich meinen Freund gefragt. Er war einverstanden. Aber dann …«
»Haben Sie das Vorhaben auch mit Ihrer Auserwählten besprochen? Ich nehme doch an, dass sie ein mündiger Mensch ist«, sagte Phryne.
»Nein, dazu ist es nicht gekommen. Meine Familie wollte es. Ihr Vater wollte es. Ich wollte es. Aber die junge Dame …«
»Die junge Dame?«
»Ist verschwunden«, sagte M'sieur Anatole und brach in Tränen aus.
Mit allen verfügbaren Informationen über Elizabeth Chambers und deren Vater Hector Chambers, Unternehmer und prominente Rennsportgröße, ausgestattet, trat Phryne den Heimweg an. Nach den beiden Gläsern Wein und dem Cognac zur Mittagszeit hatte sie leichte Kopfschmerzen. Und ein wenig verwirrt war sie auch.
Der arme M'sieur Anatole ging ihr nicht mehr aus dem Sinn. Wie er unter dem verächtlichen Blick von Jean-Paul, der ihn zurück in die Küche bugsierte, damit er sich sammeln konnte, in seinen Schnurrbart geweint hatte. Es war so traurig. Was mochte wohl die achtzehnjährige Elizabeth Chambers davon gehalten haben, mit einem ältlichen Franzosen verheiratet zu werden, der sich die Haare färbte? Es wäre nur allzu verständlich, wenn sie bis ans andere Ende des Kontinents geflohen wäre. Und was waren das für Schutzgelderpresser, die es auf das Café Anatole abgesehen hatten? Dazu könnte ihr vermutlich ihr alter Freund Detective Inspector Jack Robinson etwas sagen, aber bevor sie ihn mit dieser Frage behelligte, wollte sie erst abwarten, ob sich M'sieur Anatole und Familie der Verbrecher nicht vielleicht doch ohne die Hilfe der Polizei erwehren konnten.
Anscheinend wurde Phrynes Rückkehr dringend erwartet, denn als sie den Gartenweg heraufkam, riss ihr die Haushälterin Mrs Butler schon aufgeregt die Tür auf.
»Ach, Miss Phryne. Wie gut, dass Sie wieder da sind. Mr Bert und Mr Cec haben einen Freund mitgebracht, der Sie sprechen möchte.«
»Das hat mir gerade noch gefehlt«, murmelte Phryne ungnädig. Sie legte Mantel und Mütze ab und begab sich ins Wohnzimmer.
Vor dem Kamin, in dem ein munteres Feuer brannte, traf sie ihre beiden treuen Helfer an, den gedrungenen, dunklen Bert und den großen, blonden Cec, ihres Zeichens Werftarbeiter und Taxibesitzer, sowie einen traurigen Mann, der seinen Hut knetete. Er schien fest entschlossen, die Krempe abzureißen.
»Wir haben ein Problem«, sagte Bert.
»Stimmt«, sagte Cec.
»Dann wollen wir erst mal Platz nehmen. Wenn Mrs Butler uns einen Tee gebracht hat, könnt ihr mir alles erzählen.« Phryne bemühte sich um Contenance. Ihr taten die Füße weh, aber ohne ihre Vertraute Dot und einen Schuhlöffel konnte sie die Stiefel nicht ausziehen.
Bert drückte den traurigen Mann, der den Blick unverwandt auf seinen Hut geheftet hielt, in einen Sessel.
»Das ist unser alter Kriegskamerad Johnnie Bedlow. Hat mit uns in der gottverfluchten Schlacht von Gallipoli und bei Pozières gekämpft.« Bert musste einigermaßen aufgewühlt sein. Im Wohnzimmer einer Dame zu fluchen, ohne sich dafür zu entschuldigen, sah ihm sonst nicht ähnlich. Ob es Cec ebenso erging, ließ sich, weil er die gewohnte Unerschütterlichkeit eines Standbilds aus Granit an den Tag legte, höchstens erahnen. Johnnie Bedlow malträtierte noch immer seine arme Kopfbedeckung.
»Guten Tag«, sagte Phryne. »Ich bin Phryne Fisher.«
Der Mann sah kurz hoch, murmelte etwas und senkte den Blick gleich wieder.
»Fünf Kameraden hatten wir«, begann Bert. »Alte Kumpel. Veteranen. Mit Cec und mir waren wir sieben. Wir treffen uns einmal im Jahr um diese Zeit zum Quatschen und Saufen.«
»Und?«, sagte Phryne. Warum war er bloß so wütend?
»Zwei von ihnen sind tot«, sagte Bert.
»Und?«
»So wie sie gestorben sind, ist da was faul an der Sache. Los, Johnnie. Erzähl's der Dame.«
»Der Erste, den's erwischt hat, war Maccie. Er ist damals aufs Land rausgezogen, in so ein Siedlungsprojekt für Kriegsheimkehrer. Hat oben am Murray River Orangen angepflanzt. Lag tot in einem Bewässerungsgraben. Der Polizeiarzt sagt, er war betrunken. Aber wieso hatte er dann blaue Flecken auf den Schulterblättern? Wieso, hä? Außerdem war Maccie kein großer Säufer.«
»Stimmt«, sagte Cec.
Johnnie Bedlow hatte sich regelrecht in Rage geredet, er war puterrot angelaufen. Der Hut riss mittendurch. Laut und abgehackt fuhr er fort.
»Und dann hat es Conger erwischt. Er soll von seinem Lieferwagen erdrückt worden sein, als er ihn repariert hat. Aber der Wagenheber war tipptopp in Ordnung. Meinen Sie, den hätte mal einer auf Fingerabdrücke untersucht? Meinen Sie, es hätte sich einer gewundert, dass Conger anscheinend mitten in der Nacht seinen Wagen repariert hat? Bei der Untersuchung der Todesursache hat der Coroner auf Unfalltod befunden. Unfalltod? Dass ich nicht lache!«
»Ihr glaubt also, dass es jemand auf eure alten Kameraden abgesehen hat?«, fragte Phryne. »Aber was wäre das Motiv?«
»Bis vorhin hätte ich ja auch geglaubt, dass es nur Zufall ist«, sagte Bert. »Aber dann wurde unser Freund Johnnie hier auf dem Bürgersteig von einem Auto angefahren und gegen Ihren Gartenzaun geschleudert. Keine Frage, wir haben es mit einem Mörder zu tun. Und Sie sollen ihn finden. Und wenn wir ihn haben«, knurrte er grimmig, »kann er was erleben«.
»Stimmt«, sagte Cec.
»Ach«, sagte Phryne.
2
Ich erinnere mich an eine französische Krankenschwester. Sie hat nur ein einziges Mal von der Front gesprochen, und zwar: C'est un paysage passionnant – eine faszinierende Landschaft. Und genau so war es dann auch an der Front. Seltsam.
Gertrude Stein
Die Autobiographie der Alice B. Toklas
»Mrs Butler!«, rief Phryne. »Keinen Tee. Wir brauchen Bier. Setzen Sie sich, Bert. Bitte. Und jetzt erzählen Sie mir alles.«
Sie holte ein nagelneues, meergrünes Notizbuch aus dem Schreibsekretär, bewaffnete sich mit ihrem Füllfederhalter und nahm gespannt Platz. Normalerweise waren Bert und Cec durch nichts zu erschüttern. Ob Kriege, Schiffsuntergänge, Bandenkämpfe oder Straßenschlachten – sie hatten alles schon erlebt und sich nicht weiter dadurch beeindrucken lassen. Heute aber wirkten sie besorgt, ja, aufgebracht. Die Sache war ernst.
Phrynes Wohnzimmermöbel waren zu zerbrechlich für unberechenbare Wutausbrüche. Die Angelegenheit bedurfte eines ruhigen Händchens. Das erste Glas Bier war in einem Zug geleert, das zweite blitzschnell nachgeschenkt.
»Namen?«, sagte Phryne.
»Mich und Cec kennen Sie«, antwortete Bert. »Und das hier ist unser alter Kumpel Johnnie Bedlow. Hat eine Autowerkstatt in Fitzroy, er ist Mechaniker. Tom MacKenzie – Maccie – ist tot. Genau wie Alan Eeles – der bei uns, passend zu seinem Nachnamen, nur Conger hieß, wie der Aal. Ansonsten gehören noch dazu Billo – William Gavin – und Thommo – Thomas Guilfoyle. Billo ist Fischer und wohnt in Richtung Queenscliff an der Küste, Thommo betreibt eine Baufirma in Footscray.«
»Und ihr trefft euch regelmäßig einmal im Jahr? Immer zu dieser Jahreszeit?«
»Aye«, sagte Bert. »Zum Jahrestag von … von einer ganz großen Sause. Als der Krieg zu Ende war.«
Phryne hob fragend eine Augenbraue.
»In Paris«, erklärte Bert.
Phryne nickte. Man brauchte nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, auf welche Weise sieben junge Männer die Befreiung gefeiert haben mochten. Nach der Auflösung ihrer Sanitätseinheit war sie zur selben Zeit ebenfalls in Paris gestrandet. Der Geruch von Eichelkaffee, die Walzerklänge der Bals Musette … als wäre es gestern gewesen.
»Billo und Thommo sind schon unterwegs«, sagte Bert. »Sie kommen im Laufe des Tages an. Wir holen sie dann vom Zug ab.«
»Gut. Ich bitte meinen Freund Detective Inspector Robinson, mir die Berichte der beiden Leichenschauen zukommen zu lassen. Am sinnvollsten wäre es, wenn wir uns zusammensetzen und alles – nun ja, beinahe alles – durchgehen, was ihr Sieben gemeinsam erlebt habt.«
»Wozu?«, fragte Bert.
»Nehmen wir an, der Mörder hat es tatsächlich auf jeden Einzelnen von euch abgesehen. Dann muss es dabei um etwas gehen, in das ihr alle verwickelt seid. Vielleicht denkt er, ihr wisst etwas oder habt etwas gesehen.«
»Der Drecksack!«, ließ sich überraschend Johnnie Bedlow vernehmen.
»Genau. Wollt ihr hierbleiben, Bert? Wenn wir die Fensterläden verrammeln, können wir jede Belagerung aussitzen.«
»Ach was. Wir sind doch jetzt auf der Hut. Johnnie übernachtet bei Cec und mir. Wenn wir Billo und Thommo abgeholt haben, fahren wir alle zusammen zu uns nach Hause. Uns passiert schon nichts. Aber wir müssen wissen, was hier gespielt wird«, knurrte Bert.
»Das finden wir heraus«, sagte Phryne.
Johnnie Bedlow starrte sie sekundenlang skeptisch an. Dann seufzte er. »Na schön.«
Nachdem Phryne die Besucher zur Tür gebracht hatte, ließ sie sich in einen Sessel sinken.
»Dot!«, rief sie. »Um Himmels willen, komm und hilf mir aus diesen Stiefeln!«
Es bedurfte Dots ganzer Kraft und eines langen Schuhlöffels, bis die russischen Stiefel ihren Sauggriff um Miss Phrynes Waden lockerten und sich mit einem hörbaren »Plopp!« lösen ließen, sodass Dot rückwärts auf dem Teppich landete, einen Stiefel an ihren strickjackenbewehrten Busen gepresst. Phryne wackelte genüsslich mit den befreiten Zehen.
»Schon viel, viel besser«, sagte sie, während sie Dot auf die Beine half. »Danke dir. Ich hatte einen sehr seltsamen Nachmittag, meine liebe Dot. Setz dich zu mir, dann erzähl ich dir alles.«
»Ich hab Mr Bert und Mr Cec gesehen«, sagte Dot, eine unscheinbare junge Frau mit Milchmädchenteint und langem, braunem Haar, das streng zum Zopf geflochten war. Über ihrem braunen Lieblingskleid trug sie eine terracottafarbene Strickjacke. Sie machte ein besorgtes Gesicht. Aber Dot sorgte sich immer um Phryne. Dass in dem eleganten Wohnzimmer erregte Männerstimmen laut geworden waren, behagte ihr ganz und gar nicht. Nach ihrer Erfahrung folgten auf erhobene Männerstimmen meistens erhobene Männerfäuste. Und womöglich hätte Miss Phryne dann irgendwem wehtun müssen.
»Sie glauben, dass es ein Mörder auf sie und ihre Freunde abgesehen hat«, sagte Phryne. »Dass er bereits zwei von ihnen getötet hat und auch noch die restlichen aus dem Weg räumen will. Ich muss Jack Robinson anrufen. Ich weiß nicht, ob an der Sache tatsächlich etwas dran ist, aber es ist nie ratsam, Männern zu widersprechen, die über Erfahrung mit Feuerwaffen verfügen und von der Richtigkeit ihrer Theorie überzeugt sind.«
»Sie könnten einen Rappel kriegen«, gab Dot ihr recht.
»Außerdem habe ich heute Monsieur Anatole kennengelernt, einen exzellenten französischen Koch – wir müssen demnächst mal bei ihm speisen, Dot. Das Essen ist einfach wunderbar. Er vermisst die junge Frau, die er heiraten möchte.«
»Wie hat er sie denn verloren?« Dot graute es davor, in ein Etablissement verschleppt zu werden, in dem es ausländisch roch und man überkandideltes ausländisches Essen vorgesetzt bekam. Womöglich wurde da sogar mit Knoblauch gekocht – nicht auszudenken. Und Miss Phryne würde sie zwingen, ihn zu essen. »Ist sie tot?«
»Hoffentlich nicht. Hier habe ich ihr Bild.«
Sie beugten sich über die postkartengroße Fotografie. Als Schönheit konnte man Elizabeth Chambers nicht bezeichnen. Ihr Mund war zu breit, die Stirn zu hoch, die Augen zu klein, die Nase zu krumm, der Unterkiefer zu kantig. Stirnrunzelnd blickte sie starr in die Kamera.
»Schlechte Laune?«, fragte Phryne.
»Dann hätte sie eine Falte zwischen den Augenbrauen«, sagte Dot. »Sie sieht eher so aus, als ob sie sich einfach nicht gern fotografieren lässt, weil sie weiß, dass sie nicht gerade die Schönste ist.«
Phryne hatte das Bild umgedreht. »Ein exklusives Atelier, wo man sich eigentlich darauf verstehen müsste, die werte Kundschaft in die richtige Fotografierstimmung zu bringen. Trotzdem konnten sie Miss Elizabeth Chambers kein Lächeln abtrotzen. Das zeugt von einem starken Willen.«
»Ja«, pflichtete Dot ihr bei. »Ich vermute, sie ist ein Rotschopf, Miss. Sehen Sie, wie hell ihre Haut ist?«
»Du hast recht. Ich habe mir aufgeschrieben, dass sie blaue Augen und rostrotes Haar hat, leuchtend wie Herbstlaub. Ihr einziger Reiz.«
»Abgesehen von einem reinen Gewissen«, sagte Dot salbungsvoll. Der neumodische Körperkult schmeckte ihr zu sehr nach Weltlichkeit, nach Fleischlichkeit und dem Teufel. »Und vielleicht auch einem gewissen Pflichtgefühl.«
»Trotzdem ist sie verschwunden. Gerade, als ihr Vater sie mit einem hervorragenden französischen Koch verheiraten wollte, der an die fünfzig Lenze zählt.«
»Und wie alt ist sie?«, wollte Dot wissen.
»Achtzehn, fast neunzehn«, antwortete Phryne lakonisch.
»Dann hatte sie einen guten Grund wegzulaufen. Was ist ihr Vater für ein Mensch?«
»Er ist Unternehmer – und eine prominente Rennsportgröße.«
»Also ein Halunke«, stellte Dot fest.
»Ja, wahrscheinlich. Ich begreife immer noch nicht ganz, warum Monsieur Anatole sie heiraten möchte oder warum ihr Vater eingewilligt hat. Da steckt mehr dahinter, Dot. Es müsste doch genügend Frauen im passenden Alter geben, die Monsieur Anatoles himmlische Küche würdigen und über sein Alter und seinen Schnurrbart hinwegsehen würden.«
»Er hat einen Schnurrbart?« Dot schüttelte sich.
»Ja, Marke Hängeschnauzer. Wir müssen uns der Sache annehmen«, sagte Phryne. »Einer jungen Frau, die ganz auf sich allein gestellt ist, können die unschönsten Dinge zustoßen.«
Dot dachte an ihre schweren Jahre als Hausmädchen zurück, wie sie sich die Finger wund gearbeitet hatte und sich dabei der Avancen der Jünglinge im Haushalt erwehren musste, und stieß einen zustimmenden Seufzer aus.
Auch wenn sie sich manchmal Phrynes wegen Sorgen machte, stellte diese nie eine Gefahr für Dots Tugend dar – lediglich für ihre Nerven.
»Aber Sie haben es doch auch geschafft«, sagte Dot. »Mit siebzehn waren Sie im Großen Krieg in Frankreich, in einer weiblichen Sanitätsbrigade.«
»Das stimmt, aber ich habe Glück gehabt. Ich bin in Collingwood aufgewachsen. In einer derart verruchten Gegend überlebt man nur, wenn man sich gewisse Kenntnisse aneignet. Aber dieses junge Ding kam direkt aus dem Elternhaus aufs Internat, vom Internat aufs Pensionat und vom Pensionat wieder zurück nach Hause. Was sie von der Welt weiß, passt locker auf eine Briefmarke. Sie ist immer umhegt und umsorgt worden. Alle Entscheidungen wurden ihr abgenommen, und wenn sie schön folgsam war, hat sie die passende Belohnung bekommen. Kurz gesagt, sie war immer brav wie ein Lamm, und so jemand hat in der Welt da draußen die gleiche Überlebenschance wie eine Schneeflocke in der Hölle.«
Dot nickte nachdenklich. »Wir müssen sie finden.«
»Und wenn wir sie gefunden haben, brauchen wir sie noch lange nicht zu ihrem Vater zurückzuschicken«, sagte Phryne. »Vielleicht können wir den Herrn Papa erpressen, dass er ihr ihren Lebensunterhalt finanziert.«
»Wie denn? Er will doch, dass sie diesen alten Franzosen heiratet.«
»Prominente Rennbahngrößen haben ihre dunklen Geheimnisse, meine liebe Dot. Und ich möchte wetten, Elizabeth kennt sie alle. Wer weiß, vielleicht ist das sogar der Grund für ihr Verschwinden. Ihr Vater hat jedenfalls keinen Versuch unternommen, sie zu finden. Der Einzige, der sich Sorgen um sie macht, ist Monsieur Anatole. Wenn ich es richtig sehe, lebt ihre Mutter nicht mehr. Falls Daddy sie also unterm Pferdestall begraben haben sollte, wäre zu Hause niemand, der unbequeme Fragen nach ihrem Verbleib stellen würde.«
»Sagen Sie doch so was nicht, Miss.« Dot wickelte die Strickjacke fester um sich.
»Ist schon gut. Wir behandeln die Sache wie einen Vermisstenfall. Monsieur Anatole ist wahrlich kein Adonis, das gebe ich zu. Pack die Klatschzeitschriften aus, Dot. Du nimmst dir die Table Talk vor, ich die Society Spice. Mal sehen, was sie uns über Hector Chambers verraten. Über so einen reichen Prominenten wird sich doch bestimmt etwas finden lassen.«
Dot öffnete die Zeitschriftentruhe. Während sie sich in einen Packen der noch halbwegs renommierten Table Talk vertiefte, widmete Phryne sich der billigen, halbseidenen Society Spice, in der sie unter dem Etikett »Edelschnüfflerin« zu ihrer Freude selbst gelegentlich vorkam. Wenn etwas ihr Vergnügen an dem Blatt trübte, dann die schlechte Qualität. Das Papier bröselte und riss leicht ein, und die Seiten ließen sich nur widerwillig voneinander trennen. Die Schrifttype variierte von Ausgabe zu Ausgabe, was wohl daran lag, dass die Zeitschrift mit schöner Regelmäßigkeit von den Gerichten dichtgemacht wurde. Falls die Redaktion jemals die Dienste eines Korrekturlesers in Anspruch genommen hatte, war dieser vermutlich nach dem ersten Arbeitstag unter Tränen geflüchtet. Phrynes Blick huschte über Scheidungsmeldungen, Dienstbotentratsch, dreiste Diebstähle, unsägliche Fehltritte und … Aha! Die Rennsportnachrichten.
»Ich habe etwas gefunden, Dot. Von Old Jock, dem Rennreporter. ›Jaunty Lad, Besitzer Hector C., bekannte Rennsportgröße, beim Ballarat Cup wegen Behinderung disqualifiziert. Jockey zum gefährlichen Reiten angehalten?‹ Hm. Der Artikel lässt durchblicken, dass in dem Rennen andere Pferde Aufputschmittel bekommen haben. Offenbar ein weites Feld für kriminelle Aktivitäten. Und ja – hier haben wir's. Mir war doch so, als hätte ich da was gelesen. Hier wird angedeutet, dass das Pferd vertauscht war. Jaunty Lad stand nicht in seiner Box, als Jolly Tom das sechste Rennen gewonnen hat … Interessant. Keiner unserer ehrbarsten Mitbürger, dieser Chambers. Was hast du in Table Talk gefunden?«
»Hier ist ein Foto.« Dot markierte eine Stelle mit einer Haarnadel. Phryne sah ihr über die Schulter.
Ein nicht sehr groß geratener Mann mit wettergegerbtem Gesicht, als hielte er sich viel unter freiem Himmel auf. Vielleicht klein genug für einen Exjockey. Er hatte sich mächtig in Schale geworfen, samt Zylinder, wodurch sich seine Größe fast verdoppelte. Die feine Gesellschaft feierte eine Gartenparty: »Mr Hector Chambers beim Wein mit Mr und Mrs Thomas Chivers und deren Tochter Julia auf dem Sommerfest zu Gunsten der Jockey-Hilfe.«
»Was für einen Eindruck macht er auf dich, Dot?«
»Fies wie eine Ratte«, antwortete Dot, wie aus der Pistole geschossen.
»Ich lasse mich eigentlich nie vom Äußeren leiten, aber du kannst gut in Gesichtern lesen. Wissen wir irgendetwas über Miss Chambers' Mutter?«
»Ist letztes Jahr gestorben. Ich erinnere mich an die Beerdigung. Sehr pompös. Die Tochter war damals nicht im Lande.«
»Todesursache?«
»Das weiß ich nicht. Sie war jedenfalls noch nicht sehr alt.«
»Hm, das wird ja immer interessanter. Mit den Klatschblättchen sind wir fürs Erste fertig. Ich würde dann gern Jack Robinson anrufen. Wo ist Mr Butler?«
»Hat den Wagen zur Inspektion gebracht. Sie sagten doch, dass er ein bisschen unrund läuft.«
»Ach ja, natürlich. Heute Nachmittag werde ich so brav wie ein Chorknabe sein. Ich darf zum Lunch wirklich keinen Wein mehr trinken. Holst du mir ein Aspirin, Dot? Und ich glaube, ich schaue doch noch ein bisschen in deine Society Spice-Sammlung. Nennen wir es Recherche.«
Nachdem Dot ihr die Kopfschmerztablette gebracht hatte, stellte sie sich dem Kampf mit dem Telefon. Obwohl sie die Nützlichkeit des Apparats nicht leugnen konnte, war er ihr nicht ganz geheuer, und es hätte sie nicht überrascht, wenn eines Tages Flammen und Blitze aus dem Hörer geschlagen wären.
Mr Butler kam genau rechtzeitig wieder zurück, um Miss Fisher die Post auf dem Silbertablett, dass sie angeschafft hatte, um ihm eine Freude zu machen, ins Wohnzimmer zu bringen. Sie schlitzte die Umschläge mit dem Brieföffner auf.
»Rechnungen, Rechnungen und noch mehr Rechnungen! Aha, eine Einladung zum Bürgermeisterball, wie schön. Mit anschließendem Souper. Das überlege ich mir. Wie läuft der Wagen jetzt?«
»Schnurrt wie ein Tiger«, antwortete Mr Butler. Er war vernarrt in Miss Fishers Hispano-Suiza und hatte ihn wie eine besorgte Mutter im Auge behalten, während der Mechaniker den Motor einstellte.
»Gut. Ich gehe davon aus, dass Detective Inspector Robinson heute Abend bei uns speist, Mr B. Ich mache jetzt ein kleines Nickerchen. Es war ein ermüdender Nachmittag.«
Mr Butler nickte, schürte das Feuer und nahm die Post wieder mit hinaus. Phryne schloss die Augen. Paris, 1918. Wie war sie nach dem Ende des Großen Krieges nach Paris gekommen?
Auf der Ladefläche eines Armeelastwagens voller verwundeter Poilus, sie erinnerte sich genau. Am Ende eines dunklen, anstrengenden, bitterkalten Wintertages Anfang Dezember. Ihre Sanitätseinheit war aufgelöst worden, die Mädchen waren zu anderen Einheiten gewechselt, und Phryne war nach Paris zurückgefahren, so müde, dass sie kaum noch wusste, wie sie hieß.
Nachdem sie im Juni ihren Schulabschluss gemacht hatte, war sie auf einem Frachtschiff nach Boulogne übergesetzt, um sich einer weiblichen Sanitätseinheit anzuschließen, die der französischen Armee angegliedert war. Sie hielt sich für abgebrüht, zupackend und nicht leicht zu erschüttern. Doch als die erste Granate einschlug, war es mit ihrer Abgebrühtheit vorbei. Nachdem sie zum ersten Mal fünfzehn Stunden am Stück Verwundete versorgt hatte, fiel ihr ein Wundhaken aus der Hand. Ihre Finger verweigerten ihr den Dienst, und sie konnte ihn nicht wieder aufheben. Alles andere als zupackend. Und während sie, wie in Blut gebadet, amputierte Gliedmaßen für die Bestattung einsammelte, musste sie erkennen, dass es auch mit ihrer Unerschütterlichkeit nicht zum Besten bestellt war.
Aber sie hatte durchgehalten. Allmählich löste sich ihre eisige Erstarrung. Sie lernte Autofahren und steuerte den schwerfälligen, rumpelnden Sanitätskraftwagen unter Beschuss über ausgefahrene Feldwege und um Granattrichter herum, den Reiz der Gefahr regelrecht genießend. Als sie einmal stöhnende Verwundete aus dem Schlamm grub, erwischte sie ein Granatsplitter am Kopf. Blutüberströmt beendete sie zuerst die Bergungsarbeiten, bevor sie langsam in die Knie sank.
Eine Woche Lazarett, und sie war wieder zurück an der Front, als hochdekorierte französische Heldin. Mademoiselle Phryne Fisher, Médaille d'Honneur. Die Narbe war unter ihrer dichten Kurzhaarfrisur nicht zu sehen. Nach den beinharten, gefährlichen Monaten war sie nur noch Haut und Knochen, zäh und durchtrainiert, aber doch fast am Ende ihrer Kräfte, als sie den letzten Transport junger Verwundeter aus dem Süden nach Paris begleitete, wo sie sich vor dem Hôtel Magnifique absetzen ließ.
Sie schleppte sich die Treppe hinauf und warf ihren Tornister auf die Empfangstheke. Sie musste sich kurz daran festhalten, so schwindlig war es ihr mit einem Mal.
»Bonjour, M'sieur.« Der Portier hielt mit seiner Missbilligung nicht hinter dem Berg. Ein verdreckter, klapperdürrer Vagabund im marmor- und goldglänzenden Foyer des Magnifique? Nicht auszudenken.
Die Gestalt hob den Kopf. Rotgeränderte grüne Augen musterten den Mann mit eiskaltem Blick. Er zuckte zurück.
»Madame«, verbesserte er sich. Das Gesicht vor ihm war weiblich. Wenn er es sich recht besah, galt das auch für den schwarzen Bubikopf. Der Portier, dem in vier Kriegsjahren jegliche menschliche Emotion abhandengekommen war, musste feststellen, dass ihm doch noch ein Gefühl geblieben war: die Angst.
»Mademoiselle Phryne Fisher«, sagte die Frau. Sie reichte ihm Soldbuch und Reisepass. »Mein Vater hat ein Konto bei Ihnen. Ich möchte eine Suite mit Bad und Toilettenartikeln. Madame la Concierge soll mir zur Hand gehen. Sofort.«
Ihr Ton ließ keinen Widerspruch zu. Der Portier kannte den Namen von Mademoiselles Vater. Milord war in Friedenszeiten häufig im Magnifique zu Gast gewesen, und auch jetzt in der Nachkriegszeit würde ihn das Hotel gern wieder willkommen heißen, die Taschen voll mit nagelneuen Pfundnoten. Das musste seine älteste Tochter sein … nach dem Pass gerade achtzehn geworden. Sie sah aus wie vierzig.
»Sofort«, wiederholte er stotternd. »Wir können Ihnen eine sehr schöne Suite anbieten, Mademoiselle Fisher. Hat Mademoiselle Gepäck?«
»Noch nicht«, sagte Phryne.
Alles Weitere war ein Kinderspiel. Phryne ergab sich der wohligen Geborgenheit des Magnifique. Die Fahrt mit dem Lift in den zweiten Stock, der flauschige Teppich, das eigene Badezimmer, die Hilfe der Concierge. Die Bestellung von Guerlain-Seife, Parfüm, Talkumpuder und Kosmetikartikeln.
Während Madame alles aufschrieb, entdeckte sie zwischen Phrynes Sachen, die verstreut auf dem Fußboden lagen, die Uniformbluse mit dem angehefteten Orden. »Mademoiselle war bei den Sanitätern?«, fragte sie.
Phryne, die am Fenster saß und eine heiße Schokolade schlürfte wie Nektar, nickte.
»Bei La Toupie?« So hieß die exzentrische Führerin ihrer Einheit. Phryne nickte noch einmal, und Madame drückte sie an ihren nach Orangenblüten und Wäschestärke duftenden Busen. Phryne war zu erschöpft, um sich auch nur zu wundern.
»Sie haben meinen Enkel gerettet«, erklärte die Concierge. »Was kann ich sonst noch für Sie tun? Was brauchen Sie?«
»Etwas zum Anziehen«, sagte Phryne. »Wie heißt Ihr Enkel?«
»Pierre Valcluse.«
»Ich erinnere mich an ihn. Er war heute bei dem Transport dabei. Sie werden ihn sehr bald wiedersehen.«
Hoffentlich würde die arme Frau den Anblick verkraften. Der Junge hatte nur noch einen Arm. Aber wenigstens lebte er. Was man von den anderen in seinem Schützengraben nicht sagen konnte.
»Bon, ich schicke Ihnen meine Freundin, die ist Schneiderin. Für heute Abend leihe ich Ihnen etwas. Und Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich erledigt.«
»Gut«, sagte Phryne. »Von diesem Bad träume ich schon seit sechs Monaten.«
»Es soll Ihnen unvergesslich bleiben.«
Phryne starrte aus dem Fenster. Paris sah aus wie immer. Schmutziger vielleicht, rußgeschwärzter und voller lärmender Soldaten. Aber die Dächer, unter denen sich so viele kleine und große Schicksale erfüllten, waren die gleichen, und die Wäsche trocknete auf den zwischen die Fenster gespannten Leinen. Paris war Paris. Das tat ihr in der Seele gut.
Madame la Concierge kehrte mit einem Korb voller Toilettensachen zurück und ließ Phryne ein Bad ein. Es bedurfte einiger Anstrengungen, Miss Fisher die Patina aus Dreck und Pulverdampf und den Gestank nach Schützengraben und Desinfektionsmitteln vom Körper zu schrubben. Der Zustand ihrer Füße gab Madame auch noch nach dem zweiten heißen Bad zu denken, und ihre Fingernägel waren ein hoffnungsloser Fall. Außerdem war sie viel zu dünn. Die Phryne Fisher auf dem Passfoto, das der Portier der Concierge gezeigt hatte, wog bestimmt sieben Kilo mehr. Aber der Krieg war vorbei. Jetzt konnte das Kind sich ausruhen, heiße Schokolade trinken und sich darum kümmern, ihre weiblichen Pölsterchen zurückzugewinnen. Die Jugend war sehr widerstandsfähig. Dieses junge Ding hatte mit seinem Körper Schindluder getrieben und Schlimmes erlebt. Ihr stand das Grauen noch in die Augen geschrieben.
Ohne zu fragen, bestellte Madame ihr ein gehaltvolles Abendessen und eine Flasche Côtes du Rhône aufs Zimmer. Ein robuster Wein aus dem Süden, voll Sonnenschein.
Phryne wurde abgetrocknet, mit duftenden Cremes eingerieben, in ein voluminöses Nachthemd gesteckt, ins Bett verfrachtet und zugedeckt. Es tat so gut, warm, umsorgt und sauber zu sein, dass ihr, nachdem Madame, für den Abend ein leckeres Essen und für den nächsten Morgen die Schneiderin versprechend, gegangen war, die Tränen kamen.
Staunend blickte die Phryne Fisher des Jahres 1928 auf ihr Alter Ego von 1918 zurück. Wie jung sie gewesen war, wie müde, wie zerbrechlich, wie dumm. Und wie viel Glück sie gehabt hatte. Eines der Kleider, die Madames Freundin für sie geschneidert hatte, besaß sie heute noch. Wie geborgen sie sich in dem Kokon des Flanellnachthemds gefühlt hatte, wie sicher in dem Hotelzimmer mit der Dampfheizung, während die Welt draußen so kalt und gefährlich sein konnte.
Phryne schüttelte sich und stand auf. Die Erinnerung an Paris schien ihr auf einmal sehr nah – und irgendwie bedrohlich.
»Dot? Wie geht's dir mit der Table Talk?«, rief sie.
Schon stand ihre Vertraute in der Tür. »Ich hatte nach Ihnen gesehen, aber Sie waren eingeschlafen. Einen interessanten Aspekt kann ich noch beisteuern, und zwar zum Tod der Ehefrau. Unerwartet sei sie verstorben, heißt es in einem Bericht, an einem Herzinfarkt. Sie war erst fünfunddreißig.«
»Und der Klatschreporter der Society Spice«, antwortete Phryne, die ihren Traum noch nicht ganz abgeschüttelt hatte, »deutet an, dass sich der Vater wiederverheiraten will. ›Hector C wünscht sich, dass Julia C ihren Nachnamen ändert, aber die Initiale behält.‹ Damit meint er doch wohl nicht Julia Chivers?«
»Sie kann höchstens achtzehn sein«, sagte Dot schockiert.
»Genauso alt wie Elizabeth. Womöglich hatte sie mehr als nur einen Grund, von zu Hause wegzulaufen. Wer hätte schon gern eine gleichaltrige Stiefmutter?«
»Aber der Mann ist quasi ein Zwerg!«, empörte sich Dot. »Und mindestens fünfzig!«
»Er ist reich«, sagte Phryne. »Wer reich ist, wirkt größer. Außerdem habe ich schon sehr kultivierte Zwerge kennengelernt, Dot. Vielleicht ist er ja ein netter Mensch.«
Dot sah sich das Bild noch einmal an. Mr Hector Chambers grinste selbstgefällig in die Kamera: Schmerbauch, Doppelkinn, schmale Lippen, zusammengekniffene Augen.
»Nein«, sagte sie. »Das glaube ich nicht, Miss Phryne. Der ist kein netter Mensch.«
Die Gefangene wachte auf und öffnete die Augen. Sie war an Händen und Füßen ans Bettgestell gefesselt. Wo seine Schläge sie getroffen hatten, war ihr Kopf blutverkrustet. Die Wunden juckten.
Sie schrie nicht um Hilfe.
3
Das Leben ist nur so schwer, wie andere es uns machen.
Natalie Barney
The Woman Who Lives With Me
Um sieben Uhr führte Mr Butler Detective Inspector Jack Robinson herein, pünktlich zum Cocktail vor dem Abendessen – auch wenn er für gewöhnlich lieber einen Sherry trank. Phryne freute sich, als er sich im meergrünen Salon zu ihr setzte. Sie freute sich immer, ihn um sich zu haben.
Obwohl sie ein sehr gutes Personengedächtnis besaß, fiel es ihr schwer, sich sein Gesicht in Erinnerung zu rufen, wenn sie auch nur kurz den Blick davon abwandte. Mittelbraune Haare, mittelbraune Augen, mittelmäßiges Aussehen, mittelgroß, mittelschwer. Er war die Unauffälligkeit in Person, was bei seinem Beruf gewiss nicht schadete. Für einen Polizeibeamten konnte es lebensrettend sein, nicht bemerkt zu werden – oder ihn zumindest vor einer Tracht Prügel bewahren. Seufzend streckte er die Beine von sich und wappnete sich für das übliche Phryne-Fisher-Verhör, wohlwissend, dass er mit einem vorzüglichen spanischen Sherry und einem hervorragenden Abendessen belohnt werden würde.
»Meine Frau ist zu ihrer Schwester aufs Land gefahren, die ein Kind bekommen hat«, sagte er. »Ich bin also zurzeit Strohwitwer, und ich war noch nie besonders gut darin, mich selbst zu verköstigen. Aber aus Dosenbohnen und Toastbrot kann man sich schon irgendwie ein Abendessen zaubern.« Mr Butler, der ihm gerade ein Gläschen Amontillado reichte, schauderte leise.
»Da können wir Ihnen etwas Besseres bieten, mein lieber Jack.« Phryne nippte an ihrem Cocktail. »Soll ich Sie vor oder nach dem Essen durch die Mangel drehen? Sie haben die Wahl.«
»Davor«, sagte er. »Lassen Sie mich nur erst austrinken.«
Während er nervös seinen Sherry schlürfte, betrachtete er Phryne, als hätte er sie nie zuvor gesehen. Er legte alle Anzeichen eines Mannes an den Tag, der mit einer Gewissensfrage rang. Phryne beschloss, ihn zappeln zu lassen.
Schließlich gab er sich einen Ruck. »Ich muss Sie um einen Gefallen bitten.«
»Nur zu«, sagte Phryne.
»Meine Frau …«
»Ja?«, sagte Phryne aufmunternd. Wollte der geschätzte Jack Robinson ihr etwa ein Techtelmechtel beichten? Ausgeschlossen.
»Sie hat sich schon immer gewünscht …«
Wieder geriet er ins Stocken. Phryne bedeutete Mr Butler, ihm nachzuschenken.
»Also. Meine Frau weiß, dass ich öfter mit Ihnen zusammenarbeite und dass Sie in den besten Kreisen verkehren, und da wollte sie gern wissen …« Er krümmte sich buchstäblich vor Verlegenheit. Worum mochte es wohl gehen? Witterte Phryne etwa einen Hauch von Bestechlichkeit? Aber bei so einem kreuzehrlichen Beamten?
»Spucken Sie's aus, Jack. Und koste es mich mein halbes Königreich. Was kann ich für die gute, brave Mrs Robinson tun?«
»Ich komme natürlich für alle Kosten auf. Aber ohne eine Einladung geht es nicht.« Robinson fasste sich ein Herz. »Eintrittskarten für den Bürgermeisterball.«
»Und das anschießende Souper?«
»Ich weiß nicht«, antwortete er verwirrt. »Gehört das dazu?«
»In den besten Kreisen schon«, sagte Phryne freundlich. »Ich rufe gleich morgen den Bürgermeister an. Sonst noch etwas?«
»Nein. Rosie wird sich ja so freuen. Sie wollte schon immer mal auf den Ball. Und Sie kriegen das wirklich gedeichselt?«
»Aber ja.« Phryne war sich sicher. Nachdem der Bürgermeister schon seit geraumer Zeit versuchte, sie auf seinen Ball zu lotsen, würde er sich Miss Fishers Anwesenheit sicher gern ein paar zusätzliche Eintrittskarten kosten lassen. Und Phryne war gern bereit, sich als kleines Dankeschön für Jacks Freundschaft und Unterstützung von den Schönsten und Reichsten aus St Kilda ein paar Stunden lang auf den Zehen herumtrampeln zu lassen. »Sie müssten die Einladungen in den nächsten Tagen bekommen. War das wirklich alles, Jack?«
»Das ist mehr als genug«, sagte Robinson, der das Gefühl hatte, auf einem schmalen Grat am Rande der Vorteilsnahme zu wandeln. »Aber weshalb wollten Sie mich sehen?«
Phryne erzählte ihm von den beiden verstorbenen Veteranen.
»Ich kann mir die Berichte der Leichenschauen gern kommen lassen, auch wenn ich bezweifle, dass sie sehr aufschlussreich sind. Haben sich die Männer das Kennzeichen des Wagens gemerkt, der ihren Kameraden über den Haufen fahren wollte?«
»Nein, sie waren zu sehr damit beschäftigt, ihn aus meiner Hecke zu ziehen. Ich kann nicht beurteilen, ob wir es hier mit einem Verbrechen zu tun haben, aber Bert und Cec sind davon überzeugt, und sie geraten nicht gerade leicht in Panik.«
»Das kann man ihnen wirklich nicht nachsagen«, sagte Robinson anerkennend, obwohl er Kommunisten eigentlich nicht leiden konnte. Aber auf Bert und Cec war Verlass. Sie hatten in Gallipoli im Schützengraben gekämpft. Spätestens dort, in der Schlacht um die Dardanellen, war ihnen jede übertriebene Ängstlichkeit ausgetrieben worden.
»Außerdem beschäftigt mich das Verschwinden von Elizabeth Chambers.«
Sie erklärte ihm die Sachlage.
»Sie ist zwar schon über achtzehn, aber noch minderjährig.« Er schüttelte den Kopf. »Da kann man nicht viel machen. Die meisten Ausreißerinnen stehen nach einem Jahr wieder vor der Tür, samt Ehemann … oder Wickelkind … manchmal auch mit beidem. Ich kann die Kollegen von der Sitte bitten herumzufragen, ob sie in einem ›Etablissement‹ anschafft. In den anderen Bundesstaaten kann ich mich höchstens unverbindlich umhören«, sagte er zweifelnd.
»Noch etwas. Wurden wegen des Todes von Miss Chambers' Mutter Nachforschungen eingeleitet?«, fragte Phryne. »Sie ist recht jung und unerwartet gestorben.«
»Falls es eine Ermittlung gegeben hat, gibt es auch eine Akte. Jemand muss die Sterbeurkunde ausgestellt haben. Ich kümmere mich darum.«
»Gut.«
»Haben Sie sonst noch etwas auf dem Herzen?«, fragte Robinson, von Bratendüften aus der Küche angeweht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er bis ans Ende seiner Tage auf Dosenbohnen verzichten können.
»Eine seltsame Angelegenheit, aber vielleicht steckt auch weiter nichts dahinter. Schutzgelderpressung in der Fitzroy Street. Sabotage in Form einer brennenden Mülltonne und von Terpentin in der Butter. Einer der Ganoven wurde heute Morgen zu einem Fenster hinausbefördert. Fällt Ihnen dazu spontan etwas ein?«
»Ich kenne jemanden, der etwas darüber wissen könnte«, sagte Robinson, dem das Wasser im Mund zusammenlief. »Als junger Polizist bin ich in der Gegend Streife gegangen. Ich erkundige mich.«
»Aber unauffällig.«
»Selbstverständlich.«
»Es ist angerichtet«, verkündete Mrs Butler. Jack Robinson schnellte wie ein Blitz aus dem Sessel.
Angestachelt von Miss Phrynes Lobeshymnen auf das Café Anatole, hatte Mrs Butler sich für ein offensiv englisches Abendessen entschieden, um zu beweisen, dass auch auf der anderen Seite des Ärmelkanals gut gekocht wurde. Der rosa gebratene Lammrücken thronte inmitten seiner Beilagen, perfekt gegartem Gemüse: Kartoffeln, Zwiebeln, Pastinaken, Karotten und Rüben. Daneben stand dampfend eine große Schüssel mit Erbsen auf der Anrichte, mit einem langsam schmelzenden Stich Butter darin. Eine Terrine mit Rotweinsauce und das selbstgemachte Minzgelee von Mrs Butlers Schwester, in dessen Facetten sich sprühend grün das Licht brach, rundeten den Hauptgang ab.
Den Auftakt machte eine leichte Hühnerbrühe mit Julienne-Gemüse, die Jack Robinson im Handumdrehen vertilgte. Als Fleisch, Gemüse, Sauce und Minzgelee seinen Teller zierten, verfiel er sekundenlang in ein tiefes, andächtiges Schweigen, das jedes Köchinnenherz hätte aufgehen lassen.
Mrs Butler zog sich hochzufrieden in die Küche zurück.
Auch die anderen Tischgenossen machten sich über das Festmahl her, als hätten sie seit Tagen nichts Anständiges mehr gegessen, obwohl das ja nur für Jack Robinson galt, dessen einseitige Kost aus Dosenbohnen und Fleischpasteten aus der Garküche in der Russell Street – »Kommen Se rein, kommen Se ran, hier schmecken die Pasteten viel besser als wie nebenan«! – keinen Ersatz für seine sonst üblichen aufgewärmten Mahlzeiten darstellte. Jane und Ruth, die in ihrer Kindheit Hungerleiderjahre durchstehen mussten, konnten immer noch nicht recht glauben, dass sie jeden Tag etwas Warmes zu essen bekommen würden. Das Gleiche galt für den ehemaligen Straßenkater Ember, der sich in der Küche die Bratenreste schmecken ließ. Es traf sogar auf Dot zu, die einen gesunden Appetit hatte, und auch auf Phryne, die in jungen Jahren ebenfalls hatten hungern müssen.
Mrs Butler holte die Apfelküchlein aus dem Backofen, und eine nach Zimt duftende Dampfwolke schlug ihr entgegen. Für solche guten Esser kochte sie gern. Diese französischen Köche verstanden sich zwar auf Speisen, die kein Sterblicher freiwillig essen würde – Schnecken! –, aber einen guten Braten bekamen sie ums Verrecken nicht hin.
Fünf Minuten vergingen, in denen am Fisher'schen Esstisch kein Wort gesprochen wurde, abgesehen von »Könnte ich noch etwas Sauce haben, bitte?«, »Hervorragendes Fleisch« oder »Würden Sie mir das Brot rüberreichen?«, und erst nachdem der erste Heißhunger gestillt war, kam nach und nach ein Gespräch auf.
»Miss Dot hat uns erzählt, dass Sie einen neuen Fall haben«, sagte Jane. »Ein Mädchen wird vermisst.«