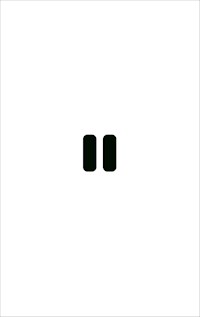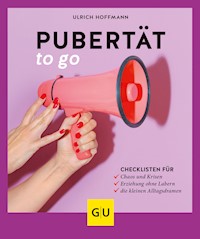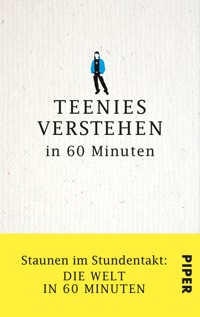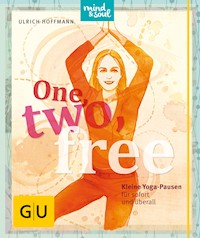4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kaitlyn «Cat» Picard ist Europas beste Tatortfotografin. Mit ihren 13jährigen Zwillingen will sie nach Venedig reisen – doch kaum am Flughafen Marco Polo gelandet, wird sie zu einem Tatort gebeten. In einem prachtvollen venezianischen Gebäude wurde eine Bürgerin der Stadt ermordet, ein ganzes Zimmer ist durchtränkt von Blut. Wer konnte Chiara di Vitale, der Oscar-Preisträgerin, Tierschützerin und engagierten Fürsprecherin für Kinder und Jugendliche, etwas Böses wollen? Cats Ermittlung bringt sie von den Glasbläsereien von Murano bis in die düstersten Ecken der Lagunenstadt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ulrich Hoffmann
Mord in Venedig
Die Tatortfotografin ermittelt
Über dieses Buch
DEM GEFRÄSSIGEN VOGEL PLATZT DER KROPF.
Venezianisches Sprichwort
Endlich Venedig! Kaitlyn «Cat» Picard ist Europas beste Tatortfotografin und alleinerziehende Mutter – also quasi im Dauereinsatz. Mit ihren Zwillingen im Teenager-Alter will sie nach Venedig reisen. Doch kaum am Flughafen Marco Polo gelandet, wird sie zu einem Tatort gebeten.
In einem prachtvollen venezianischen Gebäude wurde eine berühmte Bürgerin der Stadt ermordet, ein ganzes Zimmer ist durchtränkt von Blut. Wer konnte Vittoria di Vitale, der Oscar-Preisträgerin, Tierschützerin und engagierten Fürsprecherin für Kinder und Jugendliche, etwas Böses wollen?
Cat lässt dieser unerklärliche Fall nicht mehr los. Immer tiefer steigt sie in die Ermittlung ein und gelangt von den schönsten Plätzen und Palästen der Lagunenstadt über die Glasbläsereien von Murano bis in die finstersten Gegenden …
Vita
Ulrich Hoffmann ist Bestsellerautor, Journalist, Ressortleiter und Übersetzer aus dem Englischen. Er war unter anderem als Textchef für die Verlage Condé Nast, Springer und Gruner + Jahr tätig. Außerdem ist er Philosoph sowie zertifizierter Meditations- und Yogalehrer. Der Autor lebt mit seiner fünfköpfigen Familie in Hamburg und den USA.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Nadia Al Kureischi
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Eduardo Ramos Castaneda/Getty Images; Shutterstock
ISBN 978-3-644-40567-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Il Ghetto
Sechs Tage zuvor
Es war früh am Morgen, und Dayo hielt seine Augen geschlossen, um das Elend um sich herum nicht zu sehen. Er stellte sich vor, seine Eltern wären noch am Leben, er könnte in gut einer Woche mit seinen Geschwistern und der Familie seinen achtzehnten Geburtstag feiern. Zu Hause. Dort, wo einmal sein Zuhause gewesen war. Immer, wenn er daran dachte, drängten sich die anderen Bilder in seinen Kopf. Blut. Asche. Gräber.
Als die Männer das Dorf angriffen, flüchtete die Mutter mit drei seiner Geschwister in die eine Richtung. Er mit dem Vater in die andere. Die Männer schossen auf seinen Vater. Er fiel zu Boden. Dayo blieb einfach stehen. Das war dumm.
Die Männer stürmten auf sie zu, packten den Vater, schnitten ihm die Kehle durch. Direkt neben Dayo.
Manchmal, im Traum, schaut sein Vater ihn ein letztes Mal an, bevor einer der Männer die Finger in sein Haar gräbt, den Kopf festhält und ein anderer das Messer ansetzt. Manchmal pisst der Vater sich bloß in die Hose, als das Blut spritzt. Vielleicht sind diese Träume aber auch Erinnerungen.
Dayo weinte.
Die Männer hatten Macheten gezogen, ihm auf den Kopf geschlagen. Er war ohnmächtig geworden.
Larama, seine jüngere Schwester, rettete ihm zwei Tage später das Leben. Sie war mit der Mutter zurück ins Dorf gekommen, um nach dem Vater und ihm zu suchen. Später, im Krankenhaus, sagte sie ihm immer wieder, wie froh sie sei, zurückgekehrt zu sein. Sie erzählte, wie sie sich unter einen Baum gesetzt hatte, müde und traurig. Wie sie etwas entdeckt hatte, worauf viele Fliegen saßen. Einen Menschen. Sie hatte all ihren Mut zusammengenommen und das blutige Ding angestupst.
«Dayo?», hatte sie leise gefragt, «Dayo?»
Er hatte nur ein wenig nicken können. Seine Wunde am Kopf war tief gewesen, sein Gesicht voller Blut, aber er hatte überlebt.
Seine Schwester nahm ihn auf den Rücken und trug ihn fort. Nur einmal noch gelang es ihm, die Augen zu öffnen und zurückzuschauen auf ihr Dorf. Von dem nichts mehr übrig war. Nur Blut und Rauch und Asche. Sie hatten das Vieh gestohlen und die Häuser in Brand gesteckt.
Vier Monate lag Dayo in Kamerun im Krankenhaus. Jeden Tag kam Larama ihn besuchen.
«Ich warte auf dich!», versprach sie.
Als er entlassen wurde, humpelte er zwar, konnte aber mit der Mutter und Larama nach Norden fliehen. Durch Niger und Libyen. Die jüngeren Geschwister ließen sie bei der Großmutter in Abuja. Es ging nicht anders, sie waren zu klein und schwach. Wenn sie erst mal in Europa waren, wenn Dayo dort einen Job hatte und Geld verdiente, sollten die Kleineren nachkommen. Die Familie hätte ein Haus, ein Auto, und er würde sie morgens zur Schule fahren.
Die Mutter begleitete Dayo und Larama bis Tripolis. Dort waren sie mit vielen anderen in ein Lager gesteckt worden. Eines Morgens war die Mutter nicht mehr aufgewacht. Larama und er hatten zwei Tage neben ihr gesessen, dann hatten sie die Leiche an den Rand des Lagers zu den anderen gezerrt. Jeder hatte an einem Bein gezogen.
Dayo weinte wieder.
Spät in jener Nacht schlichen sie an den Strand. Die Mutter hatte für den Weg nach Italien bereits bezahlt. Die Überfahrt hatte fünfhundert Euro kosten sollen – pro Person. Wenn Dayo die wenigen Frauen in Il Ghetto sah, die für zehn Euro jedem zu Diensten waren, fragte er sich, was seine Mutter für Larama und ihn auf sich genommen hatte.
Sie hatten Glück. Ihr Boot kenterte nicht. Erst ein paar hundert Meter vor dem Strand warfen die Schiffsführer sie von Bord. Panisch strampelte Dayo im kalten Nachtwasser. Gerade war Larama noch neben ihm gewesen, im nächsten Augenblick war sie weg. Schließlich Boden unter den Füßen, Sand, Kies. Salzwasser brannte in Mund und Nase. Dayo schleppte sich an den Strand. Polizei, Ärzte, ein Lager, noch eines. Es regnete, es gab keine Arbeit, kein Geld.
Die Narbe, die sich vom Kopf über das Gesicht zog, juckte. Manchmal hielt er es nicht mehr aus und kratzte die Haut blutig. Obwohl er mittlerweile ein Handy besaß, rief er nicht bei seiner Großmutter an, so sehr schämte er sich. Seine Eltern, seine Schwester, sie hatten ihr Leben gelassen für ihn. Nun war er es, der die jüngeren Geschwister retten sollte. Aber dafür brauchte er Geld. Deshalb war er aus dem Auffanglager abgehauen. Seitdem arbeitete er als Erntehelfer.
Er schlief unter einer Plastikplane, die er am Straßenrand gefunden hatte. Sie hatte nur wenige Löcher, das war gut. Im Sommer war es zu heiß darunter, im Winter zu kalt. Er hatte eine alte Matratze gefunden, das war besser als die Pappen, auf denen manche schliefen.
Dayo presste die Augen zusammen und versuchte, nicht an seine Familie zu denken, die Toten, die Asche, das Blut und den Rauch. Nicht an seinen Vater, die Mutter, Larama. Nicht an seine Geschwister, die er vermutlich nie wiedersehen würde.
Langsam erwachte das Lager zum Leben. Um fünf Uhr morgens holten sie in fensterlosen Kleinbussen die Arbeiter ab.
Die nach Urin und Schimmel stinkende Matratze hatte an der Seite mehrere Löcher. In einem davon bewahrte Dayo sein Geld auf. Fast hundertzwanzig Euro hatte er gespart. Bald konnte er seine Großmutter anrufen, um ihr zu sagen, dass er Geld schicken würde. Endlich. An ihre Stimme konnte er sich schon nicht mehr erinnern. Und auch nicht an die seiner Eltern, seiner Schwester. Ihre Stimmen würde er nie mehr vernehmen. Er war ein schlechter Sohn, ein schlechter Bruder. Aber vielleicht hatte er noch die Chance, sich als guter Enkelsohn zu erweisen.
Dayo kroch unter der Plane hervor. Um ihn herum standen einfache Hütten, die aus Ästen und alten Folien aus dem Obst- und Gemüseanbau errichtet waren. Das illegale Dorf, in dem er zusammen mit Tausenden Menschen lebte. Es gab keine Toiletten, kein Wasser. Es stank nach Schweiß und Kloake, und im Staub zwischen den Hütten streunten wilde Hunde umher. Und immer flatterten die Plastikplanen im Wind.
Ein Mann kam aus einer der Hütten. Er kratzte sich an der Brust, steckte sich eine Zigarette an und pinkelte zwischen die Hütten. Zwei Hunde trotteten heran und leckten die Urinpfütze auf.
Dayo war aus der Hölle geflohen. Aber hier war es noch viel schlimmer.
Eins
Km 15.
Die Hälfte hatte sie schon geschafft. Es war Cats längster Lauf seit dem Unfall. Der Arzt hatte gesagt, sie solle nichts überstürzen, den Knöchel schonen und sich langsam steigern. Aber ihr blieben nur noch sechs Wochen bis zum Berlin-Marathon. Sie hatte keine Zeit für langsam. Queens «Don’t Stop Me Now» aus ihrer Playlist half ihr auch jetzt wieder, um durchzuhalten.
Vom Kottbusser Tor aus war sie am Landwehrkanal entlanggelaufen, hatte eine Runde durch den Görlitzer Park gedreht, dann ging es Richtung Treptow, über die Spree, vor dem Ostkreuz nach rechts durch Rummelsburg, an der Boulderhalle vorbei, und nun erreichte sie das Bolleufer. Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass sie längst noch nicht ihre alte Form wie vor einigen Wochen erreicht hatte. Sie musste also doch aufpassen, sich jetzt nicht zu sehr anzutreiben. Druck erzeugt Gegendruck.
Die Spree metallgrau unter diesigem Himmel.
Immerhin hatte Cat schon über die Hälfte der Trainingsstrecke in Halbmarathonlänge geschafft, ohne dass die Schmerzen im Knöchel zunahmen.
Der Song wurde leiser, das Handy vibrierte. Während des Laufens ließ sie nur fünf Nummern durch: ihre Schwester Emmea, ihren Vater, die Zwillinge, die Einsatzzentrale. Mist!
Sie tippte auf den Annahmesensor des Bluetooth-Kopfhörers und lief dabei in unverändertem Tempo weiter. Die Kinder.
«Ja?», keuchte sie.
«Mama! Leos Auge blutet.» Leonie klang aufgeregt.
Cat blieb stehen, stützte die Hände auf die Knie und schloss die Augen. Sie rang nach Luft. «Was? Wieso?»
«Es hat einfach so angefangen.»
Cat rieb sich die Stirn. «Kann sich das nicht Emmi ansehen?» Sie wollte so gern wenigstens über die zwanzig Kilometer kommen. Aber dann wurde ihr klar, dass dies kein Fall für ihre kleine Schwester war, sondern sie sich selbst kümmern musste. «Pass auf. In der Schublade im Flur liegt ein Notfall-Fünfziger. Nehmt ein Taxi, lasst euch in die Augenklinik der Charité bringen.» Cat musste einmal tief Atem holen. «Fragt nach Ferdinand. Dr. Menzel. Campus Mitte. Wir treffen uns dort. Ich bin in zehn Minuten mit der Bahn am Ostkreuz.»
«Okay. Machen wir.» Leonie legte auf.
Cat war alleinerziehende Mutter und Polizistin. Im Grunde bestand ihr Leben nur daraus, ständig in Bereitschaft zu sein. Diesmal also wegen Leo.
Die Musik blendete auf, und Cat rannte los. Schneller als zuvor. Sie trainierte nicht mehr, sie war im Einsatz. Ihr Knöchel konnte später heilen.
Was hatte Leo bloß wieder angestellt? Ein blutendes Auge, ausgerechnet einen Tag, bevor sie in die Ferien fahren wollten. Sie drückte sich an einem Pärchen vorbei, das vor ihr in inniger Umarmung schlenderte. Trat dabei fast in einen Hundehaufen. Berlin.
Das Wichtigste war, dass Leo keinen bleibenden Schaden davontrug. Wie gut, dass sie die Kinder zu Ferdi geschickt hatte. Der würde Leo die beste Behandlung zukommen lassen. Immerhin war er Leiter der Augenklinik der Charité.
Cat holte tief Luft. Rechts die Neubauten, links der Fluss. Der Himmel erfreulich weit. Cat genoss trotz der Sorgen um ihren Sohn die letzten Minuten ihres Laufs. Morgen um diese Zeit wollten sie schon in Venedig sein. Der erste richtige Urlaub seit über einem Jahr.
«Cat.» Ferdinand kam auf sie zu. Unter seinem offenen Kittel trug er Jeans und T-Shirt. Er begrüßte Cat mit einer Umarmung. Seit ihrem Umzug mit den Kindern nach Berlin und dem ersten Jahr in seiner WG waren sie beste Freunde.
«Was ist mit Leo?», fragte Cat.
Ihr Telefon vibrierte erneut, sie zog es aus der Rückentasche ihres Laufshirts. Papa stand im Display, darunter das gespeicherte Bild vom Besuch im Frühjahr: Ihr Vater in seinem Garten. Sie drückte ihn weg und steckte das Handy wieder ein.
Ferdinand war schon vorausgegangen. «Das wird wieder», sagte er. «Ihr fliegt morgen in den Urlaub?»
«Eine Woche Venedig», antwortete Cat. «Ist Leo denn reisefähig?»
«Ja, kein Problem. Er hat es offenbar beim Trainieren etwas übertrieben, dabei ist eine Ader im Auge geplatzt. Er hat dann so sehr gerieben, dass sich ein Riss im Augenlid gebildet hat. Und aus dem hat es geblutet, nicht aus dem Auge selbst. Er hat jetzt Salbe im und auf dem Auge – und trägt eine Augenklappe.» Ferdinand blieb vor einer Tür stehen und öffnete sie schwungvoll. «Ich präsentiere: die Piraten der Adria!»
Cat trat hinter ihm ins Behandlungszimmer. Auf der Liege saßen Leo und Leonie nebeneinander. Beide trugen Augenklappen und mit Filzstiften aufgemalte Zwirbelbärte auf der Oberlippe.
«Oh mein Gott!» Cat hob die Hände vor den Mund und wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. «Was hast du … du verdammter Blödmann!» Sie stieß Ferdinand in die Seite. «Wie soll ich mit den beiden denn morgen durch die Passkontrolle?»
Er zuckte mit den Achseln. «Mal doch einfach Augenklappen und Bärte auf die Passbilder.»
Cat seufzte. Dann nahm sie Leo in den Arm. «Ich bin so froh.»
«Argh!», raunzte der gespielt heiser. «Fünfzehn Mann auf des toten Manns Kiste!»
«Guck mal», unterbrach ihn Leonie und hielt Cat ihr Handy hin. Zu sehen war ein Foto der Zwillinge im Piratenlook, doch statt im Untersuchungszimmer in Berlin standen sie an einem karibischen Palmenstrand. «Cool, oder?»
Cat war nicht nur Tatort-, sondern auch begeisterte Hobbyfotografin. Diese Leidenschaft hatte sie offenbar an Leonie vererbt. Die war wie besessen von Filtern, Linsen und Foto-Apps. Ihr Bruder Leo interessierte sich nur für Sport. Auch das hatte er von seiner Mutter.
«Hier.» Ferdinand deutete auf eine große und eine kleine Tube, die auf dem Schreibtisch lagen. «Die kleine ins Auge, die große aufs Auge. Eine Woche lang drei Mal täglich. Dann ist alles wieder in Ordnung.»
Cat nickte.
«Oh, und wenn ihr in Venedig seid … Warte mal einen Augenblick.»
Ferdinand verließ den Raum. Cat sah ihren Kindern dabei zu, wie sie auf ihren Handys herumtippten. Offenbar reichte dafür ein Auge pro Person völlig.
Mit einer zierlichen schlanken Glasvase, in der nur eine einzige, strahlend orangefarbene Gerbera steckte, kehrte Ferdinand zurück. Die Vase hatte einen derart schmalen Fuß, dass sie eher zu schweben als zu stehen schien.
«Wow.» Cat war beeindruckt.
«Wir haben zwölf davon in der Klinik. Keine ist wie die andere. Aus Murano. Da müsst ihr hin. Schau mal.» Ferdinand hob die Vase erneut hoch und streckte sie Cat entgegen. Sie trat einen Schritt vor. Das Glas war nicht ganz durchsichtig, sondern schien einen zarten Rauchschleier zu enthalten, der es noch edler wirken ließ. Zudem waren einige orange Stückchen darin eingefangen, die aufblitzten wie Lichtreflexe auf dem Wasser, wenn die Sonne unterging.
«Faszinierend. Wie fertigt man so was?», murmelte Cat.
«Man kann bei der Arbeit zuschauen. Es gibt Touren und Vorführungen. Großer Touristenzirkus, aber es lohnt sich. Ich war dabei, als diese hier geblasen wurde, konnte die Farben und Größe festlegen. Diese Wahnsinnshitze des Glasbrennofens! Es gibt dort einen Glasbläser … ich muss den Namen raussuchen. Er ist der beste von allen, weltberühmt. Sein Glas hat diesen ganz besonderen Schimmer. Eine Lebendigkeit, die anderen fehlt. Ich schaue zu Hause nach und schicke dir seinen Namen.»
«Super, danke», sagte Cat. Sie hatte bis gestern gearbeitet und die Reise noch nicht vorbereitet. Leo wollte Spaghetti essen – Kohlehydrate! –, Leonie Gondel fahren und bei einem der fliegenden Händler eine «echte» Designerhandtasche kaufen. Das war zwar nicht legal, aber ließ sich wohl trotzdem machen, wenn Cat gerade ganz weit in die andere Richtung sah. Der Rest würde sich finden. Ob die Kinder Lust hatten, Glasbläsern bei der Arbeit zuzugucken, wagte Cat allerdings zu bezweifeln.
Das Handy klingelte erneut. Ihr Vater. Der konnte ganz schön hartnäckig sein. Sollte er doch auf die Mailbox sprechen – was er erfahrungsgemäß nie tat.
«Wo du schon hier bist …», begann Ferdinand.
Cat kniff abwehrend die Augen zusammen. Ferdi hatte sie und die Kinder nicht nur damals nach dem Umzug bei sich aufgenommen, sondern er war auch derjenige gewesen, der bei Cat einen Verdacht auf Blau-Gelb-Schwäche geäußert hatte, nur weil sie auf einem Fest im letzten Sommer die blaue Arbeitskleidung des Partyservices für grün gehalten hatte und über sie hergezogen war. Die Sachen hatten aber auch zu sehr der müden Farbe alter Polizeiuniformen geähnelt. «Tritanopie» – Cat hatte den Begriff nachschlagen müssen – war eine sehr seltene, genetisch bedingte Farbfehlsichtigkeit und führte dazu, dass die Betroffenen Blau und Grün nicht sicher und in allen Schattierungen auseinanderhalten konnten. Gelb war ganz schwierig.
Eine farbenblinde Tatortfotografin, das fehlte noch!
Sie hatte versprochen, einen Termin in der Klinik zu vereinbaren, es aber immer wieder «vergessen». Ferdinand hatte nicht mehr nachgefragt, wenn sie sich trafen. Bis jetzt. Er hatte natürlich nicht vergessen, dass er sie noch untersuchen wollte. Und sie fürchtete, dass er mit seiner Vermutung richtiglag. Seit letztem Sommer hatte sie darauf geachtet, was sie sah und wie andere über die Welt sprachen. Außerdem hatte sie mit den Einstellungen der Bildbearbeitungsprogramme experimentiert.
Sie griff zu ihrem Handy. «Ich sollte meinen Vater noch zurückrufen.»
«Kein Problem, ich kann warten», entgegnete Ferdinand.
Sie wusste, er würde sie diesmal nicht davonkommen lassen.
Warum war sie nur so vorschnell gewesen, die Kinder zu ihm zu schicken? Aber wenn es ums Sehen ging, bekam sie sofort Panik. Und Ferdinand meinte es ja nur gut mit ihr.
Ihr Handy vibrierte. Eine Textnachricht: Viel Spaß in Venedig! Papa. Sie steckte es weg.
«Okay. Na gut», sagte sie resigniert. «Bringen wir es hinter uns.»
Zwei
Schicken Sie uns Ihr bestes HDR-Foto und gewinnen Sie eine brandneue Fotoausrüstung im Wert von über 5000 Euro! Cat legte ihr Fotomagazin in den Schoß und schaute über Leonie hinweg aus dem Fenster und hinaus auf das Blau des Meeres. Oder jedenfalls das, was sie für Blau hielt.
Ferdis Diagnose gestern war eindeutig gewesen: Blausehschwäche an der Grenze zur Blaublindheit. Eine sogenannte partielle Farbenblindheit, denn Rot und Grün konnte sie hervorragend sehen. Himmel und Meer, Gras und das grüne Ampelmännchen konnte sie sehr wohl unterscheiden. Ganz im Gegensatz zu den Buchstaben und Formen im Untersuchungszimmer.
«Unser Gehirn leistet wahre Wunder», hatte Ferdinand ihr gesagt. «Du weißt ganz einfach, dass der Himmel und das Meer blau sind und Gras grün ist. Diese Informationen reichen deinem Geist bereits, um dir die Farben unterschiedlich darzustellen. Es ist wie bei diesen optischen Täuschungen, bei denen gerade Linien schief aussehen oder schiefe gerade.»
Wie sahen Leo und Leonie und alle anderen wohl die Welt? Und war die Tritanopie eine Veranlagung, über die sie ihren Arbeitgeber informieren musste?
«Du hast die Welt schon immer so gesehen und Coping-Mechanismen entwickelt», hatte Ferdinand gesagt. «So kannst du mit der Einschränkung umgehen. Wenn keiner einen anständigen Gesundheits-Check für die Eignung zum Dienst durchführt, hat dein Arbeitgeber selbst Schuld. Ich sehe keinen Grund, das freiwillig zu melden.»
«Was kann ich tun?», hatte sie leise gefragt.
«Nichts. So bezaubernd und lebensfroh bleiben, wie du immer warst.»
«Warum wolltest du dann die Diagnose stellen?»
Ferdinand hatte geseufzt. «Weil ich dein Freund bin. Du bist die Beste in deinem Job. Du kannst nur die Beste bleiben, wenn du weißt, wo deine Schwachstellen liegen.»
Das hatte sich so sehr nach ihrem Vater angehört, dass sie den gestern nicht mehr zurückgerufen hatte. Sonst hätte sie direkt zu heulen angefangen.
Zu Leonies Füßen im Tragekorb schnaufte Miss Piggy, das zahme Zwergschwein der Familie. Cat beugte sich vor und kraulte das Schweinchen. Miss Piggy grunzte zufrieden. Offiziell war das Tier der emotionale Support für die Zwillinge, weswegen es sogar mit ins Flugzeug durfte.
Die Anschnallzeichen leuchteten über ihnen, die Räder waren bereits ausgefahren, Cat hielt so unauffällig wie möglich Leos Hand. Sie saß zwischen den Zwillingen, das war erfahrungsgemäß besser so. Die beiden liebten sich heiß und innig, kamen jedoch auf engem Raum nicht immer gut miteinander klar. Cat hatte sich schon oft gefragt, ob das bei anderen Zwillingen auch so war oder ob sie als Mutter versagt hatte.
Jetzt zogen sie eine weite Kurve über der Stadt. Der Flughafen Marco Polo lag eine halbe Stunde außerhalb Venedigs. Sie würden mit der Fähre, dem Vaporetto, direkt zu ihrer Pension fahren, die mitten im Zentrum nur wenige Minuten vom Markusplatz entfernt lag. Den Weg vom Anleger zur Unterkunft hatte Cat ausgedruckt.
Der Anblick Venedigs aus der Luft war großartig. Aus der Luft sah Venedig aus wie ein Fisch, der schwungvoll auf das italienische Festland zuspringt. Der Bahnhof bildete das Auge des unglaublich dicht bebauten Fisches. Die einzigen erkennbaren Grünflächen befanden sich auf der Schwanzflosse. Der Markusplatz mit dem hohen, schlanken Turm und dem Dogenpalast direkt daneben befand sich am Bauch, wo auch der Canal Grande begann, der die Stadt s-förmig durchschnitt.
Vermutlich gab es von keinem Ort der Welt mehr Fotos als von Venedig, und auch Cat war im Geiste schon die verschiedenen Perspektiven und Tageszeiten durchgegangen, die es ihr ermöglichen würden, wenigstens ein einziges halbwegs originelles Foto zu schießen. Mit der HDR-Technik konnte sie mehrere unterschiedliche Belichtungen eines Motivs nachträglich zu einem Bild mit einer sagenhaften Ausdrucksstärke von den dunkelsten bis in die hellsten Bereiche zusammenfügen.
Der Bogen, den die Maschine flog, wurde immer enger. Cats Magen war nicht glücklich darüber, und das Festland, das sie an ihrer Tochter vorbei durch das kleine Bullauge ausmachen konnte, war auch nicht so interessant, dass der Anblick sie abgelenkt hätte. Sie schloss die Augen, bis das Flugzeug abrupt wieder in die Horizontale kippte, schnell sank und mit einem deutlichen Rums aufsetzte. Cat atmete tief durch und öffnete die Augen. Einige Passagiere klatschten. Eine Angewohnheit, die sie jedes Mal verwunderte. Wenn sie einen Täter identifizierte, klatschte auch niemand. Warum waren die Leute so begeistert, wenn ein Pilot seinen Job machte? Vermutlich war es nur die Erleichterung, wieder einmal mit dem Leben davongekommen zu sein.
Leo und Leonie hatten bereits ihre Handys aktiviert. Ihre Augenklappen und Schnurrbärte wirkten in den aufgeregten Gesichtern noch lustiger als am Tag zuvor.
«Guck mal, schon drei Likes», sagte Leonie und hielt Cat das Gerät hin. Ihr war ein grandioses Luftbild Venedigs gelungen. Das Licht war optimal, die Konturen zeichneten sich scharf ab, man konnte jedes Fenster und jeden Dachziegel sehen. Auf den Plätzen, in den Gassen und auf den Booten kleine Menschenpünktchen. In ein oder zwei Stunden würden sie ebenfalls als Pünktchen dort herumspazieren.
Vor allem die Farben. Cat schluckte. Was verstand sie schon von Farben? Vielleicht sah niemand auf der Welt dieses Foto so wie sie? Vielleicht waren die Farben misslungen? Aber ihr erschienen sie wie zauberhafte Pastelltöne. «Tolles Bild», sagte sie. «Schöne Farben!»
Leonie strahlte stolz. Cat drückte Leo den Käfig mit dem Schweinchen in die Hand und schulterte ihre Umhängetasche.
Der Flughafen war winzig, wie ein Modell seiner selbst. Es roch nach einer Mischung aus Kerosin, Salzwasser und Bolognese. Keine Einreisekontrolle, Schengen sei Dank. Die Türen des Eingangsbereiches standen offen, und auf der Terrasse eines Restaurants saßen viele Touristen.
Als sie am Gepäckband standen und auf ihre Koffer warteten, trat ein Carabinieri heran. «Signora Kaitlyn Picard?»
Cat stöhnte. Wirklich? Nur weil die Kinder Schnurrbärte aufgemalt hatten? «Also gut.» Sie begann, in ihrer Tasche nach den Ausweisen zu suchen.
Der junge Mann schüttelte den Kopf. Auf Englisch erklärte er ihr: «Your father will call you. He can explain.»
Cat runzelte die Stirn. Was hatte ihr Vater denn schon wieder zu melden? Sie war im Urlaub, auch von ihm. Leos Handy klingelte. Er schaute auf das Display, dann nahm er den Anruf an.
«Opa!», rief er und hörte einen Moment aufmerksam zu, was sein Großvater sagte. Dann reichte er das Telefon Cat. «Du hast dein Handy noch nicht wieder an. Das ist Opa.»
«Hallo?»
«Du bist gelandet, Kaitlyn», sagte ihr Vater.
«Woher weißt du …?»
«Flighttracker. Hat dich schon jemand angesprochen?»
«Wie meinst du …?», entgegnete sie verwirrt und warf einen Blick auf den jungen Polizisten neben ihr. Seine Uniform wirkte militärisch, wie es in Italien üblich war. Auf der Mütze trug er die stilisierte Granate der Elitetruppen. Trotz seiner jungen Jahre musste er also schon einen höheren Rang bekleiden. «Was hast du schon wieder vor?» Ihrem Vater, Polizist mit Leib und Seele, war nicht zu trauen.
«Erklär ich dir später. Es ist wichtig.»
Diesen Befehlston kannte sie zur Genüge. Dann hatte sie sowieso keine Chance, irgendetwas von ihm zu erfahren. «Darf ich mal Ihren Dienstausweis sehen?», bat Cat.
Der Polizist zog eine Ledermappe aus der Innentasche seiner Uniformjacke. Seine Hände waren schlank, die Fingernägel sorgfältig gepflegt. Er klappte die Mappe auf. Auf der Außenseite erkannte Cat erneut das rot-weiße Signet der Truppe. Der Ausweis enthielt sein Foto, allerdings mit Schnauzbart – um Cats Mundwinkel zuckte es –, und seine Dienstnummer sowie den Vor- und Nachnamen: Enno Rossi.
Cat nannte ihrem Vater den Namen. Sie hörte leises Tastenklicken im Hintergrund, dann: «Er ist Maresciallo Ordinario. Stabsfeldwebel. Das entspricht unserem Polizeihauptmeister. Frag ihn nach dem Geburtsdatum seiner jüngeren Tochter.»
Der Polizist beantwortete Cats Frage, ohne mit der Wimper zu zucken.
«Korrekt», bestätigte ihr Vater. «Er wird dich zum Tatort bringen.»
«Tatort?» Cat war entgeistert. «Ich mache Urlaub! Mit den Kindern. In Italien. Schon vergessen?»
«Seine Kollegen fahren die Zwillinge ins Hotel.»
«Papa!» Er schien bereits alles organisiert zu haben.
«Kaitlyn, es ist nur ein Termin. Danach kannst du Venedig genießen. Die brauchen eine Fotografin, eine gute. Und du bist die beste. Ich zähl auf dich. Ich hab’s einem Freund versprochen.»
«Du und deine Freunde.»
Ihr Vater hatte über Europol überall Kontakte, da wusch eine Hand die andere. So hatte er Cat auch zur Polizei gebracht. Wenn sie ehrlich war, die beste Entscheidung ihres Lebens. Bloß dass ihr Vater sich ihrer Meinung nach zu oft und zu stark in alles einmischte. Aber ja, eine Hand wusch die andere, immerhin verdankte sie diesem Prinzip ja auch ihren Job in Berlin.
«Also gut, also gut. Aber ich mache nur diesen einen Termin. Und du hältst dich raus.»
«Danke, Kaitlyn.» Ihr Vater klang zufrieden. «Ich wusste, ich kann auf dich zählen.»
«Scusi», sagte Rossi. «Alle warten auf Sie.»
«Und unser Gepäck?», fragte Cat und steckte das Handy weg.
«Wird in Ihre Unterkunft gebracht. Wir haben uns erlaubt, die Airline entsprechend zu informieren. Es ist vermutlich bereits unterwegs. Kommen Sie!»
Als sie die traurigen Blicke ihrer Kinder sah, schloss Cat für einen Moment die Augen. Auf was hatte sie sich da wieder eingelassen?
Wirklich schade, dass ihr Vater an seinem Arbeitsplatz bei Europol in Straßburg saß. Sonst hätte sie ihn umbringen können.
Drei
Conti steckte ihr Handy weg. Sie spürte einen Anflug von Kopfschmerzen, die sie mit einem tiefen Atemzug an den Rand ihres Schädels zu drängen versuchte. Jetzt halste Europol ihr auch noch eine deutsche Tatortfotografin auf. Kollegenhilfe, am Arsch. Die wollten nur wieder zeigen, dass sie besser waren als die Italiener. Mehr draufhatten, Fälle knackten wie am Fließband.
Dabei war die Sache schon kompliziert genug. Aufgrund der Prominenz des Opfers würde bald schon etwas an die Presse durchsickern. Solche Informationen waren viel wert, keiner der Kollegen war gut genug bezahlt, um die Angebote der Journalisten nicht wenigstens in Betracht zu ziehen.
Conti beobachtete Sottotenente Galli, der vor dem Fenster stand und eine Nachricht ins Handy tippte. Vielleicht an eine Kontaktperson bei der Presse, vielleicht machte der Leutnant aber auch nur das abendliche Date mit seiner neuesten Freundin klar.
Sie konnte niemandem trauen. Nicht nur, weil sie verhindern musste, dass wichtige Ermittlungsdetails bekannt wurden, sondern vor allem wegen ihrer besonderen Beziehung zum Partner des Opfers. Eine Beziehung, von der bislang niemand wusste, und das musste auch so bleiben, denn sonst würde sie wegen Befangenheit abgezogen und vermutlich auch suspendiert, weil sie den Fall nicht von sich aus abgelehnt hatte.
Es wäre Misstrauen erweckend gewesen, in einem derart wichtigen Fall die Unterstützung durch die Kollegin abzulehnen. «Europas beste Tatortfotografin». Na ja, sie konnte ja gern schöne Bilder machen, solange sie sich aus den restlichen Ermittlungen heraushielt.
Ihre Kopfschmerzen nahmen zu. «Schluss jetzt mit Tinder, Galli», herrschte Conti ihren Untergebenen an. «Zurück an die Arbeit!»
Vier
Die Verkehrsregeln galten wie überall auf der Welt nicht für den Fahrer eines Polizeifahrzeugs und schon gar nicht für den eines Polizeiboots auf Venedigs Kanälen. Cat hielt sich an der Reling fest. Der Mann am Steuer musste in einem früheren Leben Taxifahrer in New York gewesen sein.
Rossi hatte ihr nicht viel über den Fall verraten. «Eine Frau wurde ermordet, eine bekannte Bürgerin der Stadt. Die Ermittlungen werden auf höchster Ebene mit entsprechender Priorität geführt.»
Zwei Kollegen von Rossi hatten Leo und Leonie in Empfang genommen. Es war nicht das erste Mal, dass Cat unerwartet zu einem Einsatz gerufen wurde, aber im Urlaub in einem anderen Land war es doch etwas anderes. Trotzdem steckten die Kinder es erstaunlich gut weg. Dass die Kollegin und der Kollege, die sich um Leo und Leonie kümmern sollten, nur unwesentlich älter waren als sie, hatte sicher geholfen. Außerdem hatten sie den Kindern beste italienische Eiscreme und das schnellste WLAN der Stadt versprochen. Sogar auf Miss Piggy waren sie vorbereitet gewesen und hatten Melonen- und Apfelstücke dabei.
Cat wusste, dass ihr Vater sie nicht unnötig im Urlaub in eine Ermittlung hineinziehen würde. Trotzdem ärgerte sie sich darüber, wie er über sie verfügte.
«Wann wurde die Tote gefunden?», rief sie über den Fahrtwind hinweg.
«Heute am frühen Morgen.»
«Befindet sich die Leiche noch am Tatort?»
Rossi zuckte mit den Achseln. «Ich bin nicht direkt an den Ermittlungen beteiligt. Aber ich gehe davon aus, dass die Leiche noch nicht abtransportiert wurde.»
Cat schüttelte den Kopf. «Sie wissen, dass ich deutsche Tatortfotografin bin, oder? In Italien habe ich keinerlei Befugnis. Ich kann nur Fotos machen.»
«Der Fall hat eine internationale Komponente, deswegen wurde er an Europol gemeldet. Ihr Vater hat meine Kollegen angerufen und Ihre Hilfe angeboten. Mehr weiß ich nicht.»
Cat schloss die Augen. Papa! Er war so ungeheuer stolz auf sie … und verlangte ihr so viel ab. «Ich habe nur meine Privatkamera mit.» Cat klopfte auf ihre Umhängetasche. Ihre Kameras checkte sie nie ein.
«Meine Vorgesetzte erwartet Sie vor Ort und wird Sie über alles informieren», entgegnete Rossi.
Sie schossen in einen noch schmaleren Kanal hinein, dann verlangsamte der Fahrer so heftig, dass Cat fast gefallen wäre. Rossi hakte eine lange Holzstange in den Eisensporn in der Mauer und zog das Boot an die Wand. Über ihnen öffnete sich eine zum Kanal gelegene Doppeltür. Erst jetzt entdeckte Cat eine schmutzige Leiter, mit Muscheln und Algen bewachsen, die an der Mauer senkrecht nach oben führte. Es roch nach Abgasen mit einem Stich Fischsuppe.
Zwei Polizeibeamte mit Maschinengewehren schauten auf sie herunter. Rossi reichte Cat seine Hand und half ihr, das immer noch stark schaukelnde Boot zu verlassen. Sie trug Sneakers, aber trotzdem tat sie sich schwer mit der senkrechten Leiter.
«Signora Picard.»
Die schönste Frau, die Cat seit langem gesehen hatte, trat aus der Dunkelheit des Hausflurs auf sie zu. Cat wurden die Knie weich. Sie war ausgesprochen wählerisch, was ihre Bettpartner anging, aber nicht darin, welchem Geschlecht sie angehörten.
Das engelsgleiche Wesen schien direkt aus einem klassischen Gemälde von Botticelli oder Canaletto getreten zu sein. Das tiefbraune Haar der Frau wellte sich bis über die Schultern. Ihre mandelförmigen Augen waren von einem weichen Schokoladenbraun, ihre Lippen rot wie Kirschen. Die Nase und das Gesicht eher schmal, ebenso wie die Taille. Doch dann … der Hüftschwung, die angedeutete Rundung des Hinterns, die durchtrainierten und doch unverkennbar femininen Beine … Die Schuhe der Frau hatten Absätze, wie sie nur eine Italienerin tragen konnte. Und diese streng geschnittene Uniform!
«Vielen Dank, dass Sie gekommen sind», sagte der Engel, der Rossis Vorgesetzte sein musste, und streckte Cat die Hand entgegen. Ihre Haut war weich wie Seide.
Von dieser Frau würde sich Cat sofort verhören, sich gründlich abtasten und durchsuchen lassen. Ihr würde sie jedes Geheimnis anvertrauen.
« … gehen wir!», hörte sie nur noch. Verdammt, jetzt hatte sie wohl ausgerechnet den Namen verpasst.
Gebannt folgte Cat ihr und konnte den Blick kaum von dem sich im Takt der Absätze wiegenden Hintern abwenden.
Im zweiten Stock standen erneut zwei Wachmänner mit Maschinenpistolen und bewachten die Tür. «Maggiore Conti», grüßte einer der Männer.
Conti. Major Conti. Den Vornamen würde Cat auch noch herausbekommen, oder ihr Vater würde ihn ihr verraten.
Maggiore Conti öffnete die Wohnungstür. Kühler Muff schlug ihnen entgegen, vermengt mit einer Eisennote. Blut. Aus der Ferne waren Stimmen zu hören.
Cats Augen brauchten einen Moment, um sich an das Dämmerlicht zu gewöhnen. Im nächsten Augenblick schaltete die schöne Conti die Beleuchtung im Flur der Wohnung ein.
Cat verschlug es den Atem.
«Die Wände sind mit rotem Samt beschlagen», erklärte Conti in perfektem Englisch. Im Hauch des italienischen Singsangs in der Stimme hätte Cat baden können. «Auf dem Boden orientalische Läufer. An der Decke ein Kristalllüster. Der Zierstuck ist mit Blattgold dekoriert – so haben sich in den letzten Jahren etliche reiche Familien der Stadt eingerichtet. Man darf hier weder anbauen noch neu bauen, also muss man restaurieren.»
In ihren bequemen Flugklamotten – Jogginghose, Turnschuhen, T-Shirt – fühlte sich Cat auf einmal peinlich underdressed.
Was diese Conti wohl von ihr dachte? Da musste eine hochrangige Polizeibeamtin eine schlecht gekleidete Deutsche beaufsichtigen – und vermutlich wussten sie beide nicht, was Cat zur Lösung des Falls beitragen sollte.
Conti ging bereits weiter voran, während Cat erst noch aufnehmen musste, was sie sah. Noch nie hatte sie in einem derart üppig ausgestatteten Flur gestanden. Doch angeberisch erschien er ihr nicht, er vermittelte eher ein Gefühl von Lebensfreude. Wie bester Rotwein aus randvoll eingeschenkten Wassergläsern an einem ausgelassenen Sommerabend.
Und dieses Rot! Es schien nicht von den Wänden zu strahlen, sondern den Blick aufzunehmen und sich in die Weite auszudehnen.
Langsam durchschritt sie den Flur. Rechts und links gab es je zwei weiß lackierte Holztüren. Am Ende befand sich eine Flügeltür. Alle Türen wirkten frisch gestrichen, keine Gebrauchsspuren. Überhaupt deutete nichts darauf hin, dass die Wohnung genutzt wurde. Sie wirkte eher wie ein perfekt eingerichtetes Modell.
«Es heißt, Sie können Tatorte zum Sprechen bringen. Wir wären dankbar dafür, denn uns sagt dieser hier bislang leider nicht genug.»
Conti zog Plastiküberzieher für die Schuhe aus der Tasche. Cat schlüpfte hinein. Dann stieß die Italienerin die Flügeltür auf. Durch eine zur Lagune hin gelegene Fensterfront fiel Sonnenlicht in den großen Raum.
Das Opfer lag in der Mitte des Zimmers. Seine Kleidung war blutdurchtränkt.
Zwei Ärzte knieten neben der Leiche. Etliche Kollegen der venezianischen Polizei suchten nach Hinweisen und Spuren, sicherten und dokumentierten sie. Ein Fotograf kauerte auf der Fensterseite den Ärzten gegenüber. Mit seinem von Falten durchzogenen Gesicht sah er aus wie ein altgedienter Kriegsreporter, aber seine Kamera war ein nagelneues Spitzenmodell, erst seit wenigen Monaten auf dem Markt. Das sah Cat sofort. Im Geiste machte sie bereits selbst Fotos … klick, klick, klick, und setzte ein Panorama zusammen.
Der Kollege starrte sie herausfordernd an. Niemand bekam gern jemanden vor die Nase gesetzt und damit gesagt, man erledige nicht den eigenen Job.
Der Raum glich einem Schlachtfeld. Cat zog ihre Nikon Df aus der Schultertasche und machte sich an die Arbeit. In diesem Zimmer war nicht nur ein Mord geschehen, hier war Rache geübt worden. Die Kamera hielt Beweise fest, sie gab Cat aber auch die Möglichkeit, sich von dem Ort des Schreckens, den sie dokumentierte, zu distanzieren, sich ihm erst später, in ihrem eigenen Tempo zu nähern.
Um die Tote herum lagen zertrümmerte Stühle, aufgeschlitzte und umgekippte Sessel, Scherben einer Glasplatte, die zu einem Couchtisch gehörte, zerfetzte Bücher, ein zerschmetterter Großbildfernseher, Bilder, die von den Wänden gerissen waren.
Und überall war Blut. Um die Leiche herum auf dem Teppich, auf der zerstörten Einrichtung, an den Wänden. Kaum vorstellbar, dass es sich hierbei um Spuren der Tat handelte, um das Blut der Toten. Dafür war es zu viel und auch zu weit verteilt.
So etwas hatte Cat noch nie gesehen. Sie versuchte, sich vorzustellen, was geschehen sein könnte. Entweder hatten die Täter – denn so ein Schlachtfeld konnte unmöglich ein Einzeltäter hinterlassen haben – ihr Opfer systematisch ausbluten lassen und die Körperflüssigkeit aufgefangen, um diesen Horror zu inszenieren. Oder es handelte sich um ein Statement, das sich Cat noch nicht erschloss, und die Täter hatten Tierblut verschüttet.
Sie bahnte sich einen Weg durch das Wohnzimmer. Der einstmals weiße Hochflorteppich hatte das Blut aufgesogen, sodass er nun aussah wie feuchtes Moos.
Die Tote lag auf der Seite, das Gesicht der Zimmertür zugewandt. In ihrer Stirn befand sich ein etwa daumendickes Loch. Cat war nicht gut darin, Kaliber zu schätzen, das überließ sie den Kollegen. Aber sie sah sofort: Das hier war kein Handtaschenrevolver gewesen.
Tatorte, sagte Cat bei ihren Schulungen junger Nachwuchspolizisten, sollten eigentlich Täter-Orte heißen: Der Täter zwingt dem Ort seinen Willen auf und hinterlässt somit immer einen wichtigen Teil seiner Persönlichkeit. «Wir müssen ihn nur finden.»
«Scusi.» Cat bemühte ihre nicht vorhandenen Italienischkenntnisse, um aus einem besseren Winkel aufnehmen zu können.
Doch der italienische Tatortfotograf bewegte sich nicht vom Fleck, dabei machte er keine Fotos mehr. «Excuse me, could you please let me take my picture?» Den freundlichen, aber bestimmten Tonfall hatte sie in einem Managementworkshop geübt, geübt, geübt. Sonst nahmen die Kerle einen einfach nicht ernst, da konnte sie noch so gute Arbeit machen. «Wer am Anfang nicht der Boss ist, ist die ganze Zeit der Esel», sagte ihr Vater oft. Emmea fiel das leicht. Cat tat sich schwer damit.
Statt beiseitezutreten, begann der Kollege plötzlich laut auf Italienisch auf sie einzureden. Dabei gestikulierte er mit beiden Händen, als wäre seine Canon schwerelos. Obwohl Cat kein einziges Wort verstand, konnte sie sich denken, was er sagte. Jetzt kam er näher, so nah, dass Cat zurückweichen musste, damit sie nicht Nasenspitze an Nasenspitze voreinander standen.
Doch da dröhnte Contis Stimme aus einer Ecke des Raums. «Mattia!» Conti bellte kurz, einen Satz vielleicht, der seine Wirkung nicht verfehlte: Mattia trat zur Seite.
Durchsetzungsstark war die Polizistin also auch noch. Das wurde ja immer besser.
Cat trat vor, machte vier Aufnahmen im Querformat, dann hatte sie den Raum komplett dokumentiert. Der Gegensatz zwischen dem sonnigen Urlaubshimmel draußen vor dem Fenster und der roten, fast schwarzen Dunkelheit im Inneren wurde durch die konzentrierte Arbeit ein wenig erträglicher.
Zwei, drei Meter vor der linken Wand unter dem zur Seite gekippten Sessel aus feinstem Leder, in dem bestimmt einmal teure Zigarren gepafft worden waren, schaute eine weltbekannte Statue hervor.
«Ist der echt?», fragte sie Conti, die neben sie getreten war, und deutete auf den goldenen Oscar.
«Sie wissen nicht, in wessen Wohnung wir sind?», fragte Conti erstaunt.
Fünf
Vittoria di Vitale war in den siebziger Jahren ein Weltstar gewesen. Sie hatte mit ihrem Partner, einem berühmten skandinavischen Regisseur, bewegende Dramen und erfolgreiche Komödien gedreht. Auch Cat kannte eine ganze Reihe ihrer Filme. Nachdem das Paar sich getrennt hatte, war es für einige Jahre still um die Schauspielerin geworden, bevor di Vitale mit neuen, anspruchsvollen Rollen zurückgekehrt war, in veredelten Hollywood-Produktionen ebenso wie in europäischer Filmkunst.
Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, als sie endlich den verdienten Oscar entgegengenommen hatte, zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück. Sie heiratete einen reichen italienischen Unternehmer, engagierte sich für den Tierschutz. Man hielt sie für schrullig. Sie rettete streunende Hunde und kaufte mit dem Geld ihres Mannes ganze Kuhherden vom Schlachthof frei. Dabei lächelte di Vitale, die weit jünger aussah, als sie war, stets bezaubernd. Ihre Fotogenität steigerte zweifelsohne die Medienpräsenz ihrer Botschaft.
Weil ihr Mann gleich mit mehreren minderjährigen Prostituierten erwischt und zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, reichte sie die Scheidung ein, erstritt einen Gutteil seines Vermögens und begann einen grandiosen Kampf zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Jeder in Europa kannte das Gesicht di Vitales nicht mehr nur aus den Kinoklassikern, sondern von Konferenzen und politischen Tagungen. «Kein Kind», wiederholte sie stets, «hat es verdient zu leiden.»
Möglicherweise war ihr Engagement in Teilen auch auf ihre eigene, schwierige Kindheit zurückzuführen, über die sie erst vor wenigen Jahren ein großes Interview gegeben hatte. Der frühe Tod der Mutter, Armut, Schläge, Schulabbruch. Cat erinnerte sich, dass Auszüge daraus überall zu lesen gewesen waren, und die Ehrlichkeit und Herzlichkeit di Vitales hatten sie berührt.
Schließlich wurde Vittoria di Vitale sogar Abgeordnete im Europäischen Parlament. Allerdings wusste Cat nicht, welche Partei sie vertrat … vertreten hatte.
Polizeimajor Conti drückte ihre Zigarette in einem Taschenaschenbecher aus und senkte die Stimme: «Sie war jahrelang die Geliebte unseres amtierenden Bürgermeisters. Viele Venezianer hätten sich eine Hochzeit der beiden gewünscht. Sie galt als inoffizielle First Lady Venedigs und hat viele wichtige soziale Projekte ins Leben gerufen oder gefördert. Sie können also sicher verstehen, warum die Ermittlungen oberste Priorität haben. Wie stehen wir da, wenn nicht einmal eine Persönlichkeit von ihrem Rang und einer solchen Beliebtheit in dieser Stadt sicher ist?»
Politik also. Cat hätte es ahnen können. Warum sonst sollte ihr Vater bei einem Mordfall im fernen Venedig die Finger im Spiel haben? Europol kümmerte sich um die großen Fische, die grenzüberschreitenden Verbrecherbanden, um die international aktiven Täter – nichts davon schien auf die Ermordete zuzutreffen. Von wegen internationale Dimension!
Wer europaweit erfolgreich ermitteln will, braucht Freunde in jeder Stadt. Ihr Vater schuldete sicher jemandem einen Gefallen. Und Cats überragende Fähigkeit, Tatortfotos aufzunehmen und sie zu deuten, war in diesem Spiel nicht mehr als ein Zahlmittel. Sie spielte mit, weil auch sie ihrem Vater immer noch etwas schuldete – und weil Vittoria di Vitale, diese schillernde Persönlichkeit, sie interessierte. Sie war ein Vorbild für selbstbewusste Frauen gewesen – im Film, auf Pressekonferenzen. Sie hatte ihren Ruhm dafür eingesetzt, aus der Welt einen besseren Ort zu machen. Für Tiere und Menschen. Das können nicht viele von sich behaupten.
Vielleicht war der Fall aber auch bedeutungsvoller, als Conti es vor Ort klingen ließ, und Cat stellte die ermittlerische Trumpfkarte ihres Vaters dar.
Cat bemerkte, dass der Fotografen-Kollege sie immer noch feindselig anstarrte. «Weiß er, warum ich hier bin?», fragte sie.
«Natürlich», entgegnete Conti. «Weil Sie besser sind als er.»
Cat seufzte. Sie wusste selbst aus den statistischen Auswertungen ihrer Abteilung, dass ihre Beiträge zur Aufklärung von Verbrechen überdurchschnittlich waren. Dabei machte sie in ihren Augen doch nur Fotos und schaute sie sich auf dem Bildschirm genau an. Und das mit ihrer Sehschwäche.
Mattia sprach mit Conti, der Fotograf klang empört und herausfordernd. Seine Vorgesetzte antwortete ihm in beruhigendem Ton – ganz so wie Cat, wenn sie die Kinder ins Bett schickte, obwohl die noch fernsehen wollten.
Ein paar Sätze lang ging es hin und her, während Cat versuchte, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Die Aggression würde nicht abnehmen, solange zwei Fotografen sich eine Leiche teilen mussten. In einer solchen Situation half nur professionelle Ruhe.
Die Ärzte waren mit ihren Untersuchungen fertig und standen am Fenster. Einer von ihnen rauchte und ließ die Asche durch das gekippte Fenster davonfliegen.
«Todesursache?», fragte Cat, während sie sich neben das Opfer kniete. Das schöne Gesicht di Vitales war durch die schwere Verletzung und das viele Blut wirklich kaum wiederzuerkennen. Dafür glänzten ihre Haare umso mehr.
Conti übersetzte die Frage für die Mediziner. Deren Antwort übersetzte sie abermals: «Eintrittswunde auf der Stirn, aber keine offensichtliche Austrittswunde. Sie gehen von einer Hirnblutung aus. Genau werden wir es erst nach der Obduktion wissen. Sie starb im Laufe der Nacht, wohl zwischen dreiundzwanzig und zwei Uhr.»
Conti presste die Lippen aufeinander. Sie schien etwas blasser geworden zu sein, wunderschön war sie trotzdem. Cat musste sich beherrschen, kein Foto von ihr zu machen oder sie gar zu berühren. Schnell richtete sie ihr Objektiv auf das Gesicht der Toten.
«Die Nachbarn wurden bereits befragt», erklärte Conti weiter. «Niemand hat etwas gehört. Die Bewohner direkt über uns sind im Urlaub. Die aus dem vierten Stock haben geschlafen. Im ersten Stock wohnt ein junges Ehepaar, es vermietet zwei Zimmer an Touristen, die noch nicht wieder zurück sind. Ein Kollege wartet unten auf sie. In den Nachbarhäusern ist auch niemandem etwas aufgefallen. Keine Schreie, keine lauten Geräusche, keine verdächtigen Personen.»
Cat wechselte die Position, ließ sich zurücksinken, um den ganzen Oberkörper aufs Bild zu bekommen, die Beine, die Füße, die in eleganten Schuhen steckten. Dann erhob sie sich für eine Ganzkörper-Aufnahme der Toten. Anschließend ging sie um die Leiche herum.
Die Tat war mitten in der Nacht erfolgt, doch di Vitale trug keinen Pyjama, sondern einen schicken Hosenanzug. Dessen Farbe war nicht mehr auszumachen, da er völlig mit Blut durchtränkt war.
«Sie war noch nicht zu Bett gegangen, als es geschah», sagte sie. «Vielleicht ist sie auf einer Veranstaltung gewesen, einer Party, bei einem Essen? Ist ihre Handtasche gefunden worden?»
«Nein.»
Mit einem Blick über die Tote hinweg bemerkte Cat, dass im Bücherregal ein Fach freigelassen worden war für etliche unterschiedliche Pokale und Figuren: die Filmpreise der Diva. Ihre Kamera klickte.
Die Mischung aus Zigarettenrauch und dem Geruch nach gerinnendem Blut bereitete ihr Übelkeit. Rauchende Kollegen am Tatort kannte sie nicht aus Berlin.
«Kann ich bitte auch die anderen Zimmer sehen?»
Conti zuckte mit den Achseln. «Da ist nichts zu dokumentieren», entgegnete sie. «Der Mord wurde hier begangen. Unsere Ermittlungen konzentrieren sich daher auf den Tatort.»
Sicher hatte ihr Vater sich etwas dabei gedacht, sie herzuschicken. Und wo sie den Urlaub schon unterbrochen hatte, konnte sie genauso gut ganze Arbeit leisten. Cat ließ Conti stehen und ging in den Flur, die Kollegin lief ihr nach. «Sie können nicht einfach …», begann sie.
«Doch. Sonst können Sie gleich Europol erklären, warum Sie meine Arbeit behindern.» Sie hielt ihr Telefon bereits in der Hand.
Conti öffnete den Mund, presste die Lippen aber gleich wieder aufeinander. Oh, sie hatte so schöne Lippen, und dazu die hohen Wangenknochen, gekonnt durch einen Pinselstrich Rouge betont!
Cat öffnete die Tür zum Nachbarzimmer. Das Bad war so ordentlich, wie ihres noch nicht mal vor dem Einzug ausgesehen hatte. Sie schoss von der Tür aus ein Foto, dann trat sie ein. «Handschuhe?», fragte sie, ohne sich umzudrehen.
Conti rief einen Befehl ins Wohnzimmer. Ein junger Polizist lief herbei und reichte Cat ein Paar Latexhandschuhe.