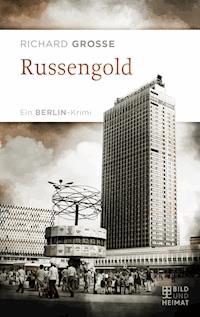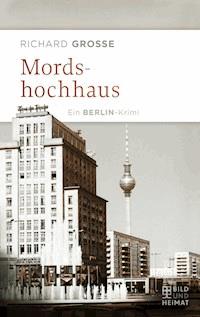
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bild und Heimat Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mörderischer Osten
- Sprache: Deutsch
1975, Ostberlin. In einem der bekanntesten Gebäude der DDR, im »Haus des Kindes« am Strausberger Platz, treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Ausgerechnet hier, wo hohe Funktionäre und verdienstvolle Bürger der Republik leben, werden Frauen, die es mit der »sozialistischen Moral« nicht so genau nehmen, erdrosselt. Major Bircher, ein zum Polizist umgeschulter Biologielehrer, nimmt die Ermittlungen auf, und je näher er dem Täter kommt, desto tiefer gerät er in ein Netz voller Intrigen, amouröser Abenteuer und schrulliger Nachbarn … Aber auch die Vertreter des Partei- und Staatsapparates haben ein Wörtchen mitzureden und verfolgen Birchers Untersuchungen mit Argwohn. Richard Grosse legt mit Mordshochhaus ein atmosphärisch dichtes und raffiniert ausgeklügeltes Krimidebüt vor. Ein Großstadt-Krimi, der in einer Zeit spielt, als die Hauptstadt der DDR noch Berlin hieß und die Feinde klar definiert waren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Richard Grosse
Mordshochhaus
Ein Berlin-Krimi
Kommissar Birchers erster Fall
Bild und Heimat
Danksagung
Herrn Dr. Jäger-Hülsmann für wertvolle sachliche und formale Hinweise und Dr. Floßmann für die Durchsicht des Manuskripts.
Herrn Prof. Dr. med. Uebelhack für den rechtzeitig erteilten fachlichen Rat, das Buch zu Ende zu bringen.
Frau Dr. med. Fietze für alle Gespräche und wohlwollende Hilfestellungen.
ISBN 978-3-95958-014-4
1. Auflage
© 2015 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagabbildung: © ullstein bild - Leber
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat
Alexanderstr. 1
10178 Berlin
Tel. 030 / 206 109 – 0
www.bild-und-heimat.de
Für G.
Die Handlung ist frei erfunden. Jedweder Bezug der Romanfiguren zu realen Personen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1
Ostberlin, im Sommer, 10. Juli 1975. Es war einsam in Berlin, zu dieser Zeit, nachts gegen zwei Uhr, und scheinbar sehr friedlich. Von der toten Frau wusste so gut wie niemand.
Die Straßen waren leer. Auf dem Asphalt spiegelte sich lediglich das weiße Licht der Laternen. Es erinnerte daran, dass hier Menschen leben. Falls sie auf die Straße treten würden, in das fahle Leuchten der Lampen, überkäme sie die Empfindung, als hätte jemand diesen Ort, wie einen Theatersaal, wenn der letzte Vorhang fällt, für das Publikum geschlossen.
Die rasch hochgezogenen Neubauten entlang der Leninallee, Wahrzeichen des Fürsorge versprechenden Staates der Arbeiter und Bauern und seiner allmächtigen Parteiführung, säumten die Straße wie eine weitere Berliner Stadtmauer. Die monoton wirkenden Wohnblöcke mit ihrer langweiligen Systematik aus sich wiederholenden farblosen Wänden, aneinandergereihten Balkonen und identischen Eingängen verlangten vom ortsfremden Besucher ein gutes Auge, denn nur die Hausnummern unterschieden die Mietshäuser voneinander.
Der Fahrer des Polizeipräsidiums fluchte leise vor sich hin, als er im Schritttempo versuchte die Hausnummern zu entziffern. Zwischen Fahrbahn und Hauseingängen befanden sich Grünanlagen, so wurden sie bezeichnet, die immer gleichen Rasenflächen mit einigen Büschen, die die Wohngemeinschaften der Häuserblöcke in freiwilligen Einsätzen pflegten. Den Bewohnern wurde gewissermaßen mit dem Hausschlüssel die Harke zur Pflege des Volkseigentums überreicht.
Der Fahrer blinzelte zwischen die Büsche, und versuchte sich an den Aufgang zu erinnern, vor dem er erst vor wenigen Tagen mit seinem Wagen gestanden und auf den Kommissar gewartet hatte. Er war in Eile, denn der Auftrag kam nicht aus der Einsatzzentrale, sondern direkt aus dem Polizeipräsidium Berlin und wurde entsprechend nachdrücklich übermittelt.
»Was zum Teufel hat die bewegt, die Hausnummern für Autofahrer fast unsichtbar zu machen!«, murmelte er und starrte abwechselnd auf den Asphalt und die Hauseingänge.
Kommissar Bircher stand in seiner Küche und beobachtete den Wartburg, der langsam am Bordstein entlangschlich.
»Na, sind ja schließlich bei der Kripo, da wird der ja wohl noch meine Hausnummer finden«, brabbelte er missvergnügt in seine Kaffeetasse.
Der Anruf aus dem Präsidium hatte ihn aus einem kurzen Schlaf gerissen, nachdem er wieder einmal lange wach gelegen hatte. Gegen Mitternacht nahm er schließlich sein Buch, warf einen kurzen Blick auf seine schlafende Frau und begab sich in das angrenzende Wohnzimmer. Er hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, das Bett zu verlassen, sobald sich seine Gedanken, oder waren es nur Satzfetzen, zu verselbstständigen begannen, leichten Stromstößen ähnlich durch seinen vor Erschöpfung gelähmten Körper irrten, keinen Ausgang fanden, erneut zur Attacke ansetzten, so, als wollten sie seine Gliedmaßen in Schwingung versetzen, bis er regungslos begann, sich zu verfluchen, weil sich sein bleierner Körper wie ein fremdes Gebilde anfühlte, das sich von seinem ruhelosen Geist gelöst hatte, und er schließlich durch die Flucht aus dem Bett weitere Qualen abzuwenden versuchte.
Irgendwann nach Mitternacht war er zurück unter die Decke gekrochen und schließlich eingeschlafen, bis ihn der Anruf aus dem Schlaf riss.
Er war ins Wohnzimmer geschlurft, die Sonderanfertigung einer Telefonschnur hinter sich her ziehend, die er aus Rücksicht auf den Schlaf seiner Frau der Post abgerungen hatte, allerdings erst nach einem klärenden Brief seines Polizeipräsidenten an den stellvertretenden Minister für das Post- und Fernmeldewesen der Republik.
Er ließ sich schnaufend in den Sessel fallen und resümierte die Informationen zu dem unklaren Todesfall, der seinen Einsatz erforderte. Es würde sich um eine junge, gut aussehende, alleinstehende Frau handeln, an der, nach dem ersten Eindruck des herbeigerufenen Abschnittsbevollmächtigten, keine Gewaltanwendung festzustellen sei. Den ABV hatten die Nachbarn gerufen, nachdem ihnen aufgefallen war, dass der Briefkasten zwei Tage nicht geleert worden war, obwohl sie das immer in Abwesenheit der Toten erledigten und deshalb auch einen Wohnungsschlüssel besaßen. Der Schlüssel wurde ihnen von der jungen Frau mit der Bemerkung überreicht, dass sie sich sicherer fühlte, wenn jemand in ihrer Nähe »abrufbereit zur Verfügung stünde«. Die leicht geschraubte Bemerkung wurde Bircher so durchgegeben, wie sie der ABV in sein Protokollbüchlein eingetragen hatte. Als die Nachbarn versuchten, die Wohnungstür zu öffnen, stellten sie fest, dass auf der anderen Seite ein Schlüssel steckte. Sie klingelten vergeblich und beschlossen dann, den ABV anzurufen.
Bircher war ein stämmiger Mann mit leicht ergrauten, zottelig anmutenden Haaren, die er jedoch, was außer seiner Frau niemand wusste, beim besten Friseur der Stadt pflegen ließ. Er ließ sie sich sogar in ihrem Originalschwarz abtönen, was Außenstehenden angesichts seiner eher uneitlen Erscheinung als ziemlich abwegig erschienen wäre. Hinter einer wuchtigen Hornbrille lagen, verdeckt durch schwere Tränensäcke, graue, seine Umgebung aufmerksam musternde Augen. Er war nach dem Krieg in Thüringen, wo sein Vater Jahrzehnte lang einen Bauernhof bewirtschaftete, aufgewachsen. Später erzählte er gerne nach einigen Gläsern ungarischen Weines, wie er einmal als junger Lehrling mit dem Auto seines Vaters zum Steilhang ihres Gutes gefahren war, um aus dem Seitenfenster Beeren zu pflücken. Als er versonnen ins Tal blickte, dorthin, wo die Lichter der großen Stadt ihm einladend zublinzelten, wunderte er sich, warum sie ihm plötzlich entgegen kamen. In letzter Sekunde riss er die Handbremse und musste Stunden später mit dem Traktor zurück auf den Weg gezogen werden. Die Neugierde, in einer großen Stadt zu wohnen, blieb.
1958 wurde er nach Dresden auf eine Lehrerbildungsanstalt delegiert, die er nach vier Jahren als Biologielehrer verließ. Die Zeit auf dem Land und in der Schule sollte ihn für immer prägen. Ebenso sorgfältig, wie er seinen Lehrstoff durchgegangen war, behandelte er später seine Fälle. Den Lehrerberuf hatte er einige Jahre ausgeübt, aus Liebe zur Biologie und weil er Geld verdienen musste. Erziehung erlebte er nicht als den großen Drang, Charaktere zu formen oder gar andere für sich einzunehmen, daran verschwendete er keinen Gedanken, für ihn hieß es, Wissen zu vermitteln und zu kontrollieren, was davon bei den Kindern zurückblieb.
Er war in seinen Urteilen klar, direkt und unbestechlich. Die Schulleitung schätzte sein überragendes Fachwissen und seinen Fleiß, ein Mangel an pädagogischen Fähigkeiten war allgemein bekannt und wurde achselzuckend hingenommen. Einige Anläufe, ihm erzieherische Feinheiten und psychologisches Geschick im Umgang mit den Schülern näherzubringen, verliefen im Sande. Stur wie ein Bauer beackerte er sein Feld, ihm war nur wichtig, dass die Ernte gut ausfiel. Seine Schüler gewannen dann auch regelmäßig Preise für gute Leistungen.
Es kam der Schulleitung nicht ganz ungelegen, als eines Tages die Genossen von der Bezirksverwaltung nachfragten, ob sie auf Bircher verzichten könnte, falls der Interesse an einer Ausbildung zum Kommissar hätte. Man war auf ihn aufmerksam geworden, nachdem einer seiner Schüler zu Hause dem einflussreichen Vater immer wieder von dem eher ungewöhnlichen Erzieher erzählt hatte.
Der Schuldirektor pries die zweifellos überragenden analytischen Fähigkeiten seines Biologielehrers. So einigte man sich, und Bircher war froh, zukünftig den Erziehungsauftrag durch einen Aufklärungsbefehl ersetzen zu können.
Die dreijährige Ausbildung durchlief er mit glänzenden Noten, nach zwei Jahren in Meißen wurde er 1962 nach Berlin versetzt, ein Jahr nach der »Errichtung des antifaschistischen Schutzwalls«.
Nun lebte Genosse Bircher, inzwischen zum Major befördert, seit Jahren in Berlin. Sein Traum vom Leben in der großen Stadt hatte sich erfüllt.
Seinen weichen thüringischen Dialekt hatte er nicht ablegen können. Er sprach langsam, die Worte schienen sich in seinem Kopf, wie in einem Puzzle-Spiel, zunächst behutsam zu einem Satz formen zu müssen, bevor sie ein Kontrollzentrum hinter seiner Hornbrille, nach eingehender Prüfung, für die Öffentlichkeit freigab. Den Gesprächspartnern in den Lagebesprechungen des Präsidiums wurde einiges an Geduld abverlangt, wenn sie, wie Rennpferde vor dem Startschuss, auf ihren Einsatz warteten, während ihr Chef, scheinbar tief in Gedanken versunken, nach einem Text für seine längst gefällte Entscheidung suchte. Die Sprache habe sich der Sorgfalt seines Denkens unterzuordnen, pflegte er zu sagen.
Die Akribie und Systematik seiner Ermittlungsarbeit waren berühmt. Vorschnelle Schlüsse oder gar Befehle waren ihm fremd, und wer ihm ungenaue oder ungeprüfte Informationen vortrug, musste darauf gefasst sein, Opfer seiner gelegentlichen Wutausbrüche zu werden. Die hatten mit den Jahren zwar merklich nachgelassen, nicht jedoch seine unnachgiebigen und kompromisslosen Ansprüche an die Arbeit seiner Mitarbeiter.
Seit seiner Kindheit gewohnt, sich jeden noch so kleinen Erfolg oder Fortschritt in der Ausbildung und später im Beruf hart zu erarbeiten, hatte er sich in der täglichen Arbeit nie um taktische Vorteile gekümmert, ebenso wenig wie ihn Kaderentwicklungspläne interessierten. Für ihn hieß es, Fakten zu sammeln, Zusammenhänge zu analysieren, den Sachverhalt zu verstehen und das Ergebnis aufzuschreiben.
So, wie er in seinem ersten Beruf mit seinen Schülern durch die Natur streifte, um mit ihnen Beeren, Blumen, Sträucher oder Bäume zu taxieren, in botanische Kategorien einzuteilen und akribisch in Tabellen festzuhalten, durchforstete er jetzt Tatorte nach Spuren, Indizien oder Personen. Er pflegte seiner Frau zu sagen, dass er früher die Geheimnisse in der Botanik zu verstehen suchte, jetzt die Taten der sie bewohnenden Menschen.
Die mit ihm zusammen arbeiteten, bemerkten rasch, dass seine Anforderungen durch nichts zu beeinflussen waren. Wer ihnen nicht standhielt, fiel in Ungnade, wurde ins zweite Glied abgeschoben oder zur Bewährung mit schwierigen Aufgaben bedacht.
Auf diese Weise hatte sich Genosse Bircher im Präsidium eine stattliche Anzahl von Gegnern aufgebaut. Da im bäuerlichen Elternhaus diplomatisches Geschick und Einfühlungsvermögen nicht gefragt gewesen waren – das wäre seinen Eltern so abwegig vorgekommen wie eine Meditation mit ihren Hühnern – stand er seinen taktisch versierten Gegnern häufig relativ hilflos gegenüber. Während die mit ausgeklügelten Verhandlungsstrategien den Sitzungssaal betraten, erschien Bircher ohne Plan, sich nur auf die Überzeugungskraft seiner Fakten verlassend. Wenn er zu Hause mit gepresster Stimme seiner zehn Jahre jüngeren Frau Karola von der Unfähigkeit eines Kollegen berichtete, der nichts richtig wüsste, aber über alles spräche, lächelte sie ihn wie ein störrisches Kind nachsichtig an. Sie war von ähnlicher Intelligenz und Unnachgiebigkeit. Obwohl auch sie sich nicht schonte und von sich, und ihren Mitarbeitern, ständig Höchstleistungen forderte, hatte sie doch ihr Beruf als Dozentin an der Berliner Universität gelehrt, Menschen nicht wie Befehlsempfänger zu behandeln. Mit mäßigem Erfolg bemühte sie sich, ihren barschen Umgangston zu unterdrücken. Ein durchsichtiges Manöver, das ihr nicht immer gelang. Beim Erreichen ihrer Ziele schien sie ihrem Mann, wie eine Schülerin ihrem verehrten Lehrer, hinsichtlich eines gewissen Mangels an Toleranz, Einfühlungsvermögen oder Charme kaum nachzustehen.
Das wesensverwandte Paar verband neben der Sucht nach Erfolg im Beruf eine weitere Leidenschaft, nämlich die Lust auf ein gutes Glas Wein oder einen erlesenen Kognak. Beide Wünsche waren mit dem Angebot im Handel der Republik nur schwer, häufig überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen. Das Sortiment umfasste Weine aus befreundeten Ländern, denen die südliche Lage einen natürlichen Vorteil angedeihen ließ. Das waren dann Sorten aus Ungarn, der Tschechoslowakei oder Bulgarien, deren mehr oder weniger säuerlicher Geschmack eine gemeinsame Produktionsweise verriet.
Die Eheleute Bircher hatten sich über die Jahre ein beträchtliches Literaturwissen über die Grundlagen des Weinanbaus angeeignet, gespeist aus dem Zugang Karolas zur Universitätsbibliothek, die sie nicht nur zum Zweck ihrer Forschung, sondern auch angetrieben durch den Wunsch, die Genüsse eines fabelhaften Weins wenigstens in der Theorie zu begreifen, regelmäßig aufsuchte. Mit der ihr eigenen Gründlichkeit hatte sie die Ergebnisse ihrer stillen Leidenschaft wie ein Önologe protokolliert, in sorgfältigen Kolonnen wurden die Weine den Trauben zugeordnet, die besten Jahrgänge aufgelistet und Anbauflächen mit knappen Daten erläutert, alles nach Ländern, die die Birchers nie würden besuchen können.
Der Geschmack des Tropfens wurde anhand von Gartenfrüchten wie Himbeere, Erdbeere, Apfel, Birne, Haselnuss oder gar Brombeere abgeleitet und notiert. Wenn sie dann am Abend mit geschlossenen Augen und einem Glas bulgarischen Pinot Noir in der Hand versuchten, die Fruchtnote zu erraten, und dazu an einer Himbeere oder einem Apfel lutschten, dann überkam sie der Hauch einer Vorstellung von dem großen Weinen aus Italien oder der Provence. Für einen Moment umnebelte das Aroma des fernen Weines die Phantasie der Birchers, und sie lächelten sich verschwörerisch zu, so als wären sie dem Geheimnis des unbekannten Tropfens auf der Spur.
Kommissar Bircher stand immer noch am Küchenfenster und wartete auf den Fahrer, als sich hinter ihm die Tür öffnete und seine verschlafene Frau barfuß auftauchte.
»Was ist los, hast du Kopfschmerzen?«, drehte sich Bircher besorgt um.
»Nein, obwohl wir die zweite Flasche nicht hätten öffnen dürfen.«
Das war ein nicht seltenes Ritual, sich zu versichern, es zukünftig bei einer Flasche zu belassen. Der Vorsatz hielt in der Regel bis zum nächsten Ärger, den einer der beiden nach Hause brachte und den es zu »verarbeiten« galt. Ein Mangel an Anlässen herrschte nicht.
»Hm, es lag an diesem Weißen aus Ungarn, der hatte zu viel Säure«, monierte Karola.
»Warum besaßen wir noch nie einen einzigen Forumscheck, dann könnten wir uns mal einen kräftigeren Tropfen aus dem Intershopladen in der Friedrichstraße holen, wie unsere Nachbarn, die haben immer den Jacobi 1880 und Asbach Uralt in ihrer Schrankwand zu stehen.«
»Ja, der ist ja auch nicht Major bei der Volkspolizei, sondern Arzt an der Charité, dem schenken das die Patienten. Oder kannst du dir vorstellen, dass sich jemand, den ich eingebuchtet habe, mit einer Flasche Uralt bedankt?«, fragte Karl. »So, und nun muss ich auf die Pirsch, da liegt eine Tote und wartet auf mich«, fügte er lakonisch hinzu.
Karola kramte im Wohnzimmer zwischen den Weingläsern und ihren Weindokumenten auf der Suche nach Zigaretten, als sie hinter sich noch die resignierte Stimme ihres Mannes hörte:
»Nicht schon so früh, warte doch wenigstens bis zum Frühstück!« Ohne Regung griff sich Karola die Packung Semper aus der Aktentasche ihres Mannes und marschierte zum Balkon.
»Wir haben doch vereinbart, dass ich die Zigaretten für dich aufbewahre. Zum Zweck deiner Suchtbehandlung, oder!?«, rief er ihr vorwurfsvoll hinterher.
Unbeeindruckt öffnete Karola die Balkontür und trat ins Freie.
Als er zu ihr auf den Balkon kam, um die Wetterlage zu prüfen, eine alte Gewohnheit aus den Zeiten, da er noch im Dorf lebte und das Heu rechtzeitig vor dem Regen einfahren musste, sah Bircher den Fahrer neben dem Wagen stehen. Er winkte ihm zu und lief zur Garderobe.
»Also, tschüss dann, bis heute Abend!«, rief er, die Türklinke in der Hand, seiner Frau zu und verließ die Wohnung.
Karola drückte die halbe Zigarette aus und begab sich in die Küche. Dort befand sich ihr Büchlein mit den Kreuzworträtseln, eine andere Sucht, der sie sich jeden Tag, bevor sie das Haus verließ, hingab. Nicht nur faszinierte sie der Anblick der kleinen leeren Kästchen, wie sie sich unter dem Druck ihres Bleistiftes allmählich mit Buchstaben füllten, bis sie aneinandergereiht den gesuchten Sinn herstellten, sie begeisterte auch, wie sich aus der Mitte des Buchstabengetümmels, wie eine Erleuchtung, ein neues Wort abzweigte oder sich quer durch die Spalte ein anderes schob, das wiederum den Hinweis für einen neuen Begriff in sich trug, bis schließlich alle Felder durch Worte vernetzt waren.
Karola hatte sich im Studium, schon damals löste sie Kreuzworträtsel, nebenbei mit Kombinatorik beschäftigt. Das Kreuzwortfeld hatte sie Jahre später zum Entsetzen ihres Mannes plötzlich auf die verrückte Idee gebracht, die Zahl der möglichen Buchstabenkombinationen von A bis Z unter der Bedingung zu errechnen, dass auf dem neunzig Kästchen umfassenden Feld derselbe Buchstabe maximal zweimal vorkommt.
Nach einigen Wochen, achtzig Päckchen Semper und zehn verpassten Seminaren beschloss sie, dass die Aufgabenstellung unlösbar sei, und beendete das Projekt.
Aber die Neigung zur Kombinatorik blieb erhalten, neu angestachelt durch Karl, der seiner Frau eines Abends beim Wein erzählte, dass selbst der von ihnen verehrte Komponist Johann Sebastian Bach dem Mythos der Zahlen verfallen gewesen sein soll. So habe er sich mit Hilfe der Zahl Vierzehn in seinen Werken selbst verewigt. Die Buchstaben BACH stehen nämlich im Alphabet an zweiter, erster, dritter und achter Stelle. Addiert man diese Zahlen, so ergibt sich Vierzehn, wie die erste Fuge des »Wohltemperierten Klaviers«, die aus vierzehn Tönen besteht. »Blödsinn«, war alles, was seine Frau dazu sagte.
Dessen ungeachtet suchte das phantasiebegabte und immer auf Entdeckungssuche befindliche Ehepaar gemeinsam nach weiteren Symbolen. Der aus katholischem Elternhaus stammende Bircher fand heraus, dass der Kreuzweg traditionell aus vierzehn Stationen besteht. Die katholische Kirche kennt die vierzehn Nothelfer, vierzehn Heilige, die in bestimmten Notlagen angerufen werden. Ihnen sind zahlreiche Kirchen geweiht, unter ihnen die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen in Oberfranken, nach der auch der umliegende Ort benannt wurde. Der griechischen Göttin Hera dienten vierzehn Gefährtinnen, von denen ihre Botin Iris die bekannteste war. Als sie schließlich nachlasen, dass es vierzehn Frauen seien, von denen die hebräische Bibel sagt, sie wären schön gewesen, gaben sie das Thema wegen mangelnder innerer Logik auf.
»Schließlich wird man mit vierzehn juristisch vom Kind zum Jugendlichen«, murrte Karl und was das solle, man könne ja noch Hunderte Beispiele mystisch aufblähen.
Einen Tag später und nach einer Flasche Meißener Weißwein, den der Nachbar dem Kommissar vor Wochen – da er herauszuhören glaubte, aus welcher Gegend dieser stammte – auf dem Korridor augenzwinkernd mit dem Hinweis in die Hand drückte, dass er es nicht als Einflussnahme auf laufende Ermittlungen verstehen solle, grinste Karola ihrem sichtlich entspannten Gatten zu:
»Ich hab noch was gefunden. Vierundzwanzig – das mag einen an ein einfaches Kreuzspiel beim Skat erinnern – doch Vierundzwanzig ist noch viel mehr. Die Quersumme dieser Zahl ist sechs, und sechs ist zwei mal drei. Und zwei hoch drei ist acht und das mal drei ist schon wieder vierundzwanzig. Immer ist alles vierundzwanzig. Zwei Apostelmannschaften sind vierundzwanzig, vierundzwanzig Päpste sind dreiundzwanzig zu viel, auf dem vierundzwanzigsten nördlichen Längen- und Breitengrad liegt die Kufra-Oase und auf dem vierundzwanzigsten südlichen Längen- und Breitengrad liegt die Kalahari-Wüste. Doch es gibt eine Sache, welche mehr und mehr in Vergessenheit gerät: Heiligabend – immer am vierundzwanzigsten!«
Ihr Mann blickte sie, noch den Geschmack des unverkäuflichen einheimischen Weißweins nachspürend, zweifelnd an.
»Jetzt reicht es mit den Spinnereien, oder ich versetze dich zur Strafe in mein Ermittlungsteam.«
Damit war der Ausflug in die geheime Welt der Zahlen beendet.
Beide ahnten nicht, dass es nur eine vorübergehende Unterbrechung werden sollte. Schreckliche Ereignisse würden sie vor der Weihnachtszeit zwingen, sich erneut mit dem Mythos der Zahlen zu beschäftigen.
2
Bircher drückte auf die Erdgeschosstaste, und während die Kabine nach unten schwebte, sann er darüber nach, was wohl seine Frau bewegte, sich immer wieder mit Zahlenreihen und ihren Auslegungen zu beschäftigen. Na ja, das ist eben ihr Forschergeist, der hinter allen Fakten eine Ursache vermutet, und falls es sie geben sollte, eine Erklärung sucht. Geht mir ja ähnlich, dachte er sich, mit meinem Hang, Ursachen von Handlungen zu ergründen.
Bircher knöpfte sich den weiten Mantel zu und ging langsam, in leicht gebücktem Gang, auf den Wagen zu. Der Mantel schlägt leichte Bauchfalten, stellte er missmutig fest. Seine kulinarischen Neigungen hatten die charakteristischen Verwerfungen hinterlassen, gegerbte schwere Augenränder und mit leichten Flecken besprenkelte Hautpartien, die schlaffe Falten schlugen, besonders nach schwierigen Nächten. Bircher seufzte leicht und beschleunigte seinen Schritt.
»Guten Morgen, Genosse Major!«, begrüßte ihn der Fahrer.
»Morgen, wo geht es hin?«, erwiderte Bircher mit müder Stimme.
»Es geht nach Marzahn in die Flunkerstraße 30«, entgegnete der Fahrer knapp.
»Na, dann man los zur Leichenschau!«, murmelte Bircher.
Der Wartburg Kombi knatterte die Leninallee entlang, stadtauswärts nach Marzahn-Dorf, wie der Stadtteil ungewollt ironisch hieß. Er unterschied sich vom Rest des Bezirks lediglich durch einige ältere Häuser, die man hatte stehen lassen, wahrscheinlich, um von den geplanten öden Häuserschluchten abzulenken.
»Hier muss es sein, Nummer 30«, meldete der Fahrer. »Sie müssen auf die fünfte Etage, Genosse Major«, fügte er hinzu, während sich Bircher leise ächzend aus dem Auto schob.
Vor der Wohnung der Toten stand mit hochrotem Kopf der Abschnittsbevollmächtigte. Wahrscheinlich wurde er noch nie zu einer Toten gerufen. Am Klingelknopf las Bircher den Namen Klaudia Fichtner.
»Also, Genosse, äh, wie ist Ihr Name?«
»Martin, Genosse Kommissar«, meldete der zackig, wie bei einer Parade.
»So, dann berichten Sie mal, was vorgefallen ist!«
»Ich wurde gegen Mitternacht von den Nachbarn geweckt, die mich auf die unklare Situation im Wohnbereich der Bürgerin Fichtner hinwiesen«, begann er umständlich.
»Die Wohnungsnachbarn, also, ich meine die beiden Genossen Marjela, hatten nämlich einen Schlüssel von der Toten und wollten in die Wohnung, nachdem ihnen der volle Briefkasten aufgefallen war. Den leerten sie nämlich immer dann, wenn die Nachbarin unterwegs war. Dieses Mal hatte die junge Frau aber nicht darum gebeten, woraus sie schlossen, dass sie zu Hause sein müsste. Das kam den Genossen Marjela also komisch vor, der volle Briefkasten und so, auch, dass Sie nichts hörten, nicht mal ihre Musik, kriegt man ja sonst alles hier mit, durch die Platte.«
Letztere Bemerkung seines Vortrages, der sich anhörte, als hätte ihn der ABV während der Anfahrt des Kommissars geübt, konnte Bircher aus eigener Erfahrung bestätigen.
»Wir haben dann den Hausmeister geweckt und der hat bestätigt, dass innen ein Schlüssel stecken muss. Ich habe daraufhin angeordnet, das Schloss auszubauen. Vorher habe ich natürlich mehrmals geklingelt. Ja, dann bin ich also allein rein und habe die Frau regungslos im Bett vorgefunden«, beendete der ABV seinen Bericht.
»Gut. Haben Sie etwas angefasst?«, fragte Bircher ruhig.
»Nein, nichts, habe mich nur bis zur Toten begeben, ich bin dann wieder raus zum Genossen Marjela, und von seiner Wohnung aus habe ich die Dienststelle angerufen. Seitdem stehe ich hier vor der Wohnungstür.«
»Sehr gut, alles richtig gemacht«, beruhigte Bircher den sichtlich aufgeregten ABV, der noch immer mit hochrotem Kopf stramm vor ihm stand.
Bircher ging langsam durch die Wohnung, zwei Zimmer, ein fensterloses Bad und eine kleine Küchennische, die über einer Art Tresen mit dem Wohnzimmer verbunden war, fast wie bei ihm zu Hause, stellte er fest. Die Wohnung war einfach und praktisch eingerichtet. Die Tote war offensichtlich in ihren Ansprüchen bescheiden, aber das Wenige war geschmackvoll gewählt. Bircher ging weiter in das Schlafzimmer.
Zugedeckt lag vor ihm, in einem schmalen Bett, eine junge Frau, bis zum Kinn bedeckt mit einem weißen Laken, auf den ersten Blick könnte man meinen, hier schliefe friedlich ein Kind. Bircher beugte sich vornüber und zog vorsichtig die Decke von der Schulter hinunter zu ihren Füßen. Sie trug ein leichtes Nachthemd, das bis knapp über die Oberschenkel reichte, beide Hände ruhten entspannt auf ihrem flachen Bauch. Die Füße waren nach innen gerichtet, als wollten sich ihre beiden großen Zehen spielerisch berühren, aus ihrem ruhigen Gesicht starrten aufgerissene Augen zur Fensterseite, als hätte sie versucht, noch rasch jemandem etwas Wichtiges mitzuteilen.
In der Toten fehlt die Spannung, wie ich sie von plötzlich Verstorbenen kenne, grübelte Bircher. Es sieht fast so aus, als würde der jungen Frau selbst im Tod ihre lässige Anmut nicht verloren gegangen sein. Die scheinbare Harmonie wurde nur durch die nach innen verdrehten Füße, und die irgendwohin nach außen weisenden, leblosen Augen beeinträchtigt.
Als wäre sie kurz vor dem Einschlafen durch die Mitteilung überrascht worden, dass es ihr letzter Schlaf sei, und sich vergeblich bemüht hätte, eine Botschaft zu hinterlassen. Keinerlei Anzeichen von Gewalt.
Inzwischen war die Spurenkommission eingetroffen und Bircher begab sich in das kleine Wohnzimmer mit der angrenzenden Küchendurchreiche, das auch als Esszimmer diente. Auf dem Couchtisch lagen einige Zeitungen, alles machte einen sehr aufgeräumten Eindruck, kein Geschirr, keine Post oder Reste vom Abendessen. Bircher öffnete die Schubladen einer Kommode. Hier lagen, säuberlich geordnet, Briefe, Kontoauszüge, Ansichtskarten und Photoalben, auch ein Blutspendeausweis mit den Abnahmeterminen fand sich in den Unterlagen. Er steckte den Ausweis in seine Jackentasche, um ihn dem Gerichtsmediziner zu zeigen, vielleicht konnte der was damit anfangen.
Bircher blätterte in den Briefen von Freunden und in nichtssagenden Urlaubskarten. Zwei begannen mit der Anrede »Liebe Tochter« und endeten mit »Liebe Grüße, Dein Papa«. Bircher fiel ein, dass er die Nachbarn nicht nach den Eltern befragt hatte.
Er verließ die Wohnung und stieß auf den ABV.
»Haben Sie nach den Eltern oder Verwandten gefragt, die zu benachrichtigen wären?«
»Ja, habe ich gleich erfragt, aber der Familie Marjela war lediglich einige Male ihr Vater flüchtig im Hausflur begegnet. Die Mutter muss wohl schon vor längerer Zeit gestorben sein. Ansonsten lebte Klaudia eher zurückgezogen, für ihr Alter ziemlich ruhig. Keine Partys oder so, wohl auch kein fester Freund. Sie war bei einer Sparkasse beschäftigt.«
»Kam der Vater regelmäßig zu Besuch?«, fragte Bircher Herrn Marjela, der auf der Treppe wartete.
»Eher nicht. Was mir noch einfällt, die Klaudia hatte ein schwaches Herz, die musste irgendwelche Tabletten nehmen.«
»Ja, Genosse Major, das passt, wir haben im Bad ein ziemliches Arsenal an Medikamenten gefunden, das müsste sich dann noch die Gerichtsmedizin ansehen«, fügte der Kollege der Spurenkommission hinzu, den Bircher zwar kannte, an dessen Namen er sich jedoch in diesem Moment nicht erinnerte.
Warum ist denn der Schmidter eigentlich nicht hier?, fragte er sich, der merkt sich doch jedes Detail und kennt das ganze Präsidium beim Namen. Leutnant Schmidter war einer der Mitarbeiter Birchers, und gewöhnlich begleitete er seinen Chef bei Delikten, die eher weniger schwerwiegend erschienen und die er dann eigenständig weiterzubearbeiten hatte.
»Gut, haben Sie etwas festgestellt, dass auf eine Straftat hinweist?«, wandte sich Bircher dem Kollegen der Technik zu und schluckte die Frage nach seinem Namen hinunter, ohnehin gab es hier augenscheinlich nicht mehr viel für ihn zu tun.
»Nein, wir haben keinen Hinweis auf die Anwesenheit dritter Personen und schon gar nicht auf die Anwendung von Gewalt, also keine Spuren eines Kampfes oder einer physischen Auseinandersetzung. Gift oder medikamentöse Einwirkung kann ich nicht ausschließen.«
»So, dann überlassen wir zunächst mal die Tote unserem Gerichtsmediziner, er wird ja gleich eintrudeln«, schloss Bircher das Gespräch und fragte sich, ob die im Präsidium wohl das Nötige veranlasst hätten.
Abgelenkt durch das plötzliche Auftauchen seiner Frau und ihrem unerwarteten Griff zur Zigarette, ein klarer Rückfall zu frühmorgendlicher Stunde, erinnerte er sich nochmals missmutig, hatte er versäumt, vom Auto aus im Präsidium nachzufragen, welche weiteren Maßnahmen eingeleitet worden waren.
Er wandte sich dem Fahrstuhl zu und drückte die Taste, um ins Erdgeschoss zum Einsatzwagen zu fahren, per Funktelefon Kontakt zum Präsidium aufzunehmen und nach dem Gerichtsmediziner zu fragen. Sobald der hier wäre und eine natürliche Todesursache festgestellt hätte, würde er den Sesselfurzern, die ihn hierher getrieben hatten, den Marsch blasen. Außerdem könnte er gleich noch rauskriegen, warum eigentlich nicht einer seiner Mitarbeiter zur friedlich verstorbenen Klaudia gerufen worden war.
Auf dem Weg zum Polizeiwagen stieß er, in Gedanken versunken, beinahe mit Professor Tetsche zusammen.
»Morgen Karl, du löst wohl deine Fälle im Schlaf«, flachste Tetsche und reichte ihm seine Hand, die sich wie ein warmes Brötchen anfühlte.
»Tag Wolfgang, auch schon hier, die Tote wird langsam ungeduldig, will endlich wissen, warum sie uns verlassen musste«, brummte Bircher.
Sie waren fast gleichaltrig und über die Jahre und die Fälle hatte sich zwischen ihnen eine freundschaftliche Beziehung entwickelt. Tetsche hielt sich stets, ähnlich Bircher, etwas nach vorn gebeugt auf den Beinen, und wenn er mit kurzen schnellen Schritten die Straße entlanglief, den Kopf leicht nach unten geneigt, sah man eigentlich nur die Bewegung seiner Beine, während ihm sein Körper scheinbar unbeweglich folgte. In der rechten Hand hielt er gewöhnlich eine Zigarette, die er manchmal zu vergessen schien, erst wenn sich die Glut bereits in den Filter fraß, suchte er schließlich einen Aschenbecher. Auch bei Zetsche hatte der regelmäßige Genuss nach Feierabend seine Spuren hinterlassen, wie nach einem scharfen Wüstensturm kerbten Furchen das Antlitz des Professors. In merkwürdigem Kontrast zu seiner stets hellrötlichen Gesichtsfarbe, die seine Gesichtszüge wie eine auflockernde Patina bedeckte, musterten müde wirkende braune Augen scheinbar gleichgültig die Umgebung. Durch seine wie aufgeblasen wirkenden Wangen zogen sich zwei Kerben, die entlang der Nase steil bis zu den Mundwinkeln verliefen. Er sprach in einem leicht thüringischen Dialekt und neigte stark zum Nuscheln, wobei sich an den Rändern des halb offenen Munds etwas Speichel ansammelte, wie bei einem lechzenden Pudel.
Tetsche arbeitete hauptberuflich am Gerichtsmedizinischen Institut der Charité in Berlin. Von der Neigung her eher ein feinsinniger, empfindsamer Grübler und zögerlicher Mensch, der jede freie Minute an seinem Flügel mit der Einstudierung von Passagen Bachs »Wohltemperiertes Klavier« verbrachte, oder seine Orchideensammlung sortierte, erschien er Außenstehenden alles andere als ein Tatmensch, man würde ihn eher einem Kunstverein zuordnen. Es war einer der vielen Widersprüchlichkeiten seines Charakters, dass ihn im Grunde seiner Seele der Wunsch nach Bestätigung und Autorität umtrieb. Seine bei offiziellen Anlässen häufig abwartende Haltung, seine sich schier endlos hinziehenden Abwägungen, und auch mangelnde Menschenkenntnisse, hatten ihm den ganz großen Aufstieg verwehrt. Wenn es jedoch vor Ort um ein schnelles Fachurteil ging, wartete er mit unerwartetem Tempo und großer Präzision auf.
Bircher und Tetsche standen sich charakterlich eher nahe. Mit Gleichmut beobachteten beide die von Langweile und Monotonie gekennzeichneten Lebensgewohnheiten mancher ihrer Mitmenschen, ohne je ein Wort darüber zu verlieren. Beiden war es im Grunde ihres Herzens egal, was andere trieben, solange sie es auf einem anderen Spielfeld taten. Gelassen beobachteten sie aus dem Augenwinkel die Lage. Auf dem von ihnen zu bestellenden Acker bestimmten sie die Regeln. Mancher Kollege hielt die beiden für überheblich, was nicht zutraf, sie umgaben sich mit einer Aura des diskreten Beobachters, über Gefühle und Mutmaßungen äußerten sie sich nicht – Arroganz, nein, die war ihnen gänzlich fremd.
»Na, hör mal, mitten in der Nacht rufen die mich an und können mir nichts weiter sagen, als dass du schon am Tatort seiest, als wäre das Grund genug, mich zu wecken«, nuschelte Wolfgang und folgte dem Kommissar in das Haus.
»Ja, mein Lieber, kannst sicher gleich zurück zu deinen Sonaten. Es sieht hier nicht nach Mord und Totschlag aus«, erwiderte Bircher mit leichtem Lächeln.
»Macht die Sache dann gänzlich unsinnig, mich hierher zu bestellen. Soll ich vielleicht zukünftig an jeder Beerdigung teilnehmen, ist es das, was ihr vorhabt?«
»Warum nicht, dann aber als Kirchenmusiker, wäre doch was, Genosse Professor.«
Bircher blickte ihn von der Seite an, als sie den Fahrstuhl betraten, und dachte bei sich, ob sich sein Kollege wohl auch am Flügel nicht von seiner qualmenden Zigarette trennen würde. Ihm fiel ein, dass Tetsche, wie auch seine eigene Frau, in der Wohnung nicht rauchen durfte. Tetsches um einige Jahre jüngere Frau, mit ihm in zweiter Ehe verheiratet, würde glatt das Klavier in den Hof schieben. Sie hatte mehrfach gegenüber Bircher angedeutet, dass sie sich wegen der Gesundheit ihres Mannes ernsthafte Sorgen machte. Der skeptische Bircher meinte aus ihren Worten die Sorge herauszuhören, als jung zurückgelassene Witwe den Professorenhaushalt aufgeben zu müssen.
»So, hier wären wir, lass dir die Tote zeigen«, bat ihn Bircher.
»Wie alt ist die Dame, die uns um den Schlaf gebracht hat?«, fragte Tetsche, während er rasch am ABV vorbei in die Wohnung huschte, als erwarte ihn dort eine angenehme Überraschung.
»Um die zwanzig, muss nochmals in den Personalausweis schauen, falls ich ihn finde«, entschuldigte sich Bircher.
Tetsche streifte sich bereits die Handschuhe über und betrachtete die junge Frau, die unverändert den Eindruck erweckte, urplötzlich in den Schlaf versetzt worden zu sein. Er dreht ihren Kopf zur Seite, betrachtete sorgfältig den weißen Hals, streifte dann die Decken ab, um den Körper bis hinab zu den Fußspitzen zu inspizieren. Es dauerte nicht länger als zwei Minuten, bis er sich abrupt aufrichtete und zu Bircher, der hinter ihm stand, murmelte:
»Ja, also auf den ersten Blick keine Fremdeinwirkung von außen, Würgemerkmale oder Ähnliches. Gift, möglich, aber eher unwahrscheinlich. Kann aber ohne Obduktion nichts Endgültiges sagen. Habt ihr Hinweise auf eine Krankheit mit möglicher natürlicher Todesfolge?«
»Nee, wie kommst du darauf? Obwohl, sie hat ’ne halbe Apotheke im Bad.«
»Ich frage, weil die erweiterte Halsvene, und hier«, Tetsche wies auf die Füße der Toten, »diese Wassereinlagerungen an beiden Füßen könnten auf Herzversagen hinweisen.«
»Komm, ich zeige dir die Medikamente!«, rief ihm Bircher zu, der bereits zum Bad ging.
»Ja, die Sammlung deutet klar auf eine Herzerkrankung hin. Betablocker, Calciumantagonisten, Digitalis, hm, könnte sogar eine Kardiomyopathie sein, und die kann im ungünstigsten Fall zum Exitus führen, selbst bei einer so jungen Person«, erklärte Tetsche.
»Endgültiges kann ich dir nach einer Obduktion sagen, wenn du mir die Genehmigung besorgst«, fügte er hinzu und begab sich freundlich nickend, als wäre für ihn die Angelegenheit erledigt, zur Haustür.
»Warte, ich nehme dich mit, den Rest können die Kollegen erledigen. Wann kann ich mit deinem Bericht rechnen?«, fragte Bircher mehr aus Gewohnheit.
»Kriegst du wahrscheinlich morgen gegen neunzehn Uhr, falls ich obduziere«, nuschelte Tetsche, eine Zigarette zwischen den Lippen, nach seinen Streichhölzern kramend.
Die beiden bewegten sich schweigend zum Ausgang. Als sie den Wagen erreichten, befahl Bircher dem Fahrer, ihn mit dem Präsidium zu verbinden. Während der Fahrer den Sprechfunk bediente, fuhr hinter ihnen ein Auto vor.
Bircher drehte sich um und lächelte Tetsche spöttisch zu:
»Na, so was, mein Mitarbeiter, da kommt zum krönenden Abschluss Oberleutnant Angler. Der kennt immer schon den Täter, selbst wenn das Opfer fehlt«, meinte Bircher, sichtlich verärgert über das verspätete Erscheinen seines Stellvertreters.
Aus dem Trabbi kroch Angler, hochgewachsen, mit etwa einem Meter fünfundachtzig überragte er seinen Chef deutlich, mit rotem Kopf, ein Ulbricht-Bärtchen um Kinn und Oberlippe. Angler sah man sein Alter nicht an, und Bircher vermutete, dass der Bart ihm Alter und Autorität verleihen sollte. Angler stand ungerührt vor ihnen, seine selbstbewusste Miene drückte aus: Hier bin ich, stehe zur Verfügung, bereit und fähig, die offenen Fragen zu klären, man soll sich mir nur anvertrauen. Bircher hatte einmal bissig bemerkt, dass er über alle Voraussetzungen eines vorauseilenden Propheten verfüge.
Angler war seit vielen Jahren sein Stellvertreter. Die beiden unterschieden sich in fast jeder Hinsicht, und manch Außenstehender fragte sich mitunter ungläubig, wie sie wohl jeden Tag miteinander auskommen könnten. Wahrscheinlich weil sie von ihren Fähigkeiten so sehr überzeugt waren, dass sie den anderen mitunter nur noch als Bestätigung der eigenen Vollkommenheit benötigten. Während Bircher emotionslos die Besessenheit und filigrane Ermittlungstechnik seines Stellvertreters zur Kenntnis nahm und ähnlich einem aufmerksamen Bahnwärter, der jeden Tag routiniert die Pünktlichkeit der Züge notiert, die Berichte seines Mitarbeiters kommentarlos entgegennahm, hoffte Angler, ungeachtet seines Selbstbewusstseins, immer auf eine Anerkennung seines Fahrdienstleiters.
Angler wurde im Kreis der Kollegen geschätzt. Schließlich war er fleißig und erfolgreich, verfügte zudem über eine Allgemeinbildung, um die ihn mancher im Präsidium heimlich beneidete. Im Unterschied zu Bircher entstammte er einem sogenannten bürgerlichen Elternhaus, jedenfalls konnte er bei der Pflichtfrage im Studienantrag »nach der elterlichen Herkunft« nicht das förderliche »Arbeiter« eintragen.
Sein Vater war ein weltgewandter Arzt, der es liebte, Bücher und Kunst um sich zu scharen, und der höchst selten über seinen Beruf sprach, der ihm eher als notwendiges Übel zur Absicherung seiner Lebensansprüche diente. Als müsste der Sohn die vom lebenslustigen Vater vernachlässigten beruflichen Pflichten kompensieren, bemühte sich Oberleutnant Angler, stets und überall an der Spitze zu sein. Manchmal erweckte er den Eindruck, als säße ihm sein Vater im Nacken, ihn neckend, es doch mal ruhiger angehen zu lassen, was seinen Sohn nur noch mehr antrieb, so als müsste er den Alten abschütteln.
Wenn Angler berichtete, ging er konzentriert wie ein Seiltänzer vor, immer darauf achtend, dass keines seiner vorgebrachten Argumente ins Leere abstürzte. Seine einzige Schwäche bestand darin, dass er sich nicht kurz fassen konnte. Irgendwann schritt Bircher gewöhnlich ein und verkündete mit ironischem Unterton, dass Genosse Angler ausnahmsweise in fast allen Punkten recht hätte, er ihm für die knappen Ausführungen danke und sich nun gestatte, die notwendigen Weisungen zu erteilen, worauf Angler misstrauisch in die Runde blickte. Für die feine Ironie seines Chefs hatte er kein Ohr.
Ein ungleiches Paar: der, bis auf seine gelegentlichen Wutanfälle, bäuerisch behäbige, verschlossene und wortkarge Bircher und sein vor Tatendrang stets berstender Stellvertreter.
»Guten Morgen!«, trompetete Angler in die Nacht.
»Morjen, na Philipp, was treibt dich denn noch hierher, so kurz vor Abschluss unserer Ermittlungen?«, sprach Bircher mehr in sich hinein.
Angler, stramm vor ihm aufgebaut, hatte sehr wohl die Bemerkung aufgeschnappt und trat auch prompt in die Falle.
»Ich wurde hierher befohlen, Anruf vor einer Stunde, leider war die Batterie von meinem Trabbi runter, musste also etwas nachhelfen, tut mir leid, wenn ich nichts zur Aufklärung beitragen konnte«, erwiderte er sichtlich enttäuscht.
»Na, mal sehen, wir müssen ja noch abwarten, was unser Medizinalrat aus der Toten rausholt«, lenkte Bircher ein und begann seinem Mitarbeiter in kurzen Sätzen den Fall zu erläutern. Dann wandte er sich an Tetsche:
»Wolfgang, bevor ich es vergesse, hier ist noch der Blutspendeausweis der Toten, wollte ich dir zeigen, sag mal, können eigentlich Herzkranke so ohne weiteres spenden?«
»Ja, warum nicht, erfolgt doch unter ärztlicher Aufsicht. Sie muss ja nicht literweise Blut lassen. Hm, AB, sehr seltene Blutgruppe«, fügte er eher gleichgültig hinzu, während er den Ausweis an Bircher zurückreichte.
»Du, Philipp, telefonierst dann morgen mit dem Professor und bringst den Fall zu Ende«, rief Bircher Angler zu, fasste Tetsche am Arm und schob ihn zum Auto, wo beide kurz darauf vor dem ihnen verdutzt hinterherschauenden Angler im Fond des Wagens verschwanden. Für Bircher war der Fall erledigt, kein Fremdverschulden, schließlich irrte sich Tetsche nie.
Als Bircher nach Hause kam, war es zum Ausschlafen zu spät und zum Wachbleiben zu früh. Trotzdem schlich er sich in sein Bett, las mit der kleinen Leselampe noch einige Seiten aus der Biographie Albert Einsteins und sank irgendwann, gerade als er sich vorstellen wollte, wie es wäre, auf den Spuren des Genies um Potsdam zu segeln, wie ein Stein im Wasser in den Schlaf.
3
4. Oktober 1975, halb acht Uhr.
Polizeivizepräsident Generalmajor Meier griff zum Telefon und wählte die Privatnummer Birchers. Die beiden kannten sich seit den Zeiten der Polizeischule, als Bircher Meier in der Rolle des Dozenten begegnet war. Meier hatte ihn nie aus den Augen verloren und seinen Werdegang aufmerksam verfolgt.
Auch die Versetzung Birchers nach Berlin hatte er gefördert, nicht ganz ohne Eigennutz, denn jeder aufgeklärte Fall diente seiner Karriere, und die unbestechliche Ermittlungstechnik Birchers hatte sich herumgesprochen. Es gab damals nicht so viele herausragende Köpfe in der Polizei. Die Eigenheiten des introvertierten Kommissars und seine nicht ganz der sozialistischen Schule entsprechenden Verhaltensweisen übersah Meier, wenn auch stirnrunzelnd, geflissentlich. Schließlich hatte man Bircher ja nicht das Amt des Rektors der Polizeiakademie anvertraut.
Im Unterschied zu Bircher war Meier kein Geschöpf des Polizeidienstes, sondern des Apparates. Seine Karriere war in den getäfelten Räumen der Parteiführung sorgfältig geplant worden. Es hieß, einen zuverlässigen und ergebenen Genossen, einen Vertrauten, an geeigneter Stelle zu platzieren. Meier war sich seines Rückhalts und Einflusses bewusst und ließ es seine Umgebung, wenn erforderlich, spüren. Lief es nicht wie gewünscht, wandte er sich mit geschlitzten Augen an seine Genossen, um in stets ruhigem Tonfall zu warnen. In sibyllinischen Wahrsagungen verschlüsselt, rieselte seine Botschaft wie Eiswasser auf die Mitarbeiter, um schließlich mit erkalteter Stimme Ungnade anzudeuten. Immer gepflegt im Auftritt, beherrscht bis zu den Haarwurzeln und konzentriert wie ein Schachgroßmeister, schien ihn eine Aura überirdischer Weisheit zu umgeben, ein perfekter Gesandter seiner Glaubensbrüder.
Bircher nahm den Hörer ab, und als hätte man ihm einen Stromstoß versetzt, saß er hellwach auf dem Stuhlrand. Der ruhige Bariton Meiers erinnerte ihn ein wenig an den eines Richters aus altrömischer Zeit, der regungslos ein Urteil verliest. Meier hatte ihn in den vergangenen fünfzehn Jahren nur dreimal zu Hause angerufen, und immer war der Anlass außerordentlich brisant gewesen.
»Hier ist Horst. Guten Morgen, noch nicht im Dienst?«, versuchte der General zu scherzen.
»Ich weiß, du hast heute frei, aber leider erstreckt sich dein Urlaub nur auf den Morgenkaffee. Du wirst gleich abgeholt.«
»Was verschafft mir die Ehre dieses morgendlichen Aufrufes?«, parierte Bircher, der sich noch bemühte, den Traum der letzten Nacht zu rekonstruieren.
Er war sehr spät eingeschlafen und hatte bis gegen vier Uhr in der Früh wach gelegen. Schließlich holte ihn die Müdigkeit ein und beendete seine Grübeleien. Irgendetwas märchenhaft Anmutendes hatte seinen Schlaf begleitet. Er hatte geträumt, dass man ihn und andere Kinder in einem Schulhof gefangen hielt. Die Lehrer standen auf einer Art Brüstung, von der herab sie den Kindern über Megaphone Befehle erteilten.
In dem Moment, als Bircher sich an den Inhalt der Anweisungen und den weiteren Verlauf der Veranstaltung zu erinnern versuchte, klingelte das Telefon.
»Ein Mord, im Hochhaus, und zwar im Hochhaus am Strausberger Platz.« Meier holte kurz Luft und fuhr fort: »Der Wagen ist bereits unterwegs, in einigen Minuten wirst du abgeholt, wir brauchen volle Truppenstärke.«
»Nun sag mir noch in zwei Sätzen, warum du dich einschalten musstest, ist der Tote eine besondere Person?«
»Es ist eine tote Frau, keine Berühmtheit, aber immerhin die Frau eines Parteifunktionärs aus der Bezirksleitung. Tja, und das Haus, das ist ein Fall für sich. Dort wohnen tatsächlich einige wichtige Personen, auch prominente Persönlichkeiten. Wir wollen deren Namen nicht morgen im Rias hören. Also, zur Besprechung bitte bei mir, wenn du nachher im Präsidium bist. Mach’s gut!«, schloss er und legte auf.
Der zivile Polizeiwagen fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht die Strecke von Birchers Wohnhaus zum Strausberger Platz, umkurvte den Springbrunnen, bog in die Karl-Marx-Allee ein, überquerte den Mittelstreifen und hielt mit quietschenden Bremsen vor dem hohen Eingangsportal.
»Da sind wir bereits, Genosse Major«, verkündete der Fahrer.
»Na, was sollte denn diese Tour um den Springbrunnen, sind doch nicht auf dem Sachsenring, zurück gehe ich zu Fuß«, raunzte Bircher.
»Entschuldigung, Genosse Major, ist ein brandneuer Lada, Viertakter, 65 PS, geht doch ab wie die Post, äh, meine, wie die Feuerwehr«, stotterte der Polizist.
»Schon gut, pflege ihn schön und übe künftig ohne mich«, ächzte Bircher und stieg aus.
Vor dem Hauseingang standen seine Mitarbeiter Angler und Schmidter, und für einen Moment überlegte Bircher, wann er wohl zum letzten Mal mit der gesamten Abteilung der Mordkommission am Tatort erschienen war. Muss ja ziemlich brisant sein, wenn Meier persönlich zum Ausrücken bläst. Wahrscheinlich gab es Weisungen von weiter oben, dachte sich Bircher, als er seinen Kollegen entgegen trat.
Schmidter war erst vor zwei Jahren in die Mordkommission versetzt worden, nachdem er fast zehn Jahre bei der Zollfahndung gearbeitet hatte. Er war, wie Angler, hoch aufgeschossen, aber von schlankerer Statur und in seinem Auftreten deutlich bedächtiger. Selbst wenn sich um ihn herum alle anderen in hitzigen Debatten aufzureiben drohten, blieb er gelassen und wartete geduldig, bis er um seine Meinung gebeten wurde. Die trug er dann langsam vor, jedes Wort abwägend, seine Gesprächspartner aufmerksam musternd, darauf bedacht, vorschnelle Schlüsse zu vermeiden. Er liebte es, die Fakten akribisch zu sortieren, wesentliche Merkmale eines Falles herauszuarbeiten, Tatabläufe gedanklich zu rekonstruieren und verschiedene Lösungsvarianten vorzutragen. Die Schlussfolgerungen überließ er seinen Vorgesetzten. Man musste ihn schon drängen, bevor er seine eigene Meinung darlegte. Dann blickte er freundlich durch seine randlose Brille, so, als würde er ergründen wollen, ob man tatsächlich seine Meinung erfragen wollte oder ob es nicht reichen würde, wenn er ihnen die Fakten liefere.
Da war sein Kollege Angler aus anderem Holz geschnitzt. Es drängte ihn stets in die erste Reihe, nach vorn, an die Rampe, wie einen klein gewachsenen Schauspieler, der fürchtete, auf der Bühne übersehen zu werden.
Bircher schätzte Schmidters Umsicht und Zurückhaltung, der Umgang mit ihm war weniger anstrengend, geradezu wohltuend für sein Gemüt, besonders wenn ihn die rastlosen Aktivitäten Anglers vom stillen Grübeln abhielten.
»Guten Morgen, Karl!« Angler hatte sich vor ihm aufgestellt. Bircher musterte ihn mit müden Augen wie einen auf Lob hoffenden Schüler.
»Tag, du hast sicher bereits die Tote beerdigt und den Täter überführt«, grinste er ihn an.
Angler kniff für einen Moment irritiert die Augen zusammen, um sogleich ungerührt fortzufahren:
»Karl, ich bin kurz vor dir eingetroffen und habe vom ABV erfahren, dass es sich bei der Toten um eine Frau Gundel Thule handelt, die auf der vierten Etage wohnte. Seit 1961.«
»So, dann gehen wir mal«, erwiderte trocken Bircher und winkte Schmidter freundlich zu, der ihm die Tür zum Hochhaus öffnete. Sie betraten eine geräumige Halle, die mit ihrer marmornen Mittelsäule und den rechtsseitig über die gesamte Wandfläche angebrachten freskenartigen Zeichnungen nach Motiven des Berliner Volksmalers Zille eher an ein Theatervestibül oder einen Museumseingang als an den Hausflur eines Mietshauses erinnerte. Die Illustrationen waren durch Zitate aus Gassenhauern unterlegt, wie »Das ist die Berliner Luft Luft Luft, die ist von besonderem Duft Duft Duft« oder »Am Wochenende woll’n wir beide segeln gehen …«, und sollten wohl das Glücksgefühl dieser auserwählten Hausgemeinschaft widerspiegeln.
Man konnte den Eindruck gewinnen, als hätten die Erbauer geplant, den Mietern einen Saal mit dem Ambiente eines Konzerthauses einzuräumen, wo sie sich sonntags zum gemeinsamen Singen einzufinden hätten. Die vornehme Ausstrahlung wurde durch die linksseitig eingebaute Portiersloge verstärkt, wobei der Portier, der sich allem Anschein nach nicht mehr im Dienst befand, wie ein Kartenverkäufer durch eine Glasscheibe vom Publikum getrennt worden war.
Bevor man zu den beiden Fahrstühlen gelangte, musste man zwei mächtige, aus verzinktem Eisen gefertigte und kunstvoll verglaste Flügeltüren aufstoßen, die das Eingangsportal vom Treppenaufgang trennten. Es war augenscheinlich, dass man sich hier nicht in einem gewöhnlichen Wohnhaus der Republik befand.
Bircher erinnerte sich an bissige Kommentare des Westens, wie sie höhnten, dass in der Stalinallee nur ausgewählte Würdenträger des Sozialismus durch die Eingangsportale schritten, wie einst die Pharaonen in ihre Tempel.
Tatsächlich wirkte das Ganze auf Bircher wie eine Verheißung vom besseren Leben. Diese Pracht ist mit der Tristesse meines Plattenbaus nicht zu vergleichen, sinnierte Bircher, als er Schmidter in den Fahrstuhl folgte. Die beiden Türen schlossen gerade, als Angler heranstürmte und einen Fuß in den Spalt schob. Der Aufzug verharrte stotternd und Angler quetschte sich hinein.
»Also, welche Etage?«, wandte sich Bircher an Schmidter.
»Die vierte, das ist die unterste Wohnetage, darunter befindet sich das Kinderkaufhaus«, klärte Angler sie auf.
Bircher nickte nur kurz und schaute aus den Augenwinkeln hinüber zu Schmidter, der ungerührt an der Fahrstuhltür lehnte.
Der Aufzug hielt, und sie betraten einen kleinen Vorraum, der in eine geräumige rechteckige Diele überging, von der aus fünf Wohnungen abzweigten.
»Mensch, ist das hier poliert, so stelle ich mir die Marmorfußböden der Moskauer U-Bahnhöfe vor«, staunte Angler, der die glänzenden Böden betrachtete, als wäre er soeben von der Rolltreppe einer Moskauer Metrostation gestiegen.
»Da sehen wir jede Spur, es sei denn, hier sind Filzlatschen Pflicht«, setzte Bircher trocken hinzu.
Trat man in die Diele ein, befanden sich jeweils zwei Wohnungen rechts und links an der Stirnseite, die fünfte lag auf der Längsseite des geräumigen Korridors, der eher einem überdachten Innenhof glich.
»Genosse Major, ich habe die Mitbewohner gebeten, ihre Türen zu schließen und sich für Auskünfte zur Verfügung zu halten«, rapportierte ein junger Polizist, der vor einer geöffneten Wohnungstür stand.
»In Ordnung, wir finden uns zurecht«, erwiderte Bircher und betrat mit seinen Kollegen langsam die Wohnung. Er hatte von der Karl-Marx-Allee einiges gelesen und wusste, dass es sich hier um außergewöhnlich großzügig angelegte Quartiere handelte, die anderswo in der Republik nicht gebaut worden waren. Sie befanden sich zunächst in einer geräumigen Diele, von der aus die Zimmer in alle Richtungen abgingen. Nobel, nobel, dachte Bircher, als er das Parkett musterte, das sachte unter seinen Füßen schwang und ihn an bestimmte Fernsehsendungen erinnerte, die er sich bisweilen mit Karola anschaute, wenn ihre Recherchen nach französischen Weingütern sie nicht ohne Staunen in entfernte Landschlösser führten.
»Die Tote liegt im Schlafzimmer, hinten rechts«, unterbrach ein Mitarbeiter der Spurenkommission seine Gedanken.
Die drei Kommissare folgten ihrem Kollegen durch einen Korridor mit eingebauten Kleiderschränken, dem sich eine Toilette und ein separates Bad mit großer Wanne anschloss, bei deren Anblick Bircher wiederum leichter Neid erfasste. Vom Bad gelangte man in das Schlafzimmer, das am Ende der Wohnung lag und von einem weiteren Korridor aus über ein Durchgangszimmer erreicht wurde.
Wie praktisch, dachte Bircher, würde ich mit der Zeitung in der Badewanne liegen, könnte Karola heimlich ins Schlafzimmer schleichen, um in meinem Nachttisch nach Zigaretten zu stöbern. Immer noch überrascht von der Großzügigkeit der Räumlichkeiten, näherte er sich allmählich der Leiche.
Das Schlafzimmer wurde, wie alle anderen Räume, von einer breiten, bis zum Parkett reichenden Fensterfront beherrscht, die den Raum noch geräumiger und vornehmer erschienen ließ. Auf dem breiten Bett lag eine bleiche Frau von etwa vierzig Jahren, nur mit einem kurzen Nachthemd bekleidet, den Kopf unnatürlich verrenkt. Wie eine Gans, die vom Bauer gerade ins Jenseits befördert wurde, schoss es Bircher unwillkürlich durch den Kopf.
Erstaunt sah er neben dem Bett Professor Tetsche stehen, den er eigentlich erst später erwartet hatte. Tetsche lief in seinem raschen Trippelschritt auf Bircher zu und zog ihn am Ärmel zur Seite.
»Guten Morgen, Wolfgang, seit wann bist du vor mir am Tatort, wohnst du jetzt auch hier im Haus, als ›Verdienter Arzt des Volkes‹?«, flachste Bircher und schüttelte ihm kräftig die Hand.
»Nee, alles wohl ungewöhnlich diesmal, die oberste Instanz hat mich herbefohlen«, nuschelte Wolfgang.
»Der Minister, oder wer?«, stellte sich Bircher ahnungslos.
»Der Polizeivizepräsident, genauer Generalmajor Meier höchstpersönlich.«
»Aha, mich auch, muss wohl alle persönlich abkommandiert haben, na ja, kann ja nicht schaden, wenn die Kollegen vor mir hier sind, so stehe ich nicht alleine vor den Opfern.«
»Welche Opfer?«
»Die Familie zum Beispiel, du herzloser Leichenbeschauer.«
»Besteht in unserem Fall nach Lage der Dinge nur aus der Toten und dem Hinterbliebenen, Genossen Thule, seines Zeichens Sekretär der Bezirksleitung«, klärte ihn Tetsche auf.
»Aha, deshalb der Großeinsatz.«
»Ja, die Tote dort ist seine Gattin, Frau Gundel Thule, als Ärztin im Regierungskrankenhaus beschäftigt, nun gewesen. Hat so manche bedeutende Herzrhythmusstörung behandelt«, murmelte Tetsche in sich hinein.
Bircher wurde endgültig klar, dass ihn ein besonderer Fall erwartete, und er war froh, Tetsche in dieser frühen Phase neben sich zu haben. So sparten sie Zeit, schließlich erwartete Meier schnellstmöglich den ersten Lagebericht.
Während Tetsche fortfuhr, die Tote zu untersuchen, wandte sich Bircher vor der Tür an seinen Stellvertreter:
»Wie wurde man denn auf den Fall aufmerksam, war ihr Mann verreist, die beiden bewohnen doch gemeinsam die Wohnung, oder?«
»Ihr Mann, Gerhard Thule, ist auf einer Dienstreise in Moskau, die Genossen versuchen, ihn dort zu erreichen. Frau Thule war wegen der Tätigkeit ihres Mannes häufiger allein. Sie war mit ihrer Nachbarin, Frau Alexandra Welling, eng befreundet.«
»Ist das die Schriftstellerin?«, unterbrach ihn Bircher.
»Ja, sie wohnt nebenan, wurde vom ABV kurz befragt«, fuhr Angler fort. »Also, Frau Welling hat berichtet, dass sich die beiden für halb acht, die ›Aktuelle Kamera‹ begann gerade, vor der Wohnungstür für halb neun verabredet hatten. Frau Thule habe sie eingeladen. Sie trafen sich regelmäßig abwechselnd in ihren Wohnungen, in der Regel kam jedoch Frau Wellig zu Frau Thule, wenn diese allein war. Jedenfalls klingelte Frau Welling gegen halb neun, Frau Thule öffnete die Tür und sie waren bis gegen halb zwölf zusammen. Frau Thule musste am nächsten Tag erst mittags in die Klinik. Sie trennten sich kurz vor Mitternacht. Frau Welling hat die Neigung, nachts lange aufzubleiben. Sie schreibt dann bis in die frühen Morgenstunden, eine Angewohnheit, die sie sich nach dem Tod ihres Mannes vor einigen Jahren angeeignet hat. Gegen halb eins bemerkte sie, dass sie ihren Kalender bei Frau Thule vergessen hatte. Wahrscheinlich hatten sie etwas vereinbaren wollen. Da es zu spät war, nahm sie sich vor, gleich vor dem Frühstück zu klingeln. Da musste Frau Thule zu Hause sein, da sie ja bis mittags frei hatte, sagte sich Frau Welling. Jedenfalls klingelte sie gegen halb neun mehrfach. Erstaunt, keine Antwort zu erhalten, lauschte sie an der Tür und beschloss dann, auf der Station im Krankenhaus nachzufragen. Die bestätigten, dass man Frau Thule erst gegen dreizehn Uhr erwartet würde. Daraufhin klingelte sie nochmals. Wie gesagt, die waren sehr eng befreundet und kannten ihre Gewohnheiten. Frau Welling beschlich allmählich ein Gefühl der Unruhe. Als sich nichts rührte, beschloss Frau Welling, die Tür zu öffnen. Beide hatten jeweils einen Schlüssel für die andere Wohnung, da ja besonders Genosse Thule viel unterwegs war, eben auch praktisch. Als es ihr langsam zu mulmig wurde, benachrichtigte Frau Welling den Genossen Jäger, der hier das Hausbuch führt. Die beiden fanden dann die Leiche. Jäger rief im Präsidium an und weiß Gott noch wo, schließlich hat der ja nicht die Nummer von Meier.«
»Was macht Jäger beruflich?«, unterbrach ihn Bircher.
»Genosse Jäger ist ein alter verdienter Genosse. Er war viele Jahre Erster Sekretär der Kreisleitung Treptow. Ist nun Rentner. Er wohnt seit 1956 im Haus und, wie gesagt, er hält seit Jahren das Meldebuch und ist auch Leiter der Hausgemeinschaft. Soweit ich das in der Kürze der Zeit erfahren habe, ist er die Seele des Hauses. Kümmert sich um Hausgemeinschaftsfeiern, Reparaturen, Arbeitseinsätze und wenn nötig stellt er sich auch mal abends als Kinderaufsicht zur Verfügung. Der kennt also das Haus in und auswendig«, berichtete Angler im Jargon eines Kaderreferenten.
Bircher nickte nur, wohl ahnend, über welchen Kanal der Hausgemeinschaftsleiter Meier so schnell informieren konnte. Er beschloss, Jäger als Ersten zu befragen.
»So, lass uns Professor Tetsche nach seiner ersten Diagnose fragen«, winkte Bircher seine Kollegen in das Schlafzimmer.
Tetsche stand immer noch am Bett und machte sich in einem schwarzen abgegriffenen Heftchen Notizen. Solange Bircher ihn kannte, trug Tetsche dieses Heftchen bei sich. Auf den Vorschlag, dass es doch einfacher sei, den Bericht zu diktieren, hatte ihn Tetsche nuschelnd korrigiert: ja, aber nicht für Raucher. Es war aber nicht das Rauchen, das störte, sondern die gelegentlichen Hustenanfälle, die ihn aus dem Rhythmus warfen. Die Sekretärin hatte ihn darauf hinweisen müssen, dass sie Textpassagen vermissen würde oder seinem Bericht nicht folgen konnte. Es war nicht nur der Husten, sondern auch das Nuscheln, das ein Schreiben vom Band zur Herausforderung werden ließ. Nachdem seine Sekretärin auf Nachfragen einige Male die Antwort erhielt, sie möge einfach genauer hinhören, verkniff sie sich weitere Bemerkungen und fügte an den entsprechenden Passagen Pünktchen im Text ein. Ungerührt füllte Tetsche dann die Lücken auf, bis er eines Tages beschloss, ganz auf das ihm lästige Gerät zu verzichten, woraufhin er seiner Sekretärin einfach die Notizen mit der Anweisung reichte, sie möge das in eine »prosaische Form« gießen. Die war anfangs entsetzt und versuchte ihn mit dem Hinweis, dass sie nur eine Schreibkraft sei, von seinem Vorhaben abzubringen. Tetsche murmelte ihr tröstend zu, dass nach den ersten fünfzig Toten kaum Neues auf sie zukommen würde. Nach anfänglichen Missverständnissen bei der Zuordnung des Textes zu Personen und einigen Fehlinterpretationen bei Niederschrift seiner gekritzelten Aufzeichnungen hatte sie es schließlich in den fünfzehn Jahren ihrer Zusammenarbeit gelernt, fast druckfertige Manuskripte auf den Tisch zu legen. Grinsend pflegt er ihr zu sagen, dass sie seine Gedanken, einem Hofdichter gleich, in Worte kleiden würde.
»So, Wolfgang, kannst du schon etwas Genaueres sagen?«
Anstelle einer Antwort winkte er die Kommissare heran und schlug die Bettdecke, die einen Arm der Toten verborgen hatte, zur Seite.
Unwillkürlich zuckte Bircher zusammen. Angler und Schmidter, die hinter ihm standen, traten wie auf Befehl einen Schritt zurück.
An der rechten Hand fehlten der Zeigefinger und der Ringfinger. In einer kleinen Blutlache hoben sich die weißen leblosen Gliedmaßen scharf vom Betttuch ab. Als würden sie darauf warten, ihren Platz wieder einnehmen zu dürfen, ruhten sie neben dem leblosen Körper. Neben der rechten Hand, am amputierten Ringfinger, glänzte, wie weggeworfen, das Gold des Eheringes. Der Mörder hatte die Finger mit Bedacht unter der Decke versteckt, als hätte er eine Überraschung vorbereitet. »Welche Botschaft beinhaltet diese Verstümmelung?«, fragte sich Bircher, als er Tetsche anblickte, der auf der anderen Seite des Bettes stand.
»Die Frau wurde erwürgt und zwar höchstwahrscheinlich ohne Strang – oder Drosselwerkzeug, also mit den blanken Händen. Du siehst hier«, er nickte Bircher zu, näher zu treten, »petechiale Blutungen in den Konjunktiven und Lidhäuten, auch im Gesicht und in den Mundschleimhäuten«, wobei er mit einer kleinen Stablampe die Mundhöhle der Toten ableuchtete. »Das beweist, dass zum Zeitpunkt des Todes eine starke Blutstauung in den Gefäßbezirken des Kopfes auftrat. Diese Stauungsblutungen sind typisch, darüber sieht man hier am Hals fleckenförmige Hämatome, klarer äußerer Befund bei gewaltsam herbeigeführtem Erstickungstod. Die Zeit für die Entstehung von petechialen Blutungen liegt zwischen Sekunden und Minuten. Für eine endgültige Festlegung muss ich in der Klinik noch eine Asphyxie oder Asphyxia, also Herzkreislaufversagen mit Atemlähmung, ausschließen.«
Bircher und seine Kollegen folgten dem Vortrag wie Studenten ihrem Dozenten. Tetsches erste Analysen erwiesen sich so gut wie immer als richtig.
»Kannst du etwas zur Tatzeit sagen?«, fragte Bircher, der sich im Zimmer umsah.
»Du siehst hier die bläulichen Totenflecken, die sich etwa dreißig Minuten nach Eintritt des Todes an der Unterseite des Körpers nachweisen lassen. Innerhalb der ersten zwölf Stunden laufen diese Flecken stetig ineinander. Bei Zimmertemperatur sind die nach etwa ein bis zwei Stunden an den Augenlidern, Kaumuskeln und kleinen Gelenken zu beobachten, danach am Hals, Nacken und danach weiter den Körper abwärts, ja, und nach sechs bis zwölf Stunden sind sie voll ausgeprägt«, dozierte Tetsche vor den Kommissaren, die seinen Hang zur Belehrung kannten und regungslos über sich ergehen ließen.
»So, mein Lieber, das könnte also bedeuteten, dass sie vor zwei bis vier Stunden erwürgt worden ist«, versuchte Bircher einen Tipp, weil er glaubte, bläuliche Flecken am Nacken gesehen zu haben.
»Hm, könnte so gewesen sein«, nuschelte Tetsche abwesend, der die Unterbrechung missbilligend zum Anlass nahm, zu seinem Mantel zu greifen. »Ich kann dann gehen, sehe ja Frau Thule nachher auf meinen Tisch«, verabschiedete er sich gleichmütig, als würde es um einen Termin zum Mittagessen gehen.
»Warte doch mal, du hast nichts zu den Fingern gesagt, die sind doch wohl nicht versehentlich beim Würgen abgefallen«, hielt ihn Bircher zurück. Er kannte seinen Freund und Kollegen nur zu gut und ahnte, dass der nur auf diese Frage gewartet hatte.
»Freut mich, dass ihr den Zeigefinger, obwohl nicht erhoben, im Gedächtnis behalten habt, ebenso den verlassenen Ring, Symbolik der ehelichen Geschlossenheit«, sprach Tetsche in die Runde.
Ihm war die Reaktion der Polizisten nicht entgangen, wie sie sich zuerst erschrocken abgewandt hatten, bis auf Bircher, der sich nichts hatte anmerken lassen.
»Dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel mehr sagen, als ihr gesehen habt, also, dass sie brutal mit einem Schnitt abgetrennt wurden, wahrscheinlich mit einem sehr scharfen Gegenstand. Wann das geschah, kann ich nicht sagen, schon gar nicht, warum. Es sieht auf den ersten Blick wie ein Ritual aus. Nur so eine Ahnung, vielleicht wollte der Mörder ein Symbol setzen, etwas in diese Richtung« , sinnierte Tetsche, die Tote betrachtend.
»Sie meinen, die Finger könnten als Hinweis auf einen weiteren Mord verstanden werden?«, schaltete sich Schmidter vorsichtig in das Gespräch ein.
»Bin kein Psychologe, ja, das müsst ihr rauskriegen: Warum hinterlässt der Täter zwei Finger, aber sonst keine weiteren Verstümmelungen, keine Zeichen sexueller Gewalt, keine Verwüstungen im Raum oder Ähnliches, was auf ungehemmte Zerstörungswut hinweisen würde?«, fragte Tetsche, der offensichtlich das Thema nicht weiter vertiefen wollte und sich wieder zur Tür wandte.
»Dazu passt, dass nichts auf Diebstahl hinweist«, pflichtete Angler bei.
Bircher löste sich vom Anblick der Toten und folgte Tetsche zur Wohnungstür.
»Wolfgang, gegen Mittag ruft mich bestimmt Horst Meier an. Das schlägt hier Wellen, die klatschen bis an die Mauern des ›Städtchens‹, wie du dir vorstellen kannst. Ich wurde bereits gebeten, den Fall streng vertraulich zu behandeln. Also, achte bitte darauf, dass alles unter deiner Kontrolle bleibt und keiner quatscht«, flüsterte Bircher ihm zu.
»Keine Sorge, ich sorge dafür, dass niemand mit Frau Thule redet«, griente Tetsche, den nach langen Jahren seiner Tätigkeit in der Gerichtsmedizin nichts mehr zu überraschen schien. Er schlug Bircher zum Abschied auf die Schulter, trippelte zur Ausgangstür und verschwand im Fahrstuhl.
Bircher stand einen Moment grübelnd in der geräumigen Diele. Jeder Anschein unnötiger Hektik, Nervosität oder Betriebsamkeit musste vermieden werden. Besonders Angler sollte ich darauf hinweisen, dachte er. Bircher überschlug in Gedanken, dass bei acht bewohnten Etagen und fünf Wohnungen pro Etage etwa vierzig Familien im Hochhaus wohnten, vielleicht bis zu einhundert Menschen. Alle Familien müssen befragt werden, in jeder Familie wird sich jemand finden, der seine Sorgen mit Freunden oder Verwandten teilen möchte, mancher will nur aus Wichtigtuerei über den Vorfall sprechen oder kann schlicht der Versuchung nicht widerstehen, sein Wissen, seine Zweifel und seine Angst mit jemandem zu teilen. Es ist fast unmöglich, das Geschehen geheim zu halten, jedenfalls nicht im Umkreis des Hochhauses, schlussfolgerte Bircher. Wir können den Bewohnern nicht alle Ventile schließen, sie müssen Druck ablassen, um ihren Alltag zu bewältigen. Ich werde zunächst mal mit Angler und Schmidter sprechen, beschloss Bircher und betrat die Wohnung.
»Genosse Schmidter, Philipp!«, winkte er seine Mitarbeiter zu sich.
»Wir gehen hier behutsam vor, also wir unterlassen alles, was Panikstimmung auslösen könnte. Wir teilen uns auf, ich spreche mit Frau Welling, du, Philipp, mit Jäger, der das Hausbuch führt und als Erster mit Frau Welling die Wohnung betrat, und Sie, Genosse Schmidter, befragen die anderen Bewohner der Etage. Weisen Sie freundlich darauf hin, dass es in unser aller Interesse ist, das Geschehen«, Bircher vermied den Ausdruck Mord, »