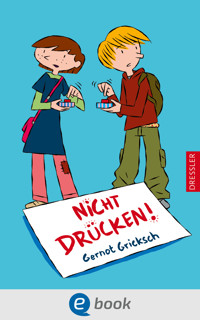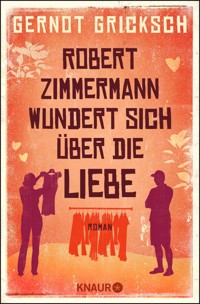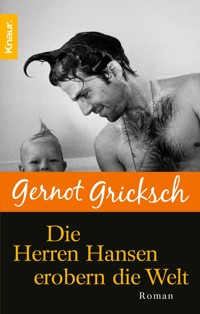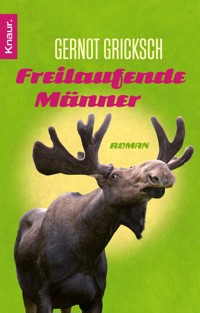6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feelings
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie kaum ein anderer deutscher Autor versteht Gernot Gricksch es, Geschichten zu erzählen, die Männer zum Lachen zu bringen und Frauen zu Tränen zu rühren (und manchmal andersherum). So eine Geschichte ist auch die von Arne: Dass ausgerechnet er bei den Zeugen Jehovas landet, muss ein besonderer Scherz Gottes sein, lebenslustiger Windhund voller schräger Ideen, der er ist. Eigentlich will er auch gar nicht lange bleiben. Aber dann lernt er Johanna kennen. Tatsächlich bringen die beiden und ihre Liebe, die gegen alle Regeln verstößt, Veränderung in die kleine Gemeinde. Doch das wird längst nicht von allen gern gesehen. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis Arne und Johanna eine schwere Entscheidung treffen müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gernot Gricksch
Morgens in unserem Königreich
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Dass ausgerechnet er bei den Zeugen Jehovas landet, muss ein besonderer Scherz Gottes sein, denkt Arne. Denn er ist ein lebenslustiger Windhund voller schräger Ideen, der so gar nicht zu den angepassten Gläubigen passt. Deswegen will Arne auch gar nicht lange bleiben. Doch dann lernt er Johanna kennen.
Johannas und Arnes Liebe, die gegen alle Regeln verstößt, bringt die kleine Gemeinde ganz schön durcheinander – was nicht von jedem gerne gesehen wird. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis die beiden nicht nur ein paar mittelschwere Hürden umtanzen müssen, sondern am Ende vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens stehen, bei der es buchstäblich um Leben und Tod geht.
Augenzwinkernd lässt Gernot Gricksch zwei Welten kollidieren. Der Stoßdämpfer: die Liebe.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Epilog
Danksagung
1.
Die verkohlten Bratwürste gehörten ganz nach links. Zwei, drei Stück lagen da eigentlich immer, am äußersten Rand des Grills.
Gerade wenn der Andrang groß war, etliche Touristen und Partypeople sich vor der Imbissbude drängelten und ihre Bestellungen durcheinandergrölten, vergaß Arne manchmal, die Würste auf dem Grill rechtzeitig zu wenden. Aus irgendeinem Grund tendierten dann besonders die Krakauer dazu, schnell anzubrennen. Erst wurden sie außen trocken und faltig, ein wenig wie Packpapier sah die Pelle dann aus, und dann, ganz schnell, nahmen sie eine schwarze Färbung an.
Anfangs hatte Arne diese Wurst-Unfälle noch schuldbewusst in den Mülleimer geworfen. Doch als Udo, dem die Imbissbude gehörte, das bemerkte, holte er die Wurst, die Arne gerade entsorgt hatte, aus dem Abfall, wischte sie mit einem Haushaltspapier notdürftig ab und legte sie zurück auf den Grill. Ganz nach links.
»Die Verkohlten geben wir den Besoffenen«, erklärte er. »Die merken eh nix mehr.«
»Aber da kriegt man doch Krebs von, von den angebrannten Dingern«, wagte Arne anzumerken.
»Alter«, knurrte Udo. »Ist das mein Problem?«
Inzwischen arbeitete Arne seit über ein Jahr im Imbiss an der Reeperbahn, und es war ihm längst in Fleisch und Blut übergegangen, die karzinogenen Linkswürstchen wie selbstverständlich an jene Kunden auszugeben, die torkelnd und mit glasigem Blick ihre Bestellung aufgaben. Und Udo hatte recht gehabt: Die merkten nichts. Noch nie hatte sich einer beschwert.
Arne füllte gerade den Kühlschrank mit Bierflaschen auf, als er Mia auf den Imbiss zukommen sah. Er winkte ihr zu.
»Hey, Süße«, sagte er und beugte sich über den Tresen, um ihr einen Kuss zu geben. Etwas Hartes kratzte an seinen Lippen.
»Neues Piercing?«, fragte Arne und zeigte auf den Ring, der sich durch Mias Unterlippe zog.
»Gefällt’s dir?«, fragte Mia.
»Ja. Cool«, nickte Arne.
»Hast du die Karten besorgt?«, fragte Mia.
Arne schüttelte den Kopf. »Tut mir leid«, seufzte er. »Ist schon ausverkauft.«
»Was?!« Mia war sauer. »Ich hab dir schon vor drei Wochen gesagt, dass du die Karten kaufen sollst. Da hatte der Vorverkauf gerade erst angefangen!«
Arne verzog schuldbewusst das Gesicht. Er wusste, wie wichtig Mia das Vampire-Weekend-Konzert im Docks war. Es war ihre absolute Lieblingsband, und er hatte ihr versprochen, sie einzuladen. Da das Konzert genau auf ihren ersten Jahrestag als Paar fiel, schien das die perfekte Idee für eine romantische Geste zu sein. Doch sechsundvierzig Euro pro Karte war happig. Zu happig für Arne. Gerade jetzt, wo sich seine Schulden zu einem kaum noch übersehbaren Berg angehäuft hatten. Also hatte Arne, wie so oft, zu tricksen versucht.
»Nulle hat gesagt, er könne uns durch den Seiteneingang reinschleusen«, erklärte er Mia. »Sein Bruder arbeitet doch für die Security, der hätte uns locker da umsonst durchgemogelt. Ich meine: Die Karten sind echt scheißteuer. Aber jetzt wurde Nulles Bruder kurzfristig bei André Rieu in der Barclaycard-Arena eingeteilt und … na ja …« Arne setzte sein schiefes Grinsen auf, das normalerweise bei Mia immer ein verzeihendes Lächeln hervorzauberte. »Ich schätze, du hast nicht zufällig Lust, unseren ersten Jahrestag inmitten fröhlicher Rentner mit einem Wiener Walzer zu feiern?«
Mia lächelte nicht. Sie drehte sich einfach um und ging.
»He, Mia!«, rief Arne ihr hinterher. »Es tut mir leid! Wirklich! He, ich lass mir etwas einfallen, ja?!«
Mia hob den Arm nebst ausgetrecktem Mittelfinger, während sie weiterging, ohne sich noch einmal umzudrehen.
»Ey, Wasisnjetzt mit mein Wurst?«, lallte der Typ, der Arnes und Mias Gespräch mit zunehmender Ungeduld mitgehört hatte.
Er gehörte zu einer Gruppe von sechs Männern, die offenbar einen exzessiven Junggesellenabschied gefeiert hatten und jetzt bei dem obligatorischen Fettfood-Finale angekommen waren. Sie alle trugen alberne Hüte und T-Shirts mit dem Aufdruck Maiks Last Day of Freedom. Arne hatte keine Ahnung, welcher dieser wankenden Endzwanziger Maik war, aber keiner der sechs sah so aus, als ob er in der Lage wäre, in wenigen Stunden aufrecht in einer Kirche zu stehen und ein Jawort zu geben.
»Wurst, ey«, maulte der Mann.
»Kommt sofort, immer mit der Ruhe«, knurrte Arne und reichte dem Mann mit dem Hütchen einen Pappteller mit einer schwarzen Krakauer drauf.
Ab vier Uhr morgens war Arnes Feierabend in Sicht. Da tauchten nur noch selten Nachteulen an der Bude auf. Udo war längst gegangen. Also fing Arne an aufzuräumen, zu wischen und zusammenzupacken. Fast wäre ihm der kleine Stoffteddy mit dem FC-St.-Pauli-T-Shirt, der oben neben den Servietten auf dem Regal thronte, in die Fritteuse gefallen. In letzter Sekunde konnte er ihn auffangen und zurück auf seinen Platz stellen. Arne fand es unhygienisch, ein Stofftier in der unmittelbaren Nähe der Lebensmittel aufzubewahren. Das hätte es in der Küche seiner Eltern nie gegeben. Aber das war hier nicht Bergkampstedt, sondern die Reeperbahn. Und Devotionalien des innig geliebten lokalen Fußballvereins waren quasi Bürgerpflicht.
Während Arne räumte und wischte, beendeten auch die Straßenhuren schräg gegenüber so langsam ihren Dienst. Einige von ihnen aßen noch einen kleinen Happen am Imbiss, bevor sie zu Hause erschöpft ins Bett fielen. Es waren nicht die tragischsten Prostituierten-Exemplare, die man auf dem Kiez fand. Ihr Revier, nahe dem Polizeirevier Davidswache, war das Filetstück von St. Pauli. Wer hier Dienst tat, war einigermaßen sicher und unter Beobachtung der Ordnungshüter. Die Minderjährigen, die Drogensüchtigen, die Russinnen, Rumäninnen und Ukrainerinnen, die nicht freiwillig taten, was sie taten, schafften woanders an.
Zwei von ihnen – Lina und Anne (beziehungsweise Lucy und Marielle, wenn man ihre Kunden fragte) – kamen an Arnes Bude. Sie beendeten ihren Arbeitstag fast immer mit einem kleinen Snack.
»Hallo, Arne«, lächelte Anne. »Hast du noch zwei Schinkenwürste für uns?«
»Ich kann nicht glauben, dass ihr euch nach sechs Stunden Dienst immer noch etwas Langes, Fleischiges in den Mund stecken mögt«, grinste Arne und reichte ihnen zwei Pappbrettchen mit den Würsten.
Die beiden jungen Frauen lachten und vollführten natürlich prompt eine Fellatio-Pantomime mit dem Essen.
Viele der jungen Prostituierten flirteten mit Arne. Er sah gut aus, er war auf eine struppige Art charmant, er war ein cooler Typ. Und er flirtete gut gelaunt zurück. Aber er hatte noch nie mit einer der Huren Sex gehabt, weder für Geld noch privat. Die Vorstellung reizte ihn nicht, sie stieß ihn sogar ein wenig ab. Er fand es blöd und spießig, dass er so empfand, aber er konnte nichts dagegen tun.
Arne war nicht in die Kiez-Welt hineingeboren worden. Er war sozusagen ein Seiteneinsteiger. In ihm existierte auch immer noch der Arne, der in dem kleinen Kaff Bergkampstedt aufgewachsen war. Ein erzkonservatives Örtchen. Seine Eltern hatten den dortigen Dorfkrug betrieben, seine Mutter war Vorsitzende des Landfrauenvereins, sein Vater Schützenkönig. Arne war mit achtzehn nach Hamburg gekommen, hatte die erste Chance zur Flucht aus dem ländlichen Raum genutzt. Seine Eltern – deren Liebe zu ihm sich vor allem in Vorwürfen und vermeintlich guten Ratschlägen manifestierte – sah er nur noch selten. Sie waren enttäuscht gewesen, dass er schon als Vierzehnjähriger angekündigt hatte, niemals das elterliche Lokal übernehmen zu wollen. Und sie missbilligten sein urbanes »Lotterleben«.
Letztes Jahr hatten Arnes Eltern den Gasthof, den sie ihm so gern vererbt hätten, schließen müssen. Einer dieser überdrehten Fernsehköche hatte im Ort nebenan ein Schickimicki-Restaurant aufgemacht, das ihnen mit pochiertem Kalbsmedaillon an Wasabi-Mangold und ähnlichem Schnickschnack die Touristen der nahe gelegenen Seenplatte als Gäste abfischte. Und ihre lokale Stammkundschaft, bislang die verlässliche Sicherung ihres Lebensunterhalts, schrumpfte beständig, starb weg oder zog fort, weil es immer weniger Jobs, eine bröselnde Infrastruktur und zu viel Langeweile gab in Bergkampstedt.
Arnes Eltern hatten keinen Käufer für ihr Lebenswerk gefunden und lebten nun in ihrer Wohnung über dem Gasthof. Ein Lokal, von dessen Inneneinrichtung sie verscherbelt hatten, was noch zu verscherbeln war. Abends saß Arnes Vater manchmal noch in der alten Gaststube an dem Tresen, hinter dem sich nichts mehr befand. Er saß da ganz allein, trank Bier von Aldi und starrte aus dem Fenster, als würde er immer noch auf Gäste warten.
Es war halb fünf, als Arne endlich den metallenen Rollladen vor der Bude herunterlassen konnte. Dann zog er die Geldkassette mit den Tageseinnahmen aus dem Regal unter dem Grill hervor. Er nahm die Kassette abends immer mit nach Hause und rechnete am nächsten Tag mit Udo ab. Udo hatte den Großteil des Geldes bereits mitgenommen, als er um kurz vor zwei Uhr gegangen war. Jetzt waren da nur noch die Einnahmen der letzten Stunden drin. Immerhin: knapp fünfhundert Euro. Zwei Reisebusse mit überdrehten Holländern hatten um kurz nach drei noch mal für ein richtig gutes Geschäft gesorgt. Bei einigen von ihnen hatte Arne absichtlich zu wenig Wechselgeld herausgegeben. Wenn es jemand bemerkt hatte, hatte er sich entschuldigt und den vermeintlichen Fehler korrigiert. Die meisten Leute aber schauten die Münzen und Scheine nicht einmal an, die er ihnen gab, sondern steckten sie einfach nur ein. Arne nahm sich hundertzwanzig Euro aus der Kassette und steckte sie in die Hosentasche. Als er das vor einigen Monaten zum ersten Mal getan hatte, hatte er noch ein schlechtes Gewissen gehabt. Inzwischen war es schon fast Routine. So wie die verbrannten Würstchen.
2.
Johanna schämte sich dafür, aber Matthias erinnerte sie an Kuchenteig. Sie versuchte, diesen Gedanken aus ihrem Kopf zu verscheuchen, doch immer, wenn sie Matthias ansah, musste sie an die weiche Masse denken, in die sie jeden Sonntagvormittag ihre Finger grub, wenn sie für ihre Familie buk.
Ihre Mutter hatte sich, als sie den Königreichssaal betrat, sofort umgeschaut, wo Matthias war. Er stand im Mittelgang, das drahtlose Mikrofon in der Hand. Matthias war sichtlich stolz auf dieses Privileg, das ihm diese Woche zum ersten Mal gewährt wurde. Wer während des Gottesdienstes das Mikrofon halten durfte, war in der Hierarchie der Gemeinde ein Stück nach oben gewandert. Ein winzig kleiner Schritt näher zum Paradies.
Da stand er also, in seiner dunklen Anzughose, mit dem weißen Hemd, das sich über seinem Bauchansatz spannte, mit seiner sorgfältig gescheitelten Frisur und den zu buschigen Augenbrauen. Das war eine irritierende Nuance in seiner ansonsten allzu konturlosen Erscheinung: Matthias hatte die Augenbrauen eines alten Mannes.
»Komm«, sagte Johannas Mutter und ging zu ihm. Ihren Sohn Karsten zog sie mit festem Griff hinter sich her.
Johanna blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Karsten – dreizehn Jahre alt und dürr wie eine Bohnenstange – schaute sich um, während er seiner Mutter hinterherstolperte. Seine freie Hand trommelte dabei auf seinen Oberschenkel. Dann winkte Karsten einem anderen Jungen zu, der aber nur halbherzig und verlegen zurückwinkte. Karsten rief laut: »Hallo!«
Ein Dutzend Köpfe drehte sich in seine Richtung.
»Pst«, zischte es, und seine Mutter zog mahnend an Karstens Arm. Sie hatte ihm schon hundertmal gesagt, dass im Königreichssaal nicht laut gesprochen wurde.
Günther – Johannas und Karstens Vater – tat so, als bekäme er davon nichts mit. Er war es leid, dass sein Sohn immer und immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich zog. Wild war er, der Junge, manchmal einfach nicht zu bremsen. Und wenn Karsten beim Abendessen saß, mit den Fingern unentwegt auf die Tischplatte klopfend und dazu eine nicht identifizierbare Melodie summend, fragte sich Günther manchmal, ob sein Sohn ein böser Scherz Satans sei.
Nein, hatte der Arzt letztes Jahr gesagt. Das sei ADHS. Die Zappelphilipp-Krankheit, gepaart womöglich mit einer milden Form von Autismus. Um das bestimmt sagen zu können, müsste man weitere Tests machen. Tests, die dann aber nie durchgeführt wurden. Es gab Medikamente, mit denen man ADHS in den Griff bekommen konnte, doch Karstens Eltern hatten sich gegen das Ritalin entschieden. Es gab keine Tabletten, die Satans Grausamkeiten und Gottes Prüfungen linderten. Das konnte nur der Glaube. Trotzdem war es schwer, nicht die Geduld zu verlieren. Karin weinte oft, wenn Karsten wieder überdrehte, sie vor den anderen blamierte und allzu nachdrücklich demonstrierte, dass er auf ewig ein Sorgenkind bleiben würde. Und Günther war voller Wut, weil sein Sohn so anders war als die anderen, so anders als er selbst. Ein paar Mal schon war Günther die Hand ausgerutscht, als könne er das, was seinen Sohn zu solch einer Zumutung machte, herausschlagen. Doch tatsächlich trieb Günther mit jeder Ohrfeige die Eigenwilligkeit noch tiefer in Karsten hinein.
Nur Johanna hatte eine unerschütterliche Geduld mit ihrem Bruder. Sie war gut mit ihm, dafür wurde sie viel gelobt. Von der ganzen Gemeinde. Barmherzig sei sie und liebevoll. Andere Dinge gefielen den Leuten zwar weniger an Johanna – einigen galt sie als hochnäsig und aufmüpfig –, aber alle fanden, Johanna sei sicher eine gute Mutter. Und sie sollte es auch längst sein!
Günther ging hinüber zu der breiten Fensterfront, vor der die meisten anderen Männer standen. Durch das Fenster sah man den Parkplatz. Dahinter der Lidl-Supermarkt. Günther schaute zu seiner Familie herüber. Sie sprach mit Matthias.
»Guten Morgen, Matthias«, sagte Johannas Mutter und lächelte.
Matthias reichte ihr eilfertig die Hand. »Guten Morgen, Karin«, antwortete er und deutete tatsächlich einen Diener an. Dann wandte er sich an Karsten und klopfte ihm kameradschaftlich auf die Schulter: »Hallo, Karsten.«
»He! Du hast ja heute das Mikro! Sing uns etwas vor, Matthias!«, lachte Karsten. »Was von Miley Cyrus!«
Matthias lächelte höflich. Nachsichtig. Miley Cyrus? Das war doch diese junge Frau, die durch irgendwelche Skandale in die Schlagzeilen kam, oder? Johanna schaute ihren Bruder an und schüttelte den Kopf in einer milden »Lass das«-Geste. Karsten grinste, schwieg aber fortan.
Matthias gab Johanna die Hand. »Guten Morgen, Johanna«, sagte er, und seine Augen zwinkerten nervös im Teig seines Gesichts. Er war schüchtern. Er war nervös. Er war der Mann, den sie heiraten sollte.
Johanna gab sich wirklich alle Mühe, etwas in Matthias zu entdecken. Etwas Geheimnisvolles, etwas Aufregendes, etwas Starkes. Es war nicht so, dass sie Matthias nicht mochte. Sie kannte ihn seit der Schulzeit und hatte ihn unzählige Male zu beschützen und zu trösten versucht, als er von anderen Jungen geärgert wurde – auf dem Pausenhof, auf dem Sportplatz. Sie war wie eine große Schwester für ihn gewesen, obgleich er ein Jahr älter war als sie. In ihren Augen war er immer der Kleinere gewesen, der Hilflose, der Schutzbedürftige. Würde sich dieses Gefühl ändern, wenn sie ihn heiratete?
Es war nicht so, dass man sie zwang. Und es gab auch noch keinen offiziellen Antrag von Matthias. Wenn er um ihre Hand anhielt, was nur eine Frage der Zeit war, konnte Johanna durchaus ablehnen. Doch sie war bereits fünfundzwanzig Jahre alt. Und sie hatte schon zu oft »Nein« zu Männern gesagt. Drei Mal insgesamt. Die Leute in der Gemeinde redeten bereits über sie. Und Matthias war nett. Er war ein freundlicher, gutmütiger Mann, der für sie sorgen und sie gut behandeln würde. Sie könnte es schlimmer treffen.
Es war Zeit. Die Ältesten traten nach vorn. Ein kurzes, vielfaches Räuspern, danach ein Moment absoluter Stille, und dann stimmte die Gemeinde kraftvoll und leidenschaftlich den Gesang an:
Jehova, unsre Zuflucht,
auf ihn wir fest vertraun.
Er stützt uns und beschützt uns,
auf ihn wir können baun.
Einige der Gläubigen schlossen die Augen beim Singen. Einige schauten sich um und musterten die anderen. Man war neugierig in der Gemeinde. Dein Bruder ist des Blickes würdig, auf dass Du Anteil nimmst an seinem Leben.
Plötzlich störte ein lautes, schrilles Pfeifen den andächtigen Gesang. Alle zuckten zusammen, einige hielten sich die Ohren zu. Die Blicke wandten sich Matthias zu, der sich mit dem Mikrofon zu sehr dem Lautsprecher genähert und so eine Rückkopplung verursacht hatte. Ein fieser Ton. Jetzt suchte Matthias mit hochrotem Kopf verzweifelt den Aus-Schalter am Mikrofon, während ein zweites, grelles Kreischen den Raum durchschnitt.
Karsten lachte schallend auf und rief: »Miley Cyrus! Yeah!«, wofür er von seinem Vater einen Stoß in die Rippen erhielt.
Es wurde gesungen. Es wurde gebetet. Johanna schaute aus dem Fenster. Schneeweiße Wolken am Himmel. Wie Zuckerwatte. Kumulus-Wolken. Wolken entstehen durch Kondensation oder Resublimation von Wasserdampf, wusste Johanna. Es gibt zehn Gattungen, achtundzwanzig Arten und diverse Unterarten von Wolken. Es gibt Sonderformen, Mutterwolken und Begleitwolken. Kumulus-Wolken sehen aus wie Zuckerwatte. Zirrus-Wolken sehen aus, als hätte jemand mit einem Pinsel über den Himmel gestrichen, an dem sich aber nicht mehr genug weiße Farbe befand, um das Blau des Tages komplett zu verdecken. Stratus-Wolken sind eigentlich kaum noch Wolken, sondern fast schon Nebel.
Vorn sprach jemand. Über die Welt nach Harmagedon. Über das Aufräumen. Johanna bekam ein schlechtes Gewissen. Ihre Gedanken waren abgeschweift, das war respektlos Jehova gegenüber. So wie es falsch war, in Wolken Zuckerwatte zu sehen oder resublimierten Wasserdampf. Wolken waren – wie alles auf der Welt – das Werk des Allmächtigen. Die Pracht, die Jehova erschuf, war keine Süßware. Und es war kein wissenschaftlicher Vorgang.
Als Johanna vierzehn Jahre alt war, hatte sie die Ältesten gefragt, ob alle Wissenschaft schlecht sei. Biologie und Physik waren ihre Lieblingsfächer in der Schule gewesen, und sie war sich nicht sicher, ob das so sein durfte. Die Ältesten hatten das Mädchen freundlich angelächelt und gesagt: Nein, Wissenschaft sei nicht schlecht, solange man sich darüber im Klaren sei, dass alle Wissenschaft das Werk Jehovas sei. Natürlich gibt es die Photosynthese und die Schwerkraft – aber es gibt sie eben, weil Jehova die Photosynthese und die Schwerkraft erschaffen hat.
Einen Monat nach diesem Gespräch hatte Johanna eine Biologie-Arbeit über die Mendelsche Vererbungslehre und die DNA des Menschen geschrieben. Sie hatte eine Eins für diese Arbeit bekommen. Ihre Eltern waren verunsichert deswegen gewesen und mit der Arbeit zu den Ältesten gegangen, woraufhin die Johanna zu sich bestellt hatten.
»Johanna«, hatte der Älteste Dorian gesagt, »es gibt keine DNA. Das ist ein Irrglaube der Weltmenschen. Wer wir sind, was aus uns wird, liegt allein in der Gnade Jehovas und unserem Glauben und gottesfürchtigen Verhalten. Unsere Seele kann man nicht in einem Zellkern finden. Wer an Gene glaubt, glaubt auch an die Evolutionslüge. Doch natürlich stammen wir nicht vom Affen ab. Jehova hat uns so erschaffen, wie wir sind, nicht als Tiere.«
»Und der Beweis«, ergänzte Georg – ein anderer Ältester – »ist doch so offensichtlich: Wenn aus Affen Menschen werden, warum verwandeln sich dann all die Affen in Afrika nicht in Menschen?«
Dorian nickte bestätigend.
Am nächsten Tag musste Johanna mit der Biologie-Arbeit zum Lehrer gehen und darum bitten, dass sie nicht gewertet wird. Sie hätte einen Fehler gemacht. Der Lehrer war natürlich sehr erstaunt gewesen. Er wollte mit ihr diskutieren, doch Johanna senkte den Blick und schwieg. Schließlich sagte der Lehrer, er würde das Problem mit der Schulleitung besprechen. Und dann schaute er Johanna mit diesem Blick an, den sie zur Genüge kannte. Derselbe Blick, den auch die Leute hatten, bei denen sie an der Tür klingelten, um mit ihnen über das Ende der Welt zu sprechen: ein mitleidiger Blick. So, als wäre sie behindert. Oder eine Gefangene. Johanna hasste diesen Blick.
Johanna hatte die Realschule besucht. Vom Religionsunterricht war sie als Zeugin Jehovas befreit gewesen, beim Sportunterricht musste sie – obwohl ihre Eltern es zu verhindern versucht hatten – mitmachen. Es gab aber Sonderregelungen. Die Zeugen Jehovas betrachteten es als Vergehen gegen ihren Gott, an sportlichen Wettkämpfen teilzunehmen. Es war falsch, gegen andere gewinnen zu wollen. Es war aber kein Vergehen, seinen Körper zu trainieren. Während ihre Mitschüler Völkerball oder Volleyball spielten, musste Johanna deshalb meistens laufen. Immer im Kreis. Sie war schnell. Und sie wurde immer schneller. Johanna lief, während die anderen spielten, und so bekam Johanna eine Eins in Sport. Johanna hatte viele Einsen. Sie hätte das Abitur machen können. Doch ihre Eltern hielten das für Unsinn. So etwas machte Mädchen nur aufmüpfig und ungebührlich stolz. Johanna sollte heiraten, im Büro arbeiten wie ihre Mutter, Kinder bekommen und ein gottesfürchtiges Leben führen.
Wieder ein schrilles Pfeifen. Matthias hatte eine weitere Rückkopplung verursacht, als er mit dem eingeschalteten Mikrofon zu den Gläubigen getreten war. Der Diskussionsteil des Gottesdienstes hatte begonnen. Meistens wiederholte nur jemand, was er in einem der Beträge des neuen Wachtturm gelesen hatte, und einer der Ältesten nickte dann und sagte: »Ja, genau, so sei es.« Anschließend wurde noch ein wenig ausgeführt, was genau dort stand und warum es richtig und wichtig war.
Doch heute war es anders. Heute wurde eine Frage gestellt, die nicht vorherzusehen war.
»Ich möchte über diesen Pulli sprechen«, sagte Anna und hielt ein Sweatshirt hoch, auf dem ein grünes Wesen zu sehen war, das Glubschaugen und zwei Tentakel auf dem Kopf hatte. Es sah süß aus. »Mein Sohn hat es in der Schule geschenkt bekommen. Die ganze Klasse hat an einem Ausflug in ein Umweltzentrum teilgenommen, und am Ende bekam jeder Schüler so einen Pulli geschenkt.«
Johanna las, was unter dem Bild des grünen Kobolds zu lesen war: Umwelt-Alien Romeo: Keep The Earth Clean.
»Mein Sohn hat sich sehr über den Pulli gefreut. Er hat auch eine richtig gute Qualität«, fuhr Anna fort. »Aber ich kann mich erinnern, dass damals, als diese Fernsehserie lief, mit diesem Außerirdischen … Wie hieß der noch?«
»Alf«, half jemand aus der Gemeinde aus.
»… dass damals ein Kind einen Pulli mit einem Bild von diesem Alf hatte und dass es hieß, es sei schändlich, ein Bildnis zu tragen, das keine Kreatur Jehovas zeige«, fuhr Anna fort. »Lästere ich meinem Herrn, wenn ich Peter den Pulli mit dieser Phantasiegestalt tragen lasse?«
Allgemeines Gemurmel und Getuschel. Johanna wusste, dass Anna und ihre Familie arm waren. Sie hatten vier Kinder, ihr Mann hatte vor zwei Jahren seine Arbeit verloren und noch keine neue Anstellung gefunden. Wie viele Zeugen Jehovas nahm die Familie keine staatliche Hilfe in Anspruch. Anna putzte Büros, ihr Mann half als Möbelpacker aus. Die beiden älteren Kinder trugen Zeitungen und Prospekte aus. Jeder Cent wurde vermutlich zweimal umgedreht, bevor er ausgegeben wurde. Ein geschenktes Sweatshirt war eine gute Sache für sie.
Die Ältesten, die vorn im Saal an einem Tisch saßen, steckten kurz die Köpfe zusammen.
Dann antwortete Dorian, der inzwischen über siebzig war und die Geschicke der Gemeinde seit vielen Jahren lenkte: »Du weißt, dass wir keine Listen führen, was erlaubt ist und was nicht. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt, sagt Epheser 5,10. Aber es ist gottgefällig, dass du diese Frage stellst und dir Gedanken darüber machst. Ich danke dir.«
Anna würde das Sweatshirt noch heute in den Müll werfen. Und etliche andere Familien würden die Schränke ihrer Kinder öffnen und über Prinzessin Lilifee- und alte Pokémon-Klamotten grübeln.
Johanna bemerkte, dass Matthias sie anschaute. Als sich ihre Blicke trafen, lächelte er. Er wurde rot dabei. Johanna lächelte zurück. So freundlich, wie es ihr möglich war.
Sie wollte keinen Mann, der rot wurde, wenn er sie ansah.
3.
Es klingelte. Zuerst nahm Arne es nicht richtig wahr, baute das Geräusch der Türklingel in seinen Traum ein, in dem es irgendwie um sprechende Fische und einen langen Tunnel ging und ein Klingeln eigentlich nichts zu suchen hatte, doch als es erneut schellte – energischer und anhaltender diesmal –, verstummten die Fische, und Arne wachte auf. Er stöhnte und schaute auf die Uhr. Es war kurz vor zwölf Uhr mittags. Es war noch keine vier Stunden her, dass er eingeschlafen war.
Wenn Arne von seiner Arbeit nach Hause kam, legte er sich nie gleich ins Bett. Nicht, dass er nicht müde wäre – das stundenlange Stehen am Grill, die Arbeit, die Mixtur aus nächtlicher Frischluft und fettigen Dünsten hatten einen unbestreitbar erschöpfenden Effekt –, aber etwas störte Arne an der Vorstellung, direkt von der Arbeit in den Schlaf zu gleiten. Irgendwas musste seiner Ansicht nach dazwischen noch geschehen. Leben. Allerdings waren die Möglichkeiten der Lebensgestaltung zwischen fünf und zehn Uhr morgens ausgesprochen begrenzt, weswegen Arne meistens noch eine Stunde »GTA« oder »Call of Duty« auf der Playstation spielte oder eine DVD anschaute. Vorhin hatte er sich den neuen Tarantino-Film angesehen, den ein Kumpel ihm aus dem Netz runtergeladen hatte. Das Ding hatte Überlänge und so war Arne noch später eingeschlafen als sonst.
Und jetzt klingelte es.
In Unterhose und einem Werbe-T-Shirt der Bierfirma, die Udos Imbiss belieferte, schlurfte Arne zur Tür. Seine Haare waren noch strubbliger als ohnehin schon, einige der weißblond-punkig gefärbten Strähnen standen ihm wie kleine Antennen vom Kopf ab. Es bimmelte erneut, und Arne öffnete seufzend die Tür. Er wusste, wer ihn störte.
»Guten Morgen, Frau Dierck«, brummelte er und schaute seine Nachbarin an. Sie war fast zwei Köpfe kleiner als er.
»Ich hab keinen Saft mehr, Schätzchen. Nicht einen Tropfen«, sagte Frau Dierck.
Frau Dierck war Mitte achtzig und tauchte in regelmäßigen Abständen mit den fadenscheinigsten Begründungen auf, um mit ihm zu klönen. Sie war nicht gerne allein, und sie wusste, dass der nette junge Mann nebenan immer ein freundliches Wort und vor allem ein offenes Ohr für sie hatte.
»Ich hab keinen Saft da, Frau Dierck«, sagte Arne. »Aber ich bring Ihnen nachher welchen von Penny mit, okay?«
»Hast du etwa noch im Bett gelegen, Schätzchen?«, fragte Frau Dierck.
Arne vermutete, dass sie seinen Namen schon vor langer Zeit vergessen hatte. Sie nannte ihn immer nur Schätzchen. Soweit er es beobachtet hatte, nannte sie jeden Menschen, mit dem sie sprach, Schätzchen: den Postboten, die Frau aus dem dritten Stock, die Tochter der Frau aus dem dritten Stock, und wenn Mia Arne besuchte und Frau Dierck es gelang, sie erfolgreich im Treppenhaus abzufangen, dann nannte Frau Dierck auch Arnes Freundin Schätzchen. Sie lebte in einer Welt voller Schätzchen.
»Du solltest nicht mitten am Tag im Bett liegen«, tadelte ihn Frau Dierck. »Musst du nicht arbeiten?«
»Ich arbeite nachts, Frau Dierck. Das wissen Sie doch«, seufzte Arne.
»Oh Gott, hab ich dich etwa geweckt, Schätzchen?«, rief sie.
»Ist okay, kein Problem«, sagte Arne.
»Das passiert nicht wieder. Versprochen!«, beteuerte Frau Dierck, und Arne wusste, dass das nicht stimmte.
Zwischen zwölf und zwei Uhr mittags war ihre bevorzugte Zeit, in der sie ihn aus dem Bett klingelte. Vor einigen Wochen hatte Arne sogar mal die Klingel abmontiert, um endlich einmal durchschlafen zu können. Er hatte nicht geahnt, wie energisch und unermüdlich diese alte Dame klopfen konnte.
»Apfel oder Orange?«, fragte Arne.
»Was?«, wollte Frau Dierck wissen.
»Soll ich Ihnen Apfel- oder Orangensaft mitbringen?«
»Maracuja«, sagte sie. »Das alte Mädchen mag Maracuja.«
Frau Dierck sprach öfter mal von sich selbst als »altem Mädchen«. Arne hatte Schwierigkeiten, sich diese hagere, verhutzelte und ungemein faltige Frau als kleines Mädchen vorzustellen. Aber natürlich war auch Frau Dierck mal jung gewesen und neugierig auf das, was das Leben für sie bereithielt.
Frau Dierck, das hatte sie ihm schon unzählige Male erzählt, hatte als Taxifahrerin gearbeitet. Bis sie siebzig Jahre alt war. »Früher sind die Männer oft gar nicht gern bei mir eingestiegen, weil sie dachten, Frauen können nicht Auto fahren«, hatte sie sich erinnert. »Aber das waren andere Zeiten.«
Arne fragte sich, ob die alte Dame auch all ihre Fahrgäste Schätzchen genannt hatte.
»Tja«, hob Arne an. »Ich muss dann auch … Ich hab noch … viel zu tun.«
»Was hast du denn zu tun?«, fragte Frau Dierck. »Ich dachte, du hast eben noch geschlafen.«
»Ach. Alles Mögliche: Steuererklärung. Spanisch lernen. Und ich wollte heute endlich mal die ganzen Küchenschränke mit Papier auslegen und auch mal gründlich in den Ecken saugen«, sagte Arne mit ernstem Gesicht.
Frau Dierck brauchte eine Sekunde, bis sie das als Scherz erkannte. Dann kicherte sie und stupste Arne: »Mach dich mal lustig über eine alte Frau! Du kleiner Rotzlöffel!«
»Ich bringe Ihnen den Saft nachher vorbei«, lächelte Arne.
»Ach, keine Eile«, sagte Frau Dierck. »Muss nicht sein. Nur wenn du Zeit hast, sonst nicht. Ich kann auch Wasser trinken.«
»Nee, nee. Das krieg ich schon hin. Kein Problem«, lächelte er. »Also, bis nachher. Tschüss, Frau Dierck.« Er schloss die Tür.
Eine Stunde später war Arne geduscht, angezogen und halbwegs wach. Während er sich fertig gemacht hatte, hatte sein PC eine Playlist von Spotify heruntergeladen und auf CD gebrannt. Er steckte die CD in die Tasche und verließ die Wohnung. Arne ging die acht Stockwerke hinunter. Der Aufzug funktionierte momentan zwar, aber Arne traute ihm nicht. Das Hochhaus nahe dem Bismarck-Denkmal, nicht weit von Landungsbrücken, Michel und Reeperbahn entfernt, war eine der letzten Malocher-Bastionen im ansonsten fast komplett gentrifizierten Hafenbereich Hamburgs. Relativ billige, relativ kleine, seit Jahren nicht mehr renovierte Wohnungen in einem Gebäude, dessen Eigentümer nur das Allernötigste an Wartungsarbeiten durchführen ließ. Wenn überhaupt. Der Lift des Gebäudes jedenfalls hatte auffallend oft ein Außer Betrieb-Schild an den Türen kleben, diverse Boden- und Wandfliesen im Treppenhaus waren und blieben zerbrochen. Arne war es egal. Lieber so als teuer.
Arne ging die Ludwig-Erhard-Straße bis zum Rödingsmarkt und dann weiter in Richtung Mönckebergstraße, Hamburgs Haupt-Einkaufsgebiet. Je näher er den großen Shops und Kaufhäusern kam, desto voller wurden die Gehwege. Samstag war Shoppingtag. Kurz bevor Arne den Rathausmarkt erreichte, blieb er stehen. Wie immer traf ihn an dieser Kreuzung ein Stich ins Herz. Arne schaute auf das leere Ladengeschäft mit dem Zu vermieten-Schild im Fenster. Innen drin: Betonboden, eine durchstoßene Wand, Schutt. Bis vor acht Wochen hatte Arne in diesem Ladenlokal die Vision einer Bar gesehen. Einer Cocktail-Bar. Er hatte eine ganz genau Vorstellung davon gehabt, wie sie sein sollte: karibisch einerseits, viel Holz, helle Farben, andererseits aber auch cool, ein wenig loungemäßig, mit DJ. Ein Indoor-Beachclub – jung, ein bisschen schräg, definitiv hip.
Jeder, der Arne kannte, wusste von seinem Traum. Da kamen die Gastronomen-Gene eben doch durch. Wenn Arne betrunken oder bekifft war, erzählte er jedem, wirklich jedem, von seinem Traum einer eigenen Bar. Freeport Lounge wollte er sie nennen. Unzählige Zettel, Bierdeckel und Servietten hatte er schon bekritzelt, um das Logo für die Fensterfront zu entwerfen. Und irgendwann – es war wie ein Geschenk gewesen – hatte plötzlich jemand seine Euphorie geteilt, seine Idee grandios gefunden und war total drauf angesprungen.
Arne hatte Nick in einem Irish Pub auf dem Kiez kennengelernt. Eigentlich nicht der Typ Mensch, mit dem er viel am Hut hatte: ein smarter, junger Geldsack mit edlen Klamotten und einer fetten Uhr. Gerade mal dreißig, aber schon stinkreich. Zumindest nach Arnes Maßstäben.
Zuerst schien es nur eine von vielen flüchtigen Kneipenbekanntschaften zu sein. Irgendjemand, mit dem Arne eine Weile quatschen und sich dann auf Nimmerwiedersehen verabschieden würde. Arne brauchte nicht lange, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Er bemühte sich nicht mal darum. Irgendwie lockte er mit seiner Art die Leute an. Doch dieser Nick, das stellte sich dann heraus, war genau der Mann, auf den Arne gewartet hatte. Denn Nick machte »in Investments«. Und Arnes Idee, die er Nick nach zwei Bier und ein paar Kurzen pitchte, schien Nick ein geiles Investment zu sein. Stundenlang – zunehmend betrunken – schwelgten die beiden Männer dann in Freeport-Lounge-Visionen.
Als Nick am nächsten Tag bei Arne anrief und weiter über das Projekt reden wollte, war klar, dass es nicht bloß eine buchstäbliche Schnapsidee war. Es war plötzlich eine realistische Option geworden. Die beiden trafen sich, ließen sich vom Makler die Immobile zeigen, planten Konzept und Inneneinrichtung. Nick stellte Arne zwei Freunde vor – gegelte Haare, fette Uhren, teure Schuhe. Die Idee war, dass sie die Bar zu viert als gleichberechtigte Partner eröffnen würden. Nick und seine Kumpel arbeiteten einen Finanzierungsplan aus. Als sie Arne dann eröffneten, dass jeder 38000 Euro Startkapital bräuchte, fiel Arne aus allen Wolken. Es war illusorisch, dass er solch eine Summe auftreiben konnte!
Nick fand es schade, als Arne abwinkte, aber da könne man nichts machen. Dann würden er und seine Freunde die Sache leider allein durchziehen müssen. Arne sei aber immer herzlich willkommen in der Freeport Lounge, Free Drinks auf Lebenszeit! Ehrensache, schließlich sei es ja seine Idee gewesen.
Die Vorstellung, dass jemand anderes seinen Traum lebte, war für Arne schlichtweg unerträglich. Er überwand sich und sprach mit seinen Eltern über diese einmalige Geschäftsgelegenheit. Arnes Vater und Mutter waren natürlich skeptisch, aber insgeheim auch glücklich, dass ihr Sohn Initiative zeigte und in gewisser Weise in ihre Fußstapfen zu treten gedachte. Also lösten sie eine ihrer Lebensversicherungen vorzeitig für ihn auf und konnten ihm so immerhin mit knapp 20000 Euro aushelfen. Mehr war nicht möglich. Arne fragte Nick, ob er mit dieser Summe einsteigen könne. Er würde sich auch mit einem kleineren Prozentsatz der Einnahmen zufriedengeben. Doch Nick, der von diesen Sachen einfach sehr viel mehr verstand als er, hielt Arne einen langen Vortrag über juristische Vorgaben einer Partnerschaft und dass solche Deals eben nur praktikabel seien, wenn jeder dasselbe beisteuere. Arne fragte, ob Nick ihm nicht den Rest leihen könnte, doch das fand Nick »unsauber«. Arne begriff, dass Nick und seine Freunde mit der Bar das ganz große Geschäft witterten und ihn gar nicht mehr dabeihaben wollten. Das aber konnte nicht angehen! Und so beging Arne den bislang größten Fehler seines Lebens: Er sprach mit Big O.
Big O hieß tatsächlich Oleksander und war der berüchtigtste Kredithai auf dem Kiez. Arne kannte ihn überhaupt nur, weil er manchmal eine Wurst an Arnes Imbiss aß, fast immer begleitet von zwei sehr gemein aussehenden Muskelpaketen. Big O hieß nicht umsonst Big O: Er war fett. Und Arnes Bratwürste hatten einen kleinen Beitrag zu seiner voluminösen Erscheinung geleistet.
»Zwei Monate, zwanzig Prozent Zinsen«, hatte Big O ihm nüchtern erklärt, nachdem Arne ihm nervös stammelnd sein Anliegen vorgetragen hatte.
»Das geht nicht«, hatte Arne eingewandt. »Ich brauche das Geld, um die Bar zu eröffnen. Bis dann die ersten Einnahmen da sind und ich alles zurückzahlen kann, dauert es eine Weile.«
Big O schüttelte den Kopf: »Du bist nur kleiner Junge mit Würstchen. Keine Langzeitkredite.«
Arne berichtete Nick davon, und Nick hatte die Lösung. Wenn sie alle vier die entsprechenden Verträge unterschrieben, die Immobilie anmieteten und das Konzept vorlegten, würde jede Bank Arne einen Anschlusskredit gewähren. Damit könne er dann Big Os Wucherzinsen zahlen und anschließend seine Schulden in Ruhe bei der Bank abstottern.
Und so bekam Arne im Hinterzimmer einer Peepshow vom gelangweilten Big O achtzehntausend Euro in bar überreicht. Wenige Tage später unterschrieb er mit Nick und seinen Freunden im Beisein eines Anwalts Verträge, überwies die gesamten 38000 Euro auf ein von Nick eingerichtetes Treuhandkonto – und hörte dann nie wieder von ihm! Nicks Handynummer war von einem auf den anderen Tag nicht mehr vergeben. Der angebliche Anwalt mit den Verträgen war bei der Anwaltskammer unbekannt. Der Vermieter des Lokals erinnerte sich zwar gut daran, dass Nick und Arne die Immobilie besichtigt hatten, aber bei wem auch immer er den vermeintlichen Mietvertrag unterschrieben habe – derjenige gehörte ganz sicher nicht zu seiner Maklerfirma.
Arne war betrogen worden. Und er war unfassbar wütend auf sich selbst, auf seine Naivität, auf die Leichtigkeit, mit der man ihn reingelegt hatte. Er hatte sich für clever gehalten, dass er auf Verträgen bestanden hatte, auf einem Juristen, der alles beaufsichtigt. Dass man ihm alles nur vorspielte, dass tatsächlich irgendein Arschloch sich als Anwalt ausgab, hatte er sich nicht vorstellen können. Arne fand es entwürdigend, dass er vermutlich nicht einmal professionellen Betrügern aufgesessen war. Offensichtlich war dieser Nick einfach ein skrupelloser Typ, der eine Chance auf schnelles Geld gewittert hatte und ein paar Freunde als Komplizen gewinnen konnte. Ganz sicher wohnten die irgendwo in Hamburg, hatten gute Jobs, ein mehr als abgesichertes Leben und brauchten das Geld gar nicht. Sie hatten es sich bloß genommen, weil sie es konnten. Vielleicht war es auch nur ein Spiel für sie gewesen. Ein lukratives Spiel. Und jetzt amüsierten sie sich wahrscheinlich prächtig darüber. Während Arne erledigt war.
Seinen Eltern hatte er immer noch nichts von seiner schmachvollen Dummheit erzählt, selbst Mia glaubte immer noch, dass er demnächst die Bar eröffnen würde und nur deshalb so knapp bei Kasse war, weil er alles in dieses Projekt stecken würde. Mia hielt ihn für einen Macher, und Arne brachte es einfach nicht fertig, ihre naive und schmeichelhafte Sicht auf ihn zu korrigieren. Er würde seiner Freundin und seinen Eltern beichten müssen, dass er sich dermaßen leichtfertig hatte reinlegen lassen. Doch das war das kleinere Problem. Das größere Problem war Big O. Der würde in zwei Tagen sein Geld zurückhaben wollen. Geld, das Arne nicht besaß. Arne würde mit ihm reden müssen, ihn um einen Aufschub bitten. Und der käme ihn vermutlich sehr teuer zu stehen. Big Os Verzugszinsen wollte Arne sich gar nicht ausmalen.
Er warf noch einen letzten wehmütigen Blick auf das ausgehöhlte Ladenlokal, dann ging er weiter.
4.
Johanna trug eine weite, grauschwarze Jogginghose, die die Form ihrer Beine nicht einmal erahnen ließ. Sie hatte schöne, lange, wohlgeformte Beine, und obwohl es sich nicht geziemte, war sie stolz darauf. Wenn Johanna die Plakate sah, auf denen Models für H&M und ähnliche Modeketten posierten, dann gestand sie sich zu, dass sie fast genauso schöne Beine hatte wie diese Frauen. Auch wenn es sonst wenig Ähnlichkeiten zwischen den Models und ihr gab.
Johanna trug ihr dunkelblondes Haar schulterlang, ohne einen besonderen Schnitt, und manchmal – so wie jetzt, wenn sie ihre Runden durch die nahe gelegenen Schrebergärten lief – band sie sie zu einem Pferdeschwanz zusammen. Johannas Gesicht war frei von Make-up.