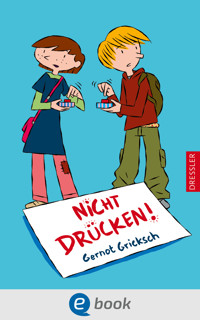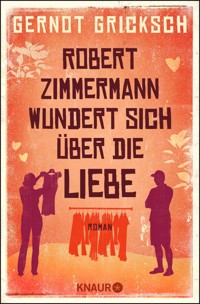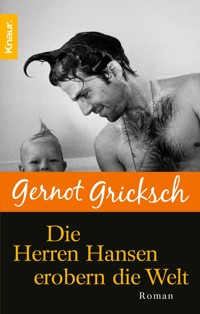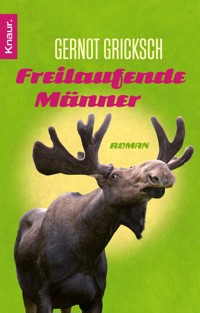6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zuerst die gute Nachricht: Ja, es gibt sie wirklich, die eine große wahre Liebe und den einen Menschen, den das Schicksal für uns vorherbestimmt hat. Dummerweise ist das Schicksal manchmal aber etwas schlampig bei der Durchführung seiner Pläne. So kommt es, dass Simone und Mark lange nach dem großen Glück suchen müssen: in Hamburger Teeläden, auf dem Roten Platz in Moskau, bei der Oderflut in Brandenburg. Während sie Taxi fahren und Sushi verkaufen. In den wilden 70ern und im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Und sie ahnen nicht, dass sie sich immer wieder haarscharf verpassen … Königskinder von Gernot Gricksch: als eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Gernot Gricksch
Königskinder
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Es gibt sie wirklich, die wahre Liebe! Simone und Mark sind füreinander bestimmt. Und obwohl sie sich immer wieder haarscharf verpassen – als Kinder in den Siebzigern, als Erwachsene zu Beginn des 21. Jahrhunderts, in Hamburg und Berlin, Moskau und Costa Rica – erzählt dieser Roman die schönste Liebesgeschichte des Jahres …
Inhaltsübersicht
Wir werden vom Schicksal [...]
19. September 2009
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
19. Mai 2010
Nachbemerkung
Wir werden vom Schicksal entweder hart oder weich geklopft.
Es kommt auf das Material an.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH
Schicksal und Wille stets in Fehden,
So dass der Wille sich am Schicksal bricht,
Nur der Gedank’ ist dein, der Ausgang nicht.
WILLIAM SHAKESPEARE, »HAMLET«
Wenn wir ständig darauf Rücksicht nehmen würden,
was realistisch ist und was nicht –
was würde dann aus der Gurkentrompete?
MARK EVANS, »BLEAK EXPECTATIONS«
19. September 2009
Hallo, Du!
Ich habe keine Ahnung, wer Du bist – aber ich weiß, dass es Dich gibt. Irgendwo da draußen bist Du. Ich schreibe Dir, weil ich nicht weiß, an wen sonst ich diesen Brief richten könnte. Ich weiß nur, dass er unbedingt geschrieben werden muss.
Ich vermute, er wird ziemlich lang werden, dieser Brief. Ich habe einiges zu erklären. Oder nein – das ist falsch. Ich kann gar nichts erklären, weil ich nämlich gar nichts verstanden habe. Das ist ja mein Problem.
Genau genommen geht’s darum in diesem Brief: um das Verstehenwollen. Ich will verstehen, warum ich mit meinen fast vierzig Jahren da bin, wo ich gerade bin, und die Dinge so laufen, wie sie laufen. Sie laufen übrigens nicht mal ansatzweise so, wie ich es gerne hätte.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Brief zu spät schreibe. Dass ich schon viel früher über mein Leben hätte nachdenken müssen. Aber ich bin ja oft zu spät. Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich eigentlich niemals pünktlich. Aber ich kann nichts dafür: Für meine innere Uhr gibt es einfach keine passende Batterie. Und wenn es doch eine geben sollte, dann wird sie heimtückischerweise von irgendjemandem vor mir versteckt. Ich bin nie dann dort, wo ich wann eigentlich sein sollte.
Ich verrate Dir ein Geheimnis. Du wirst es vielleicht für typisch weibliches Gefasel halten, für östrogenen Unfug. Aber ich meine es absolut ernst: Die Tatsache, dass die Zeit und ich auf Kriegsfuß stehen, dass ich ständig etwas zu verpassen scheine und ich mein Dasein vom ersten Tag an auf einem verschlungenen und holprigen Trampelpfad durchschreiten musste, anstatt den Luxus eines geradlinigen, sorgfältig asphaltierten und gut ausgeschilderten Lebensweges genießen zu dürfen, ist kein Zufall. Es ist Schicksal! Ja, genau: das große, gruselige S-Wort!
Vielleicht glaubst Du nicht an so etwas. An Dinge, die größer sind als wir und die wir niemals verstehen werden. An Mächte, die uns lenken und formen. Aber ich weiß, dass es so etwas gibt! Mein Schicksal hat vom ersten Tag an enorme Energie darauf verwandt, mich von etwas oder jemandem abzulenken. Ich spüre es tief in meinem Innersten: Fast vierzig Jahre lang bin ich von einer verpassten Chance zur nächsten gestolpert. Irgendetwas Großes, Mächtiges und Wunderbares wurde mir bislang von der Vorsehung böswillig vorenthalten. Es ist, als ob ich durch eines dieser vermaledeiten Spiegelkabinette auf dem Rummelplatz irre, immer wieder gegen eine heimtückisch polierte Scheibe stoße, mich von den glänzenden Spiegelflächen auf falsche Fährten leiten lasse, im Kreis laufe und permanent die falsche Abzweigung nehme. Ich komme nirgendwo an und sehe immer bloß mich selbst – orientierungslos und stetig alternd. Dabei weiß ich ganz genau: Irgendwo geht’s raus aus diesem ersten Raum meines Lebens, in dem ich mich schon viel zu lange aufhalte. Irgendwo geht’s weiter. Muss ja.
Ich habe beschlossen, Dir meine ganze Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, mein Leben wird Dich nicht allzu sehr verwirren, obwohl es zweifelsohne einige Ungereimtheiten und Widersprüche aufzuweisen hat. Und das sogar gleich schon zu Beginn.
Kapitel 1
1970
Ich kam zu früh. Drei Wochen zu früh, um genau zu sein. Unerklärlicherweise und völlig meinem Charakter widersprechend verspürte ich im spätfötalen Stadium das unbändige Bedürfnis, nicht länger warten oder trödeln zu wollen, sondern endlich geboren zu werden.
Meine Mama befand sich gerade im Hamburger Stadtpark, als ich meine erste energische Attacke in Richtung Geburtskanal startete. Sie stand auf der Wiese nahe dem Planetarium und machte Tai-Chi. Schattenboxen. Heute macht das jede fünfte Hausfrau im Wohnzimmer, während dazu in der Glotze der Shoppingkanal flimmert, aber 1970 war das noch etwas sehr Exotisches. Mama versucht stets, sich mit dem Schöpfungskreislauf der Erde in Einklang zu bringen, und hatte in einem ihrer zahllosen spirituellen Bücher gelesen, dass das am besten zu bewerkstelligen sei, wenn man sich auf ein Bein stellte, im Zeitlupentempo die Arme schwenkte, als würde man eine Schildkröten-La-Ola vollführen, und dabei durch nur minimal geöffnete Lippen, mehr aus dem Bauch als aus der Lunge heraus, ein tantrisches Ommmm entweichen ließ. Und das alles bitte schön so naturnah und frischluftig wie möglich.
Da Mama aber zu diesem Zeitpunkt einen Bauch mit sich herumschleppte, der in Form und Gewicht an einen VW-Käfer erinnerte, musste sie sich, während sie auf einem Bein in der sogenannten Kranichstellung verharrte, mit einer Hand an einem Mülleimer festhalten, den sie von der Seite einer nahe gelegenen Parkbank mühsam auf die Wiese gezerrt hatte. Mit der anderen Hand wedelte Mutti träge herum, als wolle sie ganz langsam eine imaginäre Scheibe putzen oder antriebsarme Insekten verscheuchen. Das rituelle Ommmm, das sie würdevoll summen sollte, verwandelte sich angesichts ihrer generellen Anspannung, Kurzatmigkeit und (Gleich)Gewichtsproblematik in ein ziemlich erbärmliches und unmelodisch gekeuchtes Ömmmmpf.
Da stand sie also, meine wuchtbrummige Mutter, in ihrem orangefarbenen Batikkleid, mit den langen, hennaroten Haaren, in die sie sich feine Zöpfe und Perlenfäden geflochten hatte, mit ihren selbstgefertigten Ohrringen und den indischen Stoffschuhen – und klappte fast zusammen, als ich sie ohne Vorwarnung mit der ersten Wehe überraschte.
Es war sieben Uhr morgens. Der Stadtpark war menschenleer. Niemand war in Sicht, der ihr in dieser prekären Situation zur Seite stehen konnte. Meine Mutter war klug genug, sich in ihrem Zustand nicht hinter das Lenkrad ihres klapprigen VW-Busses setzen zu wollen, der noch dazu ziemlich weit entfernt auf einem Parkplatz stand und, nebenbei bemerkt, die handgemalte Aufschrift Traumwolke – Der Laden für Schmuck, Tee und Klamotten trug. Sie setzte sich stattdessen mit stampfenden, schwankenden Schritten in Bewegung. Ihre riesigen Ohrringe und die kleinen Glöckchen an ihrer Fußkette bimmelten und klimperten, während sie zum Planetarium stampfte. Hinter der Sternwarte war die nächstgelegene Straße. Und auf dieser Straße würde sie sicher jemanden finden, der ihr half.
Der Weg dorthin erschien meiner Mutter wie die Besteigung eines Mittelgebirgszuges. Immer wieder musste sie innehalten, sich an einem Baum oder einem Laternenpfahl abstützen und die internen Schläge und Stöße, die ich ihr verpasste, aushalten, ohne zusammenzubrechen. Als Mama nach einer Viertelstunde endlich die Hindenburgstraße erreichte, lief ihr das Fruchtwasser am Bein hinunter. Vor ihr brauste, im krassen Gegensatz zur meditativen Einsamkeit des Stadtparks, eine lange und laute Autokarawane vorbei. Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Das war die Rettung!
Oder auch nicht.
Als meine Mutter brüllend aus dem Gebüsch auf die Straße stampfte wie eine wuchtige Naturgewalt, muss das ein wenig ausgesehen haben wie das Kino-Monster Godzilla, wenn es massig und tobend auf der Hügelkette über Tokio auftaucht, bereit, die ganze Stadt in Schutt und Asche zu legen.
»Ich bin schwanger!«, schrie meine Mutter den vorbeibrausenden Autos zu. »Ich bekomme ein Kind!«
Auf dem Weg zur Entbindungsklinik, erzählten mir meine Eltern, wären wir alle beinahe gestorben. Eine dicke, laut brüllende und offenbar verrückte Frau in einem bizarr bunten Kleid war plötzlich aus dem Dickicht neben der Straße hervorgebrochen und hatte sich direkt vor die Autos zu stürzen gedroht.
»Halt!«, schrie meine Mutter laut. »Um Himmels willen, Peter! Bremsen!« Doch mein Vater gab stattdessen Gas und zischte so schnell an der Frau vorbei, dass meine Mutter kaum ihr Gesicht erkennen konnte. Mit seinen stählernen Nerven und seiner nüchternen Einschätzung der Situation hat mein Vater damals vermutlich einen tödlichen Auffahrunfall verhindert, in den nach dem Dominoprinzip locker ein Dutzend Wagen hätte verwickelt werden können. Das war typisch für ihn. Mein Vater verlor nie den Überblick, reagierte immer richtig und wusste stets, was zu tun ist. Er war der präziseste und logischste Mensch der Welt. Von ihm habe ich meine fast schon manische Pünktlichkeit geerbt. Und meine erbarmungslose Logik.
Als mein Papi damals erfuhr, dass seine Frau schwanger war, hatte er sich natürlich zuerst einmal gefreut. Dann aber machte er sich unverzüglich daran, alles zu organisieren. Meine Mutter bekam bereits in der achten Schwangerschaftswoche eine von ihm sorgfältig ausgearbeitete Tabelle überreicht, in der jeweils links die Prämisse stand und rechts die logische Schlussfolgerung daraus. In Zeile 7 stand zum Beispiel: Ich leide unter Sodbrennen und/oder Durchfall. Rechts hatte er die konsequent daraus resultierende Handlung aufgeführt: Weniger Gewürze, keine Schokolade.
Als mein Vater viele Jahre später seinen ersten Computer kaufte und zum ersten Mal die tabellarischen Wunder des Excel-Programms zu Gesicht bekam, war das vermutlich einer der schönsten Momente seines Lebens. Die Schwangerschaftstabelle meiner Mutter war von ihm allerdings noch sorgfältig mit Bleistift und Lineal angefertigt worden. Sie umfasste insgesamt 19 Zeilen. In Zeile 19 war links zu lesen: Wehen in Abständen von weniger als 15 Minuten. Und rechts daneben: Es geht los. Ab ins Krankenhaus.
Als meine Eltern in der Klinik von Hamburg-Barmbek eintrafen, setzte mein Vater seine schnaufende Gattin auf einen Stuhl, ging zum Aufnahmeschalter und überreichte der diensthabenden Schwester ein kleines Klarsichtmäppchen, das alles enthielt, was für das Krankenhaus auch nur im Entferntesten von Interesse sein konnte: die Unterlagen der Krankenkasse, Mamas letzten Untersuchungsbefund vom Arzt, ein kurze Liste ihrer bekannten Allergien (Südfrüchte und Jasmin) und einen Zettel voller Telefonnummern, unter denen man ihn im Falle eines hoffentlich niemals eintretenden Unglücks erreichen könne; darauf stand die Privatnummer meiner Eltern, die Nummer der Versicherungsagentur, in der mein Vater arbeitete und sicherheitshalber auch noch die Nummer seiner Eltern, meiner zukünftigen Großeltern, die zwar in Bad Kissingen lebten, aber dennoch, sollte er nicht erreichbar sein, wichtige Entscheidungen treffen könnten.
»Ich liebe dich«, sagte er dann zu meiner Mutter, die sich schwankend erhob, gab ihr einen Kuss und nahm dann auf ebenjenem Stuhl Platz, auf dem kurz zuvor noch seine Frau gesessen hatte. Meine Mutter wurde von einer Krankenschwester in den Kreißsaal gebracht, der damals tatsächlich noch ein Saal war. Drei Frauen brüllten sich darin zeitgleich die Seele aus dem Leib, während sie ihre Kinder herauspressten. Einzig dünne Vorhänge zwischen den Betten simulierten so etwas wie eine Privatsphäre. Männer waren im Kreißsaal nicht erwünscht. Außer Ärzten natürlich.
Mein Vater saß also im Krankenhausflur auf einem Stuhl und schaute auf seine Armbanduhr. Danach holte er ein dickes Buch aus seiner Aktentasche, die er wohlweislich mitgenommen hatte, seufzte einmal und begann zu lesen. Die durchschnittliche Zeitspanne von der Einlieferung ins Krankenhaus bis zur tatsächlichen Entbindung lag bei Erstgebärenden bei 6,4 Stunden. Das hatte er zuvor in Erfahrung gebracht.
»Das darf doch nicht wahr sein!«, brüllte meine Mutter, nachdem sie fast fünf Minuten lang an der Hindenburgstraße hin und her gerannt war, mit den Armen gewedelt, hysterisch gekreischt und verzweifelt versucht hatte, eines der vorbeibrausenden Autos anzuhalten. Warum stoppte niemand? Was waren das für Menschen, die eine hochschwangere und verzweifelte Frau einfach so ihrem Schicksal überließen? Doch dann hatte meine Mutter plötzlich die Eingebung, dass die Autofahrer sich ihrer dramatischen Situation vielleicht gar nicht bewusst waren. Die hatten keine Ahnung, dass sie kurz davor war, ein Kind zu bekommen. Vielleicht dachten diese Leute, sie wäre bloß dick, nicht im neunten Monat, und obendrein ein bisschen gaga. Also raffte Mama kurz entschlossen ihr dünnes Batikkleid und hob es hoch, so dass die Welt ihren nackten, monströs runden und hoffentlich alles erklärenden Bauch sehen konnte, in dem ich gerade nach Herzenslust randalierte. Dass die Autofahrer unterhalb des Bauches ihren geräumigen Frotteeslip sahen, kümmerte sie vermutlich nicht. Ich bezweifle, dass diese exhibitionistische Aktion sie weniger verrückt erscheinen ließ.
Als sie so dastand, die Unterseite des Kleides vor ihrem Gesicht und Wildfremden ihren Berg von Bauch präsentierend, bescherte ich ihr eine erneute, energische Wehe. Mama rollte mit den Augen und kippte um wie ein gefällter Baum. Ein Taxifahrer, der das beobachtete, bremste nun tatsächlich ab, scherte nach rechts aus und kam mit seinem Wagen auf dem Gehweg zum Stehen. Er sprang aus dem Auto und rannte auf meine am Boden liegende Walfischmutter zu, die ihn mit den wenig freundlichen Worten begrüßte: »Das wurde ja auch Zeit.«
Der Taxifahrer war ein kräftiger Mann und gab sein Bestes, um meine Mutter anzuheben. Doch erst als noch zwei weitere Autofahrer anhielten und dem ächzenden Taxifahrer zu Hilfe eilten, war es möglich, Moby Mama zu dessen Auto zu schaffen. Als meine Mutter sah, um was für eine Art von Wagen es sich handelte, keuchte sie entschuldigend: »Oh, ein Taxi. Das tut mir aber leid. Ich habe gar kein Geld dabei.«
»Das ist gerade das geringste Problem«, keuchte der Fahrer angestrengt. Die drei Männer wuchteten meine Mutter auf den Rücksitz, was erst funktionierte, nachdem der inzwischen schweißtriefende Taxichauffeur den Beifahrersitz bis zum Anschlag nach vorne gezogen hatte. Dann hielt einer der drei Samariter plötzlich inne, zeigte auf einen Fleck auf dem Sitzpolster und fragte erschrocken: »Ist das Blut?« Im gleichen Moment stieß meine Mutter einen Schrei aus, der die Scheiben des Wagens zum Vibrieren brachte. »Es kommt!«, kreischte sie. »Mein Kind kommt!«
»Mark«, sagte meine Mutter zärtlich und streichelte sanft meinen Hinterkopf. Ich lag eingewickelt in eine Decke auf ihrem Bauch, frisch gewaschen und erstaunlich unrunzelig, und suchte mit dem Mund ihre Brustwarze. »Mein kleiner Mark!«
Ich wurde zum ersten Mal mit Muttermilch versorgt. Dafür hatte mich die Schwester mitsamt der Plastikwiege, in der ich lag, ins Zimmer meiner Mutter gerollt und mich dann bei ihr angedockt. Drive-in-Stillen sozusagen. Hatte ich genug getrunken, würde sie mich zurückrollen in den Raum, in dem alle Säuglinge nebeneinander in ihren Plastikschalen lagen, wie kleine Rollbraten in der Vitrine eines Fleischereifachgeschäfts. Anfang der 70er Jahre gaben sich Entbindungskliniken aus unerklärlichen Gründen die denkbar größte Mühe, einen allzu engen Kontakt zwischen Babys und ihren Eltern zu verhindern. Trotzdem gab es sie, diese intimen, familiären Glücksmomente.
Wahrscheinlich sahen wir drei in dem schmucken Zweibettzimmer der Wöchnerinnenstation aus wie die kitschige Illustration in einer Broschüre über das Glück der deutschen Kleinfamilie: Mein Vater saß in seinem dunkelgrauen Anzug auf einem Stuhl neben dem Bett, hielt die Hand meiner Mutter und strahlte über das ganze Gesicht. Meine Eltern waren vielleicht keine sehr spannenden Menschen, allzu konservativ und von einer wenig einnehmenden deutschen Gründlichkeit und Rationalität geprägt – aber sie liebten einander und mich mit der gleichen Hingabe, mit der sie ansonsten planten und organisierten. Ich war ein Wunschkind: Aufrichtig gewollt, und ganz bewusst an einem von meinem Vater ausgerechneten, besonders empfängnisbereiten Tag gezeugt. Im Moment dieser schnappschussartigen Idylle schoben zwei Pfleger eilig eine Trage durch den Flur an der offenen Tür unseres Zimmers vorbei. Darauf lag eine Frau in einem grellbunten Kleid, die aus ganzem Herzen lachte.
»Das ist doch die Verrückte aus dem Stadtpark!«, staunte mein Vater. »So ein Kleid gibt’s garantiert nicht zweimal.«
»Was ist das denn für eine?«, fragte meine Mutter eine Krankenschwester, die gerade zu uns ins Zimmer kam.
»Die hat ihr Kind eben im Taxi bekommen«, lächelte die Schwester. »Ein gesundes Mädchen. Aber die Mutter ist total fertig. Der Arzt hat ihr Schmerzmittel gespritzt und jetzt lacht sie die ganze Zeit. Zwischendurch singt sie auch. California Dreaming.« Als das gackernde Gelächter der Frau aus der Ferne des Flurs zu uns drang, musste die Schwester lächeln: »Ein ziemlich verrücktes Huhn, diese Frau. Das pure Chaos. Wir müssen sie gerade aus ihrem ersten Zimmer in ein anderes verlegen.«
Mein Vater warf einen Blick auf das zweite, leerstehende Bett neben dem, in dem meine Mutter mit mir lag, griff schnell in die Brusttasche seines Sakkos und holte einen Zwanzig-Mark-Schein heraus, den er der Schwester reichte. »Bitte sorgen Sie dafür, dass sie nicht in das Zimmer meiner Frau gelegt wird«, bat er sie. »Meine Frau braucht ihre Ruhe.«
Die Krankenschwester lächelte, steckte den Schein in die Tasche ihres Kittels und sagte: »Das wird sich wohl machen lassen. Danke schön.« Bevor sie die Tür hinter sich schloss, dröhnte noch ein »I’d be safe and warm / if I was in L.A.« durch den Gang.
Kapitel 2
1974
Meine Mutter nannte mich Simone. Französisch ausgesprochen, bitte. Nach Simone de Beauvoir, der Lebensgefährtin Jean-Paul Sartres und Mitbegründerin des modernen Feminismus. Mama sah sich als Feministin und gab es gern als emanzipiertes Statement aus, dass sie mich allein erzog. Tatsächlich aber hat sie einfach nicht den Richtigen gefunden. Oder er wollte nicht von ihr gefunden werden. Meine Mutter stand nicht gerade oben auf der Beuteschema-Liste des deutschen Durchschnittsmannes. Sie hatte locker zwanzig Kilo mehr auf den Rippen, als Frauen nach herrschender männlicher Meinung mit sich herumschleppen sollten. Heimtückischerweise verteilte sich dieses Extragewicht so ziemlich überall auf ihren Körper, nur nicht auf ihren Busen. Ihr Bauch stand auch nach Beendigung ihrer Schwangerschaft noch weiter vor als ihre Brust. Ich liebte diesen Bauch. Es war der kuscheligste Ort der Welt.
Meine Mutter war die Besitzerin eines kleinen Ladens an der Wandsbeker Chaussee, wo sie neben Vanille-, Erdbeer- und Lapsang-Suchong-Tee selbst angefertigten Schmuck und asiatische Textilien verkaufte, vorwiegend Halstücher und lange Röcke. Sie roch immer nach Räucherstäbchen und Patchouli-Öl, und sie liebte und lebte die Esoterik. Meine Mama glaubte an Meditation, an Wiedergeburt und vor allem an Karma. Logisch also, dass sie eine Schutzbehauptung aufstellen musste, warum sie zeitlebens immer nur sporadisch bemannt war. Die männliche Begeisterung für unproportional übergewichtige, selbständige, resolute, meditativ und eso-philosophisch begeisterte Frauen hielt und hält sich in engen Grenzen.
Der Laden war klein. Sehr klein. Das hinderte meine Mutter aber nicht daran, ganze Wagenladungen Teekisten, bergeweise Stoffe und unzählige Accessoires aller Art hineinzupferchen. Wenn sich jemals mehr als vier Kunden gleichzeitig darin aufgehalten hätten, wäre das ein Verstoß gegen das Brandschutzgesetz gewesen. Doch das kam in den ersten Jahren meines Lebens nie vor. Manchmal kamen überhaupt nur vier Kunden pro Tag. Traumwolke war der erste Laden dieser Art in ganz Hamburg. Meine Mutter war eine Trendsetterin. Einige Jahre später gab es Dutzende solcher Shops, doch bis die Zielgruppe für duftende Tees und gebatikte Stoffe groß genug war, um gut davon leben zu können, musste meine Mutter sich ziemlich durchbeißen. Ich habe erst Jahre später erfahren, wie sie uns trotz der spärlichen Geschäftseinnahmen einen halbwegs ordentlichen Lebensstandard ermöglichen konnte. Es war eine ziemliche Überraschung.
Als ich vier Jahre alt war, saß ich einmal neben meiner Mutter auf einem kleinen Hocker, während sie an ihrem Arbeitstisch in der Traumwolke eine Kette auffädelte. Meine Mutter hatte mir streng verboten, auch nur ein einziges der Kettenkügelchen in die Hand zu nehmen. Es war ein einleuchtendes Verbot: Sie hatte bereits zweimal den Krankenwagen rufen müssen, da ich mir nur zu gerne kleine Holzkugeln in die Nase stopfte, die dann prompt immer tiefer in meinem Schädel verschwanden. Ein anderes Mal hatte ich eine daumenkuppengroße Murmel verschluckt, die mir dramatisch die Luftzufuhr blockierte. Für mich herrschte seitdem strengstes Kügelchenverbot. Meine Mutter wollte vermeiden, dass sie mich noch vor meiner Einschulung an ein Schmuckutensil verlor.
Da saß ich also, die Hände brav im Schoß gefaltet, und stellte ganz plötzlich die Frage, vor der es meiner Mutter wahrscheinlich schon immer gegraut hatte: »Wo ist eigentlich mein Papa?«
Meine Mutter hielt inne, legte die Kette, die sie gerade bearbeitete, auf den Tisch, seufzte und sagte: »Der lebt ganz woanders, Simone.«
»Aber wieso?«, fragte ich.
»Weil er anders ist als wir.«
»Wie anders?«, hakte ich nach.
»Er ist ein Fisch«, sagte meine Mutter seufzend.
Ich riss staunend die Augen auf. Das war eine Information, die ein vierjähriges Kind ziemlich aus der Bahn werfen kann: Mein Vater war ein Fisch? Hätte ich dann als Mischlingskind nicht eine Nixe werden müssen – ein kleines Mädchen mit einer schuppigen Schwanzflosse statt zwei pummeligen Beinen?
»Ein Fisch?«, fragte ich sicherheitshalber noch einmal nach. Hätte ja sein können, dass ich sie falsch verstanden hatte. Erwachsene pflegen sich für Kinder bekanntlich oft unklar auszudrücken.
»Genau«, bestätigte meine Mutter, »er ist Fisch. Und ich bin Zwilling. Das geht überhaupt nicht zusammen.«
Das wurde ja immer verrückter! Mein Vater lebte im Meer und meine Mutter hatte eine Zwillingsschwester oder einen Zwillingsbruder? Wieso erfuhr ich das erst jetzt? Weil diese schockierende Informationsflut mich überforderte und mir zehn Fragen gleichzeitig durch den Kopf schossen, die ich nicht alle gleichzeitig stellen konnte, fing ich erst einmal an zu heulen.
»Beruhig dich doch, Saraswati«, sagte meine Mutter besänftigend. So nannte sie mich oft: Saraswati. Die indische Göttin der Weisheit. Es wäre mein regulärer Name geworden, hätte der Angestellte im Standesamt sich nicht standhaft geweigert, einem frisch geborenen Baby einen Namen zu geben, der klang wie eine Mischung aus Motorradmarke und ukrainischem Politiker.
Doch ich wollte mich nicht beruhigen. Ich hatte das Gefühl, dass meine komplette Welt gerade aus den Angeln gehoben worden war. Ich war ein Halbfisch, ich hatte Verwandte, die mir unerklärlicherweise vorenthalten wurden, und außerdem war ich vier Jahre alt. In diesem Alter schreit und heult man ohnehin gerne mit unangebrachter Vehemenz. Und da ich noch nie eine Anhängerin subtiler Verhaltensweisen war, warf ich mich zudem auch noch auf den Boden, wo ich trampelte und kreischte, was meine Gelenke und mein Lungenvolumen hergaben. Meine Mutter versuchte mich zu beruhigen und mir alles zu erklären, doch ich schlug so wild um mich, dass Mama rückwärts gegen ihren Arbeitstisch stolperte, der darob ins Wackeln geriet und eine Flut von Hunderten kleinen bunten Perlen über den Fußboden ergoss.
Meine Mutter hatte beschlossen, als Hippie zum Fasching zu gehen. »Peter, kannst du mir in der Stadt so ein billiges indisches Kleid besorgen?«, bat sie meinen Vater. »Und vielleicht noch so eine alberne bunte Kette, wenn du so etwas findest.«
»Da gibt’s doch diesen Laden an der Wandsbeker Chaussee«, fiel meinem Vater ein. »Schlummerland oder so ähnlich. Die haben bestimmt so etwas.«
»Nimm irgendetwas billiges«, sagte meine Mutter. »Ist ja nur für diese eine Feier.«
»Du als Hippie!«, schmunzelte mein Vater und gab seiner Frau, die in ihrem grauen Rock und der dezent beigen Bluse tatsächlich nicht so aussah, als würde der Geist von Woodstock sie je beseelen können, einen Kuss. »Köstlich!«
Mein Vater notierte sich den Auftrag in seinem Terminkalender. Er überlegte kurz und sagte dann: »Am besten gehe ich in Wandsbek dann gleich noch Schuhe mit Mark kaufen.«
»Gute Idee«, lobte meine Mutter.
Mein Vater war ein großer Freund konventioneller Rollenverteilung. Er hat in seinem Leben vermutlich nicht ein einziges Mal den Abwasch gemacht, dafür aber gefühlte zweihundert Regale angedübelt und sich um alle Rechnungen und Steuerdinge gekümmert. Den Männerkram eben. Eine große Ausnahme machte er jedoch: Einkäufe aller Art, inklusive Kinderklamotten, fielen entgegen aller Klischees in seinen Aufgabenbereich. Meine Mutter, die mir sicher auch gerne mal einen Pulli oder ein Paar Schuhe ausgesucht hätte, musste zugeben, dass mein Vater ein wahrer Meister darin war, die besten Angebote auszuspähen. Alle Einkäufe, die er tätigte, waren aber nicht nur günstig, sondern noch dazu absolut zielgenau. Niemals, wirklich niemals, musste er etwas umtauschen.
So setzte er mich zwei Tage später also auf den Beifahrersitz seines Mercedes, wo ich fröhlich auf und ab hüpfte. Kindersitze und die Gurtpflicht waren noch nicht erfunden. Während ich als potenzieller Todeskandidat neben ihm fuhr und im Radio, dessen einzige Auswahl zwischen NDR1, NDR2 und NDR3 bestand, Theo, wir fahren nach Lodz von Vicki Leandros dudelte, machte mein Vater ein paar Rechenübungen mit mir. Ich liebte es, wenn er das tat! Mein Vater hatte früh erkannt, dass meine Leidenschaft für Zahlen und das Aufspüren logischer Zusammenhänge ebenso ausgeprägt war wie bei ihm. Und er genoss es, diese Neigung bei mir zu fördern. Mein Vater machte mit mir Rechenaufgaben, so wie andere Väter mit ihren Kindern zum Fußballplatz gingen.
»Wenn ein Mann einen hundert Meter hohen Berg besteigen will und pro Stunde zwanzig Meter Höhenunterschied zurücklegt, wie lange braucht er dann, um den Gipfel zu erreichen?«
Ich kniff die Lippen zusammen und begann zu rechnen. Vor meinem inneren Auge tauchte kein Mann auf, der in Lederstiefeln und Lodenmantel einen malerischen Berg bestieg – ich sah nackte Zahlen und eine lange, konstante Linie. Ich abstrahierte. Das konnte ich schon sehr früh sehr gut.
»Fünf Stunden«, sagte ich nach einer Weile konzentrierten Rechnens.
»Sehr gut«, freute sich mein Vater. »Willst du noch eine Aufgabe lösen?«
»Au ja!« Ich strahlte, als hätte ich ein Bonbon zu erwarten.
Mein Vater fand ganz in der Nähe des Ladens, der nicht Schlummerland, sondern Traumwolke hieß, einen Parkplatz. Er stieg aus, ging um den Wagen herum, öffnete die Beifahrertür und ließ dann mich aussteigen. Ich nahm seine Hand, als wir gemeinsam zum Laden gingen.
Die Traumwolke hatte ein kleines Schaufenster, das so randvoll mit Sachen gestopft war, dass ich zuerst gar nichts erkannte. Da glitzerten Ketten und Ohrringe auf einem mit schwarzem Samt bespannten Brett, Tücher baumelten an einer Leine, in Schälchen lagen braune Teeblatt-Krümel. Kleine Duftöl-Fläschchen, kaum größer als ein Fingernagel, waren in einem Setzkasten sortiert, neben dem sich Bücher mit geheimnisvollen Schriftzeichen türmten. Und als wäre das alles nicht schon verwirrend genug, hingen vor, neben oder über diesem Chaos auch noch ein aufgeschlagener bunter Fächer und ein roter Lampion.
»Ein Hippie-Kostüm«, murmelte mein Vater. »Deine Mutter hat aber auch immer Ideen …«
»Was ist ein Hippie?«, fragte ich.
»Das sind Leute, die sich nicht an Regeln halten«, antwortete Papa.
Ich verzog das Gesicht. Mit Hippies zu spielen stellte ich mir total doof vor: Die würden schummeln und nichts würde klappen.
Als mein Vater die Tür öffnete, bimmelten viele kleine Glöckchen, die an einer langen Kette hingen. Uns schlug ein unglaublicher Geruch entgegen, der verführerisch schön und bedrohend intensiv zugleich war; viele Jahre später würde ich herausfinden, dass es der Duft von Amber-Räucherstäbchen war. Mit nur einer minimalen Zeitverzögerung folgte dem Glöckchengeläut ein ohrenbetäubender Schrei! Irgendetwas schrie so laut und anhaltend, dass ich mir entsetzt die Ohren zuhielt. Es klang, als würde ein Tier geschlachtet. Ich sah einen riesigen Frauenhintern in einem bunten Wollrock. Die Frau, der dieses monumentale Hinterteil gehörte, kniete auf dem Fußboden, umgeben von unzähligen kleinen, bunt schimmernden Perlen, die überall herumlagen oder kullerten, und hielt etwas fest, was ich nicht erkennen konnte. Das schlachtfertige Tier wahrscheinlich. Ich verstand nicht, was ich da sah, aber ich fand es zutiefst schockierend – und so faszinierend, dass ich wie gebannt einen Schritt in den Raum hinein machte. Mein Vater jedoch, der mit missbilligendem Gesichtsausdruck im Türrahmen verharrte, erfasste die Situation schnell. Er fragte die Frau, die immer noch mit dem mir unsichtbaren Wesen rang, kühl: »Ist alles in Ordnung?«
Die Besitzerin des überdimensionalen Hinterns rief etwas, was ich nur halb verstand. Irgendetwas mit »Trotzphase« und »Samsambali«. Damit war wahrscheinlich das Tier gemeint, das sich seinem Schicksal nicht kampflos ergeben wollte. Die Frau mit dem monströsen Hintern zähmte gerade ein Samsambali – oder machte Frikassee daraus.
Mein Vater sagte: »Dann komme ich später noch mal wieder«, nahm meine Hand und zog mich aus dem Laden. Ich war zutiefst erleichtert, dieses schaurige Geschäft verlassen zu dürfen, und gleichzeitig ein bisschen enttäuscht. So etwas Merkwürdiges hatte ich noch nie erlebt. Meine Eltern gaben sich stets große Mühe, mich von Kuriositäten, Normabweichungen und Überraschungen aller Art fernzuhalten.
Als wir wieder draußen auf dem Gehweg standen, sagte mein Vater: »Das, mein Junge, waren Hippies.«
Zwei Straßen weiter gab es einen Schuhladen, in dem wir um vierzig Prozent heruntergesetzte Halbschuhe für mich erstanden. Auf dem Rückweg zum Auto gingen wir schnurgerade am Traumwolke-Laden vorbei. »Papa, was ist denn jetzt mit dem Hippie-Kostüm?«, wollte ich wissen. Ein Teil von mir brannte darauf, den obskuren Laden erneut zu betreten und womöglich das Samsambali-Rätsel zu lösen.
»Deine Mama wird wieder als Stewardess zum Fasching gehen«, sagte jedoch mein Vater, als er mir die Autotür aufhielt. Sein Gesichtsausdruck besagte eindeutig, dass er nicht im Traum daran dachte, dieses Geschäft noch einmal zu betreten.
»Das scheint mir«, sagte ich nach kurzem Nachdenken, »der naheliegende Gedanke zu sein. Das Kostüm hat Mama schon im Schrank hängen, richtig? Dann macht es doch keinen Sinn, etwas Neues zu kaufen. Die Mama wächst ja nicht mehr.« Es hört sich merkwürdig an – aber genau das habe ich damals gesagt, inklusive dem Wörtchen naheliegend. Mein Vater verwuschelte mir liebevoll die Haare, und auf dem Weg nach Hause durfte ich ihm eine Rechenaufgabe stellen.
Ich komme mir ein bisschen seltsam vor, während ich all dies aufschreibe. Wie ich Ereignisse, Farben, Formen, Bilder und Gefühle rekonstruiere, die fünfunddreißig Jahre alt sind. Wie ich in meinen frühesten Kindheitserinnerungen krame und versuche, mir die längst vergangenen siebziger Jahre wieder vor Augen zu führen. Diese seltsame Dekade, in der Männer Schlaghosen trugen und Hemden, die genauso gemustert waren wie die Tapeten in ihrem Wohnzimmer.
Wahrscheinlich wird niemand außer mir je lesen, was ich hier schreibe – und doch werde ich mich bemühen, alles so akkurat wie möglich aufzuarbeiten. So bin ich nun mal: präzise und korrekt.
Ich schreibe mein Leben auf, weil ich es in meinem Kopf sortieren will. In ein paar Wochen werde ich vierzig, und ich habe das Gefühl, ich muss herausfinden, ob es in meiner Existenz nicht doch eine Art von System gibt, das sich mir einfach noch nicht erschlossen hat. Alles fing doch sehr sortiert und geradlinig an. Ich war viele Jahre lang auf einem absolut klaren Weg, ein regelrechter Erfolgsraser. Ich lebte auf der Überholspur, mit Lichthupe und ohne Tempolimit. Wann genau habe ich dann aber die Abzweigung genommen, die mich auf den Schlängelpfad führte, auf dem ich jetzt durchs Leben stolpere? Und vor allem: Warum bin ich abgebogen? Wieso sitze ich mit 39,27 Jahren nicht in einer schicken Penthousewohnung, sondern in einem kleinen Eineinhalb-Zimmer-Apartment, fernab aller Erwartungen und Pläne?
Nicht, dass ich unglücklich wäre. Es ist eigentlich ganz spannend, nie zu wissen, was nach der nächsten Wegbiegung auf mich wartet. Und ich genieße die Abwesenheit jeglichen Drucks. Ich trödle. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten. Aber ich kann trotzdem nicht aus meiner analytischen Haut: Ich möchte wissen, wie ich dorthin gekommen bin, wo ich jetzt bin.
Ich glaube nicht an Schicksal und Vorsehung. Jedenfalls nicht im klassischen Sinne. Ich glaube an Zufälle und ich weiß, dass eine Berechnung umso unpräziser ausfällt, je mehr Variablen darin auftauchen. Eine Formel ist ab einer gewissen Menge an X-Stellen einfach nicht mehr lösbar. Ich schätze, das Leben ist so eine Formel. Variablen bis zum Abwinken. Man rechnet sich buchstäblich zu Tode dabei.
Und doch versuche ich jetzt, den Code meiner ersten fast vierzig Lebensjahre zu knacken. Es ist, als ob jemand oder etwas mich dazu zwingt. Als ob es irgendein großes Ereignis gäbe, auf das ich unausweichlich zusteuere und auf das ich mich seit meiner Geburt vorbereite. Das klingt bescheuert, ich weiß. Wie diese merkwürdigen Moderatoren bei Astro TV, die Tarotkarten vor sich auf den Tisch legen, daraus dann in grammatikalisch fragwürdigem Deutsch irgendeine lächerliche Kausalkette ableiten und den armen Anrufern, die einsam und traurig sind und auf ein wenig Hilfe hoffen, 1,28 Euro pro Minute aus dem gebeugten Kreuz leiern. Doch nur weil eine Horde von Scharlatanen das Feld der Lebenshilfe beackert, muss es ja nicht heißen, dass es nicht vielleicht doch eine bislang unbekannte Methode gibt, den Geheimnissen unseres Daseins auf die Spur zu kommen. Ich muss es einfach versuchen.
»Leben ist das, was zwischen den Terminen passiert«, hat eine meiner Sekretärinnen mal zu mir gesagt. Sie war nicht sehr lange in der Firma. Aber der Satz klebt mir immer noch im Kopf. Ich habe inzwischen nicht mehr viele Termine – aber wo bleibt das Leben?
Kapitel 3
1975
Meine Mutter machte viele Ausflüge mit mir. Fast jeden Sonntag, wenn die Traumwolke geschlossen war, schnappte sie mich und fuhr irgendwo mit mir hin. Bevorzugt an Orte, die nicht überdacht waren. Sie ließ mich auf dem Spielplatz in den Wallanlagen der Innenstadt toben und über die Schützenfeste in den kleinen Dörfern vor den Toren Hamburgs, zeigte mir die Altstadt von Lübeck und die Strandpromenade von Travemünde. Meine Mutter hatte Hummeln im Hintern und schaute sich liebend gern alles an, was sie noch nicht kannte. Wirklich alles! Manchmal stand sie mit mir an einer Straße, irgendwo im Nirgendwo, wo bloß ein paar Häuser, ein Gasthof, ein Kuhstall und ein skeptisch dreinblickender Mann mit einer Schubkarre herumstanden, und sagte so etwas wie: »So, Saraswati. Jetzt haben wir auch Ramelsloh mal gesehen.« Oder Emsen. Oder Halstenbek. Und ich fand es schön. Ich war schließlich demselben Gen-Pool entsprungen und gierte ebenfalls nach neuen Eindrücken. Jeder neue Ort war eine Entdeckung wert. Sogar Ramelsloh.
Im Mai 1975 lag ich auf dem Rücksitz unseres alten VW-Busses, spielte mit einer mongolischen Holzpuppe, die meine Mama mir auf einem Flohmarkt gekauft hatte, und summte das Lied mit, das im Radio lief: Fox on the Run von The Sweet. Wir waren auf dem Weg in den Wildpark Schwarze Berge, einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Hamburg-Harburg. Der Wildpark versprach, halb Zoo und halb Wanderwald zu sein. Meine Mutter hatte zwei Freikarten geschenkt bekommen und wir beide freuten uns sehr. Wir wussten ja nicht, dass dieser Sonntagsausflug einen unerwartet chaotischen Verlauf nehmen und eine Charaktereigenschaft an mir offenbaren würde, die mir in meinem Leben noch eine Menge Ärger einbringen sollte: meinen Beschützerinstinkt.
Am Eingang des Wildparks kauften wir drei Tüten mit Tierfutter. Ich liebte es, Tiere zu füttern. Es dauerte keine fünfzehn Minuten, bis alle drei Tüten leer waren, obwohl wir noch keine zweihundert Meter Wanderweg zurückgelegt hatten. Der Grund dafür war die heimliche Attraktion des Wildparks Schwarze Berge: die Hängebauchschweine! Sowie man den Park betrat, waren sie da, Dutzende von klobigen, dreckigen, grunzenden Säugetieren, deren pralle Wampen fast über den Boden schleiften und die unverzüglich auf jeden Besucher zuwatschelten, um sie um den Inhalt der Futtertüten zu bringen. Ich war hingerissen! Sie waren potthässlich, diese Tiere, und trotzdem so unwiderstehlich niedlich, dass ich gar nicht von ihnen lassen konnte. Ich fütterte sie, streichelte und knuddelte sie. »Süüüüß!«, rief ich immer wieder. »Die sind so süüüüß!«
Meine Mutter stand etwas abseits und lachte. »Aber küssen solltest du sie trotzdem nicht, Schätzchen!«, bat sie mich. »Die sind wirklich schmutzig.«
»Ist gut!«, rief ich und wischte mir ein paar dreckverkrustete Borsten von den Lippen.
Einige der Hängebauchschweine hatten Junge bekommen. Die waren noch richtig winzig, kaum größer als Meerschweinchen. Leider konnte man sie nicht anfassen; die Schweinemütter wachten über sie und stupsten jeden, der sich den Kleinen nähern wollte, resolut zurück. Ich beobachtete die Frischlinge aus sicherer Entfernung und war absolut entzückt. Sie waren hässlich und goldig zugleich. Doch dann sah ich das eine Wildschweinjunge, das anders aussah als die anderen. Das ganz besondere Schweinchen, das ich bis heute nicht vergessen habe. Es war kleiner. Es war auch dünner und hatte an einigen Stellen hässliche Flecken im Fell, als wäre es dort gebissen oder gekratzt worden. Dieser Frischling stolperte nicht im Kindergarten der anderen Jungtiere herum, sondern stand, von allen ignoriert, etwas abseits an einem Baumstamm und schaute sich die Menschen und ihre Artgenossen mit einem traurig-entrückten Blick an. Und da geschah es: Ich verliebte mich! Zum ersten Mal in meinem Leben. In einen struppigen, hilflosen und unberechenbaren Außenseiter. Es würde nicht das letzte Mal sein.
Ich sah ein herzzerreißend lebensuntüchtiges Schweinchen und mein Herz ging auf.
Eines der Großschweine rempelte mich an und schreckte mich aus meinem verzückten Moment auf. Das Schwein versuchte, seinen Rüssel in meine bunte Jute-Umhängetasche zu stecken, um nachzuschauen, ob dort nicht doch noch ein paar Futterbrocken verborgen wären. Doch die Tasche war leer.
Meine Mutter rief: »Saraswati, komm jetzt! Da hinten gibt’s auch noch Rehe!«
Ich sah noch einmal zu meinem Außenseiter-Frischling hinüber, und ich schwöre: Er schaute mir direkt in die Augen! Als ob er mich um Hilfe anflehte.
Ich bin ein impulsiver Mensch. Man kann mich auch unvernünftig nennen, das beleidigt mich nicht. Vernunft ist die Bremse des Glücks, finde ich. Aber ich weiß trotzdem, dass man hin und wieder doch einen Plan braucht, dass man nicht immer spontan aus der Hüfte schießen darf. Selbst damals, mit fünf Jahren, wusste ich das schon. Ich ging also zu meiner Mutter, nahm ihre Hand und sagte, als könne mich kein Wässerchen trüben: »Oh, toll! Rehe sind soooooo schön!«
Zwei Stunden lang schlenderten wir durch den Wildpark, sahen uns allerlei Tiere an und aßen jeder ein Eis. Ich rutschte durch eine sandige Stahlröhre, schaukelte wild und balancierte auf einem umgekippten Baumstamm, so wie meine Mutter es von mir erwartete. Doch die ganze Zeit dachte ich dabei nur an das kleine Hängebauchschweinchen. Ich hatte ihm sogar schon einen Namen gegeben: Struppi.
Als wir die komplette Runde gedreht hatten und wieder am Ausgangspunkt angekommen waren, sagte ich zu meiner Mutter: »Ich muss noch mal auf die Toilette«, und flitzte sofort los, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen konnte, mich zu begleiten. Ich rannte allerdings an dem Toilettenhäuschen vorbei, hastete im Schutz einer Baumreihe hinter dem Rücken meiner Mutter einen Weg hinunter und befand mich keine Minute später im Hängebauchschwein-Areal wieder.
Ich sah Struppi sofort: Er stand an einem anderen Baum als vorhin, hatte aber immer noch denselben herzzerreißenden Blick. Die Zeit war knapp, also lief ich zu ihm hin, konnte ihn mir, da sich nach wie vor kein ausgewachsenes Schwein in seiner Nähe aufhielt, problemlos schnappen und stopfte ihn in meine Umhängetasche. Struppi ließ es sich gefallen. Er biss nicht, quiekte nicht und zappelte kaum. Ich interpretierte das natürlich als sein stilles Einverständnis; wahrscheinlich war er aber einfach zu geschockt.
Ich lief die Runde zurück und stand keine vier Minuten später wieder vor meiner Mutter.
»So, Saraswati. Jetzt haben wir auch die Schwarzen Berge gesehen«, sagte sie.
»Ja, toll«, strahlte ich und hielt mit der einen Hand so unauffällig wie möglich meinen Jutebeutel fest, in dem Struppi nun doch leicht zu randalieren begann.
Auf dem Weg zu unserem VW-Bus simulierte ich einen Hustenanfall nach dem anderen, um das immer schriller werdende Quieken meiner Schweinegeisel zu übertönen. Doch als wir dann in den VW-Bus gestiegen waren und meine Mutter schon zu überlegen begann, ob sie mit mir zu einem Krankenhaus fahren sollte, weil solch ein plötzlicher und exzessiver Husten ja nun wirklich nicht normal sei, flog meine Aktion doch noch auf.
»Was stinkt denn hier so?«, fragte Mama.
Ich kurbelte blitzschnell die Scheibe herunter und beschloss, all meine Würde aufzugeben. »Ich hab mir in die Hose gemacht«, behauptete ich. Doch während ich das sagte, quiekte Struppi plötzlich laut los. Meine Mutter sah erst mich und dann die Umhängetasche erstaunt an. Bevor ich es verhindern konnte, griff sie hinein – und schrie laut auf. Einer ihrer Finger blutete, da der verängstigte Struppi hineingebissen hatte, und die ganze Hand war eindrucksvoll mit Schweinedurchfall beschmiert, den man meinem panischen Schützling ja nun wirklich nicht vorwerfen konnte. Wie würdest du dich fühlen, wenn man dich plötzlich schnappen und in ein dunkles, schaukelndes Stoffgefängnis stopfen würde? Ich kenne dich nicht, aber ich wette, du würdest dich auch vollscheißen vor Angst! Struppi wusste ja nicht, dass ich ihm nur helfen wollte.
»Simone!«, rief meine Mutter entsetzt. »Was hast du jetzt schon wieder angestellt?«
Ich antwortete nicht, sondern riss die Wagentür auf und rannte los. Man würde mir Struppi nicht wegnehmen! Ich musste ihn retten! Ich liebte ihn, und er brauchte mich!
Ich rannte über den Parkplatz auf eine Wiese und überlegte fieberhaft, wie ich mich so schnell wie möglich nach Übersee absetzen konnte, oder nach China. Oder nach Taka-Tuka-Land. Meine Mutter, die nicht besonders sportlich war, folgte mir schnaufend. Und dann hörte ich plötzlich eine laute Männerstimme, die rief: »Da! Das ist sie! Die Kleine in dem bunten Kleid!« Ich wandte meinen Kopf beim Laufen in die Richtung, aus der die Stimme kam, und sah drei Männer, die auf mich zueilten. Einer von ihnen trug die Uniform der Parkwächter. Man musste mich bei meiner selbstlosen Rettungsaktion beobachtet haben. Ich rannte weiter, so schnell ich konnte, während der arme Struppi in der Tasche, die mir um die Schulter hing, hin und her geschleudert wurde, hysterisch quiekte und inzwischen wahrscheinlich von oben bis unten in seinen eigenen Exkrementen mariniert war.
Ich hatte keine Chance: die Männer waren schnell. Auch meine Mutter, die mit einigem Abstand hinter ihnen herrannte, bewies erstaunliche Ausdauer. Doch dann entdeckte ich einen Hochstand. Ich sprintete darauf zu, kletterte eilig die Leiter hinauf und verschanzte mich dort oben. Nicht einmal eine Minute später waren die drei Männer da.
»Mädchen!«, rief einer von ihnen, der aussah wie ein Familienvater, der hier einen eher langweiligen Tag mit seinen Kindern verbringen musste und nun heilfroh war, sich als gesetzestreuer Staatsbürger aufspielen zu können. »Komm runter! Du kannst nicht einfach ein Tier mitnehmen!«
Struppi quiekte. Ich weiß nicht, ob er den Männern zustimmte oder ihnen so etwas wie ein schweinisches »Verpisst euch!« zurief.
»Ich muss ihn retten!«, rief ich kieksend und außer Atem.
»Wovor musst du ihn retten?«, fragte der Mann in Uniform. Seine Stimme hatte einen erstaunlich milden und freundlichen Tonfall. »Glaubst du, dass ihm hier jemand etwas tut?«
»Niemand hat ihn lieb!«, antwortete ich.
»Woher willst du das wissen?«, fragte der Mann.
»Das sieht man doch!«, erklärte ich patzig.
In diesem Moment traf auch meine Mutter am Hochstand ein. Sie rief zu mir hoch: »Saraswati, Schätzchen! Komm runter!«
Ich begann zu weinen.
»Den Tieren geht’s hier gut! Vertrau uns!«, sagte der Parkwächter.
»Wir können doch kein Hängebauchschwein großziehen«, sagte meine Mutter. »Und das Schweinchen gehört zu seiner Familie, so wie du zu mir gehörst.«
Ich zog etwas Rotz hoch. Struppi quiekte und zappelte wie verrückt. Ich öffnete die Tasche und schaute hinein. Das Schweinchen lag auf dem Rücken, mit allen vier Beinen in der Luft strampelnd und sah mich mit schreckgeweiteten Augen an.
Ich seufzte.
»Da stehen doch überall Schilder«, meckerte der aufrechte Wildparkbesucher los. »Da steht’s doch drauf: Die Jungtiere nicht berühren!«
Ich wischte mir mit dem Ärmel die Tränen und den Schnodder aus dem Gesicht und schaute aus dem Einstieg des Hochsitzes auf die Erwachsenen hinunter. »Ich kann noch nicht lesen«, sagte ich. »Ich bin doch erst fünf!«
»Saraswati«, sagte meine Mutter mit leicht zittriger Stimme. Sie war nicht böse, nur ein bisschen überfordert. »Du weißt doch sonst auch, was richtig ist.«
Ja, das wusste ich. Aber schon damals ahnte ich, dass das, was richtig ist, nicht immer das ist, was sich auch richtig anfühlt.
Ich kletterte die Leiter hinunter und überreichte, noch einmal kurz zögernd, dem freundlichen Parkwächter die Jutetasche. Er schaute hinein, nickte dann und strich mir über den Kopf.
Meine Mutter und ich begleiteten die Männer zurück in den Park. Erstaunlicherweise war niemand richtig wütend auf mich. Selbst der aufrechte Familienvater hörte auf zu meckern als er begriff, dass ich kein professioneller Tierbefreier, hauptberuflicher Anarchist oder Kleptomane war, sondern bloß ein kleines dummes Mädchen mit einem großen Herzen. Alle fanden es irgendwie rührend, dass ich mich um das kleine, ausgestoßene Tier hatte kümmern wollen. Der Parkwächter schenkte mir am Ende sogar eine Jahresfreikarte, damit ich regelmäßig nachschauen konnte, dass es Struppi gutging.
Ich bin noch siebenmal hingefahren. Struppi ist insgesamt fünfzehn Jahre alt geworden. Er hat mich nicht einmal wiedererkannt. Undankbarer Mistkerl!
»Wenn du drei Murmeln hast und sechs dazubekommst, wie viele Murmeln hast du dann?«, fragte die Frau und schaute mich lächelnd und erwartungsvoll an.
»Die dreifache Menge«, sagte ich, wie aus der Pistole geschossen, »also neun.«
»Erstaunlich«, sagte die Frau und notierte sich etwas auf einem Zettel, der vor ihr auf dem Schreibtisch lag. Dann nahm sie ein großes Blatt und drehte es so, dass ich es anschauen konnte. Es war das Bild von meinem Papa, das ich eine halbe Stunde zuvor in ihrem Auftrag gemalt hatte.
»Was ist denn das?«, fragte die Frau und zeigte auf das eine Ohr, in welches ich ein großes S gemalt hatte.
»Die Ohrmuschel«, antwortete ich geduldig. »Jedes Ohr hat doch Knorpel.« Ich runzelte die Stirn. So etwas sollte eine Erwachsene doch nun wirklich wissen, oder?
Die Frau sah meine Mutter an: »Ich mache das jetzt seit über zehn Jahren, aber noch nie hat ein Kind eine Ohrmuschel gemalt.«
Meine Mutter lächelte zaghaft. Sie war sich nicht sicher, ob es gut war, wenn Kinder Ohrmuscheln malten.
»Würdest du bitte einen Moment draußen warten?«, bat mich die Frau. Ich erhob mich artig und verließ den Raum. Im Flur standen ein paar Plastikstühle. Ich setzte mich auf einen davon und nahm mir eine Broschüre, die auf einem kleinen Tischchen daneben lag. Das erste Schuljahr – Was man darüber wissen muss, las ich.
Ich wurde ein Jahr früher als normal eingeschult. Ich war fünf und kaum größer als meine Schultüte.
Kapitel 4
1976
Mit meinen Freunden war das so eine Sache: Es gab sie nicht. Die ersten sechs Jahre meines Lebens spielte ich fast immer allein, obwohl meine Eltern alles daransetzten, mich mit irgendwelchen Knirpsen zu verkuppeln. Doch andere Kinder fanden es nicht besonders reizvoll, mit mir zu spielen. Und dieses Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit.
Es gab einfach keine Schnittmenge zwischen den meisten anderen Jungen und mir. Ich interessierte mich nicht für Fußball, Matchbox-Autos, Ringkämpfe, Superhelden oder Soldaten. Und die kleinen Kerlchen, die meine Eltern ungefragt zu uns nach Hause einluden, hatten keine Lust, mit mir Halma zu spielen, mit meinem Fischertechnik-Set einen Kran zu bauen oder kleine, lustige Theaterstücke einzuüben, die man dann den Erwachsenen vorführen konnte.
Wir lebten in einem Einfamilienhaus in Marienthal. In unserem Garten standen eine Schaukel, eine Sandkiste und ein Trampolin, die ich ganz für mich allein hatte. Marienthal ist ein sogenanntes »gehobenes Viertel«, in dem vor allem Architekten und Juristen, Geschäftsleute und leitende Bankangestellte leben. Es war schon damals nicht die Elbchaussee, kein Villenviertel. Die Leute hier hatten aber so selbstverständlich Abitur, wie sie einen Zweitwagen besaßen. Die Welt der Mittleren Reife und des Hauptschulabschlusses war allerdings nicht weit entfernt. Es waren zu Fuß nur wenige Minuten bis Wandsbek. Wandsbek war natürlich auch kein Ghetto, kein zwielichtiges Viertel, aber viele Menschen dort mussten beim Einkaufen doch auf die Preise achten. Meine Eltern gaben ihr Bestes, meine potenziellen sozialen Kontakte innerhalb von Marienthal zu verankern.
Einmal lud meine Mutter zum Beispiel eine Frau ein, die zwei Straßen entfernt wohnte und »ganz zufällig« einen Sohn in meinem Alter hatte. Die Mutter bekam einen Kaffee angeboten und verschwand mit meiner Mama ins Wohnzimmer. Ihr Sohn, der Arno hieß, und ich blieben zurück. Arno machte im ersten Moment eigentlich einen ganz netten Eindruck.
»Wollen wir Cowboy und Indianer spielen?«, fragte er.
»Nur zu zweit?«, fragte ich. »Wie soll denn das gehen?«
»Ich bin der Cowboy, nehme dich gefangen und foltere dich«, erklärte Arno und krempelte hochmotiviert die Ärmel seines Hemdes hoch.
»Mmh«, antwortete ich skeptisch. »Ich weiß nicht.«
»Arschnase, Kackwurst, Jammerlappen«, brüllte Arno und rannte in den Garten.
In den drei Stunden, in denen Arno bei mir zu Besuch war, hüpfte er zwei Stunden lang auf meinem Trampolin herum und brüllte ständig »Höher! Höher! Höher!«, um danach eine Stunde vergeblich zu versuchen, unsere Katze einzufangen. Vermutlich um sie zu foltern. Ich saß derweilen auf der Wiese hinter einem Gebüsch, wo meine Mutter mich durchs Wohnzimmerfenster nicht sehen konnte, und las Micky-Maus-Comics.
»Beim nächsten Mal«, zischte Arno mir zu, als seine Mutter sich gerade überschwenglich von meiner verabschiedete, »bist du dran, Arschnase!« Er ist inzwischen übrigens ein erfolgreicher Unternehmensberater und hat neulich irgendeinen Preis vom Hamburger Bürgermeister überreicht bekommen. Habe ich in der Morgenpost gelesen.
Mit den Marienthaler Jungs und mir gab es also ein unlösbares Kompatibilitätsproblem. Ich verspürte allerdings auch keinerlei Neigung, stattdessen mit Mädchen zu spielen. Die heulten entschieden zu oft für meinen Geschmack und legten ein enervierend unlogisches Verhalten an den Tag. Mädchen machten aus jedem kleinen Pups ein großes Drama und widersprachen sich permanent selbst. Mädchen sind für Jungs, die plausible Gedankengänge schätzen und der Meinung sind, Worte sollten exakt das ausdrücken, was man auch meint, eine kaum zu bewältigende Spezies. Sie sind zutiefst verwirrend. Ein hübscher Anblick, aber irgendwie schief konstruiert. Damals dachte ich noch, dass sich das vielleicht auswächst, aber heute weiß ich es besser.