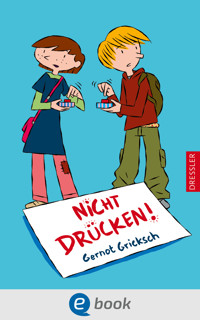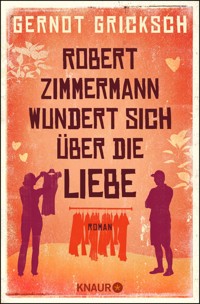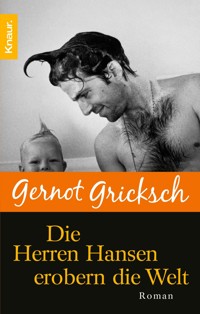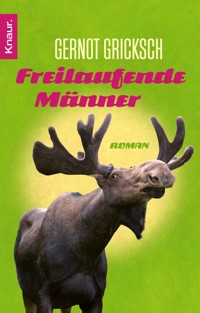6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Piet und seine Kirschkernspucker-Freunde aus alten Zeiten müssen sich auch mit 40 Lebensjahren noch den Widrigkeiten des Lebens stellen. Die lang ersehnte Lebensweisheit und eine lässige Abgeklärtheit lassen leider auf sich warten. Stattdessen winken die erste Midlife-Crisis, eine späte Schwangerschaft, die immer wieder turbulente Liebe und die Rettung eines vernachlässigten Mädchens. Wenn dazu die eigenen Kinder genauso viel Mist bauen wie man selbst früher, ist das Chaos komplett. Aber mit guten Freunden ist alles zu schaffen. Sogar das Leben. Die heldenhaften Jahre der Kirschkernspuckerbande von Gernot Gricksch ist eine unterhaltsame Geschichte über Männerfreundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Gernot Gricksch
Die heldenhaften Jahre der Kirschkernspuckerbande
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
13. 7. 2010
Heute ist mein Geburtstag. Mein fünfzigster. Eigentlich sollte ich feiern, aber als was auch immer man das beschreiben möchte, was um mich herum passiert, eine Feier ist es ganz sicher nicht.
Ich glaube nicht, dass es einen exakten Punkt gab, an dem man das alles hätte aufhalten können. Vielleicht hätte man die Ereignisse in eine andere Richtung lenken, die Dinge irgendwie begradigen, entschleunigen, beruhigen können. Vielleicht war es aber auch unausweichlich – das, was hier gerade geschieht.
Es ist müßig, darüber nachzudenken. Im Leben steht ein Ereignis niemals ganz allein für sich. Alles ist irgendwie miteinander verwoben, verknotet, verklebt. Es gibt kein simples »Ja« oder »Nein«, kein klares »Hier lang« oder »Da lang« – das, was manche Leute Schicksal nennen, ist die Summe aus unzähligen Entscheidungen und Unterlassungen.
Wir haben Angst. Aber es gibt kein Zurück. Auf keinen Fall.
Alle Kirschkernspucker sind da. Meine besten Freunde. Und noch viele andere Leute, die mir wichtig sind: meine wunderbare Tochter Nele, die verängstigte Peggy und Jörn natürlich, der fast schon selbst ein Kirschkernspucker geworden ist. Außerdem ist die verrückte Anita da, der kauzige Adze, Lucy und ihr Polizist, Florian – und dieser traurige Russe, dem ich eigentlich dankbar sein sollte, der mir aber immer noch nicht ganz geheuer ist. Der Russe ist nicht direkt bei uns. Er steht unten auf der Straße und singt in ein Mikrophon. Seine Stimme hallt laut von den Hauswänden wider. Mehrere Fernsehkameras sind auf ihn gerichtet, unzählige Handys und Fotoapparate blitzen unentwegt.
Ich wollte für meine Geburtstagsfeier eigentlich eine Kneipe mieten, vielleicht eine Band engagieren, die die ollen Hits spielt. Den Soundtrack meines Lebens, zu dem wir dann alle hätten tanzen können. Stattdessen sind wir hier in dieser Wohnung. Wir sind nervös, aber auch zu allem entschlossen. Ständig klingeln das Telefon und die Handys. Reporter rufen an. Das Blaulicht der Polizeiwagen unten auf der Straße veranstaltet eine Lightshow in den Zimmern.
Der Russe hat sein Lied beendet. Die Leute applaudieren und johlen und stimmen schon wieder einen Sprechchor an. Ich bin ihnen so dankbar. Sie sind auf unserer Seite. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir wollen gar nicht hier sein. Aber die Umstände haben uns dazu gezwungen. Es geht schließlich um ein Menschenleben.
Ich weiß nicht, ob die Welt wirklich immer schlimmer wird, ob die Menschen tatsächlich immer gröber und kaputter werden oder ob es mein Alter ist, das mich die Dinge anders wahrnehmen lässt. In den letzten zehn Jahren habe ich so viel Verwahrlosung bei den Menschen gesehen, so viel alleingelassene Kinder, so viel Kälte, Egoismus und Dummheit, dass ich dazu tendiere, zu glauben, dass die Welt generell den Bach runtergeht. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein alter Mann geworden und habe in den Früher-war-alles-besser-Modus geschaltet, den ich bis vor kurzem an alten Männern immer so furchtbar gefunden habe.
Dabei war es ja weiß Gott nicht nur Schreckliches, das ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Da war auch Liebe, sehr viel Liebe sogar, und Spaß und herrliches Chaos und viele kleine magische Momente und reichlich Kinderlachen. Und da waren nicht nur einsame und gebrochene Menschen, sondern auch Träumer und Kämpfer und Abenteurer.
Da war so viel. Und all das ist heute – ausgerechnet an meinem Geburtstag – zusammengekommen. Heute sind sie da. Alle! Und wir riskieren alle verdammt viel für das, woran wir glauben. An das Recht auf Glück.
Der Russe unten auf der Straße hat mit einem neuen Lied begonnen, doch er singt nur ein paar Takte. Dann ist abrupt Schluss. Irgendjemand hat die Tonanlage ausgeschaltet, die Rückkopplung eines Megaphons quietscht.
»Hier spricht die Polizei!«, ruft eine knarzige Stimme zu uns hoch. »Dies ist die letzte Warnung. Sie haben fünf Minuten, um …«
Ich höre nicht hin. In meinen Ohren rauscht es. Ich schaue die Kirschkernspuckerbande an. Dille, Petra, Sven und natürlich Susann. Wir lächeln uns tapfer und nervös zu.
Wir können jetzt nicht aufgeben. Wir können es einfach nicht!
Keiner sagt etwas …
2001
Das willst du anziehen?!« Susann musterte mich mit einem halb tadelnden, halb mitleidigen Blick.
Ich sah an mir herunter. Ich trug meine Lieblingsjeans – die gemütlichen, die in Höhe der Fußknöchel schon etwas ausgefranst waren –, die braunen Turnschuhe, die mir schon seit vielen Jahren zuverlässig sowohl im Alltagsleben als auch auf meinen Joggingrunden dienten, sowie das quietschgelbe T-Shirt mit Homer Simpson drauf. Wo war das Problem?
»So kannst du doch nicht zum Interview gehen«, fand Susann.
»Das ist bloß ein Radiointerview«, antwortete ich. »Ich könnte nackt vorm Mikro sitzen, mit einer rosa Schleife im Haar und einem Nasenring in den Nüstern. Die Hörer würden trotzdem denken, ich hätte einen Boss-Anzug an, wenn ich nur gestelzt genug rede.«
Susann seufzte. Das konnte sie gut. Seufzen. Es war dieses ganz spezielle weibliche Seufzen, das gestandene Männer zu hilflosen dummen Jungs degradierte. Zu instinktlosen Dumpfbacken, die stets zielsicher die falschen Entscheidungen trafen. Und das Schlimmste an diesem Seufzen war, dass meine Süße oft auch noch recht damit hatte. Was ich natürlich nur sehr selten, und wenn, dann äußerst widerwillig zugab.
Tatsächlich war ich nicht so cool, wie ich tat. Ich war ziemlich aufgeregt. Es war schließlich mein erstes Interview. Zumindest das erste, in dem ich die Fragen beantworten würde, anstatt sie zu stellen.
Vor drei Wochen war mein erster Roman erschienen. Jahrelang hatte ich davon geträumt, ein Buch zu schreiben, während ich als freier Journalist Richtfeste, Theaterpremieren und Pressekonferenzen besuchte. Ein rundes Dutzend Anläufe hatte ich genommen, hatte stundenlang jeden Tag am Computer über dem richtigen Einstieg, den interessantesten Charakteren und dem originellsten Plot geschwitzt, war aber stets nach ein paar Seiten steckengeblieben und musste mir eingestehen, dass das, was ich da zu fabulieren begonnen hatte, ein literarischer Rohrkrepierer zu werden versprach.
Dann starb mein Freund Bernhard, und ehe ich mich versah, befand ich mich auf einer emotionalen Achterbahnfahrt. Mein ganzes bisheriges Leben raste an mir vorbei, und mir wurde schwindelig, als ich zu begreifen begann, aus wie vielen Abzweigungen so ein Leben besteht, aus wie vielen verhängnisvollen oder selig machenden Entscheidungen, Zufällen, Wendungen und Untiefen. Schlagartig wurde mir klar: Ich brauchte kein ausgetüfteltes fiktives Werk zu verfassen. Die Geschichte meines Buches lag vor mir. Ich schrieb einfach auf, was mir widerfahren war. Mein Leben. Und das meiner Freunde. Das ging dann plötzlich ganz einfach, und nach wenigen Monaten lagen dreihundertachtzig Seiten Manuskript vor mir. Zu meiner großen Überraschung und Freude fand ich einen Verlag für Kirschkerne. Das ist der Titel des Buches: Kirschkerne.
Als ich das Paket öffnete, in dem die ersten dreißig Exemplare meines Buches lagen, war das ein erhebendes Gefühl. Schön sahen die Bücher aus. Viel schöner als andere. Andächtig nahm ich ein Exemplar in die Hand und strich sanft über das Cover. Susann stand neben mir und lächelte. Das kann sie auch ganz toll: lächeln. Sie wusste, wie viel mir dieses Buch bedeutete. Ich hatte es geschafft. Ich war ein Schriftsteller.
Bedauerlicherweise interessierte das außer mir, Susann, meiner Familie und meinen Freunden so gut wie niemanden. Das Literarische Quartett plante jedenfalls keine Sondersendung über mein Werk. Es thronte auch nicht in mannshohen Stapeln bei Thalia, Hugendubel und der Mayerschen Buchhandlung, noch warf es imposante Schatten über die neuen Werke von John Grisham, Henning Mankell und Stephen King. Tatsächlich konnte ich froh sein, wenn Kirschkerne es überhaupt auf den Neuheitentisch der Buchläden schaffte und nicht gleich ins Regal geschoben wurde, wo es vor allem dazu diente, unzählige Hera-Lind-Bücher zu stützen, die neben ihm standen.
Mein Name ist Piet Lehmann. Lehmann mit L. Lehmann steht getreu den Gesetzen des Alphabets im Regal neben Lind. Es war nicht schön, mit dieser Autorin in eine Reihe gestellt zu werden. Aber da musste ich durch.
Kurz: Mein Romandebüt hatte bislang unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, und deshalb war es eine erfreuliche Überraschung gewesen, als ein Mitarbeiter des NDR-Kultursenders bei mir angerufen und mich gefragt hatte, ob ich für ein Interview zur Verfügung stände.
Ob ich zur Verfügung stände? Aber hallo!
Ich würde den Herrn Kulturjournalisten um 15 Uhr im Hamburger Sender treffen. Dass ich für diesen Termin ausgefranste Hosen und ein Simpsons-T-Shirt angezogen hatte, lag nur halb darin begründet, dass ich meine Kleidungsstücke aus Gründen der Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit üblicherweise einfach oben vom Stapel nahm, ohne mir darüber Gedanken zu machen, ob sie miteinander harmonierten. Ich wollte dem Herrn aus der NDR-Kulturabteilung außerdem signalisieren, dass ich keiner dieser eitlen, affektierten Möchtegern-Literaturpreisträger war, mit denen er sonst sicher mühsame und humorlose Gespräche führen musste. Nein, ich war ein Normalo. Ein lockerer Typ. Einer, der abends die Simpsons guckte.
»Du hast dein Homo-T-Shirt an!«, lachte Nele und zeigte auf den Homer Simpson auf meinem Bauch.
Meine Tochter, die gerade ins Zimmer gekommen war, strahlte Susann und mich triumphierend an. Wie immer, wenn sie einen Witz gemacht hatte. Mein Kumpel Dille hatte ihr das beigebracht: Homo Simpsons! Haha. Dille-Humor. Nele war gerade mal sechs Jahre alt und kannte dank Dille auch schon die Ausdrücke Hämorrhoiden, Vorhaut und Amoklauf. Dille hatte meiner Tochter außerdem eine ganz besondere Form der Reaktion beigebracht, wenn Susann oder ich ihr etwas auftrugen. Sagten wir zu Nele beispielsweise: »Räum dein Zimmer auf« oder »Bring bitte den Teller in die Küche«, pflegte unsere Kleine zu antworten: »Heute nicht, Schatz. Ich hab Kopfschmerzen.«
Die Flausen, die Dille unserer Nele in den Kopf setzte, waren völlig unpassend. Zugegebenermaßen waren sie aber auch ziemlich komisch. Susan und ich mussten uns oft ganz schön zusammenreißen, um nicht loszulachen, wenn Nele einen ihrer unangebrachten Gags abfeuerte.
Da nun beide weiblichen Mitglieder meiner Familie einen abfälligen Kommentar über meine Garderobe abgegeben hatten, blieb mir keine andere Wahl, als mich umzuziehen. Eine Viertelstunde später stieg ich mit gebügeltem Freizeithemd, fransenfreier schwarzer Jeans und geputzten Halbschuhen ins Auto. Susann und Nele gaben mir Abschiedsküsse.
»Viel Glück«, sagte Susann.
»Bau keinen Scheiß, Alter«, kicherte Nele.
Ich sollte ernsthaft darüber nachdenken, Dille Hausverbot zu erteilen.
Beim NDR wurde ich von einer Sekretärin in einen schmucklosen Raum abgeschoben. Der Mitarbeiter, der mich interviewen sollte, war noch auf einem Außentermin. Ich saß also auf mich allein gestellt auf einem Bürostuhl und drehte mich in Ermangelung irgendeiner anderen Tätigkeit, die sich anbot, seit einer Viertelstunde rasant im Kreis, während aus einem Lautsprecher an der Wand das aktuelle Programm von NDR2 dudelte. Eben hatte Robbie Williams Eternity geschmachtet, jetzt besang Enrique Iglesias irgendeinen Hero. Und dann ging die Tür auf. Mein Redakteur war da! Endlich! Ich stoppte mein Bürostuhl-Karussell-Spiel so abrupt, dass ich halb von der Sitzfläche rutschte.
»Herr Lehmann?«, fragte der Redakteur und tat so, als wäre es ganz normal, dass ein ausgewachsener Mann schräg zwischen Bürostuhl und Fußboden hing wie ein nasser Sack.
Ich nickte und erhob mich so würdevoll, wie es in dieser Situation möglich war.
Als ich endlich stand, schüttelten der Mann und ich uns die Hand. Ich musterte mein Gegenüber. Das konnte nicht der Redakteur sein. Der Bursche hier war höchstens zwanzig Jahre alt. Vermutlich ein Praktikant, der mich gleich zu der graumelierten Kulturkoryphäe des Senders führen würde.
Doch dann stellte der Bubi sich vor: »Dominik Brockheffer. Freut mich sehr.«
Es war derselbe Name, den ich schon am Telefon gehört hatte. Jungchen war tatsächlich der Kulturjournalist.
Okay. Ich musste mich anscheinend langsam daran gewöhnen, dass ich als einundvierzigjähriger Mann beruflich zunehmend mit jüngeren Leuten zu tun haben würde. Ich hatte schließlich früher selbst als Mittzwanziger des Öfteren Herren gesetzten Alters interviewt. Aber hatte ich damals nicht viel reifer gewirkt als dieser Knabe hier?
Auf jeden Fall war ich besser vorbereitet gewesen. Denn nun sagte Herr Brockheffer: »Gratuliere zu Ihrem ersten Roman. Er soll ja ganz toll sein. Sie müssen entschuldigen, ich hatte keine Zeit, ihn zu lesen. Unsere Volontärin hat aber total davon geschwärmt. Es geht irgendwie um deutsche Geschichte. Und um Familie und so was, oder?«
Ich seufzte. Das konnte ja heiter werden.
Klein-Dominik hatte uns beiden Kaffee organisiert und saß mir nun freundlich lächelnd gegenüber. Er hatte mich gebeten, ihm vor dem Interview einen »kurzen Überblick« über mein Buch zu geben. Was ich tat.
»Kirschkerne«, sagte ich, »ist eine Geschichte über Freundschaft. Und über die Wege und Abzweigungen, die das Leben einem offeriert, während man in eine ganz andere Richtung schaut.« Ich lächelte Dominik Brockheffer freundlicher an, als ich dem lesefaulen Hobbyjournalisten tatsächlich gesinnt war.
»Aha«, sagte er. »Und etwas konkreter?«
Das Kerlchen wollte tatsächlich eine Inhaltsangabe! Unglaublich!
»Also«, begann ich, fest entschlossen, mein erstes Interview professionell durchzuziehen. »Es ist die Geschichte meiner fünf besten Freunde. Und meine eigene Geschichte natürlich auch. Wir sind alle im Jahr 1960 geboren, und ich erzähle in Kirschkerne, was uns in den vierzig Jahren bis zur Millenniumswende so alles widerfahren ist.«
Dominik nickte. Sein Blick forderte mich zu mehr Details auf.
Also gab ich sie ihm: »Ich selbst bin durch diverse Phasen gegangen. Punk, Alternativ … Na ja, was man in den Siebzigern eben so war. Ich habe dann lange als freier Journalist gearbeitet. So wie Sie. Kein wirklich spektakuläres Leben. Außer, dass ich über viele Umwege irgendwann die Frau meiner Träume gefunden habe: Susann. Wir waren schon Grundschulkumpel, aber ich habe ewig gebraucht, bis ich begriff, dass sie der Mensch ist, der mich glücklich machen kann.«
»Ein glücklicher Schriftsteller«, grinste Dominik. »Trifft man ja eher selten.«
Ich ignorierte seine Bemerkung. »Susann und ich haben eine Tochter. Nele. Sechs Jahre alt. Susann und ich sind immer noch zusammen. Und irgendwann wird Susann vielleicht auch mal einen meiner alljährlichen Heiratsanträge annehmen.«
Ich grinste hoffnungsvoll. Das sollte nun aber wirklich das Eis brechen. Die meisten Leute fanden es kurios und charmant, dass ich der Mutter meines Kindes in regelmäßigen Abständen die Ehe antrug, obwohl sie mich jedes Mal freundlich, aber bestimmt abblitzen ließ. Susann glaubte einfach nicht an das Hochzeitsritual.
Dominik Brockheffer aber amüsierte meine romantische Hartnäckigkeit kein bisschen. Er schien sich nur mit Mühe ein Gähnen verkneifen zu können. Das war zweifelsohne der langweiligste Plot, den er je gehört hatte.
»Schnell zusammengefasst, klingt das zugegebenermaßen ziemlich …«, murmelte ich defensiv, doch Dominik unterbrach mich.
»Und Ihre Freunde?«, fragte er in der offensichtlichen Hoffnung, dass sie nicht solche Nullnummern waren wie ich.
»Ja«, fuhr ich fort. »Da gibt es Dille. Eigentlich Dilbert. Er ist ein Spielplatzrocker, ein Maulheld, ein Teenie-Macho, ein Sprücheklopfer. Als er fünfzehn war, hatte er Sex mit Petra, die auch zu unserer Clique gehörte. Petra hat sich immer wie ein Junge benommen. Total tough. Wir waren alle aufrichtig überrascht, dass sie überhaupt eine Gebärmutter hat. Wie auch immer, die beiden gingen ins Bett, und Petra wurde von Dille schwanger. Sie haben das Kind bekommen und sind zusammengezogen. Sie haben geheiratet und zwei weitere Kinder bekommen. Die beiden sind wie Feuer und Wasser, sie fetzen sich ununterbrochen. Auch heute noch. Aber irgendwie raufen sie sich immer wieder zusammen.«
Dominik Brockheffer sah aus, als würde er darauf brennen, ein ernstes Wort mit der Volontärin zu reden, die ihm den faden Autor solch eines banalen Romans als Gesprächspartner angepriesen hatte.
»Sie müssen verstehen«, sagte ich. »Es ist eine wahre Geschichte. Es geht nicht um irgendwelche großen Ereignisse, es gibt kaum dramaturgische Knalleffekte. Es geht um die Liebe und um Freundschaft, über die Gedanken, die man sich macht, die unerwarteten Streiche, die einem das Leben spielt. Es ist auch eine Chronik über das Deutschland der letzten vierzig Jahre. Manche Leute sagen, das Buch sei sogar ein wenig philosophisch. Und viele Leute finden es, nun ja … unterhaltsam. Komisch. Rührend.«
Ich ärgerte mich über mich selbst. Warum verteidigte ich mein eigenes Buch vor einem Mann, der es gar nicht gelesen hatte?
»Gibt’s auch Tote?«, fragte Dominik.
Ich schaute ihn erstaunt an. »Es ist kein Krimi«, sagte ich und konnte mir einen säuerlichen Zug um die Mundwinkel nicht verkneifen. »Ich hasse Krimis.«
»Hm«, murmelte Dominik. »Trotzdem.«
Mittlerweile kochte ich innerlich vor Wut. Dieses Jüngelchen wollte mir unmissverständlich klarmachen, dass mein bisheriges Leben zu langweilig war, um überhaupt aufgeschrieben werden zu dürfen. Er wollte mehr Action. Sex and Crime.
Okay, konnte er haben.
»Ein bisschen Krimi ist schon drin«, sagte ich. »Da gibt es noch Sven. Meinen anderen Kumpel. Der hat lange gebraucht, bis er sich als schwul outete. Das war echt hart für ihn. Seine Mutter konnte das nicht akzeptieren, daraufhin ist Sven eines Nachts mit einem Jagdmesser in ihr Schlafzimmer gegangen und hat ihr beide Augäpfel aus dem Gesicht geschnitten, die Pupillen dann in Teriyaki-Sauce mariniert, bei milder Hitze goldbraun gebraten und schließlich per Einschreiben an den Papst geschickt.«
Dominik Brockheffer schaute mich eine Sekunde verblüfft an, dann begann er zu lachen.
Ich grinste: »Okay. Keine Augäpfel. Aber Svens Outing ist tatsächlich ein wichtiger Teil des Romans. Sven hat sich in vierzig Jahren von einem verängstigten Häschen zu einem stolzen, starken Mann entwickelt. Er und sein Lebensgefährte waren eines der ersten homosexuellen Paare in Deutschland, die geheiratet haben. Er ist heute Regisseur am Theater.«
»Cool«, fand Dominik. Er schaute für einen Moment in Gedanken versunken an die Decke. Dann sagte er: »Also, da gibt es Sie. Ihre Susann. Dille, der Chaot, und Petra, die nicht feminine Powerfrau. Sven, der stolze Schwule … Einer fehlt noch, oder?«
Ich nickte: »Da kriegen Sie doch noch Ihren Toten. Bernhard.«
Ich war erstaunt, wie schwer es mir immer noch fiel, über Bernhard zu reden. Es war ein Jahr her, seit wir ihn beerdigt hatten, aber es tat immer noch weh.
»Bernhard war ein ganz besonderer Mensch«, erklärte ich Dominik. »Er war scheu. Ein Stotterer. Ein Träumer. Und hyperintelligent. Ich habe nie wieder einen Menschen getroffen, der so klug war wie Bernhard. Er hat aus seiner Genialität nur nie etwas machen können. Er war das Kind schwerer Alkoholiker. Vernachlässigt. Und dann ist er abgehauen. Mit sechzehn. Wir haben jahrelang Briefe von ihm bekommen. Aus aller Welt. Er war Entwicklungshelfer, Abenteurer, Weltreisender. Zumindest dachten wir das. Wir haben ihn bewundert. Ich habe ihn auch beneidet. Aber dann stellte sich letztes Jahr heraus, dass er all die Jahre in Wuppertal gelebt hat. Dass alles eine Lüge war. Ein Fake. Bernhard hatte sich wie seine Eltern totgesoffen. Wir haben ihn im Juli letzten Jahres beerdigt.«
»Das tut mir leid«, sagte Dominik.
»Mir auch«, antwortete ich.
»Und wie geht die Geschichte aus?«, fragte mein Interviewer.
Ich sah ihn erstaunt an. »Gar nicht«, sagte ich.
»Wie jetzt?«, wunderte er sich.
»Wie soll so eine Geschichte denn ausgehen?«, wollte ich wissen. »Es ist das Leben. Und das Leben geht weiter.«
Klein-Dominik sah mich zweifelnd an. Er schien sich nicht vorstellen zu können, dass das Leben für Menschen über vierzig noch irgendetwas bereithielt. Wahrscheinlich dachte er, alles, was Männern meines Alters noch blieb, waren die alljährliche Prostatakrebs-Vorsorgeuntersuchung und sporadische Ü40-Partys, auf denen wir zu den Klängen von Status Quo und Cindy Lauper unsere arthritischen Gelenke schüttelten.
»Doch, doch. Es geht immer weiter, das Leben«, bekräftigte ich.
»Sicher«, sagte Klein-Dominik. »So ist das wohl.«
»Was soll das heißen, wir brauchen einen anderen Musiker?«, rief Sven. »Ich hab für Mahmoud gekämpft, und ihr habt mir zugesagt, dass es klappt, und jetzt …«
»Er hat Flugverbot«, unterbrach ihn Brückner.
»Was?«, wunderte sich Sven.
»Er darf kein Flugzeug besteigen«, erklärte Brückner. »Er ist Muslim. Und er hat diese CD gemacht mit dem Lied über Palästina und …«
»Das darf doch nicht wahr sein!«, rief Sven. »Er ist Sänger und Gitarrist. Kein Terrorist! Er ist ein fester Bestandteil des Konzepts. Wie soll ich jetzt zwei Wochen vor der Premiere …?«
Brückner machte eine hilflose Geste. »Wir haben alles versucht. Wirklich. Aber die Amis haben ihn vom Flugverkehr ausgeschlossen. Er hängt in New York fest.«
Sven schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Er saß dem Intendanten in seinem Büro gegenüber und konnte nicht fassen, dass der so ruhig blieb.
»Das ist doch ein Skandal!«, rief Sven. »Damit müssen wir an die Presse! Das können wir doch nicht einfach so …«
»Sven«, sagte Brückner. »Ich schätze deine Leidenschaft. Aber wenn du den Job erst mal so lange machst wie ich, dann gewöhnst du dich daran, dass ständig solche Dinge passieren. Theater ist ein organisches Medium. Da muss man schnell reagieren. Und der wahre Kreative beharrt nicht auf einem Konzept, sondern versteht zu improvisieren.«
Sven atmete tief durch. Er versuchte, sich zusammenzureißen. Das hier war eine Riesenchance für ihn. Seine erste Inszenierung am Großen Haus. Am Thalia Theater, um Himmels willen. Dem legendären Thalia Theater!
Sein Aufstieg hatte zwar relativ spät stattgefunden, war dafür aber kometenhaft verlaufen. Erst vor einem Jahr hatte Sven, der viele Jahre an kleinen Theatern gearbeitet hatte, seinen ersten Auftrag als Bühnenbildner am Thalia Theater gehabt. Seine innovativen Ideen hatten alle am Haus sehr beeindruckt und gingen weit über das hinaus, was andere Bühnenbildner zu einem Stück beisteuerten. Als der Regisseur des Stückes erkrankte und die Inszenierung auf der Studiobühne im halbfertigen Zustand hinterließ, sprang Sven ein. Kurz entschlossen hatte er alles in die Tonne getreten, was bislang erarbeitet worden war, und binnen sechs Wochen eine komplett neue Inszenierung auf die Beine gestellt, die euphorische Kritiken geerntet hatte und fast jeden Abend ausverkauft gewesen war.
So bot man Sven für die nächste Spielzeit ein Stück am Großen Haus an. Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Der frischgebackene Regisseur Sven siedelte die Geschichte in einem ostdeutschen Kaff an und engagierte einen angesagten New Yorker Avantgarde-Musiker, dessen Klänge und Songs essenziell für die Inszenierung waren.
Und dann flogen diese Schweine in die Twin Towers.
Und dann machten diese amerikanischen Idioten Jagd auf alles, was den Koran las.
Und jetzt saß Sven ohne Musiker da. Zwei Wochen vor der Premiere.
»Ach, komm schon, Sven«, sagte Brückner. »Ich bin mir sicher, dass dir etwas einfällt.«
Der Intendant erhob sich. Das Gespräch war beendet.
Als Sven später nach Hause kam, knallte er die Wohnungstür hinter sich zu.
»Fuck!«, brüllte er all die Wut heraus, die er eine Stunde lang im Theater mühsam unterdrückt hatte.
Jörn kam aus dem Wohnzimmer in den Flur. »Was ist denn, Schatz?«, fragte er.
»Fuck!«, brüllte Sven noch einmal, stapfte in sein Arbeitszimmer und knallte auch diese Tür hinter sich zu.
Seinen Ehemann würdigte er nicht eines Blickes.
»Wie lief das Interview?«, Susann empfing mich bereits an der Wohnungstür.
Ich mumpfte.
So nannte Susann das. Wenn ich über etwas nicht reden wollte, zog ich die Lippen zusammen und grummelte ein Geräusch heraus, das angeblich wie »Mumpf« klang.
»Mumpf?«, fragte sie.
Ich zog die geputzten Halbschuhe aus. »Der Typ sagte, es ist noch nicht sicher, ob es überhaupt gesendet wird«, brummte ich.
»Och«, sagte Susann und nahm mich kurz in den Arm. »Und warum nicht?«
Ich zuckte die Schultern. »Die bemühen sich gerade um ein Telefoninterview mit Hera Lind. Und wenn die zusagt, ist für mein Buch keine Zeit mehr in der Sendung.«
»Schlimm?«, fragte Susann.
»Ach, wer hört schon Radio«, sagte ich und versuchte, cool zu klingen.
»Ganz schlimm?«, hakte Susann nach.
»Na ja. Wäre irgendwie schon spannend gewesen, sich selbst mal in einem Radiointerview zu hören«, gab ich zu.
»Sushi-schlimm?«, lächelte Susann mich an.
»Sushi-und-Sashimi-schlimm«, nickte ich.
Das war eines unserer Rituale. Wenn einer von uns schlecht drauf war, so richtig frustriert, dann bestellten wir uns etwas Leckeres zu essen. Ich liebte japanisches Essen, das gerade seinen Siegeszug in Deutschland begonnen hatte. Es gab bereits drei Restaurants in Hamburg, die Rohe-Fisch-Röllchen anboten. Und eines davon lieferte sogar außer Haus. Da Susann mehr auf italienisches Essen stand, bestellten wir immer doppelt.
Nachdem wir Nele am Abend ins Bett gebracht hatten, füllten wir die Leckereien von den hässlichen Styroporschalen auf schöne Teller, zündeten Kerzen an, machten eine Flasche Wein auf, legten eine gute CD rein – ich hatte mir gerade das neue Album von Björk gekauft – und schauten uns tief in die Augen, während wir aßen. Wir redeten nicht viel. Wir schauten uns nur an. Ganz genau schauten wir uns an. Ganz bewusst. Und dann wurde uns immer klar, dass es wichtigere Dinge im Leben gab als den blöden Kleinscheiß, über den wir uns gerade geärgert hatten. Dass das Leben voll schöner Dinge ist. Dass es Sushi und Sashimi gab und Linguini mit Scampi. Und dass es uns gab. Susann und mich. Und unsere Nele. Und dass es das gab, was Susann und ich im Schlafzimmer anstellten, nachdem wir die Kerzen ausgepustet und die Teller in die Geschirrspülmaschine gestellt hatten.
Aber an diesem Abend musste ich dabei einmal kurz an Hera Lind denken.
Und das war nicht schön.
Petra starrte fassungslos den Strich an. Horizontal. Nicht vertikal. Es war ein horizontaler Strich! Scheiße.
Petra dachte an all die Glückwunschkarten, die sie in den letzten Monaten für werdende Eltern, für Taufen und Kindergeburtstage gestaltet hatte. Das war ihr Job: Texterin und Designerin für Glückwunschkarten. Eine der Geburtskarten der neuen Kollektion war wie ein Ei geformt. Darauf stand: Schaut mal, was meine Mama ausgebrütet hat! Und wenn man die Ei-Karte aufklappte, war da eine freie Fläche, auf der die stolzen Eltern ein Foto ihres gerade geborenen Kindes aufkleben konnten.
Und jetzt brütete Petra selbst wieder so ein Kinderküken aus. Ihr viertes!
Petra legte den Schwangerschaftsteststick auf den Badewannenrand und ließ den Kopf in die Hände sinken.
Sie war jetzt vierzig. Andere Frauen erwarteten in dem Alter begeistert ihr erstes Kind. Mutterschaft auf den nahezu letzten Drücker. Petra allerdings, die bereits mit fünfzehn schwanger geworden war und sechs Jahre später dann noch Zwillinge bekommen hatte, hatte sich gerade darauf eingestellt, mit vierzig einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Ihr ältester Sohn Jan war schon vor Jahren ausgezogen und inzwischen fast fertig mit seinem Studium. In einem Jahr würde er ausgebildeter Verfahrenstechniker sein. Petra hatte nach wie vor nur eine vage Ahnung, was genau das war. Ihre Zwillinge Lucy und Florian waren auch schon neunzehn und hatten gerade mit Ach und Krach ihr Abitur geschafft. Derzeit suchten sie eine Wohnung. Eine gemeinsame Wohnung. Sie waren nach wie vor unzertrennlich. Dann wären da nur noch Dille und sie gewesen. Ein Ehepaar. Zwei Menschen, die gemeinsam Dinge unternehmen, sich wieder annähern, eine Zweierbeziehung führen konnten – etwas, was ihnen aufgrund der frühen Elternschaft bislang nicht möglich gewesen war. Petra hatte sich darauf gefreut.
Zugegeben, Dille und sie hatten sich oft in der Wolle. Immer wieder flogen die Fetzen, Kraftausdrücke und gelegentlich auch Gegenstände mittelharter Konsistenz. Aber sie liebte ihn. Trotz allem. Und sie hatte gehofft, dass sie nach dem Auszug der Zwillinge endlich den romantischen, innigen Teil ihrer Ehe einläuten würden, der ihnen bislang versagt geblieben war. Sie hatte sich so sehr auf die Zweisamkeit gefreut. Nur Dille und sie.
Pustekuchen. Da waren jetzt Dille, sie … und der horizontale Strich.
Wie Dille wohl reagieren würde? Petra schaute auf die Uhr. Es war kurz nach Mitternacht. Es würde noch dauern, bis er nach Hause käme. Seine Counterstrike-Abende endeten selten vor drei Uhr nachts. Wenn sich Petras Mann erst mal mit seinen Freunden am Computer eingeballert hatte, vergaßen die Jungs Zeit und Raum. Da waren sie wie kleine Kinder. Nicht viele Frauen würden Verständnis dafür aufbringen, wenn ihr Gatte sich einmal die Woche zu endlosen martialischen Computerspielnächten mit seinen Freunden traf. Aber Petra hatte damit kein Problem. Sie spielte selbst ganz gern Counterstrike.
Das Telefon klingelte. Petra schaute überrascht auf. Ein Klingeln nach Mitternacht versprach nichts Gutes.
»Ja?«, meldete sie sich.
»Frau Hölters?«, sagte eine Männerstimme.
»Wer spricht da?«, fragte Petra.
»Moment«, sagte die Stimme.
Der Hörer wurde offenbar weitergereicht. Dann hörte Petra Lucys Stimme.
»Mama?«, sagte sie.
»Lucy! Was ist los?!«, rief Petra aufgeregt.
Lucy zögerte kurz. Dann sagte sie: »Könntest du uns … äh … bei der Polizei abholen?«
Als Dille um kurz nach vier nach Hause kam, war er überrascht, dass im Wohnzimmer Licht brannte. Mit fragendem Gesichtsausdruck schaute er Petra, Lucy und Florian an, die gemeinsam am Tisch saßen.
»Was ist denn hier los?«, fragte er.
»Hallo, Schatz. Es gibt ein paar kleine Neuigkeiten«, sagte Petra mit ruhiger, freundlicher Stimme. Auf unbeteiligte Beobachter hätte sie zweifelsohne völlig gelassen und entspannt gewirkt. Doch Dille kannte seine Frau lange genug, um zu wissen, dass das ihr bedrohlichster Tonfall war. Wenn sie so sprach, war die Kacke ernsthaft am Dampfen.
»Schieß los«, sagte er nervös und setzte sich.
»Deine reizenden Kinder«, sie zeigte auf Lucy und Florian, »sind bei Karstadt eingebrochen.«
»Was?!«, rief Dille.
»Das war ein politischer Protest«, erklärte Florian.
»Ein Statement gegen den Konsumterror«, ergänzte Lucy.
»Wir sind mit ein paar Freunden von der Spaßguerilla…«, begann Florian auszuführen.
»Spaßguerilla?!«, rief Dille.
»Ja. Gewaltloser, phantasievoller Widerstand«, sagte Lucy. »Eine alte anarchistische Tradition. Gab’s schon in deiner Generation. Fritz Teufel. Rainer Langhans. Das Pudding-Attentat auf Vizepräsident Humphreys…«
»Können wir vielleicht mal zum Thema zurückkehren?«, unterbrach Dille seine Tochter. »Ihr seid bei Karstadt eingebrochen?«
»Wir waren acht oder neun Leute«, fuhr Florian fort. »Wir sind in die Möbelabteilung eingestiegen und haben uns dort eingenistet. Probewohnen bei Karstadt. Bettenbesetzung! Ironie, verstehste? Wir haben uns Sachen aus der Lebensmittelabteilung geholt und eine Party gefeiert. So von wegen … Konsumgüter sind für alle da. Keiner hat das Recht…«
»Ihr habt eine Party gefeiert?! Bei Karstadt?! Nachts?!«, schrie Dille. »Seid ihr noch ganz dicht?! Dafür kommt ihr ins Gefängnis!«
»Wir haben nichts beschädigt«, beeilte sich Lucy zu versichern. »Und wir sind auch nicht richtig eingebrochen. Einer aus unserer Gruppe hat einen Bruder, der beim Wachdienst von Karstadt arbeitet, und von dem hatten wir den Schlüssel für eine Hintertür.«
»Wir haben Fotos gemacht. Und wir haben Leute vom Fernsehen angerufen«, ergänzte Florian. »Die sind mit einem Kamerateam gekommen, als wir verhaftet wurden.«
»Bei Spaßguerilla geht’s ja immer auch um Öffentlichkeit«, erklärte Lucy. »Die Karstadt-Typen werden aber versuchen, es als Bagatelle abzutun. Die haben gar kein Interesse, dass das groß thematisiert wird oder gar vor Gericht geht. Außerdem haben wir schon vorher mit einem guten Anwalt gesprochen. Einer aus unserer Gruppe kennt einen, der …«
»Ich fass es nicht!«, rief Dille. »Das ist doch … Ach, du Scheiße! Habt ihr eine Ahnung, was da jetzt alles auf uns … auf euch … auf uns alle zukommt?!«
Dille war außer sich. Er schaute zu Petra hinüber, die immer noch ganz ruhig und mild lächelnd dasaß.
»Und was grinst du so blöd?!«, rief er. »Sag doch auch mal was!«
»Ich bin schwanger«, sagte Petra völlig gelassen.
Dille fiel die Kinnlade herunter.
Der NDR sendete das Interview doch. Ich wurde jedoch nie darauf angesprochen. Wahrscheinlich hört wirklich kein Mensch die Kulturbeiträge im Radio.
Am nächsten Tag telefonierte ich mit Ulf, meinem Lektor beim Verlag.
»Ich hab eine großartige Idee für ein neues Buch«, sagte ich.
Ulf druckste herum. »Piet … Weißt du … Wir sollten erst mal …«
»Ich würde gern etwas über eine Frau mit Depressionen schreiben«, redete ich einfach weiter. »Ich finde, das ist ein faszinierendes Thema. Depressionen.«
Auf der anderen Seite der Leitung war es still.
Es war viel zu lange still.
»Piet«, sagte mein Lektor schließlich. »Um ehrlich zu sein … Wir haben von deinem Buch weniger Exemplare verkauft als von dem veganen Kochbuch für Kinder. Ich glaube nicht, dass der Verleger bereit ist, dir eine weitere Chance …«
»Depressionen!«, rief ich aus. »Es gibt Millionen Menschen da draußen mit Depressionen! Wenn nur jeder Zehnte davon mein Buch kauft …«
»Piet«, unterbrach mich Ulf. »Depressive Leute sind zu deprimiert, um deprimierende Bücher zu lesen. Die gucken lieber die Wand an.«
»Aber das wäre eine Figur, in die ich mich momentan total gut hineinversetzen könnte!«, rief ich mit der Beharrlichkeit der Verzweifelten.
Ich wäre erledigt, wenn ich nicht die Chance auf einen zweiten Roman bekäme.
»Du weißt, wie sehr ich deine Schreibe schätze«, sagte mein Lektor in väterlichem Tonfall, obwohl er zehn Jahre jünger ist als ich. »Aber momentan laufen diese Art von Bücher einfach nicht. Momentan wollen alle Fantasy. Harry Potter. Kennste doch, oder? Da gibt’s bald schon wieder einen neuen Band. Und Krimis. Henning Mankell zum Beispiel, der läuft wie blöde. Deine Art von Romanen aber, so toll ich sie finde …«
»Ich kann auch Krimi«, sagte ich verzweifelt.
»Was?«, wunderte sich Ulf.
»Ich liebe Krimis!«, log ich.
»Echt?«
»Ja! Total! Ich haben alles gelesen von … äh … Edgar Wallace bis … Patricia Highsmith.«
»Das ist so etwa fünfundzwanzig Jahre her, oder?«, hakte mein Lektor mit amüsiertem Unterton nach.
»Ja … Das sind halt … die Klassiker«, stammelte ich. »Aber ich kenn auch die aktuellen Sachen. Henning Mankell und … so.«
Es war wieder still auf der anderen Seite. Ich wusste, dass er mir nicht glaubte. Lügen war noch nie meine Stärke gewesen.
»Okay«, sagte mein Lektor schließlich. »Du bist ein guter Autor. Warum solltest du nicht einen Krimi probieren? Mitunter haben ja die genrefremden Schreiber die interessantesten Herangehensweisen. Aber beim Honorar werden wir Abstriche machen müssen. Das ist dir klar, oder?«
»Ja, äh …«, stammelte ich.
»Was schwebt dir denn so für eine Geschichte vor?«, fragte Ulf. »So ganz spontan.«
»Eine depressive Privatdetektivin?«, schlug ich vor.
Das Lachen meines Lektors war so laut, dass ich den Hörer ein Stück vom Ohr weghalten musste.
Susann saß auf der Bank am Rande eines Spielplatzes, nicht weit von ihrer Wohnung in Hamburg-Ottensen. Nele saß mit zwei anderen Kindern in der Sandkiste und buddelte mit ihnen gemeinsam hochkonzentriert elaborierte Gräben und Türmchen für ihre Playmobilfiguren.
Es war Samstagmorgen, und Susann hätte gern mit Piet und Nele einen kleinen Ausflug gemacht, ein Spaziergang an der Elbe, ein Besuch im Hirschpark vielleicht. Doch Piet hatte sich gleich nach dem Frühstück hinter seinem Computer verschanzt und sich auf sein neues Buchprojekt gestürzt. Ein Krimi. Ausgerechnet. Piet konnte regelrecht manisch werden, wenn er sich ein Ziel setzte und seine Reise dorthin begann. Dann trat die restliche Welt für eine Weile in den Hintergrund. Und selbst wenn Susann ihn tatsächlich zum Hirschpark hätte überreden können, wäre er vermutlich bloß stumm und mit den Gedanken bei seinem neuen Projekt neben ihr und Nele hergetrottet. Also: Spielplatz.
Susann schaute ab und an zu ihrer Tochter hinüber, doch da Nele völlig in ihr Spiel vertieft war, blätterte Susann die meiste Zeit in den Unterlagen, die sie mitgenommen hatte. Es waren die aktuellsten Verordnungen der Schulbehörde. Susann hatte das Gefühl, dass ihr Alltag als Lehrerin nur noch zu einem knappen Drittel aus Unterrichten bestand. Der Rest war Papierkram: Reformen, Statistiken, Schwachsinn. Sie hatte diesen Beruf einmal ergriffen, weil sie die Vorstellung gehabt hatte, junge Menschen auf einen guten Lebensweg bringen zu können. Doch dazu kam sie in letzter Zeit immer seltener. Die Bürokratie hatte sie im Würgegriff. Susann seufzte.
»Weißt du, was ich total an dir mag?«, sagte plötzlich eine Männerstimme neben ihr.
Susann blickte überrascht auf und sah Jörn, der neben ihr stand. Svens Ehemann hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt und grinste sie an.
»Meine unglaublich faszinierende Aura, meinen Humor und meinen Intellekt?«, schlug Susann vor.
»Nicht zu vergessen deinen erstklassig geformten Hintern«, fügte Svens Ehemann mit einem Zwinkern hinzu. »Nein, vor allem mag ich an dir, dass man dir immer ansieht, wie es dir gerade geht.«
»Soso?«, lächelte Susann. »Und wie geht’s mir gerade?«
»Ich habe dich hier sitzen sehen, als ich auf dem Balkon war, und dachte, das arme Mädchen braucht eine Aufmunterung«, sagte Jörn und zauberte hinter seinem Rücken zwei Becher hervor, aus denen es verführerisch dampfte.
»Cappuccino?«, strahlte Susann.
»Wozu hab ich mir schließlich diese sündhaft teure Kaffeemaschine gekauft?«, sagte Jörn.
Susann nahm ihm eine Tasse ab. »Du bist ein Engel.«
Jörn setzte sich neben sie.
In diesem Moment bemerkte auch Nele Jörn und winkte ihm begeistert von der Sandkiste aus zu. »Hallo, Onkel Jörn!«, rief sie.
Jörn warf ihr eine Kusshand zu. »Hallo, Rockerbraut!« Dann drehte er sich wieder zu Susann und zeigte auf die Papiere, die sie neben sich auf die Bank gelegt hatte. »Die üblichen brillanten Einfälle der Schulbehörde?«
»Ja«, nickte Susann spöttisch. »Die deutsche Lehrerschaft besteht nach wie vor aus Superhelden. Wir können alles! Wir machen jeden Tag aus verwahrlosten Legasthenikerkindern Atomphysiker und sparen dabei auch noch zwanzig Prozent des Bildungsetats ein.«
»Na ja, wenigstens hast du einen Job«, antwortete Jörn.
Susann legte ihre Hand auf seine. »Nichts Neues bei dir?«, fragte sie.
Jörn schüttelte den Kopf. »Ist ’ne kleine Branche. Und jeder klebt auf seinem Posten. Wenn’s so weitergeht, muss ich mich wohl umorientieren.«
Jörn war vor neun Monaten arbeitslos geworden, als das Musicaltheater, an dem er als kaufmännischer Direktor gearbeitet hatte, an eine ausländische Firmengruppe verkauft worden war.
»Aber ich habe echt keine Lust, in irgendeinem blöden Büro die Buchhaltung zu machen«, sagte Jörn.
»Kann Sven nicht irgendwie …?«, hob Susann an. »Der kennt doch Gott und die Welt am Theater.«
Susann sah an Jörns Gesichtsausdruck, dass sie einen wunden Punkt getroffen hatte. Doch bevor sie nachfragen konnte, was denn los sei mit ihm und Sven, wurden sie von einem lauten Geschrei aufgeschreckt. In der Sandkiste war plötzlich die Hölle los! Nele saß auf einem brüllenden und heulenden Jungen, dem sie mit Nachdruck immer wieder ihre kleine Plastikschaufel auf den Kopf schlug. Die beiden anderen Kinder, mit denen Nele gespielt hatte, weinten erschrocken.
Susann sprang von der Bank auf und lief zu ihrer Tochter. »Nele! Hör auf!«, rief sie. »Hör sofort auf!«
Nele schaute zu ihrer Mutter auf. »Er hat angefangen!«, rief sie, während sie die Schaufel über dem Kopf schwang.
»Das ist mir völlig egal!«, rief Susann. »Schluss jetzt!«
Nele schaute noch einmal zu dem wimmernden Jungen, auf dem sie hockte, und stieg dann achselzuckend von ihm herunter.
Susann nahm die Hand des Jungen und half ihm auf.
»Alles okay?«, fragte sie.
Der Junge weinte.
»Tut dir etwas weh?«, fragte Susann. »Tut dein Kopf weh?«
»Er hat unseren Turm kaputt getreten, und als wir gesagt haben, er soll aufhören, hat er gesagt, wir sind doof, und hat auch noch die Brücke kaputt getreten, und dann hat er Mara an den Haaren gezogen, und da hab ich …«, rappelte Nele aufgeregt herunter.
In diesem Moment spürte Susann eine Hand, die sie grob an der Schulter packte und nach hinten zog.
»Lassen Sie mein Kind in Ruhe!«, keifte eine Frau.
Susann drehte sich um und sah einer etwa dreißigjährigen Frau ins viel zu stark geschminkte Gesicht.
»Ich hab nur …«, begann Susann die Situation zu erklären.
Doch die Frau unterbrach sie barsch: »Niemand fasst meinen Sohn an, du Fotze!«
Daraufhin schnappte sie sich ihren immer noch plärrenden Jungen und zerrte ihn ruppig hinter sich her. Das Kind drehte sich noch einmal um und zeigte Susann den Mittelfinger. »Fotze!«, rief der Junge.
Reizend. Susann setzte sich auf den Rand der Sandkiste und sah den beiden kopfschüttelnd hinterher. Sie war nicht wirklich überrascht. Sie unterrichtete an einer stadtbekannten »Problemschule« und hatte es sich längst abgewöhnt, bei Kraftausdrücken und Beschimpfungen zimperlich zu sein.
»Fotze?«, wiederholte Nele nachdenklich. »Was ist eine Fotze, Mama?«
»Das ist etwas ganz Geheimnisvolles«, antwortete Jörn, der inzwischen auch dazugekommen war, mit dramatischer Stimme. »Viele haben davon gehört, aber kaum jemand weiß etwas Genaues.«
Susann musste lachen.
»Ich jedenfalls weiß so gut wie nichts darüber«, sagte Jörn zu Nele. »Es ist einfach ein großes Rätsel. Ein schwarzes Loch …«
Susann schüttelte amüsiert den Kopf.
»Ich kann ja mal meine Lehrerin fragen, was eine Fotze ist, und dann sag ich dir Bescheid«, schlug Nele hilfsbereit vor, was Susann nun endgültig zu einem Lachkrampf verhalf.
»Frag lieber Onkel Dille«, grinste Jörn.
Susann riss entsetzt die Augen auf. »Oh Gott, nein!«, sagte sie zu Nele. »Frag ihn nicht. Frag nicht Onkel Dille! Frag niemanden. Ich erkläre es dir nachher in Ruhe, okay?«
»Kennst du denn das Geheimnis?«, fragte Nele aufgeregt.
»Ja«, grinste Susann. »Ich weiß Bescheid.«
Dille und Petra schauten sich in der Wohnung um. Marode war das Wort, das die zugige Altbaubude in Bahrenfeld am besten beschrieb. Dille griff nach einer der losen Tapetenbahnen, die nur noch halbherzig an der Wand hingen, und riss sie mit einem Ruck herunter.
»Die haben hier im Laufe der Jahre mindestens sieben Schichten übertapeziert«, rief er. »Die unterste Schicht ist wahrscheinlich frühes Biedermeier. Vielleicht sind da auch noch Höhlenmalereien drunter. Das müsst ihr alles runterreißen und komplett neu machen. Wahrscheinlich sogar neu verputzen«, seufzte er. »Und dann neue Tapeten kaufen. Für fünf Räume! Das kostet!«
»Kein Problem«, sagte Lucy.
»Wir tapezieren nicht. Wir malen einfach nur die Wand an«, erklärte Florian.
Petra hörte ein knackendes Geräusch und schaute auf den Boden. Eine der Holzdielen war locker, mit einer Tendenz zur Fäulnis. Sie öffnete das Fenster, dessen Scharniere einen ähnlich maroden Eindruck machten wie der Fußbodenbelag, und rümpfte die Nase. »Was stinkt denn hier so?«, fragte sie.
»Ach das«, sagte Lucy mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Das ist nur die Ketchup-Fabrik da drüben. Das riecht man nur, wenn der Wind von Osten kommt.«
»Also … Ich weiß nicht …«, wagte Petra einen zaghaften Vorstoß.
»Die Wohnung ist auch viel zu groß für euch beide«, unterstützte Dille sie.
»Deshalb suchen wir uns ja noch einen Mitbewohner«, sagte Lucy. »Vielleicht einen aus so einem Obdachlosenprojekt oder so. Die kommen ja sonst ganz schwer unter auf dem freien Wohnungsmarkt.«
Dille rollte mit den Augen. In seiner Phantasie sah er bereits einen verfilzten und verlausten Penner mitsamt dreibeinigem Hund, fortgeschrittener Tuberkulose und schwerer Alkoholabhängigkeit bei seinen Kindern einziehen. Doch er verkniff sich jeden Kommentar. Er wusste, dass es keinen Sinn hatte, diesbezüglich ein Veto einzulegen. Seine Zwillinge würden niemals jemanden abweisen. Sie waren offen für jeden und alles, waren voll blindem Vertrauen und einem sozialen Missionarseifer, der ebenso lobenswert war, wie er verhängnisvoll sein konnte.
Die Zwillinge spielten in verschiedenen Bands (Punk und Ska) und tummelten sich in Amnesty-International-Gruppen, konspirativen Zellen von radikalen Tierschützern und Kampfvegetariern. Sie verbrachten jede freie Minute in Cliquen, Horden, Meuten. Sie sprachen wildfremde Menschen an, ließen sich von den bizarrsten Typen vollquatschen und gaben großzügig jedem Penner Geld, der in der Fußgängerzone auf dem Boden saß. Lucy und Florian hatten einen unerschöpflichen Vorrat an kuriosen Bekanntschaften. Wagte Dille es hin und wieder, ihre vertrauensselige Affinität zu allerlei dubiosem menschlichem Strandgut zu kritisieren, dauerte es selten länger als fünf Minuten, bis er von seinen Kindern als Rassist, asozial und/oder herzlos bezeichnet wurde. Wenn Lucy und Florian einem Berber ein Zimmer anbieten wollten, würde Dille sie nicht davon abhalten können. Und selbst wenn es ihm wunderbarerweise gelänge und die Zwillinge keinen offiziellen Mitbewohner aufnähmen, so würden in ihrer Wohnung vermutlich trotzdem ständig eine Handvoll obskurer Typen übernachten. Da war es Dille tatsächlich lieber, wenn sich wenigstens einer davon formell an der Miete beteiligte. Dille verdiente als Filialleiter bei der Discounterkette Hagro zwar nicht schlecht, aber weiß Gott nicht so gut, dass er problemlos die Wohnungen für seine drei Kinder finanzieren konnte. Zwar jobbten Lucy und Florian, bevor sie demnächst irgendwann vielleicht mal ihr Studium beginnen würden (»Byzantinistik und neugriechische Philologie vielleicht oder Verhaltensgestörtenpädagogik«), doch sie behielten ihre Anstellungen als Tresenkraft, Regalauffüller und Pizzafahrer selten länger als ein paar Wochen. Mal war der Chef ein Sexist, Rassist und/oder herzlos, mal war die Bezahlung »menschenunwürdig«, und manchmal scheiterte das Angestelltenverhältnis auch an dem hochkomplexen Konzept des Rechtzeitig-aufstehen-und-pünktlich-am-Arbeitsplatz-Erscheinens, auf das erschreckend viele Arbeitgeber zu bestehen schienen.
Nein, Lucys und Florians Basisversorgung fiel immer noch in den Verantwortungsbereich ihrer Eltern. Dille und Petra taten, was sie konnten. Doch auch Petras Einkommen als Grußkarten-Kreative war eher mittelprächtig. Immerhin hatten sie kistenweise Gratiskarten für alle Gelegenheiten im Keller gestapelt. Bei jeder Beerdigung, Taufe, jedem Geburtstag und in einem Fall sogar einer Bar-Mizwa versorgten sie ihre Freunde großzügig mit kostenlosen Pappkärtchen. Aber mit Goldene-Hochzeit-Glückwünschen und Konfirmationsweisheiten konnte man keine Familie durchbringen. Auch der Anwalt, der sich derzeit mit Lucys und Florians Karstadt-Eskapade beschäftigte, würde sich vermutlich nicht mit fünfhundert Pumuckl-Einladungskarten zum Kindergeburtstag abspeisen lassen.
Und dann war da auch noch das neue Kind. Dille freute sich auf den Familienzuwachs, aber die zusätzliche finanzielle Belastung lag ihm schwer im Magen …