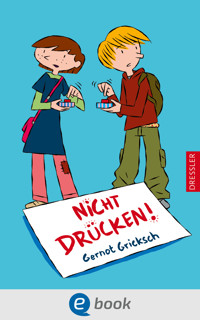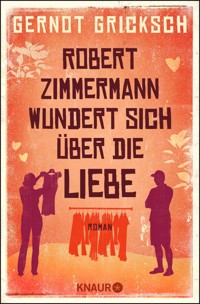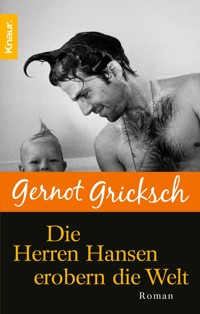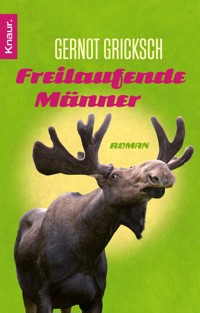6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Markus liebt seine Tochter Kim aufrichtig, aber trotzdem hat er in den letzten Jahren den Draht zu ihr verloren. Die kluge, aber störrische Fünfzehnjährige vertraute sich nur noch ihrer Mutter an. Doch nun ist Babette tot, Vater und Tochter sind auf sich allein gestellt. Kim reagiert auf den Verlust wütend und aggressiv, Markus hilflos. Er möchte seine Tochter festhalten, ihr Mut machen und sie beschützen – aber das ist nicht leicht, wenn man sich am liebsten nur die Decke über den Kopf ziehen will, um unbemerkt weinen zu dürfen. Als Kim eines Tages spurlos verschwindet, muss Markus sich auf die Suche nach ihr machen. Und am Ende dieser unerwarteten Reise wird er sie nicht nur finden – sie werden sich gegenseitig retten … Ein Roman wie das Leben: mit vielen kleinen und großen Niederlagen, aber auch voller unerwarteter Glücksmomente und der Erkenntnis, dass wir alles schaffen können, wenn wir die richtigen Menschen an unserer Seite haben. Das Leben ist nichts für Feiglinge von Gernot Gricksch: auch im eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Gernot Gricksch
Das Leben ist nichts für Feiglinge
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Markus liebt seine Tochter Kim aufrichtig, aber trotzdem hat er in den letzten Jahren den Draht zu ihr verloren. Die kluge, aber störrische Fünfzehnjährige vertraute sich nur noch ihrer Mutter an. Doch nun ist Babette tot, Vater und Tochter sind auf sich allein gestellt. Kim reagiert auf den Verlust wütend und aggressiv, Markus hilflos. Er möchte seine Tochter festhalten, ihr Mut machen und sie beschützen – aber das ist nicht leicht, wenn man sich am liebsten nur die Decke über den Kopf ziehen will, um unbemerkt weinen zu dürfen. Als Kim eines Tages spurlos verschwindet, muss Markus sich auf die Suche nach ihr machen. Und am Ende dieser unerwarteten Reise wird er sie nicht nur finden – sie werden sich gegenseitig retten …
Ein Roman wie das Leben: mit vielen kleinen und großen Niederlagen, aber auch voller unerwarteter Glücksmomente und der Erkenntnis, dass wir alles schaffen können, wenn wir die richtigen Menschen an unserer Seite haben.
Inhaltsübersicht
Für Eric.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Für Eric.
Es war ein Geschenk,dich gekannt haben zu dürfen.
Kapitel 1
Die dritthäufigste Ursache für Verspätungen der New Yorker U-Bahn –«, begann Kim.
»Jetzt nicht«, unterbrach Markus sie und nestelte an seiner Krawatte herum. Er stand in seinem neuen schwarzen Anzug in der Küche. Den fast leeren Kaffeebecher hatte er auf der Spüle abgestellt. Er betrachtete den Schlips. Der war weinrot. Noch nie hatte Weinrot für Markus so bunt ausgesehen. Er überlegte, die Krawatte noch zu wechseln. Ein schwarzer Schlips vielleicht? Aber würde er damit nicht aussehen wie einer von den Blues Brothers?
»Die häufigste Ursache sind Gleisarbeiten«, hob Kim erneut an. Seine Tochter saß am Küchentisch, neben sich eine Tasse Zimt-Lakritz-Tee, die noch fast voll war. Der Tee roch, als sei irgendwo im Orient ein Chemiewerk explodiert. Kim blickte ihrem Vater direkt ins Gesicht, die Augen angriffslustig zusammengekniffen. »Die zweithäufigste Ursache sind Signalfehler. Aber die dritthäufigste …«
Kim machte eine Kunstpause. Markus seufzte.
»Die dritthäufigste sind Frauen auf Diät! Weibliche Passagiere, die wegen Schwäche oder Unterzuckerung in U-Bahnen und auf Bahnsteigen in Ohnmacht fallen.«
»Woher weißt du nur all diesen Kram?«, murmelte er.
»Das muss man sich mal vorstellen!«, ereiferte sich Kim. »Nur weil diese blöden Ami-Weiber unbedingt sehen wollen, dass ihre Hüftknochen durch ihre Haut piksen wie bei einem Kind aus der Sahelzone, kommen tagtäglich Tausende von New Yorkern zu spät zur Arbeit. Oder zu spät zu ihrem Weight-Watcher-Treffen.«
»Ziehst du dich bitte um, Kim?«, bat Markus in so ruhigem Tonfall wie möglich. »Ausnahmsweise?«
»Nein«, sagte Kim. »Ich bin fertig angezogen.«
»Kim …«, begann Markus.
Seine Tochter erhob sich. Fünfzehn Jahre alt und ebenso schwarz wie stolz. Nicht völlig schwarz natürlich – ihre Haut war bleich, fast wie Kalk oder, wenn man’s diplomatisch formulieren wollte, wie Porzellan. Das passierte, wenn man sich in seinem Zimmer vergrub. Doch ihr hochtoupiertes Haar hatte sie glänzend schwarz gefärbt, zwei pechschwarze Kajal-Ringe umrahmten ihre Augen, die Fingernägel waren schwarz lackiert, und auch ihre Kleidung war komplett in derselben Nicht-Farbe gehalten. Von einigen kleinen Einsprengseln abgesehen: Sepulcrum Mentis stand blutrot auf ihrem T-Shirt. Der Name einer Gothic-Band. Kim hatte ihn Markus auf Wunsch einmal knurrend übersetzt. Er bedeutete »Grab des Geistes«.
»Bitte«, sagte Markus. »Mama zuliebe.«
»Mama ist tot«, antwortete Kim, und in ihrer Stimme lag eine Härte, die Markus schmerzte. »Sie hat mich immer so akzeptiert, wie ich bin. Mama hätte nie verlangt, dass ich mich verkleide!«
Jetzt brach ihre Stimme doch, Trauer durchstieß ihre trotzige, abgebrühte Attitüde. Kim erhob sich, die Augen feucht. Sie stürmte aus dem Zimmer, so würdevoll und cool, wie man eben stürmen kann.
Markus hätte fast aufgelacht, so absurd fand er den Satz seiner Tochter. Wenn sie jetzt nicht verkleidet war, wann dann? Er rief ihr nach: »Es ist ihre Beerdigung, verdammt noch mal! Mach das nicht kaputt!«
»Mama ist weg!«, kam Kims Stimme aus dem Flur zurück. »Sie ist tot. Heute wird sie nur verbuddelt. Was könnte man daran schon kaputt machen?«
Markus musterte erneut seine Krawatte. Sein Hals brannte. Er zitterte ein wenig. Kims obskurer Tee dampfte immer noch in der Tasse. Er roch jetzt wie Schwefel.
Kurz darauf schloss Markus die Haustür hinter sich zu. Kim saß bereits im Auto. Sie war hinten eingestiegen. Ganz so, als sei der Beifahrersitz auf ewig für Babette reserviert. Kim hatte ihre MP3-Stöpsel in den Ohren. Ein stupider, böser Bass dröhnte heraus. Das Mädchen hatte die Augen geschlossen. Markus fragte sich, ob sie womöglich ihre Mutter vor sich sah. Klammerte sich seine Tochter an die Erinnerungen an Babette, oder versuchte sie, sie loszuwerden, abzulösen, hinter sich zu lassen?
Wie trauerte Kim? Markus hatte keine Ahnung. Seine Tochter sprach nicht mit ihm. Nicht über Babette jedenfalls. Sie repetierte neuerdings nur ständig groteske Statistiken, erzählte von bizarren Todesfällen und kolportierte absurde Zufälle. Sie suchte Asyl in Absurdistan.
Markus lenkte den Wagen die Hauptstraße entlang. Der Ford Combi trug die Aufschrift »Partyservice Lindner«. Daneben war ein kleines Folienbild angebracht, das ein appetitliches Arrangement aus Wurstspießen, Käse und Obst zeigt. Babette hatte es immer lustig gefunden, dass sie mit dem Firmenwagen überall hinfuhren. Sogar in den Urlaub. »Allen Leuten läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn sie uns vorbeifahren sehen«, hatte sie lachend gesagt. »Das ist doch toll!«
Sie hatten viel gelacht früher. Früher? Noch vor zehn Tagen. Doch jetzt lachte niemand mehr. Der Beifahrersitz war leer, und dunkles Schweigen füllte den Wagen. Das Einzige, was man hörte, waren die leisen, knarzenden Bässe, die aus Kims Ohrstöpseln drangen. Markus bog auf den Parkplatz des Friedhofs ein.
Markus’ Mutter wartete bereits dort. Sie hatte ihren Sohn gebeten, sich hier mit ihr zu treffen, nicht vor der Kapelle. Nicht inmitten eines Pulks von Menschen, die sie größtenteils noch nie gesehen hatte.
»Mama«, sagte Markus und umarmte sie.
»Wie geht’s dir, Schatz?«, fragte Gerlinde. Ihre Stimme klang dumpf. Markus war gut eineinhalb Köpfe größer als sie, und wenn er sie umarmte, verschwand ihr Gesicht im Stoff seines Sakkos. Er lockerte den Griff, sah zu ihr hinunter und zuckte mit den Schultern.
Was sollte er sagen? Natürlich ging es ihm nicht gut. Wie sollte es jemandem schon gehen bei der Beerdigung der eigenen Frau? »Ich komme klar«, sagte er also. Was ja auch stimmte. Er würde das hier durchstehen. Es blieb ihm gar nichts anderes übrig.
Gerlinde wandte sich Kim zu. Das Mädchen stand etwas abseits, hatte immer noch die Stöpsel in den Ohren und schaute, als sie Gerlindes Blick spürte, vom Boden auf.
»Hallo, Oma«, sagte sie und zupfte tatsächlich den linken Dröhnstöpsel aus der Ohrmuschel.
Man sah Gerlinde an, dass sie versucht war, auch ihre Enkelin zu umarmen. Doch Kims Körperhaltung signalisierte den dringenden Wunsch nach Distanz. Gerlinde musterte Kim von oben bis unten, registrierte ihr unangebrachtes Grufti-Outfit – und verlor kein Wort darüber.
»Wir müssen los«, sagte Markus und wies auf den Weg, der zur Kapelle führte. Dort gingen bereits mehrere Trauergäste. Markus erkannte seine Freunde Piet und Susann, mit denen Babette und er sich regelmäßig zu Spieleabenden getroffen hatten. Susann hatte sich bei Piet eingehakt.
So wie sich Babette auch oft bei Markus eingehakt hatte. Markus’ Gedanken schweiften ab. Er bildete sich ein, Babettes leichtes Gewicht, ihre Nähe und Wärme an seinem Arm zu spüren.
»Ich habe mir heute Morgen Babybilder von dir angeschaut«, sagte Gerlinde zu ihrer Enkelin und holte damit Markus in die Realität zurück. »Erinnerungen, weißt du.«
Kim nickte.
»Du warst ein lustiges Kind. Du hast ständig gelacht. Auf fast jedem Foto hast du gelacht oder gekichert oder gegrinst.«
»Das liegt daran, dass Leute immer nur dann fotografieren, wenn die Stimmung gut ist«, sagte Kim nüchtern. »Wenn irgendwann Aliens auf unserem entvölkerten Planeten landen und unsere Familienfotos studieren, werden sie denken, wir waren die scheißfröhlichste Spezies des Universums.«
»Kim!«, ermahnte Markus sie.
Sie blickte ihren Vater an. »Ist doch wahr. Oder hast du heute etwa eine Kamera mitgenommen?«
Markus antwortete nicht.
Er war so müde.
»Früher«, fuhr Kim fort, »als der Blitz bei den Kameras noch mit Magnesium betrieben wurde, im 19. Jahrhundert, da erblindeten wegen falscher Dosierung rund 100 Menschen pro Jahr. Nur weil sie ein hübsches, fröhliches Foto von sich haben wollten.«
»Früher haben die Leute auf Fotos nicht oft gelächelt«, widersprach Gerlinde. »Früher haben sie immer ganz ernst in die Kameras geschaut.«
»Würde ich auch tun, wenn ich drei Sekunden später womöglich blind wäre«, antwortete Kim.
Die Glocken der Kapelle schallten über den Friedhof.
»Wir müssen«, wiederholte Markus seufzend.
Die drei setzten sich in Bewegung,
»Du siehst aus wie ein Mafiakiller«, sagte Gerlinde tadelnd und zupfte im Gehen an Markus’ pechschwarzem Schlips.
Es waren viele Leute da. Achtzig mindestens, vielleicht sogar hundert. Babette war beliebt gewesen. Selbst einige der Mütter waren gekommen, wollten von der toten Erzieherin ihrer Knirpse Abschied nehmen. Markus hatte jedoch darum gebeten, dass keine Kinder zur Beerdigung kommen sollten. Denn wer weiß, vielleicht hätten einige der Frauen dies als günstige Gelegenheit genutzt, ihre Kleinen mit der unerfreulichen Tatsache des Todes bekannt zu machen. Eine Beerdigung als pädagogische Maßnahme. Die waren teilweise sehr seltsam, diese Mütter. Denen war einiges zuzutrauen.
Doch nach dem heutigen Tag würde Markus nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Dieser Teil seines Lebens war mit Babettes Tod ganz plötzlich von ihm abgetrennt worden. Er würde nicht mehr beim Aufbau der Stände für das Sommerfest helfen, nicht mehr bei Ausflügen einspringen, wenn eine der Erzieherinnen krank war, nicht mehr kleinere Reparaturarbeiten an den Spielsachen ausführen. Es würde keine witzigen Kindergarten-Anekdoten mehr geben, keine Lästereien über übereifrige oder asoziale Eltern, keine Kindermund-Zitate mehr, mit denen Babette zu Hause das Abendessen aufheiterte. Seine Frau war nicht mehr da – und es machte Markus schwindelig zu erleben, was alles mit ihr verschwunden war.
Ihr Geruch in der Bettwäsche war kaum noch zu ahnen. Markus hatte sie absichtlich noch nicht abgezogen und gewaschen. Doch das war nur eine Frage der Zeit. Der kleine Mülleimer im Bad, in dem sich sonst in Klopapier eingewickelte Tampons, Kleenex-Tücher mit Lippenstiftresten, das Anspitz-Geschnetzelte von Babettes Kajalstift und andere weibliche Artefakte gesammelt hatten und der bislang täglich geleert werden musste, war immer noch so gut wie leer. Kim schminkte sich in ihrem Zimmer. Und Markus wollte gar nicht wissen, wie seine Tochter ihre Menstruations-Utensilien entsorgte.
Die Blumenvase auf dem Wohnzimmertisch war verwaist. Markus hatte Babette jeden Freitag Blumen mitgebracht – ein langjähriges Ritual, das er irgendwann fast mechanisch absolviert hatte. Jetzt war die Vase bloß noch ein hohles Gefäß. Markus fand die Vorstellung absurd, sie je wieder mit Blumen zu füllen. Es wäre taktlos. Er sollte die verdammte Vase in den Keller bringen. Zum Brotbackautomaten.
An der Garderobe im Flur hing noch Babettes Jeansjacke. Er brachte es nicht übers Herz, sie dort fortzunehmen. Bevor er zur Beerdigung aufgebrochen war, hatte er sanft mit dem Finger über den Stoff gestrichen. Babette hatte die Jacke erst zwei Wochen zuvor gekauft. Ein Schnäppchen, wie sie stolz verkündet hatte. Babette war eine euphorische Schnäppchenjägerin. Sie hatte sogar bei H&M zu feilschen versucht. Babette war nicht geizig gewesen, ganz im Gegenteil, aber sie liebte das Gefühl, einer großen Ladenkette etwas von deren Gewinnspanne abgetrotzt zu haben. »Ist wohl so etwas wie ein David-gegen-Goliath-Ding«, hatte sie mal kichernd gesagt.
Am liebsten wäre Markus dort geblieben, bei der Jacke, im Flur. In der Sicherheit seiner Erinnerungen. Doch die Beerdigung der eigenen Frau konnte man ja schlecht schwänzen.
Markus zuckte zusammen, als Kim später am Grab nach seiner Hand griff. Damit hatte er nicht gerechnet. Es war eine angenehme Überraschung. Er hielt die Hand seiner Tochter fest und drückte sie sanft. Er drehte sich zu ihr um, wollte ihr einen tröstenden Blick zuwerfen. Doch Kim starrte auf den Boden. Sie hatte den MP3-Player nicht ausgeschaltet, lauschte irgendeiner Grufti-Band, anstatt die Worte des Pastors zu würdigen. Markus zwang sich, das zu akzeptieren. Er selbst konnte auch nichts mit Religion anfangen, hatte die Bibel immer bloß für ein simples Märchenbuch gehalten. Doch Babette war im Gegensatz zu ihm nie aus der Kirche ausgetreten, ging zumindest Weihnachten und Ostern in den Gottesdienst – mit Freunden, ohne ihren Mann und ihre Tochter – und glaubte fest, dass es irgendetwas gab, was über uns Menschen wacht.
Markus hoffte sehr, dass sie recht hatte.
Babette hätte eine kirchliche Beerdigung gewollt, glaubte er. Und deshalb sprach nun ein Pastor. Einer, der Babette nie kennengelernt hatte. Beim Vorgespräch, im Kirchenbüro, hatte er Markus gefragt, ob er auch ein paar Worte sagen wolle. Markus wollte nicht. Er hatte niemandem etwas zu sagen. Nur Babette – der hätte er noch so viel zu sagen gehabt. So unsagbar viel.
Babettes Vater stand nahe beim Pastor und warf Markus einen wütenden Blick zu. Sie hatten sich vorhin nur flüchtig und kühl begrüßt. Hatten einander nie leiden können. Der Mann war ein Mistkerl. Ein Choleriker. Ein Despot. Seit er vor sechs Jahren Witwer geworden war, trank er. Nicht exzessiv, aber stetig. Es machte ihn noch feindseliger und wütender, als er ohnehin schon gewesen war. Wahrscheinlich würde Markus seinen Schwiegervater nach dieser Beerdigung nie wiedersehen. Das immerhin war okay – eines der wenigen Dinge, die durch Babettes Tod aus seinem Leben verschwinden würden, auf die er tatsächlich gut verzichten konnte.
Der Kopf seines Schwiegervaters neigte sich zur Seite, in Richtung Kim. Er kniff die Augen zusammen. Babettes Vater tat damit kund, wie empört er darüber war, dass seine Enkeltochter selbst bei solch einem Anlass als eine Art morbide Fantasygestalt daherkam und zu alldem auch noch Musik hörte. Markus tat so, als würde er die tadelnde Botschaft des Mannes mit der rotgeäderten Nase nicht bemerken. Er nickte Babettes Vater nur kurz und nichtssagend zu und wandte sich dann von ihm ab.
Gerlinde hatte das stumme Blickduell beobachtet. Erst jetzt bemerkte sie, dass ihre Enkeltochter weiterhin Musik hörte. Ohne zu zögern, ohne große Geste, beiläufig fast, zupfte Gerlinde dem Mädchen die Ohrstöpsel heraus. Sie baumelten nun an Kim herunter. Wenn man ganz genau lauschte, konnte man Marilyn Manson daraus krähen hören. Kim reagierte nicht. Sie ließ es sich einfach gefallen. Sie blickte immer noch ins Leere.
Markus’ Hals schmerzte. So war es schon als Kind bei ihm gewesen. Er hatte selten geweint. Fast nie. Doch sein Hals, der brannte bereits beim kleinsten Anflug von Traurigkeit. Als Bambis Mutter gestorben war, damals im Kino, hatte seine siebenjährige Kehle regelrecht in Flammen gestanden. Doch seine Augen waren tränenfrei geblieben. Von allen anderen Plätzen im Kino hörte man es schluchzen und heulen, doch der kleine Markus war ein trockener Fels in einer Brandung von Kindertränen geblieben. Ein Fels, in dessen Innerem es brannte.
»Er hat nicht geweint, mein kleiner, tapferer Held«, hatte sein Stiefvater damals seinen Freunden vorgeschwärmt. So als sei es eine Leistung, keinen emotionalen Anteil zu nehmen. Markus war einer, der »sich durchbeißen« würde im Leben. Das war für seinen Stiefvater die logische Konsequenz aus seinem scheinbaren Mangel an Empathie. Und jetzt stand er da, der tapfere Markus, am Grab seiner großen, einzigen und wahren Liebe, die Kehle lodernd, die Augen ausgedörrt. Schwindelig. Er drückte die Hand seiner Tochter noch einmal, diesmal fester. Er spürte jedoch keine Antwort.
Markus beobachtete die Trauergäste. Die meisten waren tatsächlich nur zu Gast, dachte er. Sie waren mal eben zum Trauern vorbeigekommen, machten einen Mitleids-Tagesausflug. Danach würden sie nach Hause zurückkehren, zu ihren Lieben. »Armer Markus«, würden sie sagen und vielleicht noch: »Nicht eine Träne hat er geweint, der Markus.« Und dann würden sie wieder vollständig in ihr eigenes Leben eintauchen. Sie würden sich über die Gaspreise ärgern oder über das Fernsehprogramm, den IKEA-Katalog durchblättern, ihren nächsten Urlaub planen, kleine Röllchen an ihren Hüften entdecken, Sex haben, Frühstücksbrote schmieren, im Büro über den wieder mal kaputten Drucker fluchen oder aber auf dem Flur des Arbeitsamtes hocken und darauf hoffen, dass sie bald wieder in einem Büro sitzen und sich über defekte Drucker ärgern dürften. Sie würden zur Toilette gehen, Staubsaugerbeutel wechseln, die Geschirrspülmaschine einräumen, Nasenhaare auszupfen.
»Wie war’s bei Babettes Beerdigung?«, wurden sie vielleicht ein paar Tage später von jemandem gefragt. Sie würden mit den Schultern zucken. »Eine Beerdigung eben. Wie Beerdigungen so sind«, würden sie antworten.
Oder?
Vielleicht würden sie auch sagen: »Ich weiß, es ist fies, aber ich hatte echt Schwierigkeiten, nicht loszulachen.«
Markus musterte die Trauergäste genauer. Grinste einer?
Wie viele von ihnen standen am Grab und bekamen es einfach nicht aus dem Kopf, wie Babette gestorben war? Dass sie nicht einfach abgetreten war aus dieser Welt, als Krebskranke oder als eines von vielen täglichen Verkehrsopfern. Sondern dass sie so bizarr gestorben war. Auf eine Weise, die das Trauern bremste. Weil das Ganze so unwirklich schien. Weil das Bild im Kopf klebte, das Bild von dem Clown.
Warum hatte Babette nicht normal sterben können?
Wie viele der Leute grinsten heimlich?
Es hatte in der Zeitung gestanden. Der Morgenpost war es eine ganze Seite wert gewesen. Kim hatte den Artikel aufbewahrt:
Ein schreckliches Bild bot sich den Erzieherinnen Tanja D. und Bettina G., als sie gestern Nachmittag den Gruppenraum des Kindergartens Butterblume betraten: Ihre Kollegin Babette L. (40) hing tot am Fenster!
»Zuerst dachten wir, sie mache einen Scherz«, sagt Bettina G., »doch dann sahen wir, dass sie nicht mehr atmete.«
Babette L. hatte sich mit einer bunten, blechernen Kette erhängt – Teil eines Clownkostüms. Ihr Gesicht war grell geschminkt. Sie trug weite, mit vielen farbigen Flicken versehene Pluderhosen, eine rote Clownnase und eine grüne Perücke. Ihre Füße steckten in überdimensionalen, knallgrünen Schuhen.
»Sie trug dieses Kostüm schon seit Jahren zu jeder unserer Faschingsfeiern«, berichtet Tanja D. unter Tränen. »Die Kinder liebten es.«
Babette L. galt als fröhlicher Mensch. »Sie hatte keine Probleme. Sie liebte das Leben, und das Leben liebte sie«, sagt eine Nachbarin. Da auch kein Abschiedsbrief gefunden wurde, geht die Polizei von einem Unfall aus. »Offenbar wollte sie eine Girlande an der Deckenlampe befestigen und ist dann mit der metallenen Kette am Griff des Kippfensters hängen geblieben«, spekuliert ein Beamter.
»Es war ein verrückter Anblick«, berichtet der Rettungssanitäter, der als Erster eintraf. »Zuerst dachten wir ehrlich gesagt, man wolle uns einen Streich spielen.«
Doch der Arzt konnte nur noch den Tod von Babette L. feststellen.
Mehrere Reporter hatten Markus an jenem Tag angerufen. Sie hatten einen Kommentar von ihm gewollt. Und vor allem wollten sie Fotos. Markus hatte keinem von ihnen geantwortet. Am Anfang hatte er nur wortlos aufgelegt. Später war er nicht einmal mehr ans Telefon gegangen.
Entweder Tanja oder aber Bettina musste den Journalisten die Bilder gegeben haben, die nun die Geschichte illustrierten: Babette in ebenjenem Clownkostüm. Bei der Feier des Vorjahres. Und Babette lachend, im Gras sitzend. Markus glaubte die Liegewiese im Tierpark darauf zu erkennen. Das Foto musste bei einem Ausflug gemacht worden sein. Sie blinzelte in die Sonne, und Markus konnte ihr Lachen förmlich hören. Babette hatte immer mit voller Wucht gelacht. Wie eine Naturgewalt.
Die Polizei hatte ihm nach der Obduktion das Clownkostüm ausgehändigt. Er hatte eine Empfangsquittung ausstellen müssen.
Die Tüte mit dem Kostüm lag immer noch in seinem Kofferraum.
Kapitel 2
Sie hatte gar nicht vor, zu gewinnen. Paula hatte nur deshalb an zwei Dutzend Internet-Preisausschreiben teilgenommen, damit sie ihre Telefonnummer angeben konnte. Während die meisten anderen Menschen, die an Web-Aktionen teilnahmen, das Formularfeld mit der Telefonnummer frei ließen oder, wenn sie vom System zum Ausfüllen gezwungen wurden, zumindest mit einer erfundenen Nummer versahen, legte Paula es gezielt darauf an, ihren Anschluss in die Listen von so vielen Telefonmarketing-Unternehmen wie möglich zu bekommen. Ja, sie wollte angerufen werden. Sie brannte förmlich darauf, dass wildfremde Menschen sie zu denkbar unpassenden Zeiten telefonisch belästigten, um ihr Versicherungen oder Zeitschriften anzudrehen, Timeshare-Appartements aufzuschwatzen oder Kleinkredite mit Wucherzinsen aufzuzwingen. Denn die Telefonmarketing-Fuzzis waren ihre liebsten Versuchskaninchen.
Paula träumte von der Schauspielerei. Sie war fest entschlossen, bei ihrem diesjährigen Vorsprechen an der Schauspielschule einen Platz zu ergattern. Zweimal war sie schon durch die Aufnahmeprüfung gerasselt. Mit wehenden Fahnen beim ersten Mal, relativ knapp im letzten Jahr. In vier Monaten würde sie ihre dritte und letzte Chance bekommen. Öfter als drei Mal durfte sich niemand bewerben. Sie musste es diesmal einfach schaffen. Und dafür brauchte sie Übung. Übung, Übung, Übung!
Dass man wirklich gut spielte, fand Paula, zeigte sich erst, wenn die anderen gar nicht merkten, dass es ein Spiel war. Paula glaubte an das berüchtigte method acting. Ein guter Schauspieler spielte eine Rolle nicht nur – er versank in ihr. Selbst wenn es nur für ein paar Minuten war. Leider wusste jeder, der Paula auch nur flüchtig kannte, von ihrer Besessenheit, kannte ihren Traum von einer Mimen-Karriere und war deshalb auf jeden Auftritt von ihr gefasst.
Sie hatte schon ihrer besten Freundin unter Tränen eine Schwangerschaft vorgespielt. Sie hatte einem Nachbarn über Wochen hinweg dermaßen glaubwürdig vorgegaukelt, dass sie eine mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestrafte Asoziale sei, dass dieser tunlichst darauf achtete, nicht zur selben Zeit wie sie im Treppenhaus zu sein. Dem Filialleiter eines Supermarkts, in dem sie mal als Aushilfe gearbeitet hatte, hatte sie lange Zeit mit offenbar sehr glaubwürdigem Akzent weisgemacht, dass sie Aussiedlerin sei und ursprünglich aus Minsk kam.
Doch ihr Vorrat an unfreiwilligem Publikum aus dem privaten Umfeld war inzwischen erschöpft. Sie brauchte Frischfleisch. Die Telefonmarketing-Fuzzis, die sie aufgrund ihrer großzügig gestreuten Telefonnummer mehrmals täglich anriefen, waren dazu bestens geeignet. Jeder, der Paula anrief, kam in das zweifelhafte Vergnügen einer spontan improvisierten Vorstellung.
Als das Telefon klingelte und Paula auf dem Display keine ihr bekannte Nummer entdeckte, schloss sie die Augen und ließ den Zeigefinger blind über einem handbeschriebenen DIN-A4-Blatt kreisen, das neben dem Telefon lag. Dann schnellte der Finger herunter wie ein Adler im Sturzflug. Als sie die Augen wieder öffnete, las sie die Zeile, auf die sie zeigte. »Verlassene Ehefrau« stand darauf. Paula räusperte sich und nahm ab.
»Jaaaa?«, meldete sie sich mit matter Stimme.
»Spreche ich mit Frau Paula Falkenberg?«, wollte ein Mann mittleren Alters mit jovialer Stimme wissen.
»Ja«, bestätigte Paula müde.
»Schön, dass ich Sie erreiche, Frau Falkenberg. Mein Name ist Jorgensen. Ich rufe im Auftrag der NSL an. Ich –«
»Hat mein Mann Sie auf mich angesetzt?«, unterbrach Paula ihn. Ihre Stimme klang nun trotz aller unüberhörbaren Erschöpfung eine Spur kampflustig.
»Äh, nein«, antwortete Herr Jorgensen. »Ich bin von der NSL, der Norddeutschen Super-Lotterie.« Geübt spulte er sein Programm ab: »Frau Falkenberg – verreisen Sie gern?«
»Ich war mal in … Venedig«, gab Paula Auskunft. Sie zerkaute die Worte, erging sich förmlich in enervierender Langsamkeit. »Vor drei Jahren war das. Mit meinem Mann. Wir –«
»Ja, Venedig könnten Sie bei uns auch gewinnen!«, unterbrach Jorgensen sie munter.
»Ganz Venedig?«, wunderte sich Paula.
»Äh … Nein, natürlich nicht.« Er kam zum ersten Mal etwas aus dem Konzept. Aber es lag ein amüsierter Unterton in seiner Stimme. »Also, eine Reise nach Venedig können Sie gewinnen. Sie –«
»Ich will da nicht noch einmal hin«, wehrte Paula ab. »Es würde mich zu sehr an meinen Mann erinnern.«
»Es muss ja nicht Venedig sein«, versuchte es Jorgensen.
»Es war unsere Hochzeitsreise, wissen Sie.« Paulas Stimme klang, als würde sie knietief durch Erinnerungen waten. »Gleich am ersten Tag hat er –«
»Also, Frau Falkenberg, eigentlich geht es um Folgendes: Die NSL …«
Paula begann zu schluchzen. Vernehmlich zog sie imaginären Rotz hoch.
»Frau … äh … Alles okay?«, stammelte Jorgensen.
»Ich weiß gar nicht, was das alles noch soll«, schluchzte Paula nun. »Er hat jetzt eine andere, wissen Sie. So eine mit einem ganz winzigen Po!«
»Äh …«
»Dabei ist mein Po auch nicht gerade riesig, wissen Sie.«
»Frau Falkenberg, ich –«
»Ich habe sowieso nie verstanden, was die Männer an diesen kleinen Hinterteilen finden. Da hat man doch gar nichts zu greifen! Ich dachte immer, Männer greifen so gern nach –«
»Vielleicht kann ich Sie später noch einmal anrufen, Frau Falkenberg?«
Paula schwieg.
»Frau Falkenberg?« Jorgensen klang nun ernsthaft angespannt.
»Vielleicht sollte ich mir Fett absaugen lassen, was meinen Sie?«, schlug sie nun vor.
»Äh …«
Jetzt brach ihre Stimme. »Vielleicht bringe ich mich aber auch einfach um. Wer würde mich schon vermissen? Er bestimmt nicht!«
»So was dürfen Sie nicht sagen, Frau Falkenberg! Ich –«, begann Jorgensen erneut.
»Sie haben mir überhaupt nicht vorzuschreiben, was ich sagen darf und was nicht!«, schrie Paula plötzlich. »Sie sind genau wie er! Kommandieren mich herum. Wollen mich nach Venedig schleppen. Da fahren Sie mal schön allein hin, Sie … Sie! Bestimmt hat er Sie geschickt! Das würde zu ihm passen. Mir einen perversen Stalker auf den Hals zu hetzen!«
»Aber ich bitte Sie …«, warf Jorgensen kläglich ein.
»Da können Sie bitten und betteln, bis Sie platzen. Ich fahre nicht mit Ihnen nach Venedig!«, schrie Paula und hängte auf.
Sie ließ sich in den Sessel fallen, atmete tief aus, zählte bis drei und gab sich dann eine Zwei minus für diese Vorstellung. War ganz lustig, ja. Aber dem Charakter hatte es an einer klaren Linie gefehlt. Beim nächsten Mal würde sie versuchen, die Figur präziser zu konzipieren.
Paula schaute auf die Uhr. Noch eine halbe Stunde, bis der Nachmittagsdienst anfing. Sie hatte den Plan im Kopf. Hatte ihr Gedächtnis trainiert. Sie konnte 50 Nomen in der richtigen Reihenfolge auswendig lernen. In weniger als fünf Minuten. Schauspieler brauchten ein gutes Gedächtnis. Theaterschauspieler zumindest.
Sie ging in die Küche und füllte unter dem Hahn ein Glas Wasser. Aus dem Kühlschrank holte sie zwei Falafel und den Rest vom Krautsalat, der noch in einer Tupperware-Dose lag.
Zuerst war heute der alte Höppner dran. 92 Jahre alt war er. Das musste man sich mal vorstellen: 92 Jahre alt zu werden! Paula fand das regelrecht atemberaubend. Höppner war fast blind. Und er war unendlich klapprig. Doch im Kopf immer noch völlig klar. Paula mochte ihn.
Für die große Morgentoilette (aufstehen, waschen oder duschen, rasieren, kämmen, Mund- und Zahnpflege) wurden 18,04 Euro berechnet. 39 Minuten durfte alles zusammen maximal dauern. Für den Toilettengang waren maximal sieben Minuten veranschlagt. Er kostete 4,92 €. Paula nannte es den Kack-Tarif. Eine Gebührenordnung für die natürlichste Sache der Welt. Ein tabellarisches Regularium für den Verdauungsprozess. Manchmal, wenn sie ihre täglichen Pflegestationen abrechnete, glaubte Paula, sie sei in einer Groteske von Franz Kafka gelandet.
Sie hielt sich selten an die Vorgaben. Was dauerte, dauerte eben. Es waren Menschen, mit denen sie zu tun hatte. Keine Automaten, die bloß befüllt, entlüftet und gereinigt werden mussten. Oft kam Paula zu spät zum nächsten Patienten auf ihrer Liste, obwohl sie schon – was sich auf ihrem Bankkonto schmerzhaft bemerkbar machte – weniger Termine pro Tag absolvierte als die meisten ihrer Kolleginnen. Das war sie den alten Leuten schuldig, fand sie. Vielleicht hätte sie es anders gesehen, wenn der Pflegedienst ein vollwertiger Job für sie gewesen wäre. Doch es war nur ein Provisorium. Eine finanziell nötige Überbrückung, bis sie endlich ihre Schauspielausbildung beginnen konnte. Ihre Senioren benutzte sie allerdings nie als unfreiwilliges Publikum für ihre darstellerischen Experimente. Die waren zumeist auch so schon verwirrt genug.
Paula ließ mit einem Teelöffel etwas Himbeermarmelade auf ihre Falafel kleckern. Das schmeckte ihr. Sie mochte es, wenn zwei Dinge aufeinandertrafen, die scheinbar nicht zusammenpassten und dann zu einer überraschend interessanten Symbiose wurden.
Als sie nach dem Imbiss in den Flur ging, ihre Jacke anzog und sich dann zu ihren Schuhen hinunterbeugte, klingelte das Telefon erneut. Sie blickte auf das Display, vollführte schnell ihr Finger-Adlerkreisen über dem Rollenzettel und nahm dann ab.
»Hallo«, meldete sie sich mit fiepsiger Stimme. »Hier spricht Lena Falkenberg. Meine Mama ist kurz im Wäschekeller, aber gleich isse wieder da. Und wer bist du?«
Kapitel 3
Heute essen alle Brownies! Die sind gleich alle. Normalerweise kippen wir die Hälfte von den Dingern weg, aber diesmal essen sie das Zeug, als ob es morgen verboten würde.« Ayse sah Markus mit einem gespielt strengen Blick an. »Hast du da etwa irgendwelche verbotenen Substanzen reingetan, Chef?«
»Natürlich nicht«, murmelte Markus. »Aber ist doch schön, wenn’s ihnen schmeckt.«
Ayse musterte Markus, schüttelte kurz den Kopf, schnappte sich die große Schale mit der roten Grütze und trug sie Richtung Buffet. Bislang hatte Markus immer eine flotte Antwort auf jeden noch so blöden Witz gehabt. Doch seit der Sache mit Babette hörte er gar nicht mehr richtig hin. Es war, als liefe er auf Notstrom. Er war nicht richtig kaputt, aber angeschlagen. Abgedunkelt war er, der Chef.
Drei Wochen war Babette jetzt tot. Das war noch nicht lange, klar. Aber es war doch genug Zeit vergangen, als dass er langsam wieder aus dem Nebel auftauchen und zumindest versuchen konnte, wieder im Alltag Fuß zu fassen. Das Leben ging weiter, fand Ayse.
In der Türkei – also, wenn da jemand starb, weinte man. Da weinte man richtig. Man schrie sich den Schmerz aus dem Leib, wenn einem danach war. Man erledigte seine Trauer. Aber diese Deutschen, die legten sie nur irgendwo ab, ihre Qual. Irgendwohin legten sie die, ihre Verzweiflung, kümmerten sich einfach nicht richtig darum. Und deswegen konnte sie dann ungestört als Traurigkeit weiterleben. Ewig.
Die drückten sich vor dem Schmerz und der Wut, die Deutschen. Die stritten sich sogar mit leiser, beherrschter Stimme. Die tobten nicht, die platzten nicht, die trotzten nichts und niemandem. Die schaukelten nur so vor sich hin auf den Wellen des Lebens.
Ayse mochte Markus. Aber dass er offenbar nie geweint hatte um seine Babette, verstand sie nicht. Also, wenn Ayse mal heiratete, dann wollte sie sich einen Mann suchen, der schreien würde, wenn sie stürbe. Ganz laut schreien müsste der. Einen anderen Mann würde sie nicht haben wollen.
Markus hielt sich bei dieser Feier zurück. Normalerweise war er allzeit bereit, ein unaufdringlicher, aber aufmerksamer Ansprechpartner für seinen Auftraggeber. Diesmal aber überließ er es Ayse, den Wünschen der Gäste nachzukommen. Sie war eine gute Angestellte. Die Seele seiner kleinen Catering-Firma. Ayse hatte alles im Griff. Sie nahm ihm seit Babettes Tod die meisten der Aufgaben ab, die eine direkte Kommunikation mit den Kunden erforderten. Markus war einfach nicht in Gesprächslaune.
Gerade bestückte er eine Konfirmation mit Kalt-Warmem-Buffet. Die Leute waren inzwischen bei den Desserts angekommen, die älteren Gäste tranken ihren ersten Verdauungsschnaps.
Der Junge, der hier konfirmiert worden war, hatte eine grotesk in alle Richtungen gegelte Frisur, dazu ein Lippenpiercing. Ein langer, schlaksiger, eitler Knabe. Er hatte drei seiner Freunde dabei. Gemeinsam lungerten die Jungs am Tresen des Clubhauses herum. Mit seinen Verwandten, die pflichtschuldigst ihre Geschenke und Geldumschläge abgegeben hatten und somit nicht mehr interessant waren, wechselte der gestylte Konfirmand so wenige Worte wie möglich. Markus war sich nicht sicher, aber der Junge sah so aus, als hätte er sich die Augenbrauen gezupft. Entweder das – oder er hatte irgendeine seltsame Hautkrankheit, die die Brauen zu zwei dünnen Strichen deformierte.
War das die Art von Junge, die Kim irgendwann anschleppen würde? Ein halbreifer Lackaffe? Unwahrscheinlich. Eher würde sich seine Tochter ein männliches Gothic-Pendant suchen. Einen wandelnden Klumpen schwarz geschminkter, pickliger Todesfaszination, die demnächst bei ihnen an der Tür klingelte. Hey. Ist Kim da? Wir wollen Fotos vom Friedhof machen. Ist ’n Kunstprojekt.
Markus schüttelte sich.
Hatte Kim schon einen Freund? War sie noch Jungfrau? Fünfzehn – das ist ein Alter, da weiß man rein gar nichts mehr über seine Tochter. Oder wussten andere Eltern mehr über ihre Kinder als Markus? Babette hätte alles Mögliche über Kim gewusst.
Warum hat er Babette eigentlich so wenig nach Kim gefragt? Weil er dachte, es eilt nicht. Weil immer etwas anderes war. Irgendwelcher Kram. Und dann war Babette plötzlich fort. Und all die Fragen blieben übrig.
So viele Fragen.
Markus ging früher. Normalerweise blieb er, bis der letzte Großonkel betrunken ins Taxi bugsiert wurde. Doch heute strich er, als die Cognac-Runden begannen, die Segel. Er war der Chef. Es war sein gutes Recht, das zu tun. Trotzdem hatte er ein schlechtes Gewissen. Als er Ayse bat, den Rest allein zu übernehmen, hatte er jedoch fast das Gefühl, sie sei erleichtert, ihren Boss endlich von den Hacken zu haben.
Markus hatte nur zwei Festangestellte. Norbert, der kochte. Und Ayse, die manchmal in der Küche half, vor allem aber bei den festlichen Anlässen, die Markus’ Firma ausrichtete, alles organisierte. Weitere Hilfen wurden von Markus nur stundenweise engagiert. Das heißt, Markus zahlte sie stundenweise, engagiert wurden sie jedoch von Ayse. Zumeist waren es Verwandte von ihr. Es war schier unglaublich, wie viele Menschen über ein, zwei oder drei Ecken mit Ayses DNA gekoppelt waren. Und dass die bloße Tatsache einer genetischen Verwandtschaft offenbar automatisch einschloss, dass sich Ayse ihnen auch emotional verbunden oder zumindest in irgendeiner Form verpflichtet fühlte.
Auch an diesem Abend hatte Ayse zwei ihrer Verwandten als Aushilfen dabei. Nilgün, die so schüchtern wie flink war und oft bei Feiern half, sowie Massoud, der aus einem arabischen oder persischen oder sonstwie weiter östlich sprießenden Zweig der Sippe stammte.
Massoud war zum ersten Mal dabei. Er war so dick, dass Markus ursprünglich gefürchtet hatte, er würde die Hälfte des Buffets selbst plündern. Und vielleicht war er tatsächlich auch nicht ganz unschuldig an der auffallend starken Schrumpfung des Brownie-Kontingents. Aber gleichzeitig entpuppte sich Massoud als echter Wirbelwind – er war zuverlässig, selbstständig denkend und absolut goldig im Umgang mit den Gästen. Besonders die Kinder, die im Saal herumwuselten, amüsierte dieser Brocken von Mann mit kleinen Scherzen und sogar mit Zauberkunststückchen. Ja, wenn er wollte, durfte er auch bei zukünftigen Feiern helfen. Wie Markus überhaupt fast immer den Verwandten von Ayse zustimmen konnte.
Markus verabschiedete sich von den Eltern des Konfirmanden, nahm den Dank über das gelungene Buffet und den tollen Service freundlich entgegen und setzte sich ins Auto. Dann atmete er ein paarmal tief ein und aus.
Und dann tat er gar nichts.
Irgendetwas hinderte ihn daran, loszufahren. Irgendetwas zwang ihn, einfach sitzen zu bleiben, durch die Windschutzscheibe zu starren und nichts zu tun. Markus schloss die Augen. Fünf, sechs Sekunden lang war da nichts als seliges Schwarz. Dann öffnete er die Augen wieder. Er blickte in den Rückspiegel. Sah die Lichter des Clubhauses. Da feierten die Leute. Er hörte leise den Ententanz. Der wurde oft ab einem gewissen Alkoholpegel aufgelegt. Dadadadadadadammm …
Markus spürte, dass seine Hände zitterten. Er legte sie schnell auf das Lenkrad, hielt sich daran fest, atmete noch ein paarmal tief ein und aus.
»Nein«, sagte er. Und wusste absolut nicht, warum er das tat. Und was es bedeuten sollte. »Los jetzt«, sagte er dann. Und noch einmal, energischer diesmal: »Los jetzt!« Und doch drehte er nicht den Zündschlüssel.
Markus atmete noch einmal tief ein – und dann öffnete er plötzlich blitzschnell die Fahrertür, löste den bereits befestigten Sicherheitsgurt, lehnte sich weit hinaus aus dem Wagen, so weit es ging – und erbrach sich keuchend.
Eine knappe halbe Stunde und vier Fisherman’s Friend später schloss Markus die Tür zu seiner Wohnung auf. Er zog seine Schuhe aus und hängte seine Jacke an die Garderobe.
Im Wohnzimmer lief der Fernseher.
Markus blieb im Türrahmen stehen und betrachtete den Bildschirm. CSI offenbar. Kim lag auf dem Sofa und hob nur den Kopf. »Es gibt ein Gift«, sagte sie zu ihrem Vater und zeigte auf die Glotze, »das lähmt dich ganz systematisch. Total der Reihe nach. Es fängt im großen Zeh an und endet bei deinen Haarwurzeln. Dann bist du endgültig steif wie ein Surfboard. Krass, oder?«
»Wenn die Sendung zu Ende ist, gehst du zu Bett, okay?«, antwortete Markus. »Morgen ist Schule.«
Kims Kopf verschwand wieder unterhalb der Sofalehne. CSI war noch nicht vorbei. Das Opfer war erst halb erstarrt.
Kapitel 4
Wichtig ist jetzt vor allem Ihre Einstellung, Frau, äh …« Der Arzt blickte in die Unterlagen.
Gerlinde sah ihn nur an. Sie gedachte nicht, ihm zu helfen.
»Frau, äh …«
»Meine Einstellung zum Krebs ist feindselig«, sagte Gerlinde. »Ist das hilfreich?«
Der Arzt schwieg für ein paar Sekunden. Während er auf dem Patientenformular immer noch nach Gerlindes Nachnamen suchte, musste er gleichzeitig eine taktvolle, psychologisch geschickte Antwort auf die provokante Frage der Patientin finden. Zynismus war für diese Frau natürlich ein Ventil, eine Methode, den Schock zu kompensieren. Nicht unüblich, so etwas. Das durfte man nicht persönlich nehmen. Da musste man als Mediziner … Ah, gut. Der Name!
»Frau Lindner.«
Gerlinde nickte. »Sehr gut«, sagte sie. »Wir kommen voran.«
Über dem Kopf des Arztes schwammen zwei Schwäne. Es war ein großformatiges Foto in milden, milchigen Farben, das gerahmt an der Wand hing. Die Schwäne ließen sich auf einem malerischen See treiben und sahen in ihrer Schönheit ein wenig unecht aus. Und ein bisschen selbstverliebt.
»Jede physische Krankheit ist immer auch eine Manifestierung der psychischen Verfassung, Frau Lindner«, fuhr der Arzt ungerührt fort. »Zwischen Geist und Körper herrscht eine weitaus engere Verbindung, als man gemeinhin annimmt. Es ist jetzt wichtig, dass …«
Gerlinde hörte nicht mehr hin.
Ärzte. Gelaber. Psyche.
Blödsinn.
Als ob man 100 Zigaretten am Tag rauchen könnte und trotzdem keinen Lungenkrebs bekommt, wenn man nur gut genug drauf ist. Gerlinde war jetzt 72 Jahre alt. Ihr konnte man mit diesem Strickpulli-Gequatsche nicht mehr kommen. Sie hatte genug Leute sterben sehen, um es besser zu wissen. Wenn deine Stunde geschlagen hat, dann ist es egal, ob du eine quietschaktive Frohnatur bist oder ein lebensmüder Mistkerl. Dann entscheidet sich höchstens noch, ob der liebe Gott dich abholt oder der Teufel.
Eigentlich glaubte Gerlinde nicht an diese Dinge. Aber seit sie ahnte, dass sie Krebs hatte, hoffte sie insgeheim doch, dass es da vielleicht etwas geben könnte. Danach.
Heute hatte sie die endgültige Diagnose bekommen. Von diesem Jungspund da, mit dem Pferdeschwanz und dem albernen roten Sticker am Kittel. Was sollte das überhaupt darstellen? Eine Schleife?
Heute war es offiziell geworden. Aber sie hatte schon länger geahnt, dass da etwas sein könnte. Blut im Stuhl. Diese Schmerzen. Acht Kilo Gewichtsverlust in drei Monaten. Gerlinde sah Arztserien, Gerlinde las die Apotheken Umschau, Gerlinde war nicht blöd. Natürlich hätte sie schon früher zum Arzt gehen können. Aber solange sie das nicht tat, war eben noch nichts in Stein gemeißelt.
Als sie schwanger war, damals, mit Markus, da hatte sie sich auch geweigert, es in letzter Konsequenz zur Kenntnis zu nehmen. Vier Monate hatte sie so getan, als sei nichts. Man hatte ja auch nichts gesehen. Gerlinde hatte damals ordentlich was auf den Rippen gehabt, ein kleines Bäuchlein besaß sie schon immer. Wenn sie frühzeitig etwas von der Schwangerschaft gesagt hätte – wer weiß? Vielleicht hätte sie dann jemand zu einer Abtreibung überredet. Ein uneheliches Kind von einem verheirateten Mann? Das war Anfang der sechziger Jahre zwar kein Weltuntergang mehr, aber durchaus noch ein Skandal. Vor allem in dem kleinen Kaff, aus dem sie kam.
Gerlinde ließ das Problem damals einfach keimen – und dann war es irgendwann wundersamerweise gar kein Problem mehr. Es war ein Kind. Ihr Kind. Ein großartiger Sohn. Gerlinde, 27 Jahre alt, unverheiratete Mutter, zog in die Stadt, nach Hamburg. Sie blühte auf. Alles war gut.
Den Krebs hatte sie auch keimen lassen. Und dann kam diese Sache mit Babette, all das Chaos. Sie musste sich um ihren Sohn kümmern und um ihre Enkelin. Da war keine Zeit für Bauchschmerz und Stuhlblut. Wegschieben, abwarten. Augen zu und durch. In der Zeit blühte er dann so richtig auf, der Krebs. Das Problem war größer geworden. Sehr groß sogar. Es klappt eben nicht immer, das Wegschieben.
»Die Metastasen haben sich leider schon weit ausgebreitet«, sagte der Pferdeschwanz nun. »Doch noch ist nicht aller Tage Abend.«
Was für ein altmodischer Ausdruck für solch einen jungen Mann.
»Ich werde Ihnen gleich für nächsten Montag einen Platz im UKE besorgen.«
»UKE?«, fragte Gerlinde.
»Verzeihung«, sagte der Arzt, und bestimmt machte er sich brav eine mentale Notiz, dass man mit Patienten nicht im Fachjargon reden sollte »Universitätskrankenhaus Eppendorf. Die sind dort spezialisiert auf Gastr…, äh, Darmkrebs.«
Darmkrebs. Das war ein Wort, das in Fernsehserien gehörte. In irgendeine Schicksalsschmonzette. Aber das hatte doch nichts mit ihr zu tun! Das durfte nichts mit ihr zu tun haben.
»Nächsten Montag geht nicht«, sagte Gerlinde. »Die ganze nächste Woche habe ich noch sehr viel auf dem Zettel. Eine Woche später wäre in Ordnung.«