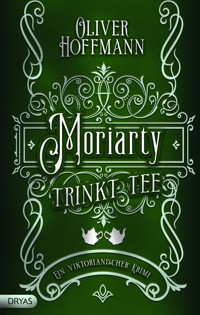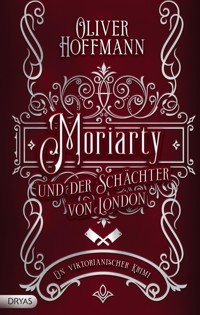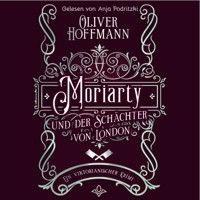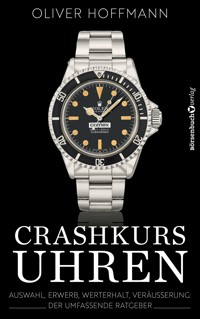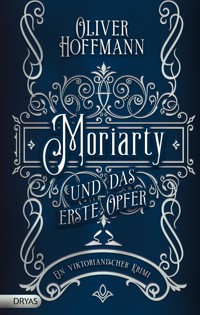
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Moriarty ermittelt
- Sprache: Deutsch
London 1896. Weil seine Nemesis Sherlock Holmes nach wie vor unpässlich ist, kehrt der Professor aus Frankreich ins kalte London zurück. Er muss sich einer Mordserie annehmen, die die britische Hauptstadt erschüttert. Scheinbar wahllos tötet jemand Honoratioren. Doch schon bald ahnt Moriarty, dass im Zentrum des Geschehens die neu eröffnete Tower Bridge steht ... und eine mysteriöse Geheimgesellschaft, der er und Molly Miller nicht zum ersten Mal begegnen. Wird das ungleiche Ermittlerduo ihrem geheimnisvollen Widersacher das Handwerk legen können?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Hoffmann
Die Fälle des Professor MoriartyBand 3
Moriarty
und das erste Opfer
Ein viktorianischer Krimi
Prolog
London, Vereinigtes Königreich, 11. Februar 1831
Die Nacht lag wie ein undurchdringlicher Schleier über London, als vier Männer in Mayfair eine Droschke bestiegen und sich auf den Weg ins East End machten. Alle vier trugen Abendgarderobe in Schwarz, Zylinder und Operncapes, und alle vier führten makellose, ausschließlich zur Zierde dienende Gehstöcke aus edlen Tropenhölzern mit ziselierten Messing- oder Silbergriffen bei sich.
Der Besitzer der Kutsche, aus dessen palastartigem Haus die vier in die Nacht getreten waren, um zu ihrem lange verabredeten Ziel aufzubrechen, war der Architekt, eine imposante Erscheinung von beeindruckender Statur und außergewöhnlicher Intelligenz. Hätte er nicht feinste Glacéhandschuhe getragen, man hätte gesehen, dass seine Hände von Jahren harter Arbeit gezeichnet waren. Sein Blick barg das Wissen um die höchsten Weihen der Baukunst und die tiefen Geheimnisse der Brückenkonstruktion. Er war der Hüter der Vision, der die London Bridge aus dem Nichts erschaffen hatte und darauf bedacht war, ihr eine Bedeutung zu verleihen, die weit über eine bloße Verbindung zwischen den beiden Ufern der Themse hinausging.
An seiner Seite saß in Fahrtrichtung der Ingenieur, der bei dem gesamten Unterfangen des Quartetts, das in dieser Nacht seinen Höhepunkt finden sollte, ein stummer Beobachter von eisernem Willen gewesen war. Am Revers trug er eine Goldbrosche, die Zirkel und Lineal darstellte. Seine Gedanken waren stets bei den Kräften, die auf die Steine einwirkten, und den geometrischen Formen, die sie zusammenhielten. Doch auch er wusste um das düstere Geheimnis dieser Kutschfahrt und hatte den Plan der vier in den letzten Wochen und Monaten unaufhaltsam vorangetrieben, ebenso rücksichtslos und zielstrebig wie den Brückenbau. Er war der Meister der Loge, und von ihm stammte die Idee für den Plan, dessen letzte Phase umzusetzen die vier Ehrenmänner im Begriff waren.
Ihnen gegenüber saß der Landvermesser, ein Mann von ruhigem Gemüt und scharfem Blick. Sein Theodolit hatte die exakten Winkel gemessen, die den Bogen der Brücke formten, und seine Kenntnisse über die unsichtbaren Linien des Grundrisses der Brücke, die in den nächsten Tagen eröffnet werden würde, waren unübertroffen. Als einziger der vier war er in dieser Nacht nicht frei von Zweifeln und Ängsten.
Dann war da noch der Bankier, ein Mann der Zahlen und der Geschäfte, der mit seinem Geschick im Umgang mit allem Monetären und den Finanzressourcen der Krone den Bau der Brücke finanziert hatte. Doch seine Beteiligung am Bau der Brücke ging weit über finanzielle Angelegenheiten hinaus. Die Freimaurer hatten ihn schon vor Jahren in ihre Reihen aufgenommen, und er hatte wie die drei anderen den Schwur geleistet, das Geheimnis zu hüten, das die vier Männer in der Kutsche miteinander verband.
Sie waren so kurz vor dem Ziel. Es fehlte nur der letzte Schritt. In dieser Nacht würden sie ihn gehen.
***
Ein Haus in Shoreditch war in jener Nacht das Ziel der eleganten Kutsche. Shoreditch war ein Viertel nordöstlich des Zentrums von London, in dem zumeist hart arbeitende Menschen in heruntergekommenen Gebäuden lebten, in dessen südwestlichem Zipfel man allerdings einige Bauten renoviert hatte, die nunmehr Familien als Behausung dienten, deren Ernährer ein einträglicheres Salär nach Hause brachten. Die vier Männer stiegen vor einem ebenjener Häuser aus, und der Architekt befahl seinem treuen Kutscher halblaut zu warten. Nach insistentem Hämmern gegen die Tür trat aus dem Schatten, die die Front des schmalen Hauses auf die Brick Lane warf, eine Gestalt hervor – Benjamin Thorne. Thorne, der mit seiner hochschwangeren Frau Win hier lebte, war seit Anfang der Konstruktionsarbeiten 1827 Bauleiter der neuen, aus fünf steinernen Bögen bestehenden London Bridge.
Er entstammte einer Familie von Handwerkern mit einem gerüttelt Maß an Organisationstalent. Seine Vorfahren waren Schiffsbauer und Werftmeister in den Docks entlang der Themse gewesen, wo sie den Bau von Überseefrachtern beaufsichtigten. Thorne war ein Mann von robustem Äußeren und eindrucksvoller Erscheinung. Seine Gestalt verriet die Kraft und Ausdauer eines Mannes, der sein Leben dem Arbeitsalltag auf Baustellen gewidmet hatte. In seinem wettergegerbten Gesicht zeichneten sich feine Linien ab, die von Jahren harter Arbeit und unermüdlichen Einsatzes zeugten. Seine Augen, die tief unter buschigen Brauen lagen, strahlten eine Mischung aus Entschlossenheit und Überlegenheit aus, und sein Blick verriet die Intelligenz und das strategische Denken, die ihn zu einem geschätzten Baufachmann machten, obgleich er aus bescheidenen Verhältnissen stammte.
Seine Kleidung war üblicherweise schlicht und aus derbem Stoff, passend für einen Mann, der den größten Teil seiner Zeit auf Baustellen verbrachte. Doch trotz seiner schlichten Erscheinung strahlte er bei der Arbeit eine Aura von Autorität und Selbstsicherheit aus, die ihm Respekt und Anerkennung einbrachte. Benjamin Thorne war ein Mann der Tat, der keine Mühen scheute, um Projekte, die man in seine Hände gelegt hatte, zum Erfolg zu führen. Sein Ruf als zuverlässiger, kompetenter Fachmann war weit über die Grenzen von London hinaus bekannt, und sein Name stand für Qualität und Präzision.
Doch zu dieser späten Stunde war er bereits im Nachthemd, über das er rasch einen reichlich fadenscheinigen Hausmantel geworfen hatte, und seine Miene war gezeichnet von Verwirrung, als er die vier Männer vor seiner Haustür sah. Alle vier gehörten zur oberen Gesellschaftsschicht der Stadt und hatten um diese Uhrzeit ganz sicher nichts in Hackney zu tun. »Was führt Sie hierher, meine Herren? Was bringt Sie zu so später Stunde an meine Schwelle?«, fragte er mit bebender Stimme, während er das Gefühl hatte, dass alle vier ihn unverwandt von Kopf bis Fuß musterten.
Er hatte während der gesamten Bauphase, sieben Jahre lang, sicherlich tausend Ungerechtigkeiten von diesen vier Männern erlitten. Doch er hatte sie mit Gleichmut ertragen und kein einziges Mal, nicht einmal seinem treuen Weib gegenüber, eine Drohung gegen einen der Herren ausgestoßen. Das hatte zweierlei Gründe: Zum einen war Benjamin Thorne ein gläubiger Christ, der in der Überzeugung erzogen worden war, dass Gott, der Herr, jeden Menschen dorthin stellte, wo er hingehörte, und zum anderen bewunderte er die vier. Es war auf der Brückenbaustelle ein offenes Geheimnis, dass die Männer, die nun da mitten in der Nacht im Londoner Nebel vor seiner Tür standen, nicht nur Mitglieder der obersten Gesellschaftsschicht der Hauptstadt waren, sondern auch führende Mitglieder der Londoner Freimaurerei. Er selbst war ein glühender Bewunderer dieses »Bundes freier Menschen«, wie die Mitglieder sich selbst nannten, und wünschte sich (vielleicht einmal abgesehen von Gesundheit für sein erstes Kind, das in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken sollte ) nichts im Leben sehnlicher, als eines Tages selbst zu ihren Reihen zu gehören. Tatsächlich hatte Thorne gegenüber Ebenezer McCubbin, dem Bauingenieur, der von allen vieren am wenigsten einen Hehl daraus machte, der Freimaurerei anzuhängen, im Laufe der letzten sieben Jahre mehrfach schüchterne Andeutungen in diese Richtung gemacht, die dieser aber jeweils entweder gänzlich ignoriert oder mit einem blasierten Lächeln abgetan hatte.
»Dies ist Ihre große Nacht«, sagte der Ingenieur nur.
»Sie meinen …?«, fragte Thorne atemlos.
»Keine Fragen. Kommen Sie«, sagte McCubbin.
»Aber ziehen Sie sich vorher noch etwas an«, ergänzte der Landvermesser mit einem Anflug von Humor.
»Bitte warten Sie draußen, meine Herren, ich werde sofort bei Ihnen sein«, versicherte der robuste Mann seinen vier Gästen. »Ich muss Sie bitten, leise zu sein, Win geht es nicht besonders, und ich möchte sie auf keinen Fall wecken.«
Wenig später rumpelten sie zu fünft, eine Zahl, für die die Kutsche des Architekten nicht mehr bequem ausgelegt war, durch die Nacht in Richtung Fluss. Mehrfach versuchte der Bauleiter zu erfragen, was denn seiner harre, doch seine vier Begleiter schwiegen hartnäckig, bis die Kutsche zum Stehen kam, sie ausstiegen und ihn aufforderten, es ihnen gleich zu tun – und da war sie: die London Bridge.
Sie führten ihn aus dem Licht der Fackeln, die auch bei Nacht die Baustelle der nahezu fertiggestellten Brücke erhellte – auch wenn dieses nur als verwaschene Lichtflecken durch den Nebel drang – die schlammig-steinige Böschung hinab in die finsteren Schatten der Nacht und zum zweiten Brückenbogen, der knapp am Wasser stand.
Die London Bridge, die an dieser Stelle die Themse überspannte, verband die City of London am Nordufer mit dem Stadtteil Southwark im gleichnamigen Stadtbezirk auf der Südseite des Flusses. Drüben am südlichen Ufer ragte die schwarze Silhouette der Southwark Cathedral aus dem Nebel auf, und unweit davon, so wusste Thorne, befand sich die Großbaustelle des nach der Brücke benannten Bahnhofs. Hier am nördlichen Ufer erhob sich ganz in der Nähe das Monument des Großen Brandes von London 1666.
Nahezu an derselben Stelle existierte seit bald zweitausend Jahren eine Brücke über die Themse. Sie ging auf die Zeit der römischen Besatzung zurück und war im Laufe der Jahrhunderte mehrfach niedergebrannt, bis der für ihren Unterhalt zuständige Geistliche Peter de Colechurch nach einer weiteren Zerstörung im Jahre 1136 vorgeschlagen hatte, die Holzbrücke durch eine dauerhaftere Konstruktion aus Stein zu ersetzen. Man setzte seine Idee in die Tat um, und die geringe Größe der Bögen und die Wellenbrecher an den Pfeilersockeln stauten große Teile des Flusslaufes. Das nördliche Tor zur Brücke, das New Stone Gate, einen wuchtigen, die Brücke überragenden Doppelturmtorbau, hatten die Anwohner im Laufe der Zeit in die Häuser integriert. Während der Renaissance war die gesamte Brücke mit Läden, Verkaufsständen und Wohngebäuden zugewuchert, die zum Teil auch außen an der Brücke gehangen hatten, doch die Gebäude bargen eine große Brandgefahr. Im 13. Jahrhundert und später beim Großen Feuer gingen weite Teile der Brücke in Flammen auf. Doch alles wurde immer wieder aufgebaut, weil die London Bridge eine wichtige Verkehrsader der Metropole war und blieb. Bis Anfang des vorigen Jahrhunderts hatte der Verkehr auf der Brücke derart zugenommen, dass der Lord Mayor bestimmt hatte, alle Wagen und Karren, die aus Southwark Richtung Stadtzentrum unterwegs waren, müssten auf der Westseite der Brücke fahren, der Gegenverkehr auf der Ostseite. Die alte London Bridge war bis zur Eröffnung der Westminster Bridge im Jahr 1750 die einzige Brücke über die Themse im Stadtzentrum geblieben.
Ende des 18. Jahrhunderts war es dann soweit gewesen: Die mittlerweile sechshundert Jahre alte London Bridge war endgültig an ihre Grenzen gekommen. Nach langen Planungsarbeiten hatte John Rennie den Entwurf einer neuen, aus fünf Bögen bestehenden Steinbrücke eingereicht, um die alte Brücke zu ersetzen. Sein Plan hatte den Zuschlag erhalten, und so war in den vergangenen sieben Jahren dreißig Meter flussaufwärts die neue London Bridge entstanden. Der Bau hatte die unvorstellbare Summe von zwei Millionen Pfund verschlungen.
In einem halben Jahr sollten der König und die Königin sie eröffnen, und nun näherten sich die vier führenden Köpfe hinter dem Projekt und ihr Baumeister ihrem gemeinsamen Meisterwerk, der neuen Brücke. Ihre massiven Steinbögen verschmolzen mit den Schatten, die aus den verwinkelten Gassen der Stadt gen Fluss drangen. Unter dem bleichen Licht des Mondes versammelten sich die fünf Männer inmitten dieser düsteren Kulisse, ihre Umrisse von dunklen Kapuzen verhüllt, ihre Schritte kaum hörbar auf dem feuchten Uferschlamm. Ein geheimnisvolles Flüstern schien von der nahen Themse herüberzuwehen, als habe der Fluss die Ankunft der Männer geahnt.
Benjamin Thornes Augen weiteten sich vor Überraschung, als der Landvermesser, ein Mann von auffallend hochgewachsener Statur, einen großen eisernen Bartschlüssel aus den Tiefen seines Umhangs hervorzog und damit eine unscheinbare Eisentür, grau wie der Granit der sie umgebenden Steine, am Fuß des Brückenpfeilers aufschloss. Thorne war deshalb so überrascht, weil er die Baupläne des fünfbögigen Wunders aus Granit kannte wie seine Westentasche, doch dieses Türchen auf keinem davon zu sehen gewesen war. Seine vier Begleiter führten ihn in eine Art Keller im Fundament des Brückenbogens, dessen feuchte Wände den Geruch von Moder und Verfall verströmten. Auch von diesem Kellergelass wusste Thorne nichts – ein Projekt der Freimaurer, gar keine Frage. Der Bauleiter konnte nur mutmaßen, wer dieses Steingeviert im Fundament des Brückenpfeilers geschaffen hatte.
Exakt in der Mitte des ansonsten völlig leeren Raumes befand sich ein kleiner ebenfalls aus Granit gemauerter Steinaltar, in den ein Steinmetz Zirkel und Winkel, zwei der bekanntesten Symbole der Freimaurerei, graviert hatte. Der Architekt, dieser nur mittelgroß und von kräftiger Statur, brachte unter seinem Kapuzenumhang eine Art lederne Arzttasche zum Vorschein und entnahm ihr eine große, schwarze Kerze, die er auf den Altar genau in den Winkel der Gravur stellte und mittels ebenfalls mitgebrachter Sturmzündhölzer entfachte. Alte Symbole zierten die Wände. Keine Frage: Hier, in diesem düsteren Raum im Uferschlamm, sollte das Ritual stattfinden, das den Grundstein für die Zukunft der London Bridge legen würde.
»Die Loge ist offen«, intonierte der stämmige Mann feierlich. Es lag wohl an irgendwelchen architektonischen Kniffen, dass die Akustik des Raumes seine Stimme verstärkte und ihr einen Hall hinzufügte, als stünden sie in einer tiefen Kaverne oder einer Tropfsteinhöhle irgendwo in einem fernen Gebirge, weit unter der Erde.
Die vier Herren, die ihn hergeleitet hatten, sprachen in gedämpften Stimmen, ihre Worte erfüllt von Ehrfurcht und Furcht, als sie uralte, unter den Freimaurern seit Generationen weitergegebene Verse rezitierten. Der Architekt entnahm seiner ledernen Tasche eine Schriftrolle und entrollte sie, sie war mit alten Symbolen verziert – sicherlich ein Schlüssel zu einem Wissen, das über die Grenzen der Zeit hinausreichte.
Dann schlug die Glocke der Southwark Cathedral am gegenüberliegenden Ufer Mitternacht. Hohl und dumpf dröhnend klangen die Glockenschläge über die Themse, und das Wasser und der Nebel verzerrten ihren Schall auf unheimliche Weise.
»So beginnt nun der Ritus der Mitternachtswacht«, intonierte der Mann mit der Schriftrolle. »Namenloser Bruder, der du in unsere Reihen aufgenommen zu werden begehrst, lege deine Kleidung ab, denn es ist Brauch, dass du bei deiner Aufnahme in die Loge nur in Dunkelheit gehüllt vor der heiligen Kammer der Freimaurer stehen sollst.«
Die Kammer war durch die flackernde Kerze nur schwach beleuchtet, die unheimliche Schatten auf die arkanen Sigillen auf dem Mauerwerk warf. Benjamin Thorne überwand seine Scham und gehorchte.
Jemand – Benjamin vermutete, es war der Landvermesser, denn die Hände kamen von oben – trat hinter ihn und verband ihm mit einem Tuch, das sich kühl und seidig anfühlte, die Augen. Die Kammer war erfüllt vom gedämpften Flüstern der Brüder.
»Drei ist die heilige Zahl – mach drei Schritte auf meine Stimme zu«, hieß ihn der Architekt vor ihm. Benjamin Thorne gehorchte. In seinem Kopf hallte jeder seiner drei Schritte wie ein Echo in den Ebenen des Abgrunds wider. Eine Atmosphäre der Erwartung und der Angst umhüllte ihn.
Thorne spürte, wie ihm Hände eine Art Robe über den Kopf streiften.
»Dieses einfache weiße Gewand symbolisiert die Reinheit des Herzens und des Geistes des Opfers«, hörte er den Architekten, zweifellos der Großmeister der Loge, sagen. Jemand hinter ihm nahm ihm die Augenbinde ab. Die vier Brüder, deren Kapuzenumhänge nun ihre Gesichter gänzlich verdeckten, umkreisten Thorne in einem bedrohlichen Tanz aus Schatten und Flüstern. Hatte der Architekt eben wirklich »Opfer« gesagt?
Der Großmeister, ganz und gar verhüllt von seinem nachtschwarzen Umhang, trat vor und befahl: »Sprich mir nach!«
Dann trug er eine Eidformel vor, unterbrochen jeweils durch angemessene Pausen, um dem Neophyten die Möglichkeit zu geben, seine Worte zu wiederholen: »Ich gelobe und schwöre hiermit in Gegenwart des allmächtigen Gottes und dieser ehrwürdigsten Versammlung, dass ich die Heimlichkeiten oder das Geheimnis der Maurer oder Maurerei, so man mir offenbaren wird, hehlen und verbergen und niemals entdecken will, es sei denn einem treuen und rechtmäßigen Bruder, nach gehöriger Erforschung, oder in einer rechten und ehrwürdigen Loge von Brüdern und Gesellen.«
Vor Erwartung und Kälte zitternd sprach Thorne den feierlichen Schwur Wort für Wort nach, gelobte der heiligen Bruderschaft Treue und schwor, ihre alten Traditionen und Geheimnisse zu wahren. Dann herrschte tiefe Stille.
Er hatte den Eid abgelegt – nun würde man ihn zweifellos Stück für Stück in die Geheimnisse der Freimaurer einweihen. Der Großmeister reichte ihm einen Kelch mit blutrotem Wein. »Dieser Wein symbolisiert das Blut des Bundes und bindet die Brüder durch ein Band, das stärker ist als der Tod selbst«, verkündete er. Feierlich gestimmt trank er einen Schluck davon.
Damit erreichte das Ritual seinen Höhepunkt. Urplötzlich löschte der Großmeister die Kerze und tauchte die Kammer in völlige Dunkelheit. In absoluter Finsternis rezitierten die Brüder uralte Beschwörungsformeln auf Latein, ihre Stimmen hallten durch die Kammer wie das Flüstern längst vergessener Geister.
Aber Benjamin Thorne hörte sie nicht mehr. Das schnell wirkende Gift im Kelch hatte seine Sinne schwinden lassen; er verlor das Bewusstsein und brach unmittelbar vor dem Granitaltar zusammen, lag auf dem eiskalten Steinboden, gehüllt nur in eine schlichte weiße Leinenrobe.
»So schließt der Ritus der Mitternachtswache, und das Ritual des Bauopfers kann beginnen, das die Brüder in einer heiligen Gemeinschaft vereint, sie eins werden lässt in ihrem Streben nach Wahrheit, Weisheit und Erleuchtung«, intonierte der Großmeister.
Benjamin Thorne spürte, dass er starb. Unwillkürlich zog er die Knie an, seine Hände zitterten. Die Männer umringten ihn, die Kapuzen noch immer tief ins Gesicht gezogen. Dann traten sie zum Eingang des Raumes und begannen, die Steine zu setzen. Jeder Schlag des Hammers hallte durch den Raum, als errichteten sie nicht nur eine Mauer, sondern besiegelten gleichzeitig Schicksale.
»Für die Brücke«, flüsterte der Architekt und setzte den ersten Stein. »Möge das Geheimnis, das sie birgt, ihr ewigen Bestand verleihen.”
Die anderen drei Männer folgten seinem Beispiel. Die Steine, die sie setzten, trugen das Gewicht von Jahrhunderten. Die Schriftrolle lag auf dem Boden, die lateinischen Worte darauf verschwammen vor Thornes brechenden Augen.
»Das Bauopfer ist vollbracht”, verkündete der Ingenieur schließlich. »Möge die Brücke uns verbinden, wie sie die Ufer der Themse verbindet – durch Raum und Zeit.”
Als das erste Licht der Morgendämmerung die Dunkelheit und den Nebel an der Themse durchbrach, verließen die Männer den geheimen Keller im Brückenpfeiler, die Kapuzen noch immer tief ins Gesicht gezogen. Die Dunkelheit des Geheimnisses lastete auf ihren Schultern, doch sie gingen erhobenen Hauptes. Sie hatten Unheil über einen einzelnen Mann gebracht und dabei so vielen Gutes getan. Benjamin Thorne blieb sterbend zurück, eingemauert in Stein und Geheimnisse. Sein Atem wurde flacher, und er spürte, wie die Dunkelheit ihn verschlang.
Die London Bridge würde der Zeit trotzen, Jahrhunderte überdauern, und niemand würde je von dem Mann wissen, der ihr Fundament bildete. Ein Bauopfer, dargebracht für die Ewigkeit.
Kapitel 1
Sangatte, 28. Februar 1896
Ich weiß es noch, als wäre es erst gestern gewesen: Mein drittes großes Abenteuer mit Professor James Moriarty begann an einem Samstag. Wir drei – der Professor, seine Gattin und ich – weilten damals schon seit dem Jahreswechsel in einem Fischerdörfchen namens Sangatte an der französischen Atlantikküste; unsere Tage waren von ruhiger Schönheit und Einfachheit geprägt.
Aber ich greife vor. Das ist eine dumme Angewohnheit, die ich einfach nicht loswerde – ich bin wieder einmal davon ausgegangen, verehrte Leserinnen und Leser, dass Sie alle auch von meinen bisherigen Berichten über meine Eskapaden mit dem Professor Kenntnis haben, doch dies dürfte gewiss nicht der Fall sein. Also denke ich, es ist Zeit für ein paar einführende Worte.
Nun denn, von Anfang an: Mein Name ist Molly Miller, und geboren bin ich im Jahre des Herrn 1878. Da ich im Sternzeichen des Skorpions geboren bin – nicht, dass ich an derlei Hokuspokus glaube, Gott bewahre –, ein Kind der kalten, nieseligen Spätnovembertage in der englischen Hauptstadt, war ich also zum Zeitpunkt der Ereignisse dieses Berichtes noch nicht volljährig. Mein Elternhaus stand, wie eben erwähnt, im Londoner East End, und man darf es wohl mit Fug und Recht als zerrüttet bezeichnen. Mein Vater war ein einfacher Fleischhauer auf dem Smithfield Market, meine Mutter, Gott hab‘ sie selig, Näherin. Ich habe noch eine zehn Jahre ältere Schwester namens Mary – treue Leserinnen und Leser meiner kleinen Berichte sind ihr in meinem letzten Abenteuer bereits begegnet –, und mein Vater hätte meiner Mutter bestimmt noch viele kleine irisch-katholische Bälger gemacht, hätte er sie nicht leider eines Tages volltrunken die Treppe hinuntergeprügelt. Er ist dann zur Arbeit gegangen, als wäre nichts gewesen und hat es mir überlassen, Hilfe für meine Mutter zu suchen. Das war kurz vor Weihnachten 1884, und ich war gerade sechs Jahre alt geworden. Zwei Tage danach ist sie trotz der redlichen Bemühungen der Ärzte im Armenspital in der Kingsland Road ihren inneren Verletzungen erlegen.
Ein paar Monate später ist meine Schwester Mary dann Hals über Kopf ins Kloster gegangen und hat die Gelübde abgelegt, weil unser Vater ihr aus Ermangelung einer Ehefrau an die Wäsche wollte – ein Mann hat eben Bedürfnisse, schätze ich. Ich dagegen habe es noch fast sieben Jahre unter demselben Dach mit diesem Widerling ausgehalten, habe versucht, so wenig wie möglich zu Hause zu sein, wenn er es war, erst heimzukommen und einzuschlafen, wenn er volltrunken im Bett lag und mich davonzustehlen, ehe er aus seinem Stupor wieder aufwachte.
Als ich dreizehn war, hat mein Vater dann das erste Mal versucht, mir Gewalt anzutun. Ich sage mal so: Der Versuch ist ihm nicht gut bekommen. Danach bin ich von zu Hause weggelaufen und habe mich fortan auf mich allein gestellt auf den Straßen Londons durchgeschlagen, während er sich von der Prellung in seinen Kronjuwelen erholt hat. In den Jahren nach diesem einschneidenden Erlebnis gab es in meinem Leben viele Höhen und Tiefen, aber letztere überwogen.
Zumindest bis ich vor zwei Jahren aus beruflichen Gründen – ein mir gut bekannter, inzwischen leider verstorbener indischer Hehler hatte mich angeheuert, ein bestimmtes kostbares Schreibgerät für ihn zu entwenden, das er weiter zu veräußern gedachte – in die Stadtvilla eines älteren Herrn, des Mathematikprofessors James Moriarty, in der Dunraven Street im Londoner Nobeldistrikt Mayfair einstieg. Das ist ein Reichenviertel im Londoner West End am östlichen Rand des Hyde Parks, und man muss gut situiert sein, um sich ein Leben dort leisten zu können.
Der Herr Professor ertappte mich auf frischer Tat und stellte mich zur Rede, eins kam zum anderen, und am Ende half ich ihm und seinem kuriosen »Hofstaat«, wie er in sanftem Spott über die von mir nicht uneingeschränkt geteilte britische Begeisterung für unsere Monarchie die kleine Gruppe von Bediensteten und andern helfenden Händen und Köpfen nennt, mit denen er sich umgibt, einem Serienmörder das Handwerk zu legen. Der Professor brachte ihn mit ein wenig Schützenhilfe des selbsternannten »größten Detektivs der Welt« – Sie wissen schon, dieser Sherlock Holmes – zur Strecke. Im Jahr darauf war ich ihm dann erneut bei einer größeren Ermittlung behilflich, bei der er den besten Freund jenes großen Privatdetektivs, einen Arzt namens John Watson, von einem falschen Mordverdacht reinwusch. Am Ende dieser komplizierten Geschichte täuschte der Professor aus Gründen, die wohl für immer sein Geheimnis bleiben werden, seinen Tod vor und verließ in einer Nacht- und Nebelaktion England, um für eine nicht näher genannte Institution der englischen Krone zunächst in Brest tätig zu werden, einer französischen Hafenstadt in der Bretagne, die nicht nur ein wichtiger Handelshafen war, sondern eben auch Stützpunkt der französischen Atlantikflotte. Sollte jetzt jemand von Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, »Spionage« denken, so werde ich gewiss nicht widersprechen, doch behaupten Sie bitte später bloß nicht, ich hätte Ihnen recht gegeben.
Ein Weile nach seinem Tod in der Themse, der mich als Nichteingeweihte zunächst in tiefe Trauer stürzte, ließ mir der große Detektiv einen Brief von des Professors Hand zukommen, in dem er mich aufforderte, ihm in jene westlichste Stadt Frankreichs zu folgen. Mein Gönner und Mentor war gar nicht tot und hatte sich entschlossen, mich quasi an Tochters statt anzunehmen.
Natürlich trieb mich meine angeborene Abenteuerlust dazu, seiner Aufforderung umgehend Folge zu leisten, und ich traf ihn auf einem beschaulichen Landgut unweit von Brest an, wo er unter dem Namen Vincent Tremayne und unter dem Deckmantel, für einen französischen Freund namens Adrien Saumur dessen dortige Ländereien zu verwalten, buchstäblich lebte wie Gott in Frankreich. Mehr noch, er lebte nicht allein: An seiner Seite war seine Gattin Irene Adler-Moriarty, eine geheimnisvolle, schöne Frau, die fünfzehn Jahre jünger war als er und, wie sie mir später anvertraute, in ganz Europa unter verschiedenen Decknamen allerlei spektakuläre und oft nicht ganz mit dem Gesetz zu vereinbarende Taten vollbracht hatte. Er hatte sie, wie sich im Laufe meines Aufenthalts in Brest herausstellte, schon vor unserer ersten Begegnung geehelicht, hatte diese Tatsache aber geheim gehalten – um ihrer beider Privatsphäre zu schützen, wie er behauptete, doch ich vermute, nicht zuletzt auch aus einer absonderlichen Geste der Rücksichtnahme auf seine große Nemesis, den Detektiv, der Irene seit seiner ersten Begegnung mit ihr ebenso begehrt hatte wie mein lieber Professor. Sie war jedenfalls die ganze Zeit in eigenen Geschäften auf dem Kontinent unterwegs gewesen und hatte ihren Gatten auch nach über zwei Jahren gerade das erste Mal wieder getroffen.
Doch ich schweife ab – all das war zum Zeitpunkt der Ereignisse, die ich zu schildern gedenke, auch schon wieder eine ganze Weile her. Kehren wir zurück zu den Ereignissen Ende Februar 1896. Nachdem ich zu den beiden gestoßen war, hatte der Professor abermals seine Deckidentität gewechselt. Wir bewohnten in jenen Tagen ein weiß getünchtes, einfaches Haus unweit der Küste, das der Professor als unser Feriendomizil für die Saison angemietet hatte. Er nannte sich nun André Urbain und gab sich als Geschäftsmann aus Toulon aus, der mit Frau und Tochter in Sangatte in der Sommerfrische war.
Am Morgen hatten mich die sanften Wellen des Ozeans geweckt, die gegen die Felsen und den sandigen Küstenstreifen rauschten. Die Luft war frisch und salzig, und die Meeresbrise wehte durch die offenen Fenster. Nach einem einfachen Frühstück in einem gemütlichen Gasthaus namens Les Deux Vagues hatten wir einen Spaziergang entlang der zerklüfteten Küste gemacht, die lebhafte Szenerie der Fischerboote beobachtet, und Irene, die des Französischen mächtig war, hatte ein wenig mit den Einheimischen geplaudert, die ihre Netze reparierten oder ihre Boote für die nächste Ausfahrt zum Fischen vorbereiteten.
Am Nachmittag hatten wir uns für einen Ausflug ins Landesinnere entschieden, um die Natur zu erkunden, wo sich zaghaft erste Frühlingsblüten an den Sträuchern und Bäumen zeigten, durch malerische Dörfer zu schlendern und die Ruinen einiger alter Burganlagen im Hinterland zu besichtigen, die von der reichen Geschichte der Atlantikküste zeugten.
Zurück in Sangatte hatten wir den Abend bei einem Glas Wein (Irene und ich, in meinem Fall verdünnt mit Wasser) und einem lokalen Bier (der Professor) in einem charmanten Café namens La Sardine Dorée am Hafen verbracht, den Sonnenuntergang über dem Meer bewundert und den Klängen der Wellen gelauscht.
Darüber war es Nacht geworden, der Himmel war klar, und wir gingen trotz der empfindlichen Kühle hinunter zum Strand, mit Decken bewaffnet, setzten uns in den Sand und betrachteten die Sterne, während das Rauschen der Brandung eine beruhigende Melodie lieferte. Ich glaube, wenn ich noch lange dort gesessen hätte, das Wellengeräusch hätte mich in den Schlaf gewiegt.
Doch ich wurde schlagartig wieder wach, als ein abgerissener kleiner Junge sich uns unvermittelt über den Sand näherte. Obwohl ihm deutlich anzusehen war, dass er aus ärmlichen Verhältnissen stammte, waren seine Bewegungen lebhaft – offenbar wuchs er unter den harten Bedingungen des Küstenlebens auf, das nur begüterten Touristen wie uns pittoresk erschien (wobei ich mir durchaus darüber im Klaren war, dass mein Wohlstand ein geborgter, mir nur von des Professors Gnaden zur Verfügung stehender war – wären er und Irene nicht gewesen, ich hätte vermutlich ausgesehen wie dieser Junge da).
Er blieb in einiger Entfernung stehen und musterte uns im schwachen Licht der Sterne und der fernen Beleuchtung der Straße zum Strand mit neugierigen Augen. Obgleich er so ein ärmliches Äußeres hatte, hatte ich den Eindruck, der Kleine sei in der Lage, sich in jeder Situation zu behaupten. In vielerlei Hinsicht erinnerte er mich sehr an mich vor einigen Jahren. Sein Haar war zerzaust, und seine schmutzige Kleidung gezeichnet von den Abenteuern des Tages. Ich stellte mir vor, dass er ein Fischerkind war, das tagsüber die nahegelegenen Felder und Wälder durchstreifte, um nach Abenteuern zu suchen und sich mit Gleichaltrigen zu treffen, die ähnlich arm waren wie er. Vielleicht reparierte er am Hafen für ein paar Münzen Fischernetze oder erledigte kleine Aufgaben für die Fischer, um etwas zum Lebensunterhalt seiner Familie beizutragen.
Schließlich trat er vor und sagte in gebrochenem Englisch: »Sie müssen Professor Moriarty sein. Und wenn Sie das sind, dann habe ich ein‘ Brief für Sie.«
Der Professor gab sich zunächst nicht zu erkennen, sondern fragte: »Wie heißt du, mein Junge?«
»Mein Name ist Pierre«, antwortete der Kleine in gebrochenem Englisch.
»Du sprichst meine Sprache, Pierre. Das ist erstaunlich für einen kleinen Mann deines Alters.«
»Ist gut fürs Geschäft, der Herr«, entgegnete der Junge wie aus der Pistole geschossen. »Wenn man mit die Fremden reden kann, hat man mehr … wie sagt man … eventualités de revenu.«
»Verdienstmöglichkeiten«, warf Irene ein.
Der Professor nickte versonnen, während ich den Jungen neugierig musterte. Seine Augen hatten einen frechen Glanz, auf seinem Gesicht lag ein lebhaftes Lächeln.
Mit einem ebensolchen Lächeln wandte sich der Professor erneut an ihn: »Gesetzt den Fall, ich wäre Professor Moriarty. Von wem kommt denn dieser geheimnisvolle Brief, der so wichtig ist, dass du ihn mitten in der Nacht ausliefern musst?«
»Sag ich nich‘.«
»Warum das denn?«
»Darf ich nich‘.«
»Hat dir das der Absender des Briefes aufgetragen?« Die Neugier des Professors war offensichtlich geweckt, und wie es bei Befragungen seine Art war, drang er sanft, aber unnachgiebig in unseren kleinen Postboten.
»Das darf ich auch nicht sagen.«
»Hat dir denn ein Mann den Brief gegeben oder eine Frau?«
Diesmal warf Pierre dem Professor nur einen Blick zu, der so viel besagte wie: Du weißt doch, dass ich dir auch das nicht beantworten werde.
Ich verspürte zu diesem Zeitpunkt bereits den Drang, den Burschen zu packen und zu schütteln, bis er ein paar Antworten ausspuckte. Wenn des Professors alter Weggefährte, Colonel Sebastian Moran, zugegen gewesen wäre, der in solchen Situationen nicht viel Federlesens machte, hätte dieser das zweifellos schon zwei bockige Antworten zuvor erledigt. Aber da der Professor und seine Gattin offensichtlich Langmut zu zeigen gedachten, tat ich dasselbe, zügelte mein Temperament – das der Professor gerne mal als »jugendlichen Leichtsinn« titulierte – und wartete.
Moriarty seufzte leise und hielt dem Jungen die Hand hin. »Nun gut, ich beiße an. Du hast deinen Adressaten gefunden – ich bin besagter Professor.«
Der Junge kam ein wenig näher, und nun sahen wir, dass er etwas hinter seinem Rücken hielt. Er zögerte allerdings offensichtlich, seinen Botengang zu Ende zu bringen. Der Professor streckte ihm auffordernd die Hand hin. Einige Sekunden verstrichen, ohne dass etwas geschah.
»Nun mach schon, worauf wartest du?«, brummte ich. Irene warf mir einen warnenden Seitenblick zu.
»Ich …«, begann der Junge zögerlich, brach dann ab und wischte sich mit der Handkante den mit Sand, Salz und Rotz verschmierten Bereich zwischen Nase und Oberlippe ab.
»Ja?«, fragte der Professor ungewöhnlich sanft nach.
»Ich hab noch kein Geld bekommen. Ich mach so was nicht umsonst.«
Professor Moriarty zog überrascht die Augenbrauen hoch.
»Du hast noch keine Bezahlung bekommen?«, vergewisserte er sich. Das war in der Tat ungewöhnlich. Der Professor wusste so gut wie ich, dass Jungen vom Schlage Pierres, wie wir sie aus London zum Beispiel von Holmes‘ berüchtigter Baker-Street-Spezialeinheit kannten, so sehr auf diese kleinen Verdienste angewiesen waren, dass sie keinen Schritt machten, bevor ihnen nicht jemand eine Münze in die Hand gedrückt hatte.
»Nein«, bestätigte Pierre.
»Wie das?«, hakte der Professor nach.
»Es hieß, ich krieg mein Geld, wenn ich den Brief abgebe. Aber jetzt bin ich auf einmal nicht mehr so sicher …«
»Es hieß?«, mischte sich Irene mit ebenfalls sanfter Stimme ins Gespräch ein und schenkte dem Jungen dasselbe strahlende Lächeln, mit dem sie schon russische Großfürsten und britische Diplomatinnen betört hatte. »Magst du uns das ein wenig näher erklären, Pierre?«
»Darf ich nicht«, brummte der Knabe trotzig.
»Na schön, kürzen wir das ab«, seufzte der Professor. Er richtete sich im Sand auf die Knie auf und kramte ein paar Francs aus der Tasche seines leichten Sommerjacketts, die er dem Fischerjungen in die schmutzige Hand drückte. Der überprüfte mit einem raschen Blick, ob die Beute seinen Erwartungen entsprach. Offenbar kam er zum Schluss, dass dies der Fall war, denn er warf den Brief, den er mit der anderen Hand hinter dem Rücken gehalten hatte, vor dem Professor in den Sand, machte auf den Fersen seiner bloßen Füße kehrt und rannte davon.
Mit einem leisen Lachen und einem Kopfschütteln hob Professor Moriarty den Brief auf. »Dann wollen wir doch mal sehen, was es mit diesem geheimnisvollen Schreiben, das uns auf so ungewöhnlichem Wege erreicht hat, auf sich hat.«
An dieser Stelle ließ Irene alles damenhafte Betragen fallen, und wir umringten ihn neugierig von beiden Seiten.
»Nicht hier, meine Damen«, lächelte er, stand auf und klopfte sich den Sand von Knien und Hosenboden. Dann ließ er den Brief des Fischerjungen in der Innentasche seines Jacketts verschwinden. »Das tun wir besser in der Sicherheit unserer eigenen vier Wände. Denn trotz meiner Neugier gibt es etwas zu bedenken, das mir tatsächlich ein wenig Sorgen bereitet.«
»Du hast recht, James, mein Lieber«, stimmte ihm seine Gattin zu und erhob sich mit unnachahmlicher Eleganz aus dem Sand. »Der Junge hat nach Professor Moriarty gefragt – dabei ist der doch offiziell in der Themse ertrunken, und du bist hier für alle, die es betrifft, André Urbain.«
***
Eine Viertelstunde später saßen wir um den einfachen Holztisch in unserem Ferienhaus herum. Der Professor hatte einem Lederetui, das er in der Schublade des Sekretärs im Salon aufbewahrte, eine Reihe von Gegenständen entnommen, die jetzt feinsäuberlich angeordnet auf dem Küchentisch lagen: eine Pinzette, eine Lupe und einen kleinen, aber sehr scharf wirkenden Brieföffner. Während er die Vorbereitungen für die Öffnung des geheimnisvollen Briefes getroffen hatte, hatte ich Tee bereitet, den ich jetzt in einer bauchige Kanne zusammen mit drei Porzellantassen, die aus dem Inventar des Ferienhäuschens stammten und schon bessere Tage gesehen hatten, auftrug.
Zunächst betrachteten wir den Umschlag. Das Kuvert war etwas größer als das eines gewöhnlichen Briefes und aus billigem, braunem Papier.
»Der Umschlag erinnert mich ein wenig an die, in denen Handwerker in London ihre Rechnungen versenden«, bemerkte Irene Adler-Moriarty.
Der Professor warf ihr nur wortlos einen Blick zu und drehte ihn so, dass die Vorderseite oben lag. Flüchtig hingeworfen stand da, offenbar mit Tinte und Feder geschrieben, »Prof. M.« Die Buchstaben waren raumgreifend und schnörkelig, aber so, als hätte die schreibende Person sie eher geistesabwesend auf den Umschlag gekritzelt. Ich fühlte mich vage an etwas erinnert, das ich schon gesehen hatte, aber im ersten Augenblick konnte ich diese Erinnerung nicht zuordnen.
»Offenbar weiß wirklich jemand, dass ich hier bin«, murmelte der Professor und fügte dann mit ironischem Unterton hinzu: »Und keineswegs tot. Das schränkt die Anzahl der möglichen Absender sehr ein, es sei denn, es hätte ein überaus bedauerliches Leck im Schirm der Geheimhaltung um meine Mission auf dem Kontinent gegeben.«
»Ein Leck in einem Schirm?«, spottete seine Gemahlin liebevoll. »Du warst mit deinen Metaphern auch schon mal exakter, mein Herz.«
»Ich bin Mathematiker, kein verfluchter Literaturwissenschaftler.« Moriarty bemühte sich, verärgert zu klingen, aber das Amüsement klang deutlich durch. Währenddessen drehte er den Umschlag um und löste mit dem scharfen Brieföffner die Gummierung, sodass er entgegen seiner Gewohnheit, die Kuverts eingehender Korrespondenz einfach oben aufzuschlitzen und das enthaltene Schriftstück zu entnehmen, die Lasche des Umschlags zurückklappen konnte. Zu meiner Überraschung nahm er sie mit der Lupe genauestens in Augenschein, ehe er mit einem unzufriedenen Brummen endlich den Inhalt der geheimnisvollen Sendung zum Vorschein brachte.
Zwischen Daumen und Zeigefinger hielt der Professor einen vergilbten Fetzen Papier, der unregelmäßig aus einem größeren Bogen gerissen und mit etwas bedruckt war, das ich auf den ersten Blick nicht erkannte. Darauf war nur wenig Text gekritzelt, augenscheinlich in derselben Handschrift wie die Adresse. Er lautete:
BBA2
und war nachlässig, aber schwungvoll umkringelt. Daneben war ein absonderliches Strichmännchen gekritzelt, das eine seltsam gebauschte Mütze und eine schwarz-weißkarierte Hose trug.
Während ich mich noch wunderte, was das für eine absonderliche Botschaft war, sah ich aus dem Augenwinkel, wie ein begreifendes Lächeln über Irene Adler-Moriartys scharf geschnittene, aristokratische Züge huschte. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber der Professor, der augenscheinlich auch bereits mehr mit der geheimnisvollen Nachricht anzufangen wusste als ich, warf ihr wortlos einen warnenden Blick zu, und sie hielt sich zurück.
Moriarty schob mir die Nachricht über den Tisch zu und bemerkte: »Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, deinen Spürsinn auf die Probe zu stellen, meine liebe Molly. Ich nehme mal an, deine detektivischen Fähigkeiten sind vor lauter Sommerfrische in letzter Zeit ein wenig eingerostet. Nun, was sagt dir die Botschaft?«
Ich spürte den prüfenden, erwartungsvollen Blick der beiden älteren Personen, mit denen ich an diesem Tisch saß, auf mir und rutschte unwillkürlich ein wenig unangenehm berührt auf meinem Stuhl herum. Ich hatte zwar wenig formelle Ausbildung genossen, stellte mir aber vor, dass sich so die Eton-Schüler, mit deren Familien der Professor in London sehr viel Umgang gehabt hatte, fühlen mussten, wenn eine mündliche Prüfung bevorstand.
Nun, da musste ich wohl durch. Zögernd zog ich Umschlag und Inhalt zu mir heran und studierte beides eingehend. Den Umschlag legte ich sofort beiseite, weil er mir keinerlei Aufschluss bot außer der Tatsache, dass das Schreiben an den Professor gerichtet war. Sodann nahm ich den Inhalt näher in Augenschein.
»Keine Scheu, meine liebe Molly«, ermunterte mich Professor Moriarty. »Dies ist kein Mathematikexamen, und es gibt keine falschen Antworten. Immer frei heraus mit allem, was dir einfällt«.
Also gut. »Das … das ist kein normales Briefpapier«, sagte ich das Erste, was mir in den Sinn kam.
»Sehr richtig«, pflichtete mir Moriarty in lobendem Tonfall bei. »Sondern …?«
Wir hatten viele Stunden damit zugebracht, das Beobachten und das Beschreiben von Situationen und Objekten zu üben. Der Professor hatte mir vieles beigebracht, und ich schlüpfte in die Routine der Hilfs-Detektivin wie in einen bequemen, aber gut passenden Handschuh. »Es sieht aus wie ein Ausriss aus einem alten Stadtplan. Ich sehe breite Straßen und schmalere Gassen …« Als ich den Blick wieder auf den vergilbten Fetzen Papier richtete, erkannte ich plötzlich eine vertraute Form. » …und einen Fluss …«
»… dessen Verlauf dir eigentlich etwas sagen sollte …«, soufflierte Irene Adler-Moriarty.
Ich hatte einen Geistesblitz. Natürlich! Hinter den kryp