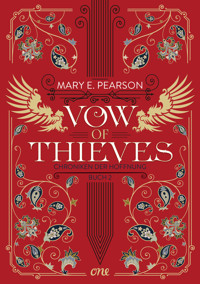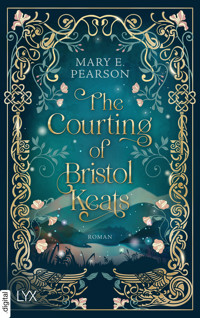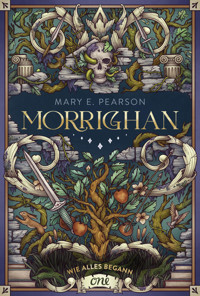
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Verbliebenen
- Sprache: Deutsch
Vorgeschichte zu den Chroniken der Verbliebenen von Bestsellerautorin Mary E. Pearson
Noch bevor die großen Königreiche der Verbliebenen geboren wurden, die in Kuss der Lüge und Folgebände im Zentrum stehen, kämpfte ein Mädchen darum, zu überleben. Ihr Name war Morrighan. Schon als Kind trifft sie auf einen Jungen aus einem verfeindeten Lager. Beiden ist klar, dass diese Begegnung verboten ist. Und doch treffen sie sich über die Jahre immer wieder und lernen sich immer besser kennen ...
- Poetische Forbidden-Love-Geschichte - voller Romantik und mit einer Magie, die das Herz berührt
- Wunderschön illustriert und hochwertig ausgestattet - das ist das perfekte Geschenk!
- Vorgeschichte zur Trilogie Kuss der Lüge / Das Herz des Verräters / Der Glanz der Dunkelheit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Karte
Vorwort
Gaudrels Vermächtnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Nachwort der Autorin
Danksagung
Weitere Titel der Autorin
Der Kuss der Lüge
Das Herz des Verräters
Der Glanz der Dunkelheit
Klang der Täuschung
Ruf der Rache
MARY E. PEARSON
WIE ALLES BEGANN
Übersetzung aus dem amerikanischen Englischvon Barbara Imgrund
Titel der englischsprachigen Originalausgabe:Morrighan – The Beginning of the Remnant Universe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2022 by Mary E. PearsonCopyright Illustrationen © 2022 by Kate O’HaraPublished by Arrangement with Mary E. Pearson
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische AgenturThomas Schlück GmbH, Hannover.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 KölnÜberarbeitete und erweiterte Neuausgabe
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Julia Przeplaska, IngolstadtUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.denach einer Vorlage von Jeannine Schmelzer undeinem Design von Mallory Grigg;Illustration: © 2022 by Kate O’Hara.Satz: two-up, Düsseldorf
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-7423-9
Sie finden uns im Internet unter one-verlag.de
Bitte beachten Sie auchluebbe.de
Für Ava, Emily, Leah und Rileyund die Reisen, die noch vor uns liegen
Bevor man Grenzen zog,bevor man Vereinbarungen unterzeichnete,bevor man Kriege führte – ja,bevor die großen Reiche der Verbliebenenentstanden und als die alte Welt längst nurnoch eine verschwommene Erinnerung war,von der Geschichten und Legenden erzählten,kämpften ein Mädchenund seine Familie ums Überleben.
Dieses Mädchen hieß
Sie bittet um eine weitere Geschichte, eine, die ihr die Zeit vertreibt und sie satt macht.
Ich suche nach der Wahrheit, den Einzelheiten einer Welt, die nun schon so lange vergangen ist, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob es sie je gegeben hat.
Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit,
in einer Zeit, bevor Ungeheuer und Dämonen die Erde heimsuchten,
einer Zeit, in der Kinder frei über die Wiesen liefen
und Früchte schwer von den Bäumen hingen.
Es gab Städte, groß und schön, mit funkelnden Türmen, die den Himmel berührten.
Hat Zauberei sie erschaffen?
Ich war selbst noch ein Kind. Ich dachte, sie könnten eine ganze Welt stützen. Für mich waren sie aus …
Ja, sie waren gesponnen aus Zauberei und Licht und den Träumen der Götter.
Und gab es auch eine Prinzessin?
Ich lächle.
Ja, mein Kind, eine edle Prinzessin. Genau wie du. Sie hatte einen Garten voller Bäume, von denen Früchte so groß wie Männerfäuste hingen.
Die Kleine sieht mich zweifelnd an.
Sie hat nie einen Apfel gesehen, nur Männerfäuste.
Gibt es wirklich solche Gärten, Ama?
Jetzt nicht mehr.
Ja, mein Kind, irgendwo schon. Und eines Tages wirst du sie finden.
Gaudrels Vermächtnis
Kapitel 1
Morrighan
ICHWARACHTJAHREALT, als ich ihn zum ersten Mal sah. In diesem entsetzlichen Augenblick war ich überzeugt, dass ich nun sterben würde. Er war ein Plünderer, und ich war noch nie einem von ihnen so nahe gekommen. Ich war allein. Und hatte nichts, um mich zu verteidigen, nur ein paar Steine, die vor meinen Füßen herumlagen, aber ich war zu gebannt von der Angst, um mich zu bücken und sie aufzuheben. Eine Handvoll Steine hätte mir ohnehin nicht viel genutzt. Ich sah das Messer, das in der Scheide an seiner Seite steckte.
Er stand auf einem Felsen und blickte neugierig zu mir herab, musterte mich. Mit nackter Brust und wüst verfilztem Haar verkörperte er jene Wildheit, vor der man mich gewarnt hatte, auch wenn er selbst dem Kindesalter kaum entwachsen war. Seine Brust war schmal, man konnte seine Rippen zählen.
Ich hörte das ferne Donnern von Hufen und erbebte vor Furcht. Weitere Plünderer kamen, es gab keine Möglichkeit zu fliehen. Zwischen zwei Felsen in einer dunklen Spalte unter ihm kauernd, saß ich in der Falle. Ich atmete nicht. Rührte mich nicht. Ich konnte nicht einmal den Blick von ihm abwenden. Ich war nur noch Beute, ein stummes Kaninchen, gestellt und in die Enge getrieben. Ich würde sterben. Er fasste den Beutel mit Samenkörnern ins Auge, die ich den ganzen Morgen über gesammelt hatte. In all der Hast, all dem Schrecken hatte ich ihn fallen lassen, und nun lagen die Körner zwischen den Felsen verstreut.
Der Junge riss den Kopf hoch, und das Getöse von Pferden und Rufen drang an mein Ohr.
»Hast du etwas gefangen?« Eine laute Stimme. Die, die Ama so hasste. Die, von der sie und die anderen nur flüsterten. Sie gehörte ihm. Dem, der Venda geraubt hatte.
»Sie sind in alle Richtungen auseinandergelaufen. Ich konnte sie nicht einholen!«, rief der Junge.
Noch eine entrüstete Stimme. »Und sie haben nichts zurückgelassen?«
Der Junge schüttelte den Kopf.
Weitere unzufriedene Rufe wurden laut, dann wieder das Donnern von Hufen. Fort. Sie ritten fort. Der Junge kletterte von seinem Felsen herunter und ging mit ihnen, ohne mich noch einmal anzuschauen oder mich anzusprechen; das Gesicht wandte er absichtlich ab, fast als würde er sich schämen.
Ich sah ihn zwei Jahre lang nicht wieder. Dass ich nur mit knapper Not entkommen war, hatte mir bleibende Angst eingeflößt, und ich entfernte mich nie mehr weit von meinem Stamm. Wenigstens nicht bis zu einem warmen Frühlingstag. Die Plünderer schienen weitergezogen zu sein. Seit den ersten Herbstfrösten hatten wir keine Spur mehr von ihnen gesehen.
Aber da war er wieder, einen Kopf größer nun; er versuchte gerade, Rohrkolben aus meinem Lieblingsteich zu ziehen. Sein Haar war noch wilder, seine Schultern ein wenig in die Breite gegangen, während sich seine Rippen noch immer zählen ließen. Ich sah, wie seine Enttäuschung wuchs, als die Stängel einer nach dem anderen abbrachen und er nur die unbrauchbaren Halme in den Händen hielt.
»Du bist zu ungeduldig.«
Er fuhr herum und zückte sein Messer.
Selbst im zarten Alter von zehn Jahren wusste ich, dass ich ein Risiko einging, indem ich mich zeigte. Ich war mir nicht sicher, warum ich es tat, vor allem als ich seine eisblauen Augen sah, ungezähmt und hungrig wie die eines Wolfs, in denen kein Zeichen des Erkennens zu sehen war.
»Zieh die Stiefel aus«, sagte ich. »Ich zeige es dir.«
Er stach in die Luft, als ich einen Schritt auf ihn zu machte, aber ich setzte mich auf den Boden und zog meine Kalbslederschuhe aus. Dabei ließ ich ihn keinen Moment aus den Augen, denn ich dachte, dass ich vielleicht doch noch würde weglaufen müssen.
Seine Angst schwand genau wie sein wilder, glasiger Blick, und endlich breitete sich ein Ausdruck des Erinnerns auf seinem Gesicht aus. Ich hatte mich in den beiden Jahren stärker verändert als er. Er ließ das Messer sinken.
»Du bist das Mädchen in den Felsen.«
Ich nickte und deutete auf seine Stiefel. »Weg damit. Du musst hineinwaten, wenn du an die Knollen kommen willst.«
Er zog die Stiefel von den Füßen und folgte mir, bis wir knietief im Teich standen. Ich sagte, er solle mit den Zehen tasten, sie tief in den Schlamm graben, um die fetten, fleischigen Knollen zu lockern, bevor er an den Stängeln zog. Unsere Zehen mussten genauso viel arbeiten wie unsere Hände. Wir wechselten nur wenige Worte. Was hatten sich ein Plünderer und ein Kind der Verbliebenen auch schon zu sagen? Alles, was wir gemeinsam hatten, war der Hunger. Aber er schien zu verstehen, dass ich mich für die Gnade bedanken wollte, die er mir gegenüber vor zwei Jahren hatte walten lassen.
Als wir uns trennten, war sein Beutel voller fleischiger Knollen.
»Das ist jetzt mein Teich«, sagte er scharf, während er den Beutel an seinem Sattel festband. »Komm nicht wieder her.« Er spuckte auf den Boden, um deutlich zu machen, dass er es ernst meinte.
Ich wusste, was er mir in Wahrheit sagen wollte. Die anderen würden jetzt auch hierherkommen. Es war nicht mehr sicher für mich.
»Wie heißt du?«, fragte ich, als er sich in den Sattel schwang.
»Du bist nichts!«, antwortete er, als hätte er eine andere Frage gehört. Er setzte sich zurecht, dann sah er mich widerstrebend an. »Jafir de Aldrid«, erwiderte er.
»Und ich bin …«
»Ich weiß, wer du bist. Morrighan.« Und er galoppierte davon.
Es dauerte weitere vier Jahre, bis ich ihn wiedersah, und während dieser ganzen Zeit fragte ich mich, woher er meinen Namen kannte.
Kapitel 2
Morrighan
ICHWARANDIESEMTAG argwöhnisch ins Lager zurückgekehrt. Es hatte den Anschein, als würde mir die Angst im Blut liegen. Sie sorgte dafür, dass meine Sinne geschärft blieben, aber schon mit zehn Jahren war ich ihrer müde. Von Kindesbeinen an hatte ich gewusst, dass wir anders waren. Das war es, was uns überleben half. Aber es bedeutete auch, dass den anderen nur wenig entging, nicht einmal das Verborgene und Ungesagte. Ama, Rhiann, Carys, Oni und Nedra waren diejenigen, bei denen das Wissen am stärksten war. Und Venda, aber sie war nun fort. Wir erwähnten sie nicht mehr.
Ama sprach, ohne den Blick von dem Korb mit den Bohnen abzuwenden. Ihr grauschwarzes Haar war ordentlich zu einem Zopf zurückgebunden. »Pata hat mir erzählt, dass du das Lager verlassen hast, während ich fort war.«
»Nur bis zum Teich hinter der Felswand, Ama. Ich bin nicht weit weg gegangen.«
»Weit genug. Ein Plünderer braucht nur einen Augenblick, um dich zu schnappen.«
Wir hatten dieses Gespräch schon viele Male geführt. Die Plünderer waren grausam und rücksichtslos, Diebe und Wilde, die anderen die Früchte ihrer Arbeit raubten. Und manchmal waren sie auch Mörder, je nach Laune. Wir versteckten uns in den Hügeln und Ruinen, liefen lautlos, sprachen leise, wo die Mauern einer leeren Welt uns Deckung gaben. Und wo die Mauern zu Staub zerfallen waren, verbargen wir uns im hohen Gras.
Aber manchmal genügte selbst das nicht.
»Ich habe aufgepasst«, flüsterte ich.
»Was hat dich denn an den Teich getrieben?«, fragte sie.
Meine Hände waren leer – ich hatte nichts als Grund für meinen Ausflug vorzuweisen. Nachdem Jafir davongeritten war, war auch ich gegangen. Ich konnte Ama nicht anlügen. In ihren Worten lagen genauso viele Fragen wie in ihrem Schweigen. Sie wusste es.
»Ich habe einen Plündererjungen gesehen. Er hat Rohrkolben ausgerissen.«
Ihr Blick flog zu mir. »Du hast doch nicht –«
»Er heißt Jafir.«
»Du kennst seinen Namen? Du hast mit ihm gesprochen?« Ama sprang auf, sodass die Bohnen von ihrem Schoß fielen. Zuerst packte sie mich an den Schultern, dann strich sie mir das Haar zurück und musterte prüfend mein Gesicht. Auf der Suche nach Verletzungen fuhr sie hektisch mit den Händen über meine Arme. »Geht’s dir gut? Hat er dir wehgetan? Hat er dich angefasst?« Ihre Augen waren groß vor Angst.
»Ama, er hat mir nichts getan«, erwiderte ich fest, um ihr die Sorge zu nehmen. »Er hat nur gesagt, dass ich nicht mehr zum Teich gehen soll. Dass es jetzt sein Teich ist. Und dann ist er mit einem Beutel Knollen davongeritten.«
Ihr Gesicht wurde hart. Ich wusste, was sie jetzt dachte – Sie nehmen sich alles –, und es stimmte. Das taten sie. Immer wenn wir uns am anderen Ende eines Tals oder einer Wiese eingerichtet hatten, fielen sie über uns her, raubten uns aus und verbreiteten Angst und Schrecken. Ich ärgerte mich inzwischen selbst darüber, dass ich Jafir gezeigt hatte, wie man die Knollen erntete. Wir schuldeten den Plünderern gar nichts, denn sie hatten uns schon so viel genommen.
»War es schon immer so, Ama? Gehören sie nicht auch zu den Verbliebenen?«
»Es gibt zwei Sorten von Überlebenden – die einen, die beharrlich weitermachen, und die anderen, die Beute machen.«
Sie ließ den Blick über den Horizont schweifen, und ihre Brust hob sich in einem müden Atemzug. »Komm, hilf mir, die Bohnen aufzusammeln. Morgen brechen wir in ein anderes Tal auf. Eines, das weit weg ist.«
Es gab kein Tal, das weit genug von den Plünderern entfernt war. Sie vermehrten sich so zahlreich wie Kletten, die sich im Gras versteckten.
Nedra, Oni und Pata murrten, sagten aber nichts weiter dazu. Sie fügten sich Ama, weil sie die Älteste und das Oberhaupt unseres Stammes war und die Einzige unter uns, die sich noch an die Zeit früher, das Davor, erinnerte. Außerdem waren wir es gewohnt, weiterzuziehen, und nach einem friedlichen Tal des Überflusses zu suchen. Irgendwo musste es eines geben. Ama hatte das gesagt. Sie hatte es mit ihren eigenen Augen gesehen, bevor die Grundfesten der Welt erschüttert worden und die Sterne vom Himmel gefallen waren. Irgendwo musste es einen Ort geben, an dem wir vor ihnen sicher waren.
Kapitel 3
Jafir
ICHWISCHTEMIRDASBLUT von der Nase und hütete mich, mein Messer zu zücken – aber ich würde nicht immer einen Kopf kleiner sein als Steffan. Auch er schien das zu wissen. Ich bekam seinen Handrücken in letzter Zeit seltener zu spüren.
»Du warst den ganzen Tag weg und hast nur einen Beutel voller Unkraut vorzuweisen?!«, schrie er.
Piers zog an seiner Pfeife, während er Steffans Vorstellung zusah. »Das ist mehr, als du vorzuweisen hast.«
Die anderen lachten; sie hofften, die Beleidigung würde Steffan zu einer wütenden Prügelei verleiten, doch er tat Piers’ Bemerkung mit einer verächtlichen Handbewegung ab. »Ich kann nicht jeden Tag ein Spanferkel heimbringen. Wir müssen alle etwas beitragen.«
»Du hast das Schwein gestohlen. Fünf Minuten Anstrengung«, entgegnete Piers.
»Was willst du von mir, alter Mann? Es hat dich doch satt gemacht, oder?«
Liam schnaubte. »Mich nicht. Du hättest zwei stehlen sollen.«
Fergus warf einen Stein und sagte, sie alle sollten still sein. Er hatte Hunger.
So ging es jeden Abend – in unserem Lager drohten ständig hitzige Worte und Fäuste zu fliegen, doch wir schenkten uns gegenseitig auch Kraft. Wir waren stark. Aus Angst vor den Folgen vermieden es alle anderen, sich mit unserer Sippe anzulegen. Wir hatten Pferde. Wir hatten Waffen. Wir hatten uns das Recht erstritten, andere kleinzuhalten.
Laurida winkte mich heran, und ich leerte meinen Beutel vor ihr aus. Wir beide begannen, die zarten Knollen aufzuschneiden, dann schälten wir die harten Stängel. Ich hatte gewusst, dass sie zufrieden sein würde.
Sie bevorzugte die grünen Sprossen – sie briet sie in Schweinefett und mahlte die längeren Stängel zu Mehl. Brot war eine Seltenheit für uns – es sei denn, wir stahlen es ebenfalls.
»Wo hast du sie gefunden?«, fragte Laurida.
Ich sah sie verwundert an. »Was gefunden?«
»Die hier?« Sie hielt eine Handvoll kleingeschnittene Stängel hoch. »Was ist denn mit dir los? Hat dir die Sonne das Hirn ausgedörrt?«
Die Stängel. Natürlich. Nichts anderes meinte sie. »In einem Teich. Warum ist das so wichtig?«, blaffte ich zurück.
Sie versetzte mir einen Schlag auf den Hinterkopf, dann beugte sie sich vor, um meine blutige Nase zu untersuchen. »Er wird sie dir eines Tages noch brechen«, knurrte sie. »Besser so. Du bist sowieso zu hübsch.«
Der Teich war bereits vergessen. Ich konnte ihnen nicht sagen, dass das Mädchen vom Teich mich heute ohne jede Vorwarnung überrumpelt hatte, und nicht andersherum. Ich hätte mehr als eine blutige Nase davongetragen. Es war eine Schande, sich überraschen zu lassen, besonders von ihresgleichen. Ihresgleichen war dumm. Langsam. Schwach. Das Mädchen hatte seine Dummheit bewiesen, indem es mir zeigte, wie ich ihm das Essen wegnehmen konnte.
Am nächsten Tag kehrte ich an den Teich zurück, aber diesmal verbarg ich mich hinter einigen Felsen, um auf sie zu warten. Ich hielt Ausschau nach den weichen Wellen ihres dunklen Haars. Nach einer Stunde watete ich ins Schilf, um die Rohrkolben zu ernten, weil ich dachte, das würde sie aus ihrem Versteck locken. Doch ich täuschte mich. Vielleicht war sie nicht so dumm wie der Rest. Vielleicht beherzigte sie einfach nur meine Warnung. Ja, Jafir hatte ihr Angst eingejagt. Jetzt war es mein Teich. Jafirs Teich für immer und ewig.
Ich lud meinen Beutel aufs Pferd und ritt weiter nach Süden, um nach ihrem Lager Ausschau zu halten. Sie hatten keine Pferde, dafür hatten wir gesorgt. Sie konnten nicht weit von dem Teich entfernt lagern, aber es fand sich keine Spur von ihr.
»Morrighan«, flüsterte ich, um auszuprobieren, wie sich ihr Name auf meiner Zunge anfühlte. »Mor-uh-guhn.«
Harik wusste nicht einmal, wie ich hieß. Er nannte mich bei jedem seiner Besuche bei einem anderen Namen. Aber er kannte den ihren. Warum sollte der größte Krieger des Landes den Namen eines mageren, schwachen Mädchens kennen? Noch dazu eines Mädchens von denen.
Wenn ich sie fand, würde ich sie dazu bringen, es mir zu sagen. Und dann würde ich ihr mein Messer an die Kehle halten, bis sie weinte und darum bettelte, dass ich sie gehen ließ. Genau wie es Fergus und Steffan mit den Stammesleuten machten, die Essen vor uns versteckten.
Von einem Hügel aus sah ich über die leeren Täler, in denen nur der Wind übers Gras strich.
Das Mädchen verbarg sich gut. Die nächsten vier Jahre fand ich sie nicht wieder.
Kapitel 4
Morrighan
»HIER«, SAGTEPATA. »Das ist ein guter Platz.«
Ein gewundener Pfad hatte uns hierhergebracht, einer, dem man nicht leicht folgen konnte, ein Pfad, den zu finden ich geholfen hatte. Das Wissen schlug Wurzeln in mir und wurde stärker.
Ama betrachtete das Dickicht aus Bäumen. Sie suchte die schiefen Ruinen nach einem potenziellen Unterschlupf ab und nahm die Hügel und felsigen Klippen, die uns vor fremden Blicken verbargen, in Augenschein. Aber vor allem betrachtete sie den Stamm. Alle waren müde. Alle hatten Hunger. Alle trauerten. Rhiann war von der Hand eines Plünderers gestorben, als sie sich geweigert hatte, das Zicklein in ihren Armen loszulassen.
Ama sah wieder in das kleine Tal und nickte. Ich konnte den Herzschlag des Stammes so deutlich hören wie sie. Sein Takt war schwach. Es tat weh.
»Hier«, nickte Ama, und die Stammesmitglieder legten ihre Bündel ab.
Ich besah mir unser neues Heim, wenn man es denn so nennen konnte. Die Gebäude befanden sich in einem erbärmlichen Zustand. Sie waren hauptsächlich aus Holz gebaut und durch Vernachlässigung, den Lauf der Jahrzehnte und natürlich den großen Sturm dem Verfall preisgegeben. Sie konnten jederzeit zusammenbrechen – die meisten hatten das schon getan –, aber wir konnten aus den Trümmern unsere eigenen Unterstände bauen. Wir konnten uns ein Dach über dem Kopf schaffen, das länger als ein paar Tage hielt. Ich hatte es nie anders gekannt, war immer weitergezogen, aber ich wusste, dass es eine Zeit geben würde, in der die Menschen bleiben konnten, wo sie waren; eine Zeit, in der es einen Ort gab, an den man für immer gehörte. Ama hatte es mir erzählt, und manchmal träumte ich mich dorthin. Ich träumte mich an Orte, die ich noch nie gesehen hatte, in gläserne Türme, von Wolken bekrönt, in ausgedehnte Obstgärten mit roten Früchten, in warme, weiche Betten, umgeben von Fenstern mit Vorhängen.
Dies waren die Orte, die Ama in ihren Geschichten beschrieb, Orte, an denen alle Kinder des Stammes Prinzen und Prinzessinnen mit immer vollen Mägen wären. Es war eine längst vergangene Welt von früher.
Im letzten Monat, seit Rhianns Tod, waren wir nirgends länger als einen Tag oder zwei geblieben. Immer wieder nahmen uns Plündererbanden das Essen ab und jagten uns dann davon. Der Zusammenstoß, den Rhiann mit ihnen gehabt hatte, war der schlimmste gewesen. Wir waren wochenlang unterwegs gewesen und hatten nur wenig Nahrung gesammelt. Der Süden hatte sich als gefährlicher als der Norden erwiesen, im Osten herrschte Harik, und sein Herrschaftsbereich wurde jeden Tag größer. Im Westen, jenseits der Berge, lauerte noch immer das Übel des Sturms, und dahinter streiften wilde Tiere umher. Wie wir waren auch sie hungrig und fielen über jeden her, der dumm genug war, sich dorthin zu verirren. Zumindest war es das, was man mir gesagt hatte – niemand, den ich kannte, hatte die trostlosen Berge je überquert. Wir wurden von allen Seiten bedrängt und waren immer auf der Suche nach einem verborgenen Winkel, in dem wir uns niederlassen konnten. Wenigstens hatten wir uns. Wir rückten enger zusammen, um die Lücke zu füllen, die Rhiann hinterlassen hatte.
Und auch die Lücke, die Venda hinterlassen hatte. Ich war sechs, als sie fortgegangen war. Pata sagte, sie habe vom Sturmstaub die Nase voll gehabt. Oni sagte, sie sei neugierig