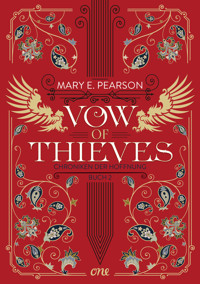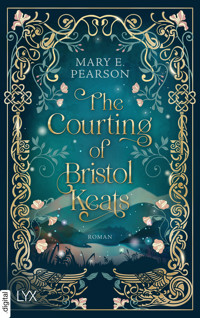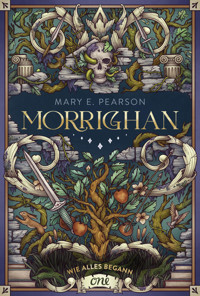Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken der Verbliebenen
- Sprache: Deutsch
Sie befahl, und das Licht gehorchte. Auf einen Wink von ihr fielen Sonne, Mond und Sterne auf die Knie und erhoben sich wieder. Es war einmal eine Prinzessin, mein Kind, und die ganze Welt lag ihr zu Füßen ...
Blonde Locken, ein warmer Blick, freundlich - der eine. Dunkle Augen, braungebrannt, ein beunruhigendes Lächeln - der andere. Gleich zwei Männer sind es, die Lias Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Es ist der erste Abend, an dem Lia als Schankmädchen in der Taverne arbeitet. Dabei ist sie eigentlich eine Prinzessin. Doch sie ist auf der Flucht, weggelaufen von zu Hause, weil sie sich nicht auf die Ehe mit einem Prinzen einlassen wollte, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Was sie nicht ahnt: Einer der beiden Männer ist der Prinz, gegen den sie sich entschieden hat. Und der andere ein Mörder, losgeschickt, um Lia zu töten. Während Lia sich zu beiden hingezogen fühlt, ahnt sie nicht, dass sie längst in größter Gefahr schwebt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Karte
Gaudrels Vermächtnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Danksagung
Weitere Titel der Autorin
Morrighan. Wie alles begann
Das Herz des Verräters
(Die Chroniken der Verbliebenen 2)
Der Glanz der Dunkelheit
(Die Chroniken der Verbliebenen 3)
Der Klang der Täuschung
Der Ruf der Rache
MARY E. PEARSON
DIE CHRONIKENDER VERBLIEBENEN
Übersetzung aus dem amerikanischen Englischvon Barbara Imgrund
Vollständige Hardcoverausgabeder bei one by lübbe 2017 erschienenen Hardcoverausgabe
Titel der englischsprachigen Originalausgabe:»The Remnant Chronicles. Kiss of Deception«
Für die Originalausgabe: Copyright © 2014 by Mary E. PearsonPublished by arrangement with Mary E. Pearson
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG, Köln Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Julia Przplaska, IngolstadtUmschlaggestaltung: © Sabine Dunst | Guter Punkt, MünchenUmschlagmotiv: Lydia Blagden © Hodder & Stoughton 2022;Satz: two-up, Düsseldorf
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4121-8
Sie finden uns im Internet unter one-verlag.de
Bitte beachten Sie auchluebbe.de
Für den Jungen, der sein Glück beim Schopf packte.Für den Mann, der es festhielt.
Das Ende der Reise. Das Versprechen. Die Hoffnung.
Erzähl mir noch einmal davon, Ama. Erzähl mir von dem Licht.
Ich durchforste mein Gedächtnis nach einem Traum. Einer Geschichte. Einer verschwommenen Erinnerung.
Ich war jünger als du, Kind.
Die Grenze zwischen Wahrheit und Überleben löst sich auf. Die Not. Die Hoffnung. Meine eigene Großmutter, die mir Geschichten erzählte, um mich satt zu kriegen, weil es nichts anderes gab. Ich betrachte dieses kleine Mädchen. So spindeldürr. Nicht einmal im Traum weiß sie, was ein voller Magen ist. Und dennoch ist sie voller Hoffnung. Voller Erwartung. Ich ergreife sie an den dünnen Armen und ziehe ihren federleichten Leib auf meinen Schoß.
Es war einmal eine Prinzessin, mein Kind, die war nicht größer als du. Die ganze Welt lag ihr zu Füßen. Ein Befehl von ihr, und das Licht gehorchte. Ein Wink von ihr, und Sonne, Mond und Sterne fielen auf die Knie und erhoben sich wieder. Es war einmal …
Vorbei. Nun ist da nur noch dieses Kind mit den goldenen Augen in meinen Armen. Das ist es, was zählt. Das und das Ende der Reise. Das Versprechen. Die Hoffnung.
Komm, mein Kind. Es wird Zeit zu gehen.
Bevor die Plünderer kommen. Das, was überdauert. Das, was bleibt. Das, was ich ihr nicht zu sagen wage.
Ich erzähle dir mehr, wenn wir laufen. Über das, was davor war.Es war einmal …
Gaudrels Vermächtnis
Kapitel 1
HEUTEWARDER TAG, an dem tausend Träume sterben mussten und ein einziger geboren wurde.
Der Wind wusste es. Es war der erste Juni, aber kalte Böen verbissen sich so heftig wie im tiefsten Winter in die Festung oben auf dem Hügel. Sie rüttelten fluchend an den Fenstern und fuhren mit warnendem Raunen durch zugige Hallen. Es gab kein Entrinnen vor dem, was kommen sollte.
Unaufhaltsam rückte die Stunde näher. Ich verschloss die Augen vor diesem Gedanken, doch ich wusste genau, dass der Tag bald in zwei Teile zerfallen würde. Für immer würde er mein Leben in ein Davor und ein Danach aufspalten, und zwar mit einem raschen Handstreich, an dem ich ebenso wenig etwas würde ändern können wie an der Farbe meiner Augen.
Ich stieß mich vom Fenster ab, in meine eigene Atemwolke gehüllt, und überließ die endlosen Hügel von Morrighan ihren eigenen Sorgen. Es wurde Zeit, mich meinem großen Tag zu stellen.
Die Zeremonien liefen ab, wie es bestimmt war, und die rituellen Handlungen waren haargenau so vorbereitet, wie es geschrieben stand – als Vermächtnis der Größe Morrighans und der Verbliebenen, der das Königreich entsprungen war. Ich wehrte mich nicht. Zu diesem Zeitpunkt war ich längst wie betäubt, aber dann kam der Mittag, und mein Herz raste wieder, als ich dem letzten jener Schritte ins Auge blickte, der das Hier vom Dort trennte.
Ich lag nackt mit dem Gesicht nach unten auf einem steinharten Tisch, den Blick auf den Boden unter mir gerichtet, während Fremde mit stumpfen Messern über meinen Rücken schabten. Ich verharrte absolut reglos, obwohl ich wusste, dass die Messer, die über meinen Rücken strichen, von umsichtigen Händen geführt wurden. Jenen, welchen sie gehörten, war sehr wohl bewusst, dass ihr Leben von ihrer Geschicklichkeit abhing. Absolute Bewegungslosigkeit half mir, die Scham über meine Blöße zu verbergen, während mich diese fremden Hände berührten.
Pauline war immer in der Nähe geblieben und beobachtete uns wahrscheinlich mit besorgtem Blick. Ich konnte sie nicht sehen, sondern nur den Schieferboden unter mir. Mein langes dunkles Haar hing in einem wirbelnden schwarzen Tunnel rund um mein Gesicht herab und blendete die ganze Welt aus – abgesehen von dem rhythmischen Kratzen der Messer.
Das letzte Messer fuhr tiefer an meinem Rücken hinab und schabte über die zarte Kuhle genau über meinem Gesäß. Ich kämpfte gegen den Impuls an zurückzuschrecken, doch schließlich zuckte ich doch. Ein kollektives Stöhnen lief durch den Raum.
»Lieg still!«, mahnte meine Tante Cloris.
Ich spürte die Hände meiner Mutter an meinem Kopf; sie liebkosten mich sanft. »Nur noch ein paar Linien, Arabella. Das ist alles.«
Obwohl ihre Worte als Trost gemeint waren, sträubte sich alles in mir gegen meinen offiziellen Namen, auf dessen Verwendung meine Mutter pochte – jenen ererbten Namen, den schon so viele vor mir getragen hatten. Ich wünschte, dass sie wenigstens an meinem letzten Tag in Morrighan alle Förmlichkeit fahren lassen und den Namen benutzen würde, den ich bevorzugte. Den Kosenamen, den meine Brüder gebrauchten und der einen meiner vielen Namen auf seine letzten drei Buchstaben abkürzte. Lia. Ein einfacher Name, der wirklich zu mir passte.
Das Schaben endete. »Es ist vollbracht«, erklärte der Erste Künstler. Die anderen murmelten zustimmend.
Ich hörte das Klappern eines Tabletts, das auf dem Tisch neben mir abgestellt wurde und den überwältigenden Duft von Rosenöl verströmte. Füße schlurften umher und fanden sich in einem Kreis zusammen – meine Tanten, Mutter, Pauline, andere, die bestellt worden waren, um dem Ritus beizuwohnen. Murmelnd wurden Gebete gesungen. Ich beobachtete, wie die schwarze Robe des Priesters an mir vorüberzog, dann erhob sich seine Stimme über die anderen, während er warmes Öl auf meinen Rücken träufelte. Die Künstler rieben es ein, wodurch ihre geübten Finger die zahllosen Traditionen des Hauses Morrighan versiegelten. Sie fixierten jene Versprechen, welche auf meinen Rücken geschrieben worden waren. Diese wiederum kündeten von den Verbindlichkeiten des heutigen Tages und versicherten, dass sie auch an jedem kommenden Tag gelten würden.
Sie sind voller Hoffnung, dachte ich bitter, während mein Verstand die geordneten Bahnen verließ und die anstehenden Aufgaben zu ordnen versuchte – jene Aufgaben, die nur in mein Herz und nicht auf ein Stück Papier geschrieben waren. Ich hörte kaum, was der Priester von sich gab. In einem monotonen Singsang sprach er von ihrer aller Bedürfnissen, aber nicht von meinen.
Ich war erst siebzehn. Hatte ich denn kein Recht auf meine eigenen Träume für die Zukunft?
»Und für Arabella Celestine Idris Jezelia, Erste Tochter des Hauses Morrighan, die Früchte ihres Opfers und die Segnungen des …«
Er schwadronierte weiter und weiter, und bei den endlosen vorgeschriebenen Segnungen und Sakramenten schwoll seine Stimme immer mehr an, bis sie den ganzen Raum beherrschte. Als ich schon dachte, ich könnte es nicht mehr ertragen, weil seine Worte mir die Luft abschnürten, hielt er inne. Einen gnädigen, süßen Augenblick lang erfüllte nichts als Stille meine Ohren. Ich holte wieder Luft, und dann wurde der Schlusssegen erteilt.
»Denn die Königreiche erstanden aus der Asche der Menschen und wurden aus den Knochen der Verlorenen errichtet, und dorthin werden wir zurückkehren, wenn der Himmel es will.« Er hob mein Kinn mit einer Hand, und mit dem Daumen der anderen bestrich er meine Stirn mit Asche.
»So geschehe es dieser Ersten Tochter des Hauses Morrighan«, vollendete meine Mutter, wie es die Tradition verlangt, und wischte die Asche mit einem ölgetränkten Lappen ab.
Ich schloss die Augen und senkte den Kopf. Erste Tochter. Segen und Fluch zugleich. Und wenn die Wahrheit ans Licht kam, war ich auch eine Betrügerin.
Meine Mutter legte mir eine Hand auf die Schulter. Meine Haut brannte unter ihrer Berührung. Ihr Trost kam zu spät. Der Priester sprach ein letztes Gebet in ihrer Muttersprache, ein Schutzgebet, das seltsamerweise nicht Tradition war. Als er zum Ende gekommen war, zog sie die Hand wieder weg.
Es wurde noch mehr Öl vergossen, und ein leiser, spukhafter Gebetssingsang hallte durch die kalte Steinkammer, während der Rosenduft schwer in der Luft und in meinen Lungen lastete. Ich atmete tief durch. Trotz meiner Lage genoss ich diesen Teil – das heiße Öl und die warmen Hände, die Knoten weich massierten, welche sich seit Wochen in meinem Rücken verhärtet hatten. Die samtige Wärme nahm der mit Zitrone angemischten Farbe die saure Schärfe, und der blumige Duft entführte mich für einen Augenblick in einen verborgenen Sommergarten, in dem mich niemand finden würde. Wenn es nur so einfach wäre.
Aber auch dieser Schritt wurde für vollbracht erklärt, und die Künstler traten von ihrem Werk zurück. Geräuschvolles Luftholen erklang, als das Ergebnis auf meinem Rücken zur Begutachtung freigegeben wurde.
Ich hörte jemanden näher rücken. »Ich könnte mir vorstellen, dass er ihrem Rücken gar nicht besonders lange Beachtung schenken wird, wenn er den ganzen Rest sehen kann.« Ein Kichern lief durch die Kammer. Tante Bernette hatte noch nie ein Blatt vor den Mund genommen, nicht einmal wenn ein Priester im Raum und ein Protokoll einzuhalten war. Mein Vater behauptete, ich hätte meine vorlaute Zunge von ihr, obwohl ich heute ermahnt worden war, sie zu zügeln.
Pauline nahm meinen Arm und half mir beim Aufstehen. »Eure Hoheit«, sagte sie, als sie mich in ein weiches Laken hüllte, um das letzte bisschen Würde, das mir noch blieb, zu bewahren. Wir wechselten einen raschen, wissenden Blick, der mir Kraft gab, dann führte sie mich zu dem großen Spiegel und reichte mir einen kleinen Handspiegel, damit auch ich das Ergebnis betrachten konnte. Ich strich mein Haar zur Seite und ließ das Laken so weit fallen, dass ich bis auf meinen unteren Rücken sah.
Die anderen erwarteten schweigend meine Reaktion. Ich unterdrückte den Drang, nach Luft zu schnappen. Diese Genugtuung wollte ich meiner Mutter nicht gönnen, aber ich konnte nicht leugnen, dass mein Hochzeitskavah vorzüglich gelungen war. Es versetzte mich tatsächlich in Ehrfurcht.
Sogar das hässliche Wappen des Königreichs Dalbreck war erstaunlich schön geworden: Der knurrende Löwe auf meinem Rücken war gezähmt, und komplizierte Muster fassten anmutig seine Klauen ein; die verschlungenen Reben Morrighans umrankten ihn elegant und ergossen sich in einem V meinen Rücken herab, bis die letzten zarten Verästelungen sich wirbelnd an die sanfte Ausbuchtung meines unteren Rückens schmiegten. Dem Löwen war Ehre zuteilgeworden, und doch hatte man ihn auf kluge Weise gebändigt.
Es schnürte mir die Kehle zu, und meine Augen begannen zu brennen. Es war ein Kavah, das mir hätte gefallen können … Ich hätte stolz sein müssen, es tragen zu dürfen, doch nun schluckte ich und stellte mir vor, wie der Prinz ehrfürchtig glotzen würde, wenn die Gelübde gesprochen waren und der Hochzeitsumhang fiel. Die lüsterne Kröte. Aber ich zollte den Künstlern den verdienten Respekt.
»Es ist vollkommen. Ich danke euch, und ich habe keinen Zweifel daran, dass im Königreich Dalbreck vom heutigen Tag an die Künstler von Morrighan in höchstem Ansehen stehen werden.« Meine Bemühungen entlockten meiner Mutter ein Lächeln, denn sie wusste, wie hart ich mir diese Worte abgerungen hatte.
Nun wurden alle Außenstehenden hinausgeleitet, sodass ich die restlichen Vorbereitungen nur noch mit meinen Angehörigen und Pauline teilte, die mir assistieren würde. Meine Mutter holte das weiße Seidenunterkleid aus dem Kleiderkasten; es war nur ein Hauch von Stoff und so dünn und fließend, dass es über ihre Arme zu schmelzen schien. In meinen Augen war es bloß eine nutzlose Formalität, denn es bedeckte nur sehr wenig und war so hilfreich wie die unaufhörlichen Schichten von Traditionen. Das Brautkleid kam als Nächstes; ein V-förmiger Rückenausschnitt sollte dem Kavah zu Ehren des Königreichs des Bräutigams einen würdigen Rahmen geben und aller Welt die neue Gefolgschaftspflicht seiner Braut verdeutlichen.
Meine Mutter straffte die verborgenen Schnürbänder des Kleides und zog sie zusammen, sodass sich das Mieder eng an meine Taille schmiegte, obwohl der Rücken unbedeckt war. Es war eine ebenso bemerkenswerte technische Glanzleistung wie die große Brücke von Golgata – vielleicht sogar eine noch bemerkenswertere. Unwillkürlich fragte ich mich, ob die Näherinnen mit ein wenig Magie in Stoff und Garn nachgeholfen hatten. Es war besser, über Nebensächlichkeiten wie diese nachzudenken als darüber, was die nächsten Stunden bringen würden. Meine Mutter drehte mich feierlich zum Spiegel um.
Trotz meines Grolls war ich wie hypnotisiert. Es war zweifellos das schönste Kleid, das ich jemals gesehen hatte. Die atemberaubende blickdichte Quiassé-Spitze, handgefertigt von einheimischen Klöpplerinnen, war die einzige Verzierung. Sie floss den Ausschnitt und das Mieder hinab. Schlichtheit. Die Spitze fiel in einem V, um den Schnitt des Kleides am Rücken widerzuspiegeln. Ich sah darin wie jemand anders aus, wie jemand, der älter und klüger war. Wie jemand mit einem reinen Herzen, dem Geheimnisse fremd waren. Wie jemand … der nicht ich war.
Ich wandte mich wortlos ab und blickte aus dem Fenster, verfolgt vom leisen Seufzen meiner Mutter. In weiter Ferne sah ich die einsame rote Turmspitze von Golgata; die bröckelnden Ruinen waren alles, was von der einstmals mächtigen Brücke über den breiten Meeresarm übrig geblieben war. Bald würden auch sie verschwunden sein, verschluckt wie der Rest der großen Brücke. Selbst die geheimnisvolle Ingenieurskunst der Altvorderen konnte dem Unausweichlichen nicht die Stirn bieten. Warum sollte ausgerechnet ich es versuchen?
Mein Magen schlug einen Purzelbaum, und ich ließ den Blick zum Fuße des Hügels schweifen, wo Fuhrwerke weit unterhalb der Festung auf der Straße zum Marktplatz dahinrumpelten. Vielleicht waren sie mit Obst oder Blumen beladen oder mit Fässern voll Rebensaft aus den Weinbergen Morrighans. Aber auch prächtige Kutschen, die von bändergeschmückten Rössern gezogen wurden, sprenkelten die Fahrspur.
Vielleicht fuhren mein ältester Bruder Walther und seine frisch angetraute Frau Greta in einer dieser Kutschen meiner Hochzeit entgegen, Händchen haltend und nur selten fähig, den Blick voneinander abzuwenden. Und vielleicht waren meine übrigen Brüder bereits auf dem Platz und warfen jungen Mädchen, die ihre Fantasie beflügelten, ihr strahlendstes Lächeln zu. Mir fiel Regan ein, der vor einigen Tagen mit verträumten Augen in einem dunklen Korridor mit der Kutscherstochter geflüstert hatte, und Bryn, der jede Woche mit einem neuen Mädchen schäkerte und nicht in der Lage war, sich für ein einziges zu entscheiden. Drei ältere Brüder, die ich vergötterte, und sie alle durften sich in eine Person ihrer Wahl verlieben und sie heiraten. Die Mädchen waren ebenso frei. Alle waren frei, auch Pauline, deren Liebhaber am Ende des Monats zu ihr zurückkehren würde.
»Wie hast du das geschafft, Mutter?«, fragte ich, während ich weiter auf die vorüberfahrenden Kutschen unter mir starrte. »Wie konntest du den weiten Weg von Gastineux hierherreisen, um eine Kröte zu heiraten, die du nicht geliebt hast?«
»Dein Vater ist keine Kröte«, sagte meine Mutter streng.
Ich fuhr zu ihr herum. »Er mag ein König sein, aber das ändert nichts an der Kröte. Willst du mir etwa weismachen, du hättest den Fremden, der doppelt so alt war wie du, nicht für eine Kröte gehalten, als du ihn geheiratet hast?«
Die grauen Augen meiner Mutter ruhten gefasst auf mir. »Nein, das habe ich nicht. Es war mein Schicksal und meine Pflicht.«
Ein mattes Seufzen entrang sich meiner Brust. »Weil du eine Erste Tochter warst.«
Das Thema Erste Tochter war eines, das meine Mutter stets klug umschiffte. Aber heute waren da nur wir beide und nichts, was uns hätte ablenken können – heute entkam sie ihm nicht. Ich sah, wie sie erstarrte und das Kinn in königlicher Manier hob. »Es ist eine Ehre, Arabella.«
»Aber mir wurde die Gabe der Ersten Tochter nicht zuteil. Ich bin keine Siarrah. Dalbreck wird bald herausfinden, dass ich nicht der Hauptgewinn bin, für den sie mich halten. Diese Hochzeit ist ein Schwindel.«
»Die Gabe zeigt sich vielleicht noch rechtzeitig«, antwortete sie lahm.
Ich wollte nicht dagegenhalten. Es war bekannt, dass die Gabe zu den meisten Ersten Töchtern kam, wenn sie zur Frau wurden, und bei mir war es nun schon seit vier Jahren so weit. Anzeichen für eine wie auch immer geartete Gabe hatte ich jedoch nie offenbart. Meine Mutter klammerte sich an falsche Hoffnungen. Ich wandte mich um und sah wieder aus dem Fenster.
»Und selbst wenn sie sich nicht zeigt«, fuhr meine Mutter fort, »ist die Hochzeit kein Schwindel. Bei dieser Verbindung geht es um viel mehr als nur das. Schon allein die Ehre und das Privileg einer Ersten Tochter in einer königlichen Blutlinie ist eine Gabe. Sie bringt Geschichte und Tradition mit sich. Das ist alles, was zählt.«
»Warum die Erste Tochter? Ist es nie ein Sohn, dem die Gabe geschenkt wird? Oder eine zweite Tochter?«
»Das ist schon vorgekommen, aber … man sollte nicht damit rechnen. Und es hat keine Tradition.«
Hat es denn auch Tradition, die Gabe wieder zu verlieren? Diese unausgesprochenen Worte hingen rasiermesserscharf zwischen uns, aber selbst ich konnte meine Mutter nicht so tief verletzen. Mein Vater hatte sich schon früh in ihrer Ehe nicht mehr mit ihr über Staatsangelegenheiten beraten, aber ich hatte Geschichten gehört, wie es davor gewesen war, als ihre Gabe noch stark war und ihr Wort Gewicht hatte; zumindest falls irgendetwas davon der Wahrheit entsprach. Ich war mir da nicht mehr so sicher.
Mir fehlte die Geduld für solches Geschwätz. Ich hielt meine Worte und mein Denken lieber geradlinig. Und ich war es so müde, wieder und wieder von Traditionen zu hören, dass ich meinte, mein Kopf müsse platzen, wenn dieses Wort noch ein einziges Mal laut ausgesprochen würde. Meine Mutter entstammte einer anderen Zeit.
Ich hörte, dass sie sich mir näherte, und spürte ihre warmen Arme, die sich um mich schlossen. Der Hals schwoll mir zu. »Meine geliebte Tochter«, flüsterte sie in mein Ohr, »ob die Gabe kommt oder nicht, ist nicht von Bedeutung. Mach dir keine Gedanken darüber. Heute ist der Tag deiner Hochzeit.«
Mit einer Kröte. Ich hatte einen Blick auf den König von Dalbreck erhascht, als er gekommen war, um die Vereinbarung aufzusetzen – als wäre ich ein Pferd, das er für seinen Sohn erstand. Der König war so altersschwach und krumm wie die gichtigen Zehen eines alten Weibs und alt genug, um der Vater meines eigenen Vaters zu sein. Gebückt und langsam, wie er ging, brauchte er Hilfe, um die Stufen zum Großen Saal hinauf zu erklimmen. Selbst wenn der Prinz auch nur einen Bruchteil seiner Jahre auf dem Buckel hatte, musste er immer noch ein vertrockneter, zahnloser Geck sein. Der Gedanke daran, dass er mich anfassen würde, ganz zu schweigen von …
Mich schauderte bei der Vorstellung von knochigen alten Händen, die meine Wange liebkosten, oder von schrumpeligen Lippen, die die meinen berührten. Ich hielt den Blick starr aus dem Fenster gerichtet, aber ich nahm nichts jenseits der Scheibe wahr. »Warum habe ich ihn mir vorher nicht einmal anschauen dürfen?«
Meine Mutter ließ die Arme sinken. »Einen Prinzen anschauen? Unsere Beziehung zu Dalbreck kann man bestenfalls ein zartes Pflänzchen nennen. Hättest du wirklich gewollt, dass wir ihr Königreich mit einer solchen Bitte beleidigen, während Morrighan hofft, eine bedeutende Allianz zu schmieden?«
»Ich bin kein Soldat in der Armee meines Vaters.«
Meine Mutter kam näher, strich mir über die Wange und flüsterte: »Doch, mein Liebling. Das bist du.«
Ein Schauer huschte über meinen Rücken.
Sie umarmte mich ein letztes Mal und trat zurück. »Es ist Zeit. Ich gehe den Hochzeitsumhang aus dem Gewölbe holen«, sagte sie und verließ den Raum.
Ich ging zum Schrank hinüber und riss die Türen auf; dann zog ich die unterste Schublade heraus und entnahm ihr ein grünes Samtsäckchen, in dem sich ein schmaler juwelenbesetzter Dolch befand. Er war ein Geschenk von meinen Brüdern zu meinem sechzehnten Geburtstag gewesen. Ein Geschenk, das ich nie hatte benutzen dürfen – jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit –, doch die Rückseite der Tür zu meinem Ankleidezimmer trug die Narben meiner heimlichen Übungen. Ich packte noch ein paar andere Habseligkeiten, wickelte sie in ein Hemd und verschnürte alles mit einem Band, damit nichts herausfallen konnte.
Pauline kehrte umgezogen zurück, und ich händigte ihr das kleine Paket aus.
»Ich kümmere mich darum«, sagte sie; diese Vorbereitungen in letzter Minute setzten ihr sichtlich zu und machten sie nervös. Sie verließ mein Gemach gerade, als meine Mutter mit dem Umhang kam.
»Worum kümmern?«, fragte meine Mutter.
»Ich habe ihr noch ein paar Dinge gegeben, die ich mitnehmen will.«
»Alles, was du brauchst, wurde gestern in Truhen fortgeschickt«, sagte sie, während sie quer durchs Zimmer auf mein Bett zuging.
»Ich hatte ein paar Sachen vergessen.«
Sie schüttelte den Kopf und erinnerte mich daran, dass der begrenzte Platz in der Kutsche kostbar war und dass die Reise nach Dalbreck lange dauern würde.
»Ich schaffe das schon«, entgegnete ich.
Sie breitete den Umhang sorgfältig auf meinem Bett aus. Er war im Gewölbe geplättet und aufgehängt worden, damit kein Fältchen seine Schönheit mindern konnte. Ich ließ meine Hand über den weichen Samt gleiten. Das Blau war so dunkel wie der Mitternachtshimmel, und die Rubine, Turmaline und Saphire entlang des Saums waren seine Sterne. Die Juwelen würden sich noch als nützlich erweisen. Es war Tradition, dass beide Elternteile gemeinsam der Braut den Umhang umlegten, doch meine Mutter war allein zurückgekehrt.
»Wo ist …«, begann ich, doch dann hörte ich eine Armee von Stiefeltritten durch den Korridor hallen. Mein Herz wurde noch schwerer, als es ohnehin schon war. Er kam nicht allein, nicht einmal heute. Mein Vater betrat das Gemach flankiert vom Lord Vizeregent auf der einen und dem Kanzler sowie dem Königlichen Gelehrten auf der anderen Seite; diverse Speichellecker aus seinem Ministerrat folgten ihnen auf dem Fuß. Ich wusste, dass der Vizeregent nur seines Amtes waltete. Kurz nach der Unterzeichnung der Dokumente hatte er mich beiseitegenommen und gesagt, dass er sich als Einziger gegen diese Ehe ausgesprochen hatte; aber letztendlich war er ein strenger Pflichtmensch wie alle anderen auch. Ich konnte vor allem den Gelehrten und den Kanzler nicht leiden, und das wussten sie ganz genau, aber ich fühlte mich deshalb nicht besonders schuldig, denn diese Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit. Immer wenn ich in ihrer Nähe war, bekam ich Gänsehaut. Gerade so, als wäre ich soeben über eine Wiese voller blutsaugender Zecken gelaufen. Sie freuten sich wahrscheinlich mehr als jeder andere, mich loszuwerden.
Mein Vater kam auf mich zu, küsste mich auf beide Wangen und trat wieder zurück, um mich zu betrachten und schließlich tief zu seufzen: »Genauso schön wie deine Mutter am Tag unserer Hochzeit.«
Ich fragte mich, ob diese ungewohnte Zurschaustellung von Gefühlen für unser Publikum bestimmt war. Augenblicke der Zuneigung zwischen meiner Mutter und meinem Vater erlebte ich nur äußerst selten, aber jetzt bemerkte ich, dass sein Blick von mir zu ihr schweifte und dort verharrte. Meine Mutter erwiderte ihn, und ich versuchte zu verstehen, was da zwischen ihnen in der Luft hing. Liebe? Oder Bedauern über die verlorene Liebe und darüber, was hätte sein können? Diese Ungewissheit füllte eine seltsame Lücke in mir, und hundert Fragen brannten mir auf den Lippen; doch unter den Augen des Kanzlers und des Gelehrten und der ungeduldigen Entourage widerstrebte es mir, auch nur eine einzige davon zu stellen. Vielleicht war dies die Absicht meines Vaters.
Der Zeitwächter, ein rundlicher Mann mit Froschaugen, zog seine ständig präsente Taschenuhr hervor. Er und die anderen scheuchten meinen Vater herum, als wären sie es, die das Reich regierten, und nicht er. »Die Zeit drängt, Eure Majestät«, mahnte er.
Der Vizeregent sandte mir einen teilnahmsvollen Blick, nickte aber zustimmend. »Wir wollen die königliche Familie von Dalbreck bei diesem bedeutsamen Anlass nicht warten lassen. Wie Ihr sehr wohl wisst, Eure Majestät, würde das nicht gut aufgenommen werden.«
Der Bann war gebrochen genau wie der Blick. Meine Mutter und mein Vater nahmen den Umhang auf, legten ihn mir um die Schultern und schlossen die Spange an meinem Hals. Dann schob mein Vater die Kapuze über meinen Kopf und küsste mich abermals auf jede Wange, diesmal allerdings viel zurückhaltender und auch nur, um dem Protokoll Genüge zu tun. »Du erweist heute dem Königreich Morrighan einen großen Dienst, Arabella.«
Lia.
Er hasste den Namen Jezelia, weil ihn vor mir noch niemand in der königlichen Linie getragen hatte – und auch niemand sonst, wie er ins Feld führte, doch meine Mutter hatte ohne jede Erklärung darauf bestanden. In diesem Punkt war sie unnachgiebig geblieben. Es war wahrscheinlich das letzte Mal gewesen, dass mein Vater einem Wunsch von ihr entsprochen hatte. Ich hätte nie davon erfahren, wenn Tante Bernette nicht gewesen wäre, und sogar sie behandelte das Thema, das noch immer ein wunder Punkt zwischen meinen Eltern war, mit größter Vorsicht.
Ich forschte in Vaters Gesicht. Die flüchtige Zärtlichkeit von eben war verschwunden, seine Gedanken wandten sich wieder Staatsangelegenheiten zu; doch in der Hoffnung auf mehr hielt ich seinem Blick stand. Es kam nichts. Ich hob das Kinn, um mich größer zu machen. »Ja, ich erweise dem Königreich einen großen Dienst, wie es meine Pflicht ist, Eure Majestät. Schließlich bin ich ein Soldat in Eurer Armee.«
Er runzelte die Stirn und sah fragend zu meiner Mutter. Sie schüttelte den Kopf, stumm darum bittend, meinen Worten keine Beachtung zu schenken. Mein Vater, der immer zuerst König und dann Vater war, ließ meine Bemerkung auf sich beruhen, denn wie immer waren andere Angelegenheiten wichtiger. Er drehte sich um, sagte, dass wir uns in der Abtei sehen würden, und verließ mit seiner Entourage den Raum, da er seine Pflichten für den Moment erfüllt hatte. Pflichten. Dieses Wort hasste ich genauso wie Tradition.
»Bist du bereit?«, fragte meine Mutter, als auch die anderen den Raum verlassen hatten.
Ich nickte. »Aber ich muss noch etwas Persönliches erledigen, bevor wir gehen. Wir treffen uns im unteren Saal.«
»Ich kann doch …«
»Bitte, Mutter …« Zum ersten Mal brach mir die Stimme. »Ich brauche nur ein paar Minuten.«
Sie gab nach, und ich lauschte dem Hall ihrer einsamen Schritte, während sie sich auf dem Gang entfernte.
»Pauline?«, flüsterte ich.
Pauline schlüpfte durch das Ankleidezimmer in meine Kammer. Wir blickten uns an; Worte waren nicht notwendig, da wir genau wussten, was vor uns lag – jede Einzelheit dieses Tages hatten wir bereits in einer langen, schlaflosen Nacht durchgespielt.
»Es ist noch nicht zu spät, deine Meinung zu ändern. Bist du dir sicher?«, fragte Pauline, um mir eine letzte Gelegenheit für einen Rückzieher zu geben.
Sicher? Meine Brust schnürte sich unter Schmerzen zusammen, Schmerzen, die so stark und echt waren, dass ich mich fragte, ob Herzen tatsächlich brechen können. Oder war es Angst, die mich quälte? Ich presste mir die Hand fest auf die Brust und versuchte, das Stechen zu lindern. Vielleicht war dies der Augenblick der Entscheidung. »Es gibt kein Zurück. Die Wahl wurde mir abgenommen«, antwortete ich. »Von diesem Moment an ist dies das Schicksal, mit dem ich leben muss, im Guten wie im Schlechten.«
»Ich bete, dass es im Guten sein möge.« Pauline nickte verständnisvoll.
Damit eilten wir den Gewölbegang entlang zum rückwärtigen Teil der Festung und dann die dunkle Dienstbotentreppe hinab. Wir begegneten niemandem – alle waren entweder unten in der Abtei mit Vorbereitungen beschäftigt oder warteten vor der Festung auf den königlichen Festzug zum großen Platz.
Wir traten durch eine kleine Holztür mit dicken schwarzen Scharnieren ins blendende Sonnenlicht; der Wind fuhr in unsere Kleider und riss mir die Kapuze vom Kopf. Mein Blick fiel auf das rückwärtige Festungstor, das nur für Jagden und heimliche Ausflüge benutzt wurde. Nun stand es wie befohlen offen. Pauline führte mich über einen schlammigen Sattelplatz zu der im Schatten liegenden Mauer des Kutschenhauses, wo ein Stallbursche mit weit aufgerissenen Augen und zwei gesattelten Pferden auf uns wartete. Seine Augen wurden noch größer, als ich näher kam. »Eure Hoheit, Ihr sollt die Kutsche nehmen, die schon bereitsteht.« Er verschluckte sich fast an den Worten, die nur so aus ihm heraussprudelten. »Sie wartet an der Treppe vor der Festung. Wenn Ihr …«
»Die Pläne haben sich geändert«, sagte ich fest. Ich raffte mein Brautkleid zusammen, damit ich den Fuß in den Steigbügel schieben konnte. Dem strohblonden Burschen fiel die Kinnlade herunter, als er mein einst so makelloses Kleid betrachtete. Der schlammbespritzte Saum beschmutzte jetzt auch meine Ärmel und das Spitzenmieder und – was wohl am schlimmsten war – den juwelenbesetzten Hochzeitsumhang.
»Aber …«
»Beeil dich! Deine Hand!«, herrschte ich ihn an und entriss ihm die Zügel. Er gehorchte und half Pauline aufs Pferd.
»Was soll ich ausrichten …«
Ich hörte nicht mehr, was er danach noch sagte, denn die trappelnden Pferdehufe stampften alle ausgesprochenen und unausgesprochenen Argumente in Grund und Boden. Einer Entscheidung folgend, die nie mehr ungeschehen zu machen war, die tausend Träume beendete und einen einzigen gebar, galoppierte ich mit Pauline an meiner Seite auf die Deckung des Waldes zu. Ich sah nicht ein einziges Mal zurück.
Damit wir die Geschichte nicht wiederholen,sollen die Geschichten weitererzählt werden,vom Vater auf den Sohn, von der Mutter auf die Tochter,denn innerhalb einer einzigen Generationgehen Geschichte und Wahrheit für immer verloren.
Buch des Heiligen Textes von Morrighan, Bd. III
Kapitel 2
WIRSCHRIEN. Wir brüllten aus Leibeskräften, und wir wussten, dass der Wind, die Hügel und die Entfernung unsere noch so argwöhnisch beäugte Freiheit vor allen Ohren, die in Hörweite sein mochten, verbergen würden. Wir schrien mit schwindeliger Hingabe und dem tiefen Bedürfnis, an unsere Flucht zu glauben. Hätten wir daran gezweifelt, hätte die Angst uns übermannt. Ich spürte schon, wie sie in meinem Rücken die Hände nach mir ausstreckte, und trieb das Pferd noch mehr an.
Wir wandten uns nordwärts, da wir sehr wohl wussten, dass der Stallbursche uns beobachten würde, bis der Wald uns verschluckte. Als wir sicher und in Deckung waren, fanden wir das Flussbett, das ich auf Jagdausflügen mit meinen Brüdern entdeckt hatte. Wir wateten durch das seichte Rinnsal zurück, bis wir am anderen Ufer eine felsige Böschung erreichten, an der wir das Wasser verlassen konnten, ohne verräterische Spuren zu hinterlassen.
Sobald die Hufe unserer Pferde wieder festen Boden berührten, gaben wir ihnen die Sporen und jagten dahin, als würden wir von Ungeheuern verfolgt. Wir ritten und ritten auf einem kaum benutzten Pfad, der an dichten Kieferngehölzen entlangführte. Dort würden wir Zuflucht finden, wenn wir uns rasch verstecken mussten. Manchmal wurde uns schwindelig vor Lachen, manchmal peitschte uns die rasende Geschwindigkeit Tränen über die Wangen; aber die meiste Zeit schwiegen wir und konnten selbst nicht fassen, dass wir es tatsächlich getan hatten.
Nach einer Stunde war ich nicht mehr sicher, was mir mehr wehtat – meine Oberschenkel, meine krampfenden Waden oder mein lädierter Allerwertester. Diese Körperteile waren inzwischen alle nur noch an den steifen königlichen Schritt beim Reiten gewöhnt, da mir mein Vater in den letzten Monaten nichts anderes mehr erlaubt hatte. Meine Finger waren taub vom Umklammern der Zügel, doch Pauline hielt nicht an, und so tat ich es auch nicht.
Mein Kleid wallte hinter mir her und vermählte mich nun mit einem Leben in Unsicherheit. Es ängstigte mich deutlich weniger als jenes künftige Leben, das mir sicher gewesen wäre. Dieses Leben war ein Traum, den ich mir selbst geschaffen hatte, einer, dessen einzige Grenze meine eigene Vorstellungskraft war. Es war ein Leben, über das ich allein entschied.
Ich verlor jedes Zeitgefühl; der Rhythmus der Hufe war das Einzige, was zählte. Jeder Hufschlag vergrößerte die Entfernung. Endlich schnaubten unsere glänzenden kastanienbraunen Ravianer fast gleichzeitig und wurden aus eigenem Antrieb langsamer, als hätten sie eine geheime Botschaft ausgetauscht. Die Ravianer waren der ganze Stolz der Morrighan-Stallungen, und diese hier hatten uns bewiesen, was sie wert waren. Ich blickte zu dem bisschen westlichen Himmel empor, das ich über den Wipfeln sehen konnte. Es würde noch drei Stunden hell sein. Wir konnten jetzt noch nicht haltmachen. Wir zogen mit gedrosseltem Tempo weiter, und als schließlich die Sonne hinter den Andeluchi-Bergen verschwand, suchten wir nach einem sicheren Lagerplatz für die Nacht.
Ich lauschte angestrengt, während wir die Pferde durch die Bäume lenkten und Ausschau nach einem geeigneten Unterschlupf hielten. Mein Nacken kribbelte, als aus der Ferne plötzlich Vogelkrächzen wie eine Warnung durch den Wald kreischte. Wir trafen auf die zerfallenen Ruinen der Altvorderen, Bruchstücke von Mauern und Säulen, die inzwischen mehr Wald als Zivilisation waren. Dickes grünes Moos und Flechten überwucherten sie. Sie waren wahrscheinlich das Einzige, was die Überreste noch aufrecht hielt. Vielleicht waren die bescheidenen Ruinen einst Teil eines prächtigen Tempels gewesen, aber jetzt eroberten Farne und Kletterpflanzen sie zurück. Pauline drückte einen Kuss auf ihren Handrücken, zum einen als Segnung, zum anderen als Schutz vor Geistern, die hier lauern mochten. Dann ließ sie die Zügel schnalzen, um so schnell wie möglich weiterzukommen. Ich küsste weder meine Hand, noch hetzte ich vorüber, sondern musterte neugierig die grünen Skelette aus einer anderen Zeit, wie ich es immer tat, und dachte über die Menschen nach, die sie erbaut hatten.
Endlich erreichten wir eine kleine Lichtung. Da über uns das letzte Tageslicht schimmerte und wir beide uns nur noch mühsam in den Sätteln halten konnten, kamen wir wortlos überein, dass dies der Ort für unser Lager war. Alles, was ich mir wünschte, war, aufs Gras zu sinken und bis zum Morgen zu schlafen; doch die Pferde waren genauso erschöpft und verdienten Aufmerksamkeit, zumal sie unsere einzige echte Chance zur Flucht waren.
Wir nahmen die Sättel ab und ließen sie achtlos zu Boden plumpsen, da uns zu allem anderen die Kraft fehlte. Dann schüttelten wir die feuchten Decken aus und hängten sie zum Trocknen über einen Ast. Wir tätschelten den Tieren den Rücken, die schnurstracks zum Fluss liefen, um zu saufen.
Pauline und ich sanken zu Boden; wir waren beide zu müde, um zu essen, obwohl wir den ganzen Tag nichts zu uns genommen hatten. Heute Morgen waren wir wegen unseres geheimen Plans zu nervös für eine richtige Mahlzeit gewesen. Obwohl ich seit Wochen in Erwägung gezogen hatte wegzulaufen, war es selbst für mich undenkbar gewesen – bis zum Abschiedsfest von meiner Familie gestern Abend im Aldrid-Saal. Erst da änderte sich alles, und mit einem Mal schien das Undenkbare die einzige Möglichkeit zu sein, die mir noch blieb. Während Trinksprüche und Gelächter durch den Saal brandeten und ich unter dem Gewicht der Lustbarkeiten und der zufrieden lächelnden Mienen des Hofstaats zu ersticken meinte, war ich Paulines Blick begegnet. Sie stand wartend mit den anderen Dienern an der gegenüberliegenden Wand. Als ich den Kopf schüttelte, wusste sie Bescheid. Ich konnte es nicht. Sie nickte zur Antwort.
Es war ein stummer Austausch, den niemand anders bemerkte; doch spät am Abend, als sich alle anderen zurückgezogen hatten, kehrte sie zu meinem Gemach zurück, und die Pläne sprudelten nur so aus uns hervor. Es blieb so wenig Zeit und so viel vorzubereiten, und fast alles hing davon ab, dass es uns gelang, ohne Mitwisser zwei Pferde satteln zu lassen. Bei Tagesanbruch schlich sich Pauline am Stallmeister vorbei, der eifrig die Gespanne des königlichen Festzugs vorbereitete, und sprach ernst mit dem jüngsten Stallburschen. Er war ein unerfahrener Junge, der, eingeschüchtert wie er war, niemals eine direkte Anordnung aus dem Hofstaat der Königin infrage gestellt hätte. So weit waren unsere überstürzt zusammengeschusterten Pläne aufgegangen.
Obwohl wir zu müde zum Essen waren, wich die Erschöpfung der Angst, als die Sonne weiter sank und das Licht schwand. Wir sammelten Feuerholz, um die Kreaturen, die im Wald hausten, auf Abstand zu halten oder doch wenigstens ihre Zähne sehen zu können, bevor sie uns zerrissen.
Die Dunkelheit kam rasch und deckte die Welt jenseits des kleinen flackernden Kreises zu, der unsere Füße wärmte. Ich beobachtete, wie die Flammen vor uns in die Luft leckten, lauschte dem Prasseln, dem Fauchen und Knistern von zusammenfallendem Holz. Dies waren die einzigen Geräusche, aber wir horchten, ob sich noch andere daruntermischten.
»Glaubst du, dass es hier Bären gibt?«, fragte Pauline.
»Mit Sicherheit.« Aber ich war gedanklich schon bei den Tigern. Ich hatte einmal einem gegenübergestanden, als ich zehn Jahre alt war; so dicht, dass ich seinen Atem spürte, sein Knurren, seinen Geifer, seine schiere Gewaltigkeit, bereit, mich zu verschlingen. Ich hatte damit gerechnet, sterben zu müssen. Warum er nicht sofort angegriffen hatte, wusste ich nicht, aber ein Ruf meines Bruders aus der Ferne, der mich suchte, hatte mir endgültig das Leben gerettet. Das Tier verschwand so schnell in den Wald, wie es aufgetaucht war. Niemand glaubte mir, als ich es erzählte. Man berichtete von Tigern in den Cam Lanteux, aber sie kamen nicht sehr zahlreich vor. Morrighan war nicht ihr natürlicher Lebensraum. Die glasigen gelben Augen der Bestie verfolgten mich immer noch in meinen Träumen. Ich spähte an den Flammen vorbei in die Dunkelheit, wo mein Dolch noch in der Satteltasche steckte, nur wenige Schritte von unserem sicheren Lichtkreis entfernt. Wie dumm von mir, erst jetzt daran zu denken.
»Oder schlimmer als Bären – vielleicht gibt es hier Barbaren«, sagte ich mit gespieltem Entsetzen in der Stimme, um uns beide aufzuheitern.
Paulines Augen weiteten sich, obwohl schon ein Lächeln dahinter lauerte. »Ich habe gehört, dass sie sich wie die Karnickel vermehren und kleinen Tieren den Kopf abbeißen.«
»Und dass sie sich nur durch Grunzlaute verständigen.« Ich hatte es ebenfalls gehört. Soldaten brachten von ihren Streifzügen Geschichten über die viehische Lebensweise der Barbaren mit, wie auch über ihre wachsende Zahl. Nur wegen ihnen war die langjährige Feindschaft zwischen Morrighan und Dalbreck ausgesetzt und eine unsichere Allianz geschmiedet worden – auf meinem Rücken. Ein großes, wildes Reich auf der anderen Seite des Kontinents mit wachsender Bevölkerung, von dem Gerüchte umgingen, dass es seine Grenzen auszudehnen trachtete, stellte eine größere Bedrohung dar als ein mehr oder weniger zivilisierter Nachbar, der immerhin von den erwählten Verbliebenen abstammte. Mit vereinten Kräften vermochten Morrighan und Dalbreck Großes, aber auf sich allein gestellt waren beide verwundbar. Nur der Große Fluss und die Cam Lanteux hielten die Barbaren noch in Schach.
Pauline warf einen trockenen Ast ins Feuer. »Du bist doch sprachbegabt – du solltest keine Probleme mit dem Grunzen der Barbaren haben. So spricht der halbe Königshof.«
Wir brachen in Gelächter aus und äfften das Knurren des Kanzlers und das hochnäsige Seufzen des Königlichen Gelehrten nach.
»Hast du schon mal einen gesehen?«, fragte sie.
»Ich? Einen Barbaren? Ich bin in den letzten Jahren so kurzgehalten worden, dass ich generell nicht viel gesehen habe.« Die Tage in Freiheit, an denen ich über die Hügel streifen und meinen Brüdern nachjagen durfte, hatten abrupt geendet, als meine Eltern beschlossen, ich würde allmählich wie eine Frau aussehen und sollte mich daher auch wie eine benehmen. Ich wurde der Freiheiten beraubt, die ich mit Walther, Regan und Bryn teilte. Dass wir etwa zusammen die Ruinen in den Wäldern auskundschafteten, unsere Pferde um die Wette über die Wiesen laufen ließen, kleine Tiere erlegten und jede Menge Unfug anstellten – diese Tage waren gezählt. Als wir älter wurden, nahm man dies bei ihnen weiterhin achselzuckend zur Kenntnis, nur bei mir nicht, und von da an wusste ich, dass ich nach anderen Maßstäben bemessen wurde als meine Brüder.
Nachdem meine Freiheiten beschnitten worden waren, entwickelte ich ein gewisses Geschick, mich unbemerkt davonzustehlen – wie heute. Das war keine Fähigkeit, die meine Eltern zu schätzen gewusst hätten, auch wenn ich selbst ziemlich stolz darauf war. Der Gelehrte ahnte meine Fluchten und stellte mir jämmerliche Fallen, die ich mühelos umging. Er wusste, dass ich mich durch den Raum mit den alten Texten gestöbert hatte, was verboten war, da die Texte angeblich zu heikel für unachtsame Hände wie meine waren. Aber auch wenn es mir damals gelungen war, mich aus der Festung zu schleichen, hatte es doch keinen Ort gegeben, an den ich hätte gehen können. Jeder in Civica wusste, wer ich war, und meinen Eltern wäre selbstverständlich zu Ohren gekommen, was ich angestellt hatte. Dementsprechend beschränkte ich meine Fluchtversuche auf gelegentliche nächtliche Streifzüge zu Karten- oder Würfelspielen in zwielichtigen Hinterzimmern mit meinen Brüdern und ihren zuverlässigen Freunden. Sie wussten, dass sie den Mund halten mussten über Walthers kleine Schwester, und nahmen vielleicht sogar Anteil an mir und meiner Misere. Meine Brüder hatten sich immer diebisch über die überraschten Gesichter ihrer Freunde gefreut, wenn ich genauso gut austeilen wie einstecken konnte. Keiner verkniff sich Ausdrücke und Themen nur wegen meines Geschlechts oder Titels, und so bildete mich ihre »anrüchige« Gesellschaft auf eine Art und Weise, wie sie in meiner königlichen Erziehung nicht vorgesehen war.
Ich hielt mir die Hand über die Augen, als würde ich im Wald Ausschau nach Barbaren halten. »Ich würde es begrüßen, mich jetzt von einem Wilden ablenken zu lassen. Barbaren, zeigt euch!«, rief ich. Es kam keine Antwort. »Ich glaube wirklich, dass wir ihnen Angst einjagen.«
Pauline lachte, aber unsere nervöse Angeberei hing zwischen uns in der Luft. Wir wussten beide, dass in den Wäldern hin und wieder kleine Barbarentrupps auf dem Weg von Venda in die verbotenen Territorien der Cam Lanteux gesichtet worden waren. Manchmal wagten sie sogar mutige Ausfälle nach Morrighan und Dalbreck und verschwanden so mühelos wie Wölfe, wenn sie verfolgt wurden. Im Augenblick waren wir dem Herzen Morrighans noch zu nahe, als dass wir uns ihretwegen Sorgen hätten machen müssen. Das hoffte ich zumindest. Wir würden eher auf Vagabunden treffen, Nomaden, die manchmal von den Cam Lanteux aus umherstreiften. Ich selbst hatte noch nie welche gesehen, aber ich hatte von ihren merkwürdigen Sitten gehört. Sie zogen mit bunten Wagen von Ort zu Ort, um mit allerlei Krimskrams zu handeln, Vorräte zu erstehen, ihre geheimnisvollen Tränke zu verkaufen oder zuweilen für eine Münze oder zwei zu musizieren. Aber sie waren nicht meine größte Sorge. Meine größten Sorgen galten meinem Vater und dem Umstand, dass ich Pauline in all das mit hineingezogen hatte. Es gab so vieles, was zu besprechen wir gestern Nacht keine Zeit gehabt hatten.
Ich beobachtete, wie sie abwesend ins Feuer starrte und immer wieder Feuerholz nachschob. Pauline war einfallsreich, aber ich wusste, dass sie nicht furchtlos war, und das machte ihren Mut heute viel größer als meinen. Sie hatte alles zu verlieren. Ich hatte alles zu gewinnen.
»Es tut mir leid, Pauline. In was für einen Schlamassel habe ich dich da hineingezogen?«
Sie zuckte die Achseln. »Ich wollte doch sowieso weg vom Hof. Ich hab’s dir ja gesagt.«
»Aber nicht so. Du hättest unter viel günstigeren Umständen gehen können.«
Sie schmunzelte, denn das konnte sie schlecht leugnen. »Vielleicht.« Ihr Lächeln schwand langsam, während ihr Blick auf meinem Gesicht ruhte. »Aber ich hätte aus keinem wichtigeren Grund gehen können. Wir können nicht immer auf den perfekten Zeitpunkt warten.«
Ich verdiente eine Freundin wie sie gar nicht. Das Mitgefühl, das sie mir entgegenbrachte, schmerzte mich. »Man wird uns jagen«, sagte ich. »Man wird ein Kopfgeld auf mich aussetzen.« Darüber hatten wir in den frühen Morgenstunden nicht gesprochen.
Sie sah weg und schüttelte energisch den Kopf. »Nein, doch nicht dein eigener Vater.«
Ich seufzte, umfasste meine Schienbeine noch etwas fester und sah in die glühende Asche zu meinen Füßen. »Vor allem mein eigener Vater. Ich habe Hochverrat begangen, ungefähr wie ein Soldat, der aus der Armee desertiert. Und was noch schlimmer ist: Ich habe ihn gedemütigt. Ich habe ihn schwach aussehen lassen. Der Ministerrat wird es ihm ständig in Erinnerung rufen. Er wird handeln müssen.«
Auch das konnte sie nicht abstreiten. Seit ich zwölf Jahre alt war, hatte man mich als Mitglied des Königshofs gezwungen, der Exekution von Verrätern beizuwohnen. Es kam selten vor, denn mit öffentlichen Hinrichtungen ließ sich ganz vorzüglich ein Exempel statuieren; doch wir beide kannten die Geschichte der Schwester meines Vaters. Sie war noch vor meiner Geburt gestorben – sie hatte sich vom Ostturm gestürzt. Ihr Sohn war aus seinem Regiment desertiert, und sie wusste, dass man nicht einmal den Neffen des Königs verschonen würde. Was auch nicht der Fall war. Er wurde am nächsten Tag gehenkt, und man verscharrte beide ohne Segen in einem namenlosen Grab. Ein paar Grenzen durfte man in Morrighan nicht überschreiten. Königstreue war eine davon.
Pauline runzelte die Stirn. »Aber du bist kein Soldat, Lia. Du bist seine Tochter. Du hattest keine Wahl, und das bedeutet, dass ich auch keine Wahl hatte. Niemand sollte gezwungen werden, jemanden zu heiraten, den er nicht liebt.« Sie ließ sich ins Gras sinken, blickte zu den Sternen empor und zog die Nase kraus. »Vor allem keinen angestaubten, aufgeblasenen Prinzen.«
Wir mussten wieder kichern. Für Pauline war ich noch dankbarer als für die Luft, die ich atmete. Zusammen betrachteten wir die blinkenden Sternbilder über uns, und sie erzählte mir von Mikael, dem Versprechen, das sie sich gegenseitig gegeben hatten, den süßen Dingen, die er ihr ins Ohr geflüstert hatte, und den Plänen, die sie hatten, wenn er Ende des Monats von seiner letzten Patrouille mit der königlichen Garde zurückkehren würde. Da war so viel Liebe in ihren Augen, und ich hörte eine Veränderung in ihrer Stimme, wenn sie von ihm sprach.
Sie erzählte mir, wie sehr sie ihn vermisste; doch sie war zuversichtlich, dass er sie finden würde, denn er kannte sie so gut wie niemand anders auf der Welt. Sie hatten zahllose Stunden über Terravin gesprochen – über das Leben, das sie sich aufbauen, und die Kinder, die sie dort aufziehen wollten. Je mehr sie sagte, desto größer wurde mein Schmerz. Ich hatte nur eine vage, leere Vorstellung von der Zukunft. Meistens wusste ich nur, was ich nicht wollte, während Pauline von konkreten Details träumte, die Hand und Fuß hatten. Sie hatte sich eine Zukunft mit jemand anderem erschaffen.
Ich fragte mich, wie es wohl wäre, jemanden zu haben, der mich so gut kannte, jemanden, der mir geradewegs in die Seele blickte, jemanden, dessen Berührung alle anderen Gedanken aus meinem Kopf verdrängte. Ich versuchte, mir jemanden vorzustellen, der sich nach denselben Dingen sehnte wie ich und der den Rest seines Lebens mit mir verbringen wollte – und zwar nicht, um eine lieblose Vereinbarung auf dem Papier zu erfüllen.
Pauline drückte meine Hand und setzte sich auf, um noch mehr Holz ins Feuer zu legen. »Wir sollten ein bisschen schlafen, damit wir früh loskommen.«
Sie hatte recht. Wir hatten einen Ritt von mindestens einer Woche vor uns, vorausgesetzt, dass wir uns nicht verirrten. Pauline war nicht mehr in Terravin gewesen, seit sie ein Kind war, und kannte den Weg nicht gut, und ich war noch nie dort gewesen; wir konnten uns also nur auf ihren Instinkt verlassen und auf die Hilfe von Fremden, denen wir begegneten. Ich breitete zum Schlafen eine Decke für uns auf der Erde aus und strich mir die Nadeln vom Waldboden aus dem Haar.
Pauline warf mir einen zögernden Blick zu. »Macht es dir etwas aus, wenn ich zuerst die heiligen Andachten aufsage? Ich bin auch ganz leise.«
»Natürlich tust du das«, flüsterte ich und versuchte, ihr zuliebe ein Mindestmaß an Respekt an den Tag zu legen. Ich hatte Gewissensbisse, weil ich selbst dieses Bedürfnis nicht verspürte. Pauline war gläubig, während ich kein Hehl aus meiner Verachtung für alle Traditionen machte, die mir die Zukunft diktiert hatten.
Sie kniete nieder und sprach die heiligen Andachten mit einer hypnotisierenden Stimme, ähnlich leisen Harfenklängen, die durch die Abtei hallten. Ich beobachtete sie und dachte, wie töricht das Schicksal doch war. Aus ihr wäre eine viel bessere Erste Tochter von Morrighan geworden; eine Tochter, wie meine Eltern sie sich gewünscht hätten, die wusste, wie man seine Zunge in Zaum hält, ruhig, geduldig, den alten Sitten treu ergeben, reinen Herzens, sensibel auch für das, was nicht gesagt wurde, der Gabe näher, als ich es je sein würde – eine in jeder Hinsicht vollkommene Erste Tochter.
Ich legte mich nieder und lauschte den Worten, die sie skandierte, der Geschichte der wahren Ersten Tochter. Diese hatte die Gabe, die die Götter ihr geschenkt hatten, dazu genutzt, die auserwählten Verbliebenen aus der Zerstörung in die Sicherheit eines neuen Landes zu führen und eine verwüstete Welt zu verlassen, um eine neue voller Hoffnung aufzubauen. In ihrer anmutigen Tonlage war die Geschichte schön, erlösend, fesselnd, und ich verlor mich in ihrem Rhythmus, in der Tiefe der Wälder, die uns umgaben, in der Welt, die hinter uns lag, in einer Zeit, die längst vergangen war. In Paulines zarten Tönen reichte die Geschichte bis zum Anbeginn des Universums und wieder zurück. Beinahe hätte es einen Sinn ergeben.
Ich starrte in das Himmelsrund hoch über den Kiefern, das so weit und unerreichbar war, funkelnd, lebendig, und die Sehnsucht wuchs in mir, nach ihm zu greifen und an seinem Zauber teilzuhaben. Auch die Bäume streckten sich danach aus; dann erschauerten sie gleichzeitig, als wäre eine Armee aus Geistern geradewegs über ihre Wipfel hinweggefegt. Dies war eine vollständige wissende Welt jenseits meiner Reichweite.
Ich dachte an all die vielen Male in meiner Kindheit, als ich mich mitten in der Nacht heimlich in den ruhigsten Teil der Festung schlich – aufs Dach, an jenen Ort, an dem der ständige Lärm verstummte und ich selbst ganz ruhig und zu einem Teil des Universums wurde. Ich fühlte mich dort mit etwas verbunden, dem ich keinen Namen zu geben vermochte.
Wenn ich nur die Hand ausstrecken müsste und die Sterne berühren könnte, dann würde ich alles wissen, alles verstehen.
Was wissen, mein Liebling?
Das hier, sagte ich immer und legte mir die Hand auf die Brust. Mir fehlten die Worte, um den Schmerz in mir zu beschreiben.
Da gibt es nichts zu wissen, mein Kind. Das ist nur die Kühle der Nacht. Meine Mutter nahm mich dann auf den Arm und brachte mich zurück ins Bett. Später, als meine nächtlichen Wanderungen immer noch nicht aufhörten, ließ sie ein Schloss an der Tür zum Dach anbringen, dort, wo ich gerade nicht mehr hinreichte.
Pauline kam endlich zum Ende; ihre letzten Worte waren ein gedämpftes, ehrfürchtiges Wispern. So sei es bis in alle Ewigkeit.
»Bis in alle Ewigkeit«, flüsterte ich vor mich hin und fragte mich, wie lange das wohl sein mochte.
Sie rollte sich auf der Decke neben mir zusammen, und ich breitete den Hochzeitsumhang über uns beide. Die plötzliche Stille ließ den Wald einen großen Schritt näher kommen, und unser Lichtkreis wurde kleiner.
Pauline schlief rasch ein, doch mich wühlten die Ereignisse des Tages immer noch zu sehr auf. Es spielte keine Rolle, dass ich erschöpft war. Meine müden Muskeln zuckten, und mein Geist sprang von einem Gedanken zum nächsten wie eine glücklose Grille, die einem Heer von Füßen zu entkommen suchte.
Als ich zu den funkelnden Sternen emporsah, war mein einziger Trost, dass der Prinz von Dalbreck wahrscheinlich ebenfalls noch wach war. Ich stellte mir vor, wie er zornig auf einer holperigen Straße nach Hause donnerte, während seine alten Knochen in der kalten, unbequemen Kutsche schmerzhaft umhergestoßen wurden – und weit und breit keine junge Braut, die ihn wärmte.
Kapitel 3
Der Prinz
ICHZOGDIE SCHNALLE an meinem Bündel fest. Ich hatte genug für zwei Wochen dabei und ausreichend Geld in der Tasche, falls es länger dauern sollte. Sicher gab es einen Gasthof oder zwei auf dem Weg. Sie war wahrscheinlich noch nicht weit gekommen, vielleicht einen Tagesritt von der Festung aus.
»Ich kann das nicht zulassen.«
Ich lächelte Sven an. »Meinst du, dass du eine Wahl hast?«
Ich war nicht mehr sein junger Schutzbefohlener, dem er Schwierigkeiten ersparen konnte. Ich war erwachsen, fünf Zentimeter größer und fünfzehn Kilo schwerer als er und hatte genug Enttäuschung in mir aufgestaut, um einen respektablen Gegner abzugeben.
»Ihr seid immer noch zornig. Es ist erst ein paar Tage her. Lasst noch ein paar mehr verstreichen.«
»Ich bin nicht zornig. Amüsiert vielleicht. Neugierig.«
Sven riss mir die Zügel meines Pferdes aus den Händen. »Ihr seid zornig, weil sie vor Euch auf die Idee gekommen ist.«
Manchmal hasste ich Sven. Für einen kampferprobten Haudegen war er zu einfühlsam. Ich schnappte mir die Zügel wieder. »Nur amüsiert. Und neugierig«, versicherte ich noch einmal.
»Das habt Ihr schon gesagt.«
»Das habe ich.« Ich legte meinem Pferd die Decke auf den Rücken, schob sie über den Widerrist und strich die Falten glatt.
Sven konnte nichts Amüsantes an meinem Unternehmen finden und fuhr damit fort, Gegenargumente aufzuzählen, während ich den Sattel zurechtrückte. Ich hörte kaum hin. Ich dachte nur daran, was für ein gutes Gefühl es wäre, fort zu sein. Mein Vater war außer sich, viel mehr, als ich es war, und behauptete, es sei ein vorsätzlicher Affront. Welcher König hat seine eigene Tochter nicht im Griff? Und das war noch eines seiner vernünftigeren Argumente.
Er und sein Ministerrat ließen bereits Truppen zur Verstärkung entlegener Garnisonen aufmarschieren, um Morrighan zu demonstrieren, wie entschlossene Stärke aussah. Die unsichere Allianz war über seinem Kopf zusammengebrochen. Aber schlimmer noch als das Imponiergehabe und die Verschwörungstheorien des Ministerrats waren die bekümmerten Blicke meiner Mutter. Sie sprach bereits davon, eine andere Braut in einem der Geringeren Reiche oder sogar in den Reihen unseres Adels zu suchen, ohne überhaupt zu begreifen, worum es eigentlich ging.
Ich schob den Fuß in den Steigbügel und schwang mich in den Sattel. Mein Pferd schnaubte und stampfte, denn es war so erpicht darauf wie ich loszukommen.
»Wartet!«, sagte Sven und vertrat mir den Weg. Eine törichte Aktion für jemanden, der so gut über Pferde Bescheid wusste – und besonders über meines. Er begriff und ging beiseite. »Ihr wisst ja nicht mal, wohin sie geflohen ist. Wie wollt Ihr sie finden?«
Ich hob die Augenbrauen. »Du unterschätzt deine eigenen Fähigkeiten, Sven. Denk daran: Ich habe vom Besten von allen gelernt.«
Ich konnte fast sehen, wie er sich selbst verwünschte. Er hatte mir das immer unter die Nase gerieben. Wenn meine Aufmerksamkeit abschweifte, hatte er mich in die Ohren gekniffen, als ich noch zwei Köpfe kleiner war als er, und mich daran erinnert, dass ich den besten Lehrer hätte und seine kostbare Zeit nicht vergeuden solle. Natürlich war uns beiden diese Ironie bewusst. Ich hatte wirklich den besten Lehrer gehabt. Sven hatte mir viel beigebracht. Man hatte mich ihm anvertraut, als ich acht Jahre alt gewesen war, mit zwölf wurde ich Fahnenjunker, schwor mit vierzehn auf die Fahne und war mit sechzehn ein vollwertiger Soldat. Ich hatte mehr Jahre unter Svens Vormundschaft verbracht als mit meinen eigenen Eltern. Ich war der vollkommene Soldat, was zu einem nicht unwesentlichen Teil sein Verdienst war; ein Soldat, der die anderen überflügelte, was es nur umso bitterer machte: denn ich war zugleich auch der vermutlich unerprobteste Soldat in der Geschichte unseres Landes.
Zu Svens Lektionen hatte das Pauken der königlichen Militärgeschichte gehört – die Leistungen dieses oder jenes meiner Vorfahren, und von denen gab es viele. Die Könige von Dalbreck hatten sich immer schon militärisch verdient gemacht – auch mein Vater. Er erwarb sich ganz rechtmäßig den Rang eines Generals, während sein eigener Vater noch auf dem Thron saß; doch weil ich der einzige Erbe des einzigen Erben war, hatte man meinen soldatischen Einsatz deutlich eingeschränkt. Ich hatte ja nicht einmal einen Cousin, der an meine Stelle hätte rücken können. Ich ritt mit einer Kompanie, erhielt aber nie die Erlaubnis, an vorderster Front zu kämpfen. Die Hitze des Gefechts hatte sich längst abgekühlt, wenn ich aufs Schlachtfeld kam, und selbst dann war ich noch von den Stärksten aus unserer Garnison umgeben; als zusätzliche Lebensversicherung gegen feindliche Geschosse.
Zum Ausgleich hatte Sven – um jedes Gerücht über meinen Sonderstatus im Keim zu ersticken – mir stets die doppelte Dosis der schmutzigsten und niedrigsten Arbeiten in unserer Garnison verabreicht: vom Ausmisten der Ställe über das Polieren seiner Stiefel bis hin zum Aufladen und Abtransportieren der Toten vom Schlachtfeld. Ich hatte nie Groll in den Gesichtern meiner Kameraden gesehen oder aus ihrem Mund vernommen, immer nur jede Menge Mitleid. Ein Soldat, der nicht zum Einsatz kam, war kein Soldat, ganz egal, wie gut er ausgebildet war.
Sven stieg auf sein Pferd und ritt an meine Seite. Ich wusste, dass er nicht weit kommen würde. Wie sehr er meine Pläne auch verteufelte – immerhin war genau das seine Pflicht und er daran gebunden –, er war doch auch den starken Banden verpflichtet, die wir im Laufe der gemeinsamen Jahre geknüpft hatten.
»Wie werde ich erfahren, wo Ihr seid?«
»Gar nicht. Das ist doch mal was Neues, oder?«
»Und was soll ich Euren Eltern sagen?«
»Sag ihnen, dass ich zum Jagdhaus geritten bin, um dort schmollend den Sommer zu verbringen. Das sollte ihnen gefallen. Es ist ein hübsch sicherer Hafen.«
»Den ganzen Sommer über?«
»Wir werden sehen.«
»Es könnte etwas passieren.«
»Ja, es könnte etwas passieren. Ich hoffe es sogar. So wirst du mich nicht überzeugen, ist dir das klar?«
Ich beobachtete aus dem Augenwinkel, dass er meine Ausrüstung begutachtete; ein Zeichen dafür, dass er sich tatsächlich mit meinem Aufbruch ins Ungewisse abgefunden hatte. Wenn ich nicht der Thronerbe gewesen wäre, hätte er keinen zweiten Gedanken daran verschwendet. Er wusste, dass er mich auf das Schlimmste und das Unerwartete vorbereitet hatte. Meine Fähigkeiten waren erwiesen – zumindest in Übungskämpfen. Er grunzte, wie um widerstrebend seine Zustimmung zu signalisieren. Vor uns lag eine enge Schlucht, in der die beiden Pferde nebeneinander keinen Platz mehr hatten, und ich wusste, dass er sich dort von mir trennen würde. Der Tag neigte sich ohnehin bereits dem Ende entgegen.
»Werdet Ihr sie zur Rede stellen?«
»Nein. Ich werde wahrscheinlich nicht einmal mit ihr sprechen.«
»Gut. Besser, wenn Ihr es nicht tut. Und wenn, dann achtet auf das ›r‹ und das ›l‹. Sie verraten, aus welcher Gegend Ihr kommt.«
»Schon notiert«, sagte ich, um ihm zu versichern, ich hätte an alles gedacht; doch dieses Detail war mir entgangen.
»Wenn Ihr mir eine Nachricht schicken müsst, schreibt sie in der alten Sprache für den Fall, dass sie abgefangen wird.«
»Ich werde keine Nachrichten schicken.«
»Was immer Ihr tut, sagt ihr nicht, wer Ihr seid. Das Erscheinen eines Staatsoberhaupts von Dalbreck auf dem Boden von Morrighan könnte als kriegerische Handlung interpretiert werden.«
»Du verwechselst mich mit meinem Vater, Sven. Ich bin kein Staatsoberhaupt.«
»Ihr seid der Thronerbe und der Stellvertreter Eures Vaters. Macht die Sache nicht noch schlimmer für Dalbreck und Eure Kampfgefährten.«
Wir verstummten.
Warum ging ich überhaupt? Was sollte das Ganze, wenn ich sie nicht zurückbrachte oder nicht einmal mit ihr sprach? Ich wusste, dass diese Gedanken in Svens Kopf umgingen, aber es war dennoch nicht so, wie er meinte. Ich war nicht wütend, weil sie sich aus dem Staub gemacht hatte, bevor ich es tat. Ich war schon vor langer Zeit auf dieselbe Idee gekommen, gleich als mir diese Heirat von meinem Vater nahegelegt worden war; aber er hatte mich davon überzeugt, dass dieser Bund zum Wohle Dalbrecks war und alle wegschauen würden, wenn ich beschloss, mir nach der Hochzeit eine Geliebte zu nehmen. Ich war zornig, weil sie den Mut gehabt hatte zu tun, was ich nicht getan hatte. Wer war dieses Mädchen, das zwei Königreichen eine lange Nase drehte und machte, was ihm gefiel? Das wollte ich wissen.
Als wir uns der Schlucht näherten, durchbrach Sven das Schweigen. »Es geht um die Nachricht, oder?«
Einen Monat vor der Hochzeit hatte Sven mir einen Brief von der Prinzessin überbracht. Eine geheime Nachricht. Sie war noch versiegelt gewesen, als Sven sie mir aushändigte. Seine Augen hatten nie gesehen, was darin stand. Ich hatte sie gelesen und ignoriert; was ich wahrscheinlich nicht hätte tun sollen.