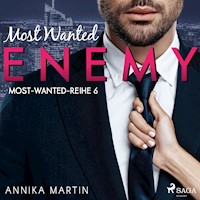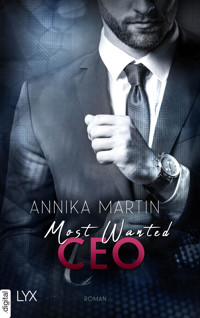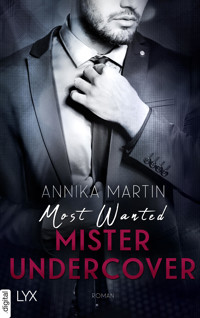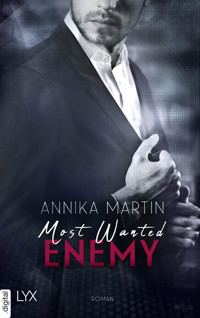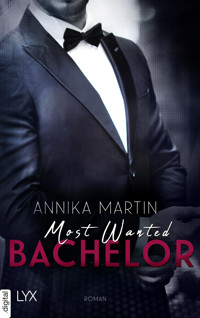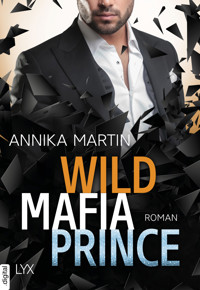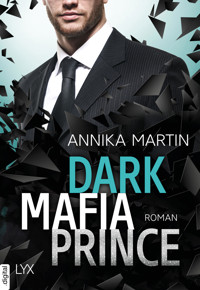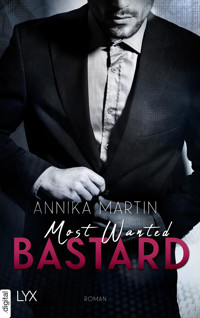
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Most-Wanted-Reihe
- Sprache: Deutsch
Liebe ist Chefsache ...
Henry Locke ist New Yorks einflussreichster CEO. Er hat aus dem kleinen Familienunternehmen ein weltweit agierendes Millionen-Imperium erschaffen. Auch wenn ihm das Geld egal ist - die Firma ist sein Leben. Bis seine Mutter auf dem Sterbebett ihr gesamtes Vermögen - und damit auch das Unternehmen - ihrem geliebten Hund Smuckers vermacht - und seiner Dogsitterin! Henry ist sich sicher, dass er die hübsche Victoria Nelson mit einer entsprechenden Summe schnell loswerden kann. Doch wenn Vicky im Leben eins gelernt hat, dann dass man sich nichts nehmen lassen sollte, was einem rechtmäßig zusteht - schon gar nicht von einem arroganten Millionär, der denkt, ihm gehöre die Welt. Vicky ist bereit die Firma zu übernehmen, auch wenn dies bedeutet, Henry öfter zu sehen, als ihr lieb ist ...
"Unglaublich unterhaltsam!" USA Today
Band 1 der Most-Wanted-Reihe von New-York-Times-Bestseller-Autorin Annika Martin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem Buch12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334DanksagungDie AutorinDie Romane von Annika Martin bei LYX LeseprobeImpressumANNIKA MARTIN
Most Wanted Bastard
Ins Deutsche übertragen von Nina Restemeier
Zu diesem Buch
Henry Locke ist New Yorks einflussreichster CEO. Er hat aus dem kleinen Familienunternehmen ein weltweit agierendes Millionen-Imperium erschaffen. Auch wenn ihm das Geld egal ist – die Firma ist sein Leben. Bis seine Mutter auf dem Sterbebett ihr gesamtes Vermögen – und damit auch das Unternehmen – ihrem geliebten Hund Smuckers vermacht – und seiner Dogsitterin! Henry ist sich sicher, dass er die hübsche Victoria Nelson mit einer entsprechenden Summe schnell loswerden kann. Doch wenn Vicky im Leben eins gelernt hat, dann dass man sich nichts nehmen lassen sollte, was einem rechtmäßig zusteht – schon gar nicht von einem arroganten Millionär, der denkt, ihm gehöre die Welt. Vicky ist bereit die Firma zu übernehmen, auch wenn dies bedeutet, Henry öfter zu sehen, als ihr lieb ist …
1
Vicky
Ich schmuggele ein kleines weißes Hündchen namens Smuckers in ein Krankenhaus in Manhattan, damit es ein letztes Mal sein Frauchen sehen kann, Bernadette Locke. Dank eines regelmäßigen Termins in einem von Kronleuchtern geschmückten Hundesalon auf der Fifth Avenue, dessen Besitzerin angeblich Hunde liebt, aber sie vermutlich insgeheim hasst, ist Smuckers’ Gesichtsfell zu einer so fluffigen weißen Wolke geföhnt, dass seine neugierigen schwarzen Augen und seine kleine Rosinennase kaum noch zu sehen sind.
Drei Dinge muss man über Bernadette wissen: Sie ist die bösartigste Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Sie hält mich für so eine Art Hundeflüsterin, die Smuckers’ Gedanken lesen kann. (Kann ich nicht.) Und sie liegt im Sterben. Allein.
Die Leute in ihrem Wohnblock werden wahrscheinlich erleichtert sein, von ihrem Dahinscheiden zu hören. Ich weiß nicht, was sie getan hat, um ihren Zorn auf sich zu ziehen, und wahrscheinlich ist das auch besser so.
Irgendwo da draußen hat Bernadette einen Sohn, doch selbst der will nichts mit ihr zu tun haben. Auf dem gesprungenen Kaminsims in Bernadettes Wohnung steht ein Foto von ihm, ein Kleinkind mit einer trotzigen kleinen Furche zwischen den grimmigen blauen Augen. Und obwohl er von anderen Leuten umgeben ist, wirkt der kleine Junge irgendwie schrecklich einsam.
Damals, als Bernadette die Diagnose Endstadium erhielt, habe ich sie gefragt, ob sie es ihrem Sohn mitgeteilt habe und ob er sie nicht vielleicht endlich besuchen kommen würde. Doch sie tat die Frage mit einer verächtlichen Handbewegung ab – das ist Bernadettes Lieblingsantwort auf so ziemlich alles. Er kommt nicht, das kann ich Ihnen versichern.
Ich kann nicht glauben, dass er sie nicht besucht, nicht einmal jetzt. Das ist wirklich mies. Deine Mutter stirbt hier ganz allein, du Idiot.
Wie auch immer, wenn man das alles in einen Topf wirft und einmal umrührt, kommt diese seltsame Suppe heraus, wie ich mich an einem Pförtner vorbeischleiche und ihn herzlich – und hoffentlich umwerfend genug – anlächle, damit er nicht bemerkt, dass sich meine übergroße Handtasche ein wenig zu unnatürlich ausbeult.
Smuckers ist ein Malteser, das sind unfassbar niedliche Schoßhündchen. Und Smuckers ist der allerniedlichste.
In der Gegend auf der Upper West Side, wo meine kleine Schwester und ich aktuell in einer hübschen Wohnung zur Untermiete wohnen und auf einen Papagei aufpassen, waren Bernadette Locke und Smuckers ein berüchtigtes Paar auf den Bürgersteigen.
Ich sehe sie noch genau vor mir: Smuckers lockte die Leute mit seiner wahnsinnigen Flauschball-Niedlichkeit an, doch sobald sich ein nichts ahnendes Opfer näherte, bekam es von Bernadette eine Beleidigung an den Kopf geworfen. Ungefähr so, als wäre sie eine Venusfliegenfalle in Menschengestalt, die mit der Schönheit ihrer Blüte Fliegen anlockt, nur um sie gnadenlos zu zerquetschen.
Die Anwohner haben mit der Zeit gelernt, sich von den beiden fernzuhalten. Ich habe es auch versucht – wirklich.
Und dennoch bin ich jetzt hier, husche einen weiteren grell erleuchteten Krankenhausflur entlang und schmuggle den kleinen Hund zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen hinein. Es gehört nicht zu den Top Ten meiner Lieblingsbeschäftigungen. Nicht einmal zu meinen Top Hundert, aber Smuckers ist Bernadettes einziger wahrer Freund. Und ich weiß, wie es ist, gehasst zu werden und allein zu sein.
Ich weiß, wenn man gehasst wird, verhält man sich manchmal so, als wäre es einem egal, als Überlebensstrategie. Und das bringt die Leute dazu, einen noch mehr zu hassen, weil sie das Gefühl haben, dass man wenigstens ein bisschen niedergeschlagen aussehen sollte.
Bernadettes Hass war echter, analoger Nachbarschaftshass; meiner war auch echt, doch dazu kam noch eine lustige landesweite Online-Komponente, aber das Prinzip ist das gleiche, und wehe, wenn man auch noch einen süßen Hund hat. Oder wenn jemals ein Bild bei Facebook, Huffpost oder People.com erscheint, auf dem man zu lächeln wagt.
Ich weiß auch, wie es ist, wenn der Hass sich selbst verstärkt. Wie man manchmal Dinge tut, die die Leute dazu bringen, einen noch mehr zu hassen, weil es sich auf eine verdrehte Art besser anfühlt. Ich glaube, nur Menschen, die in ihrem Leben schon einmal gehasst wurden, können das wirklich verstehen.
Dann betrete ich das Krankenzimmer. »Da wären wir«, flöte ich und bin froh und erleichtert, dass kein Pflegepersonal in der Nähe ist. So gerne sich Smuckers auch in einer Handtasche tragen lässt, steckt er doch am liebsten den Kopf heraus, wie der verwegene Kapitän eines Kunstleder-Luftschiffs. Unnötig zu erwähnen, dass es ihm in der Tasche langsam zu eng wird. Ich hole ihn heraus. »Schau mal, Smuckers, deine Mama!«
Bernadette lehnt in ein paar Kissen. Ihre Haut ist fahl und die wenigen Haare, die sie noch hat, sind blendend weiß. Sie schlägt die Augen auf. »Endlich.«
In ihrem Arm steckt eine Kanüle, aber das ist alles. Die Ärzte haben alle Medikamente außer dem Morphium abgesetzt. Sie haben Bernadette aufgegeben.
»Smuckers freut sich so, Sie zu sehen.« Ich trete ans Bett und setze Smuckers neben ihr ab. Er leckt Bernadette über die Finger, und die Liebe, die in ihrem Gesicht aufleuchtet, lässt sie für einen Moment weich aussehen. Wie eine nette Frau.
»Smuckers«, flüstert sie. Sie bewegt die Lippen und redet mit ihm. Ich kann nichts hören, doch ich weiß aus früheren Gesprächen, dass sie ihm sagt, wie lieb sie ihn hat. Manchmal gesteht sie, dass sie ihn nicht verlassen will, dass sie nicht allein sein möchte. Sie hat Angst davor, allein zu sein.
Kraftlos krault sie Smuckers übers Fell, aber ihr Blick ist auf mich gerichtet, und inbrünstig flüstert sie etwas. Ich komme näher. Es hört sich an wie Aubergine.
»Haben Sie Hunger?«
»Aubergine …«, krächzt sie mit schwacher Stimme.
»Ja, Bernadette?«
»Aubergine lässt Ihren Teint …« Sie verzieht das Gesicht, »… wurmartig aussehen.« Sie schafft es, eine unglaubliche Verachtung in das Wort wurmartig zu legen, als hätte ich eine derartige Modesünde begangen, dass sie ihre ganze Kraft aufbringen muss, um es mir mitzuteilen.
»Mist. Ich hatte eigentlich auf schneckenartig gehofft«, erwidere ich scherzhaft, während ich Smuckers ein wenig anders hinsetze, damit er nicht auf ihren Schlauch tritt.
Sie schnaubt und wendet sich wieder ihrem Hündchen zu.
In den drei Jahren, die ich sie jetzt schon kenne, hat mich Bernadette stets für meine Modeentscheidungen kritisiert. Haben Sie das aus einem Sechzigerjahre-Katalog für Bibliothekare, Vicky? Hatte JCPenney Bleistiftröcke im Sonderangebot? Manchmal scheint ihr mein Anblick buchstäblich in den Augen wehzutun, mit meinem uninspirierten Pferdeschwanz und der Brille und so.
Ich habe den Verdacht, dass Bernadette früher einmal richtig viel Geld hatte, dass ihr Vermögen jedoch im Laufe der Jahre geschrumpft ist. Hinweis eins: Ihre Wohnung befindet sich in einer teuren Wohngegend, aber sie ist innen wirklich schäbig, als wäre sie einmal herrschaftlich gewesen, inzwischen allerdings heruntergekommen. Auch ihre Kleider sind abgetragene Versionen von dem, was vor vielleicht fünfzehn Jahren teuer war. Offensichtlich gibt sie für sich selbst kein Geld aus. Aber Smuckers? Für Smuckers ist ihr nichts zu teuer.
Ich nehme ihre Hand und lege sie dorthin, wo Smuckers es am liebsten mag, damit er sich beruhigt.
»Smuckers«, haucht sie.
Ich verspüre den Drang, ihr tröstend eine Hand auf den Arm zu legen, doch menschlicher Kontakt ist nichts, was Bernadette jemals von mir wollen würde.
Eigentlich bin ich nur als eine Erweiterung von Smuckers hier, als Kanal für seine wichtigen Botschaften. Abgesehen davon bin ich überflüssig. Wenn Bernadette mich irgendwie automatisieren oder in einer Sardinenbüchse aufbewahren könnte, an der nur eine Ecke nach oben gerollt ist, damit meine Stimme herausdringt, dann würde sie es tun.
Sie schaut erwartungsvoll zu mir auf. Mir ist klar, was sie will. Was hat Smuckers ihr mitzuteilen?
Ich weiß nicht, was ich sagen soll, oder vielmehr, was Smuckers sagen könnte. Diese Haustierflüsterer-Geschichte war nicht meine Idee, und nun, da sie auf dem Sterbebett liegt, kommt es mir in besonderem Maße falsch vor.
Aber sie wartet und funkelt mich an. Smuckers oder gar nichts.
Ich hole tief Luft und setze meinen Flüstererblick auf, der eigentlich nichts weiter ist als ein aufmerksamer Zuhörerblick. »Smuckers sagt, Sie brauchen keine Angst vorm Sterben zu haben«, fange ich an.
Sie wartet. Sie will mehr.
»Sie sollen wissen, dass alles gut wird, auch wenn es sich im Moment nicht so anfühlt.«
Sie nickt und murmelt Smuckers etwas zu.
Thematisch begebe ich mich hier auf neues Terrain. Bisher hat Smuckers sich auf Lifestyle-Themen beschränkt – bestimmte Arten des Nackenkraulens oder die Geschmacksrichtung seiner Hundeleckerlis. Hin und wieder kommentiert er die Possen der Tauben vor dem Fenster. Doch er hat ganz bestimmt noch nie eine göttliche Weisheit über den Tod oder ein besonderes Verständnis der esoterischen Geheimnisse des Kosmos von sich gegeben.
Aber an Bernadettes Gesicht erkenne ich, dass ihr Smuckers’ Worte gefallen.
»Vicky«, sagt sie zu Smuckers. »Vicky wird sich um dich kümmern.«
»Das werde ich, Bernadette«, bestätige ich. »Ich kümmere mich um Smuckers, als wäre er mein eigen Fleisch und Blut.«
Natürlich nicht im wörtlichen Sinne. Ich habe nicht vor, mit ihm im Central Park herumzurennen und Gänsescheiße zu fressen.
»Er wird wie ein kleiner König leben«, beteuere ich.
Bernadette murmelt etwas, und ich setze mich in den überraschend luxuriösen, ledergepolsterten Stuhl in dem geräumigen Einzelzimmer, das sie ihr zugeteilt haben. Dies ist der Hospizflügel eines der größeren Krankenhäuser in Manhattan, von dem es in den Nachrichten oft heißt, es sei hoffnungslos überfüllt.
Wahrscheinlich hat sie eine gute Versicherung oder so.
Bernadette krault Smuckers den Hals. »Ich habe dich lieb, Pokey«, flüstert sie.
Ich scrolle leise durch Instagram, ein Ohr ständig auf die Tür gerichtet, aber alles, was ich höre, sind Schritte und gedämpfte Gespräche auf dem Flur, zusammen mit gelegentlichen Durchsagen aus der Gegensprechanlage. Ich möchte, dass dieser Besuch so lange wie möglich dauert.
Ja, Smuckers wird wie ein kleiner König leben, jedoch vielleicht nicht gerade wie der König eines wohlhabenden Landes. Eher wie der König einer verarmten Nation, aber immerhin einer, die ihren König liebt. Das ist das Beste, was ich für ihn tun kann.
Vor zwei Wochen, am Tag bevor Bernadette ins Krankenhaus kam, habe ich Smuckers mit zu mir nach Hause genommen. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass das tiefgekühlte rohe Fleisch, das er bekommt, teurer ist als gesponnenes Gold, und ich kann nur erahnen, was es kostet, bei seinem monatlichen Fixtermin im oben genannten Hundesalon, in dessen Wartebereich ein echter Warhol von einem Pudel hängt, seine Wattebauschfrisur auffrischen zu lassen.
Das soll sich jeder selbst ausrechnen.
Also, nein, ich kann mir nicht vorstellen, Smuckers genau das Leben zu bieten, an das er gewöhnt ist. Ich sorge für meine kleine Schwester Carly, seit sie neun Jahre alt war, und sie soll alles haben, was ich mir nie leisten konnte. Sie soll sich sicher fühlen und große Träume haben.
Und wenn noch Geld übrig ist für eine fabelhafte Föhnfrisur, dann ist sie diejenige, die auf dem Frisierstuhl sitzt, und sie muss man dafür auch nicht festbinden wie den armen Smuckers.
Carly ist jetzt sechzehn. Es ist schwer, in Manhattan einen Teenager großzuziehen, aber irgendwie schaffen wir es, dank meines Etsy-Shops für flippiges Hundezubehör. Irgendwann werde ich auch Damenschmuck designen, doch im Augenblick verkaufe ich vor allem paillettenbesetzte Hundehalsbänder mit Fliege.
Bernadette bewegt die Lippen. Nichts kommt heraus, außer dem Wort allein. – Ich will nicht allein sein.
Ich spüre einen Stich im Herzen.
Es ist merkwürdig, wie sich ein langes Leben auf ein abgedunkeltes Krankenzimmer, eine Fremde, die durch Instagram scrollt, und einen kleinen weißen Hund reduzieren lässt.
Aber wahrscheinlich auch nicht merkwürdiger, als dass ich hier die Rolle des Haustierflüsterers spiele, was ich nie im Leben vorhatte, und wofür ich hundertprozentig meine Freundin Kimmy verantwortlich mache.
Kimmy hatte ein Fest organisiert, um Spenden für ihr Tierheim zu sammeln, und sie war es auch, die mich flehentlich ansah, einen bunten Schal und Ohrringe in der Hand, als der echte Haustierflüsterer nicht auftauchte.
Denk dir einfach irgendwas aus, sagte sie. Das wird lustig.
Ich ließ Carly an meinem Stand mit dem Hundezubehör allein und legte mir den Schal um.
An diesem Tag erzählte ich, was mir in den Sinn kam. Viele Haustiere beklagten sich über ihr Futter. Die meisten wünschten sich, dass ihre Besitzer mehr mit ihnen spielten. Manchmal, wenn die Begleitperson traurig erschien, drückte das Haustier intensive Anteilnahme und Liebe aus. Ich denke, egal, wer Sie sind, Ihr Haustier liebt Sie.
Manchmal erzählte ich, wie sehr es den Haustieren gefiel, wenn die Besitzer mit ihnen sprachen oder ihnen vorsangen, denn mal ehrlich, redet nicht jeder mit seinem Tier oder singt ihm vor?
Dann kam Bernadette, stählern und entrüstet, und donnerte den Gehstock neben ihrem winzigen, energischen Schoßhund auf den Bürgersteig.
Sie warf zwei Fünf-Dollar-Scheine auf den Tisch und verlangte zu hören, was Smuckers ihr mitteilen wollte. Ich konnte beim besten Willen nicht erkennen, ob sie mich entlarven oder ob sie es wirklich wissen wollte.
Also nahm ich den kleinen Hund auf den Schoß, rieb ihm die flauschigen Ohren und fing an zu reden. Im Laufe meines Nachmittags als Haustierflüsterer hatte ich eines festgestellt: Je mehr man den Leuten schmeichelt, umso eher kaufen sie es einem ab.
Smuckers liebt Sie sehr, erzählte ich ihr. Sie glauben, Sie seien zu langsam für ihn, doch das ist ihm egal. Er liebt Sie. Und am liebsten hört er Sie singen. Sie können vielleicht nicht mit ihm herumrennen, aber Sie sollen wissen, dass er Ihren Gesang ganz wunderbar findet. Er sagt, Sie sind schön, wenn Sie singen.
Als ich aufblickte, strahlten ihre Augen. Sie glaubte mir tatsächlich. Bis zu diesem Augenblick hatte ich mich nicht wie eine Betrügerin gefühlt. Sie wollte meine Visitenkarte haben, aber ich erklärte ihr, das alles sei nur Spaß. Sie glaubte mir nicht. Als wollte ich ihr meine Karte aus bösem Willen vorenthalten.
Ich versicherte ihr, sie müsse Smuckers nur genau genug beobachten, dann könne sie das auch. Sie antwortete schnippisch irgendetwas von Nicht jeder von uns ist ein Tierflüsterer und versuchte anschließend, von anderen anwesenden Personen meine Kontaktdaten zu bekommen. Da sie sie ihr nicht geben wollten, beleidigte sie sie.
Als sie schließlich ging, wähnte ich mich in Sicherheit, aber New York hat die Angewohnheit, die Leben von beliebigen Menschen miteinander zu verknüpfen. Und Sie können sicher sein, dass ausgerechnet die Person, der Sie in dieser Millionenstadt auf keinen Fall begegnen wollen, garantiert dort als Stammgast auftauchen wird, wo Sie arbeiten oder einkaufen. In Bernadettes Fall war es die Bank, an der wir auf dem Weg zu Carlys Schule unweigerlich vorbeikamen.
Ich blicke von Instagram auf und sehe Smuckers an der Bettkante, als wolle er hinunterspringen. Ich gehe zu ihm und kraule ihm kräftig die Ohren. Er dreht sich einmal um sich selbst und legt sich wieder hin.
Als ich das letzte Mal hier war, kam ein Priester herein und bot an, ein paar Worte zu sprechen, doch Bernadette nannte ihn eine Kanalratte und jagte ihn aus dem Zimmer. Kanalratte ist eine ihrer Lieblingsbeleidigungen für Nachbarn, Postboten, Verkäufer und die ständig wechselnde Schar von Dienstmädchen, die sie um sich hat.
Aber nie für Smuckers. Ich bleibe an ihrem Bett und habe riesiges Mitleid mit ihr.
»Smuckers möchte, dass Sie keine Angst haben«, verkünde ich. »Smuckers sagt, Sie sind nicht allein und werden es auch nicht sein.«
Sie bewegt die trockenen Lippen. Ich würde ihr so gerne eine Möglichkeit geben, damit sie keine Angst haben muss, aber das ist in ihrer Situation ziemlich unvermeidlich. Ganz egal, welcher Religion man angehört, das Unbekannte ist immer beängstigend, und der Tod ist die ultimative Unbekannte.
Genau in diesem Moment schleicht sich eine Krankenschwester herein. Sie entdeckt Smuckers, bevor ich die Decke über ihn werfen kann, wie es mir sonst immer geglückt ist. »Sie dürfen hier drinnen keinen Hund haben!«
Ich setze mein überraschtestes Gesicht auf. »Davon haben die anderen Schwestern gar nichts gesagt …« Die haben den Hund ja auch nicht gesehen.
»Das Tier muss hier raus.«
»Hauen Sie ab«, befiehlt Bernadette heiser.
»Es tut mir leid«, sagt die Schwester. »Tiere sind nicht erlaubt.«
Ich gehe zu ihr. »Bitte«, flüstere ich. »Der Hund ist alles, was sie noch hat. Seien Sie etwas nachsichtiger mit ihr.«
»Krankenhausvorschriften.«
Ich werfe einen Blick zurück zu Bernadette, die sich nervös an Smuckers’ Fell klammert, etwas, das Smuckers nicht allzu lange erdulden wird. Deshalb gehe ich zu ihr und lege meine Hand beruhigend auf ihre, damit sie damit aufhört.
»Nur noch ein paar Minuten«, flehe ich. »Wenn er ein Therapiehund wäre, dürfte er hier sein. Können Sie nicht einfach so tun, als wäre er ein Therapiehund? Ich meine, im Grunde ist er doch einer.«
»Das Tier muss hier raus.«
»Noch ein paar Minuten.«
Sie dreht sich um und geht weg. Security.
Ich wende mich an Bernadette. »Das Tier«, sage ich. »Bitte.«
Aber sie hat nur Augen für Smuckers. Ihr Atem geht unregelmäßig. Sie regt sich auf.
Die Security wird uns rausschmeißen, und ich werde Smuckers wahrscheinlich nicht noch einmal hier hereinschmuggeln können. Was bedeutet, dass Bernadette Smuckers heute zum letzten Mal sieht, und vermutlich weiß sie das auch.
Ich bin traurig und hilflos, habe aber auch das Gefühl, dass jetzt alles von Bedeutung ist. Als hätte ich einen wichtigen Job als falscher Haustierflüsterer zu erledigen.
Dann erfinde ich die Geschichte.
»Smuckers möchte Ihnen etwas sagen, Bernadette«, setze ich an. »Er hat Ihnen das noch nie erzählt, aber jetzt ist es an der Zeit.«
Sie bewegt die Lippen. Nichts kommt raus, aber ich weiß, was es ist.
Schießen Sie los.
Das sagt sie jedes Mal, wenn ich verkünde, dass Smuckers etwas Wichtiges zu kommunizieren hat.
Immer wenn ich Smuckers’ Gedanken kanalisiere, benutze ich das neugierige Zuhörergesicht und ändere ein kleines bisschen meine Stimmlage. Ich hasse es, wenn mein Wassernapf leer ist, Bernadette. Manchmal bin ich sehr durstig! Oder: Du solltest diesen zwielichtigen Handwerker nicht mehr reinlassen, Bernadette, es sei denn, jemand, dem du vertraust, ist bei dir. Ich mag ihn nicht besonders. Das Futter im Kühlschrank riecht sehr eklig. Vielleicht ist es alt.
Smuckers benutzt das Wort sehr ziemlich oft.
Neben den Haushaltsangelegenheiten ist Smuckers auch für moralischen Zuspruch gut. Deine geblümten Blusen sind sehr hübsch. Bitte zieh die Vorhänge auf, Bernadette, ich liebe es, die Vögel zu beobachten. Ich bin sehr glücklich, wenn du singst.
Bernadettes Gesang war eine große Leidenschaft von Smuckers, jedenfalls mir zufolge. Und wie sich herausstellte, war Bernadette tatsächlich eine recht gute Sängerin, nach allem, was ich in den drei Jahren, in denen ich mit ihr zu tun hatte, von ihr gehört habe.
»Das ist sehr wichtig. Hören Sie mir zu? Smuckers will, dass Sie wissen, dass er einen Bruder hat. Einen Zwilling.«
Bernadette beruhigt sich offenbar. Sie hört zu.
»Die Erinnerung tut Smuckers sehr weh. Sein Zwillingsbruder starb als Welpe. Er hieß Licky Lickardo.« Bernadettes Mundwinkel zucken.
Gefällt ihr der Name? Sie war seinerzeit ein großer Fan von I Love Lucy.
»Welcher Schwachkopf hat ihm denn den Namen gegeben?«, krächzt sie.
Oh. »Ähm … Das ist unwichtig. Licky Lickardo wohnt auf der anderen Seite. Er sieht genauso aus wie Smuckers. Smuckers hat Licky alles über Sie erzählt. Licky braucht ganz dringend einen Freund, und er wartet auf der anderen Seite auf Sie. Direkt hinter dem Licht. Und er ist genau wie Smuckers. Sie werden bestimmt glauben, es sei Smuckers. Und Sie werden seine Gedanken verstehen. Mich brauchen Sie dafür nicht.«
Ich habe einmal von diesem antiken Inselstamm gelesen, bei dem ein König, wenn er starb, seine Königin und seine Diener und Haustiere töten und mit sich begraben ließ, in dem Glauben, dass sie ihn dann ins Jenseits begleiten würden.
Diese Licky-Lickardo-Geschichte erfüllt einen ähnlichen Zweck – aber auf eine weniger grausame Art und Weise: Sie bekommt das Haustier und die speziellen Flüsterdienste im Jenseits oder woran auch immer sie glaubt, doch der Flüsterer und das Haustier dürfen in Manhattan bleiben.
Tatsächlich scheinen sich Bernadettes Atemzüge zu beruhigen.
»Also, das ist die Abmachung: Ich kümmere mich um Smuckers, wie versprochen, aber Sie müssen Smuckers auch etwas versprechen. Hören Sie mich?«
Sie bewegt die Lippen. Schießen Sie los.
»Smuckers muss wissen, ob Sie sich um seinen Bruder kümmern. Licky ist genau wie Smuckers, Bernadette. Smuckers kann es kaum erwarten, dass Sie ihn kennenlernen.«
An der Art, wie sich ihre Hand verändert, wie sie Smuckers am Hals hält, erkenne ich, dass ihr der Gedanke gefällt.
Ich mache weiter. »Smuckers sagt, Sie werden Licky so sehr lieben. Oh, wow! Er sagt, dass Licky gerade mit dem Schwanz wedelt – er kann es kaum erwarten. Er wedelt wie Smuckers, wenn er Sie kommen sieht.«
Bernadettes Gesichtszüge entspannen sich eindeutig. Ist das falsch? Ich weiß es nicht. Andererseits habe ich mit dieser Geschichte sowieso schon einen weiten Weg auf der falschen Straße zurückgelegt.
»Smuckers hat Ihnen noch etwas Wichtiges zu sagen. Anweisungen! Er sagt, Sie sollen Somewhere over the Rainbow singen, sobald Sie auf der anderen Seite ankommen. Smuckers meint, sie sollen dem Licht folgen, und dann sehen Sie Licky Lickardo, wie er mit dem Schwanz wedelt. Und Sie sollen sofort Somewhere over the Rainbow singen.«
»Was zum Teufel ist hier los?«
Ich erstarre wie das Kaninchen im Scheinwerferlicht – oder vielmehr wie die zu opfernde Jungfrau, gefesselt vom wütenden Blick eines Mannes in einem maßgeschneiderten Anzug, ein mächtiger Prinz, der in der Tür steht, obwohl das Wort stehen es nicht ganz trifft. Er besitzt sie. Dominiert sie. Wie ein rechtmäßiger Gott beherrscht er von der Tür aus die ganze Welt.
Seine braunen Haare sind unglaublich glänzend, mit Gold gesprenkelt, wo sie vom Licht berührt werden.
Irgendwas an ihm ist wie verzaubert, oder vielmehr bösartig verhext. Seine Augen sind kobaltblau. Eisige Dolche, mit denen man töten kann.
Mich töten.
Wie lange steht er schon da?
»Was zum Teufel …«
Bernadette klammert sich wieder fester an Smuckers.
»Pssst«, flüstere ich und lege einen Finger auf die Lippen.
Er richtet sich auf, als wäre Pssst ein ungewohnter Befehl für seine Ohren, und vermutlich ist es das auch. Er ist kein Typ, zu dem man Pssst macht. »Was setzen Sie meiner Mutter für Flausen in den Kopf?«
Mutter? Ich komme wieder zu mir. Das ist der Sohn?
»Nun …« Ich verschränke die Arme. »Wurde auch Zeit, dass Sie kommen.«
Er runzelt die Stirn und schreitet souverän durch den Raum.
Er erinnert mich an einen rachsüchtigen Gott auf einem dieser alten Gemälde, die im Metropolitan Museum hängen. Derzeitige Stimmung: Erde zerstören! Aber dieser Gott trägt einen Anzug statt fließender Roben. Rachegott 2.0 – die heiße, aber furchterregende Wall-Street-Variante: hart, zielstrebig und todschick.
Es kommt mir unmöglich vor, dass dieser Mann jemals der einsame kleine Junge auf dem Foto auf Bernadettes Kaminsims gewesen sein soll.
Er stellt einen Einwegbecher auf den Tisch neben einen kleinen Stapel leerer Becher. Dort liegen auch mehrere iDings, und über der Stuhllehne hängt ein Herrenmantel aus Kaschmir.
Also ist er schon eine ganze Weile hier.
Er dreht sich zu mir um. »Smuckers sagt, sie soll dem Licht folgen? Er sagt, sie soll Over the Rainbow singen? Ein Bruder namens Licky Lickardo auf der anderen Seite? Würden Sie mir das bitte erklären?«
Ganz bestimmt nicht, denke ich.
Ich drehe mich zu Bernadette um, vielleicht möchte sie es ja an meiner Stelle erklären, aber sie hat die Augen geschlossen. Schläft sie, oder tut sie nur so? Das wäre so typisch für Bernadette. »Bernadette«, sage ich. »Hey, sagen Sie Ihrem Sohn …«
Die Worte bleiben mir im Hals stecken, als er sich nähert und sich von der anderen Seite des Bettes über sie beugt. Er blickt mit einem Gesichtsausdruck auf sie hinab, den ich nicht deuten kann.
»War sie … wach?«
»Ja, klar«, flüstere ich.
»Sind Sie sicher?«
»Ja.«
Er schweigt einen Augenblick, immer noch mit diesem undurchschaubaren Gesichtsausdruck, doch zwischen seinen Augenbrauen bildet sich eine kleine Furche, als grübelte er über irgendetwas nach – über etwas Beunruhigendes oder Verstörendes. Und in diesem Moment sehe ich den Jungen von dem Foto wieder aufblitzen.
»Sie wollte Smuckers sehen«, erkläre ich. »Ich wollte nur … helfen.«
Als er eine Sekunde später zu mir aufschaut, ist der Junge verschwunden. Vielleicht war das Ganze auch nur Einbildung. »Helfen«, spuckt er verächtlich aus, »ist ein lustiger Ausdruck für den Versuch, eine sterbende Frau glauben zu machen, man kommuniziere mit ihrem Hund. Ihr bizarre Botschaften von ihrem Hund auszurichten.« Er holt sein Handy heraus. »Vielleicht können Sie Ihre Hilfe der Polizei erklären.«
Mein Herz pocht. Kommunikation mit ihrem Hund, bizarre Botschaften von ihrem Hund – genau das habe ich getan.
»Sie wollte ihn doch bloß sehen.«
Er schaut mich angewidert an. »Und Sie sind ihr mit Freude behilflich. Weil da etwas für Sie herausspringt.«
Ich setze mich so gerade hin, wie ich kann, denn ich habe nichts Unrechtes getan.
Ich habe nichts Unrechtes getan!
»Sie verbringt gerne Zeit mit Smuckers.« Ich schlucke. »Sie will nicht allein sein.«
»Harry«, sagt er, schlendert in den Flur hinaus und spricht leise. Ist Harry die Polizei?
»Bernadette.« Ich fasse ihre Hand an. »Ich muss gehen, Bernadette.«
Sie rührt sich nicht. Hat sie mich überhaupt gehört?
Der Sohn kommt einen Augenblick später zurück. »Sie sind gleich da.« Sein stahlharter Blick bohrt sich in meinen Bauch wie ein Korkenzieher.
Ich lasse mir von ihm keine Angst einjagen. Vor Jahren habe ich mir geschworen, dass ich mich nie wieder von einem reichen Arschloch einschüchtern oder schikanieren lassen würde – nie wieder.
Also starre ich einfach zurück.
In diesem Moment fällt mir auf, dass er etwas seltsam Vertrautes an sich hat. Er hat diesen klassischen Hollywood-Hauptrollen-Look, zumindest, wenn es in dem betreffenden Hollywood-Film um einen düsteren, aber faszinierenden Geschäftsmann geht. Ginge es in dem Film um einen freundlichen Cowboy, würde dieser Typ wahrscheinlich nicht funktionieren, es sei denn, er würde am Ende böse und eroberte die ganze Stadt.
»Gut«, sage ich. »Sollen sie doch kommen.« Das meine ich nicht so. Das Letzte, was ich brauche, sind die Bullen.
Er blickt böse drein. »Mom«, sagt er und schaut auf sie herab.
Als sie nicht antwortet, entsteht eine peinliche Stille, und ich denke, ich sollte gehen, aber ich will ihr Smuckers nicht wegnehmen.
»Sie haben gesagt, sie war vorhin … bei Bewusstsein?«
Er fragt es beiläufig und ohne aufzublicken.
»Sie hat geredet«, bestätige ich. »Und Smuckers gestreichelt.«
In diesem Augenblick kommt ein kräftiger Glatzkopf in der Uniform des Sicherheitspersonals herein, gefolgt von zwei Krankenschwestern. »Das Tier muss hier raus. Sofort«, knurrt der Wachmann.
Bernadettes Hand liegt auf Smuckers’ flauschigem Rücken.
»Lassen Sie ihn«, bitte ich. »Sie wird so traurig sein.«
Niemand hört mir zu; ihre ganze Aufmerksamkeit gehört dem Sohn, der sich ausgerechnet diesen Moment ausgesucht hat, um das grelle Licht seines Zorns auf den Wachmann und die ihn flankierenden Krankenschwestern zu richten.
Ich hole tief Luft. Ich fühle mich, als hätte ich den Atem angehalten, seit er den Raum betreten hat.
Schweigend neigt der Sohn den Kopf. Er und der Wachmann sind ungefähr gleich groß – der Wachmann könnte sogar etwas kräftiger sein, aber wenn es zu einem Kampf käme, würde ich mein ganzes Geld auf den Sohn setzen. Er strahlt Macht und Selbstvertrauen aus. Er strotzt geradezu davor.
Doch der Wachmann ist auch kein Weichei. Er starrt zurück, voller Testosteron. Es ist, als würde man Animal Kingdom anschauen, die Midtown-Manhattan-Edition.
»Wenn meine Mutter den Hund bei sich behalten will«, erklärt er ruhig, »dann behält meine Mutter den Hund bei sich.«
»Vorschrift ist Vorschrift«, knurrt der Security-Typ. »Sie bringen das Tier hier raus, oder ich bringe es raus und es kommt ins Tierheim.«
Tierheim? Es?
Die blauen Augen des Sohnes funkeln belustigt, als wären die Drohungen des Wachmannes nur ein clowneskes Flüstern in einer Welt, die nur für ihn allein erschaffen wurde.
Er spricht die versammelten Mitarbeiter als Gruppe an. »Wissen Sie nicht, wer das ist?«
Das ist Smuckers, ihr Penner!, denke ich.
Die genervte Krankenschwester verschränkt die Arme. »Das ist mir egal. In dieser Einrichtung sind Haustiere nicht erlaubt.«
Ich richte meine Aufmerksamkeit auf den Sohn. Ich mochte ihn nicht, als er seinen eiskalten Blue-Magnum-Blick auf mich gerichtet hat, aber in diesem Moment ist seine Arschloch-Power auf meiner Seite, oder zumindest auf der Seite von Smuckers.
»Das ist Bernadette Locke, Vorsitzende der Locke-Foundation, der Stiftung, die diesen Flügel finanziert hat, die medizinische Lehr- und Forschungseinrichtung auf der anderen Seite des Skyways und wahrscheinlich auch Ihre Gehaltsschecks.«
Ich richte mich auf. Was?
Noch mehr Leute kommen ins Zimmer, darunter auch eine Frau, die offensichtlich eine Art Verwalterin ist. »Henry Locke«, begrüßt sie ihn und ergreift seine Hand. Sie entschuldigt sich für das Missverständnis, indem sie Worte des Mitgefühls, der Bewunderung und Dankbarkeit ausspricht. Wenn er einen Ring hätte, würde sie ihn küssen. Sie würde ihn abknutschen.
»… und natürlich kann Mrs Locke ihren Hund so lange bei sich behalten, wie es ihr gefällt«, fährt sie fort. »Es tut uns wirklich aufrichtig leid – wir hatten keine Ahnung, dass die Spätschicht nicht informiert war …« Sie murmelt weiter jede Menge Entschuldigungen.
»Danke«, sage ich. »Das ist wirklich sehr freundlich.«
Alle sehen mich an, als wollten sie sagen: Was macht die denn noch hier?
Der Sohn zeigt auf mich. »Sie! Raus hier!«
»Moment! Ich habe Bernadette versprochen, auf Smuckers aufzupassen. Sie hat mich ausdrücklich gebeten, mich um ihn zu kümmern, wenn sie … na ja …«
Er atmet genervt aus und hält mir seine Hand hin. »Karte.«
Ich schnappe mir mein Portemonnaie und reiche ihm meine Etsy-Visitenkarte, dann ziehe ich schnell meine Hand aus seiner Reichweite, aus seiner prickelnden Umlaufbahn.
Die Visitenkarte zeigt einen grimmigen Schäferhund, der eine Fliege aus rosa Pailletten trägt.
Henry Locke blickt sie einen langen Moment finster an. Wirklich finster.
Ich glaube, er stellt sich all die Dinge vor, die er tun würde, sobald ihm jemand ein Hundehalsband mit Fliege anlegen wollte. Und ich schätze, keines dieser Szenarien endet damit, dass das Fliegen-Hundehalsband noch in irgendeiner Weise als Fliegen-Hundehalsband zu erkennen ist.
»Sie will sichergehen, dass Smuckers ein Zuhause hat und …«
»Ich weiß, was Ich kümmere mich um Smuckers bedeutet«, unterbricht er mich. »Wir schicken Ihnen Smuckers mit einem Wagen.«
Einen Wagen. So hat Mrs Locke es immer ausgedrückt. Ich schicke einen Wagen. Ich dachte die ganze Zeit, sie meinte Uber oder ein Taxi.
Aber jetzt geht mir auf, dass Bernadette Locke in eine ganz andere Welt gehört als ich, und in ihrer Welt ist ein Wagen eine Limousine.
2
Zwei Wochen später
Vicky
Beinah reagiere ich gar nicht auf das Schnarren der Türklingel. Ich erwarte niemanden. Und wer taucht schon einfach so auf und klingelt? Ein Besoffener oder ein Irrer, sonst niemand.
Meine Schwester Carly ist mit Haarstyling-Operationen beschäftigt, die komplexer sind als eine Space-X-Mission, und erfüllt so eifrig ihre Pflicht als Sechzehnjährige, uns zu spät kommen zu lassen. Die Klingel schnarrt wieder und wieder. Smuckers bellt.
Ich hebe ihn hoch. »Pssst.« Genau genommen dürfen wir keinen Hund in der Wohnung halten.
Carly geht an die Tür. »Für dich«, ruft sie.
Ich drücke auf den Knopf der Gegensprechanlage. »Hier ist Vicky.«
»Einschreiben für Smuckers, wohnhaft bei Vicky Nelson.«
»Ein Brief für Smuckers?«
»Ja. Wohnhaft bei Vicky Nelson.«
In meinem Kopf erscheint ein Mengendiagramm.
Der Kreis mit meinen Freunden, die sich so einen bescheuerten Witz ausdenken würden, überschneidet sich nicht mit dem Kreis mit denjenigen, die so früh schon wach sind. »Nein, danke«, sage ich.
Schnarrrrrr.
»Es steht hier auf dem Umschlag«, verkündet die Stimme. »Smuckers, wohnhaft bei Vicky Nelson. Von der Kanzlei Malcomb, Malcomb und Miller.«
Vielleicht, geht mir auf, hat sich Bernadette doch an ihr Versprechen erinnert, für Smuckers’ Unterhalt aufzukommen. Sie hat es erwähnt, als sie mich gebeten hat, für ihn zu sorgen, nachdem sie die Diagnose bekam. Kümmern Sie sich um meinen Schatz. Ich werde Ihnen die Unkosten erstatten.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie das auch durchziehen würde. Bernadette hat in ihrem Leben eine Menge versprochen. Versprechungen zu machen gefiel ihr besser, als sie auch tatsächlich einzuhalten.
Ich hatte nicht angeboten, mich um Smuckers zu kümmern, um daran etwas zu verdienen. Das Hündchen war Carly und mir über die Jahre einfach ans Herz gewachsen. Ich brachte es nicht über mich, ihn in ein Tierheim zu stecken, wo man sein flauschiges kleines Gesicht nicht lieben würde.
Aber was, wenn doch?
»Ich komme.«
Ich wirble herum und mustere Carly. Sie ist immer noch nicht fertig. »Ich bringe Smuck runter. Wir kümmern uns darum und warten auf dich. Fünf Minuten.« Ich werfe einen Blick in die Ecke, wo Buddy, der Papagei, mich vorwurfsvoll ansieht. »Und füttere Buddy!«
Ich trage Smuckers alle sechs Stockwerke nach unten. Mit Treppen hat er es nicht so.
Nach dem Tag im Krankenhaus mit Henry Locke habe ich Bernadette nicht mehr gesehen. Sie starb wenig später, und Henrys Assistent rief mich an und benachrichtigte mich, dass Smuckers zu mir gebracht werden würde. Er kam tatsächlich in einer Limousine. Carly und ich haben uns schlappgelacht, als wir seine pelzige kleine Schnauze auf dem Rücksitz des schicken schwarzen und sauteuren Fahrzeugs gesehen haben.
Instagram!
Ich ging nicht zu Bernadettes Beerdigung. Ich war nicht eingeladen – aber nachdem ich diesen sturen Hund Henry Locke kennengelernt hatte, hatte ich damit auch nicht gerechnet.
Carly liegt mir die ganze Zeit in den Ohren, ich solle Henry ausfindig machen und ihn darauf festnageln, dass er Bernadettes Versprechen einhält, für Smuckers’ Unterhalt aufzukommen. Und jedes Mal antworte ich ihr, eher würde ich einen Job im Glory Daze Massagesalon annehmen, als Henry um Geld zu bitten. Das Glory Daze gibt es wirklich in der heruntergekommenen Wohngegend in der Bronx, wo wir gewohnt haben, bevor wir unseren sehr süßen Langzeit-Wohnungs-und-Papageiensitting-Auftrag angenommen haben. Und es ist genau das, wonach es sich anhört.
Ich werde Henry niemals um irgendetwas bitten.
Henry ist einer von diesen reichen, privilegierten Arschlöchern, denen ich seit Jahren aus dem Weg zu gehen versuche.
Vor der Haustür treffe ich auf einen Kurier. Er reicht mir einen großen Umschlag und will eine Unterschrift von mir. Ich bedanke mich und lege Smuckers die grüne Leine an, die zu der heutigen grünen Fliege passt.
Während er einen Haufen neben seinen mit Graffiti beschmierten Lieblingslaternenpfahl macht, öffne ich den Umschlag. Ich bin enttäuscht, als ich nur ein Schreiben darin finde. Keinen Scheck.
Na gut. Ich gehe mit Smuckers zur nächsten Ecke, um den Kotbeutel in den Mülleimer zu werfen. Er schnuppert an dem kleinen Zaun um das verkrüppelte Bäumchen, untersucht eine schlammige schwarze Pfütze mit gelblichen Stücken drin, die hoffentlich eine zertretene Eiswaffel sind, und stupst mit der Nase einen zusammengeknüllten Kaffeebecher an. Als wir damit fertig sind, setzen wir uns auf die oberste Stufe der Vortreppe, gerade außerhalb des Menschenstromes, der an uns vorbeihastet, und ich fange an zu lesen.
Es dauert eine gute Minute, bis mir klar wird, dass das nicht irgendein Brief ist. Es ist die Einladung zur Testamentseröffnung von Bernadette Locke.
»Das wäre ja auch zu einfach gewesen«, sage ich zu Smuckers, den es schon wieder zu der verdächtigen möglichen Eiswaffel zieht.
Eine junge Frau mit wilden, magentafarbenen Haaren und einer blonden Strähne an der Seite kommt an uns vorbei, und Smuckers gibt seine Futtersuche zugunsten von Streicheleinheiten der Fremden auf, die er auch bekommt.
Carly kommt aus dem Haus und strahlt die Frau an. »Ich liebe Ihre Frisur! Die will ich auch!« Die Frau lächelt und geht weiter, Carly macht heimlich ein Foto von ihr. »Hast du das gesehen?«, fragt Carly. »Genau solche Haare will ich auch.«
»Mmm-hmm«, mache ich.
»Es gibt diesen süßen Salon auf der Eighty-Fourth Street, wo sie so was machen. Bess lässt sich dieses Wochenende die Haare pink färben, und ich denke auch über eine Veränderung nach …« Sie zwirbelt eine rote Locke. »So etwas mit Pink und Gelb …«
»Du kennst die Regel.«
»Aber ich möchte es mit Bess zusammen machen. Und sie will bestimmt nicht warten.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Einundzwanzig Tage Abkühlungsfrist. Für alle größeren finanziellen und optischen Entscheidungen.«
»Bunte Haare sind ja nicht wirklich etwas Großes.«
»Meinst du? Haare in zwei verschiedenen Bonbonfarben ist nichts Großes?«
Sie schmollt.
Ich schnappe mir ihren Rucksack. »Na, komm. Das ist unsere Abmachung.«
»Das ist ungerecht. Du triffst nie irgendwelche finanziellen oder optischen Entscheidungen. Bei dir bleibt einfach alles gleich.«
»Das ist die Abmachung. Ende der Durchsage.«
Wir eilen über den überfüllten Gehweg, weichen gekonnt Leuten aus, die auf ihre Smartphones starren, und umschiffen mit der Präzision einer Kampfjet-Flugstaffel bummelnde Touristen.
»Ich werde Bess einfach bitten, noch einundzwanzig Tage zu warten, und dann machen wir es zusammen«, verkündet sie, als wir wieder aufeinandertreffen.
Ich schaue sie an.
»Was?«, fragt sie.
»Das ist eine Zusage. Wenn du zu deinem Wort stehst, und das tun wir, dann ist eine Zusage fast das Gleiche, wie es sofort zu tun. Du sagst Bess, sie soll warten, damit ihr es zusammen machen könnt?« Das Thema hatten wir schon so oft. »Wir beide, wir stehen zu unserem Wort.«
Sie schnaubt. Aber das ist unsere Abmachung, und das weiß sie auch.
Wir zwei Schwestern halten unser Wort. So ist das.
Außerdem hat dieser Pakt sie schon von einigen fehlgeleiteten Tattoos abgehalten.
»Was wollte der Kurier? Ging es um Smuckers’ Taschengeld?«
»Wer weiß?«, antworte ich. »Vielleicht hat sie das Hundefuttergeld in ihr Testament aufgenommen. Ich muss mir einen Nachmittag frei nehmen und einmal quer durch die halbe Stadt fahren, um es herauszufinden. Reiche Leute haben einfach keine Vorstellung vom Leben.«
Carly fasst eine weitere topmodische Frau mit grellbunten Haaren ins Auge und wirft mir einen Seitenblick zu.
»Schleck!«, sage ich, das ist unsere schwesterliche Version von Leck mich.
Doch im Grunde genommen wünsche ich es mir genauso für sie: dass sie sich um nichts anderes Sorgen zu machen braucht als um Frisuren und Popmusik und die beste Technik, wie man ein Selfie ausleuchtet. Ich kämpfe dafür, dass sie das bekommt. Sie hat beschlossen, Schauspielerin zu werden, aber sie muss warten, bis sie in der zwölften Klasse ist, bevor sie auch in außerschulischen Produktionen mitspielen darf.
Mir ist bewusst, dass ich sie an der kurzen Leine halte. Sie darf nicht bis tief in die Nacht in der Stadt herumstreunen wie andere Mädchen in ihrem Alter. Ich bin eine Helikopterschwester. Aber das ist immer noch besser als unser Wrack von Mutter zu Hause in Deerville.
»Weißt du was?«, sage ich. »Wenn ich den Deal mit Saks bekomme, gönnen wir uns jede eine Zweihundert-Dollar-Frisur.«
»Ich nehme dich beim Wort.«
Den Einkäufern hat meine Damenschmuckkollektion gefallen. Gelassene Eleganz, so haben sie sie genannt, und das stimmt. Es ist nicht das ausladende, wilde, quietschbunte Zeug, zu dem ich mich früher hingezogen gefühlt habe, doch damit bin ich zufrieden. Heutzutage geht es in meinem Leben mehr darum, unterm Radar zu fliegen. Nicht aufzufallen.
Ich würde alles dafür tun, um mich von damals zu distanzieren. Vor sieben Jahren war ich einen Sommer lang Amerikas meistgehasster Teenager, damals, als ich noch Vonda O’Neil war. Das Mädchen, das gelogen hat. Dabei war alles wahr.
Niemand hat mir geglaubt.
Carly hasst meine Kleider noch viel mehr als Bernadette. Du stehst nicht mehr vor Gericht, sagt sie immer. Du kannst aufhören, wie eine Nonne zu leben. Du brauchst diese end-langweiligen Sachen nicht mehr zu tragen.
Aber die Bleistiftröcke und die dunklen Strickjacken, die meine Anwältin mir empfohlen hat, sind mir ans Herz gewachsen. Und nur fürs Protokoll: Sie sind nicht end-langweilig. Sie strahlen Vertrauenswürdigkeit aus, und das ist mir wichtig.
Wie dem auch sei, mit meiner Schmucklinie muss ich nur noch eine wichtige Hürde nehmen: die Produktmanagerin von Saks überzeugen. Ein Großauftrag würde einen riesigen Unterschied machen. Carly weiß nicht, dass wir tatsächlich von der Hand in den Mund leben; wir haben immer noch Schulden von zwei Jahren Zahnspange, aber das werde ich ihr nicht erzählen. Ich will sie nicht nur vor Mom beschützen, ich will sie vor allem beschützen.
»Geht das überhaupt? Den Unterhalt für einen Hund im Testament festzusetzen?«
»Reiche Leute können machen, was sie wollen«, seufze ich, doch dann schlucke ich meine Bitterkeit hinunter. Carly braucht das nicht. Carly hat keinen Grund, reiche, privilegierte Leute, vor allem reiche, privilegierte Männer, so sehr zu hassen wie ich.
Ich bin immer noch darüber erschrocken, dass Bernadette so unglaublich reich war. Es ist ihr gut gelungen, das zu verbergen. Wenn überhaupt, dann wirkte sie, als wäre sie früher einmal reich gewesen. Manchmal frage ich mich, ob sie es vor mir verheimlicht hat, weil sie meine Verachtung für Reiche gespürt hat.
Nach dem Fest im Tierheim tauchte Bernadette plötzlich auf dieser Bank auf, an der Carly und ich unvermeidlich auf dem Weg zu Carlys Schule vorbeikommen mussten. Sie rief uns zu sich und bat um eine Deutung – nur ein paar Eindrücke, verlangte sie manchmal. Und jedes Mal lehnte ich höflich ab.
Carly glaubte schon, sie würde uns nachstellen, weil sie ständig irgendwo auftauchte. Ich bin mir da nicht so sicher, doch sie wurde eindeutig von Mal zu Mal ärgerlicher, weil ich ihr keine Botschaften von Smuckers übermitteln wollte. Sie dachte anscheinend, ich hätte etwas gegen sie persönlich. Die Frau hatte ein wirklich paranoides und argwöhnisches Naturell.
Dann kam der Tag, an dem sie in Schwierigkeiten war, draußen in der Hitze. Wir waren wie üblich auf dem Weg zur Schule, und sie saß halb zusammengesackt auf der Bank, so blass und zerbrechlich. Smuckers hechelte am Ende seiner Leine. Wir blieben stehen, um sicherzugehen, dass es ihr gut ginge. Sie erzählte uns, ihr sei schwindelig, und bat uns, sie nach Hause zu begleiten.
Ihr Haus entpuppte sich als ein prächtiges Vorkriegsgebäude nur ein paar Blocks entfernt. Wir halfen ihr auf, brachten sie nach Hause und versorgten sie mit Flüssigkeit. Kaum war sie wieder ganz sie selbst, bot sie mir Geld für eine Hundeflüsterer-Sitzung.
Da sah ich Smuckers’ knochentrockenen Wassernapf.
»Okay, eine kurze Gratislesung«, stimmte ich zu.
Carly riss die Augen auf, als ich Smuckers von der Leine ließ und ihn hochhob. Ich legte ihm eine Hand auf Kopf, wie ein Vulkanier bei der Gedankenverschmelzung, und schloss die Augen. So durstig. Ich brauche viel Wasser. So sehr durstig, Bernadette.
Bernadette wirkte ziemlich entsetzt, als sie auf Smuckers leeren Wassernapf hinabblickte. Ich bat Carly, ihn aufzufüllen, und danach machten wir, dass wir so schnell wie möglich rauskamen.
Das war mein erster Schritt auf dem dünnen Eis, ein Haustierflüsterer zu sein.
Bernadettes nächster Schachzug war meisterhaft. Von einer anderen Bank aus entdeckte sie Carly mit einigen Freundinnen beim Frisbee-Spielen im Park. Sie fragte sie, ob sie mit Smuckers für dreißig Mäuse Gassi gehen würde – nur einmal um den Park herum.
Carly sprang darauf an und lud ihre Freundinnen anschließend zu Frozen Yogurt ein. Ein paar Tage später kam die große Anfrage: Bernadette wollte, dass Carly Smuckers regelmäßig ausführte, leicht verdiente dreißig Dollar. Zweifellos ahnte sie, wie gerne Carly annehmen wollte, und vermutlich war ihr klar, dass ich Carly nicht allein mit dem Hund durch die Straßen von Manhattan ziehen lassen würde.
Zuerst erlaubte ich es nicht, aber schließlich gab ich nach, nachdem ich Carly dazu überredet hatte, jeweils fünfundzwanzig von dreißig Dollar fürs College zurückzulegen. Außerdem ist Gassigehen ja eine legale Dienstleistung, ganz im Gegensatz zum Haustierflüstern. Besonders für Bernadette.
Von da an legten wir auf dem Heimweg von Carlys Schule jedes Mal einen Zwischenstopp bei Bernadettes Wohnung ein. Wir schnappten uns Smuckers und machten ein oder zwei Besorgungen. Manchmal nahmen wir ihn mit, um den Pantomimen in unserem Viertel zuzuschauen. Sie tun uns leid, denn sie sind eigentlich vollkommen untalentiert, aber sie freuen sich immer auf eine lustige Pantominenart, wenn Smuckers auftaucht.
Nach und nach begann Smuckers, Bernadette sicherheitsbewusste oder moralisch erbauliche Botschaften zu übermitteln. Sie war so allein, und Smuckers war der Einzige, auf den sie hörte. Es kam mir vor wie ein Dienst an der Menschheit.
Manchmal fragte ich mich, ob Bernadette spürte, was wir gemeinsam hatten – meine Vergangenheit als eine von allen gehasste Mediensensation und ihre Gegenwart als ein verachteter Bestandteil der Nachbarschaft.
So oder so, mit dem Geld tat sie Carly und mir einen Gefallen. Auch deshalb habe ich bisher nicht auf mehr Unterhalt für Smuckers gedrängt.
Na gut, ich habe seine Ernährung von tiefgefrorenem rohen Kaninchenfleisch auf ein armseliges Supermarktfutter umgestellt, und das, was einer Föhnfrisur in einem Hundesalon mit einem echten Warhol am nächsten kommt, ist eine knallbunte Hundebürste, die ihm durchs Fell gezogen wird, aber dafür hat Smuckers ein tolles Leben und bekommt jede Menge Aufmerksamkeit von Teenagern.
Ich beschließe, dass ich trotzdem zur Testamentseröffnung gehen werde, denn wenn Bernadette Geld für Smuckers hinterlassen hat, damit er weiterhin zu seinem speziellen Hundefriseur und Tierarzt und so weiter gehen kann, na ja, dann habe ich eben ein Schnäppchen gemacht.
Zum Glück ist die Testamentseröffnung in der nächsten Woche während der Schulzeit. Sie findet auf der Upper East Side statt, und in dem Brief wird ausdrücklich Smuckers Anwesenheit verlangt. Ich bürste ihn besonders sorgfältig, lege ihm ein adrettes, mit schwarzen Pailletten besetztes Fliegenhalsband um, setze ihn in seine geblümte Tragetasche und mache mich auf den Weg. Unterwegs zur U-Bahn-Station werfe ich den Pantomimen einen Dollar in den Hut. An der Haltestelle Lexington Avenue/59th Street steige ich aus und muss noch ein paar Blocks laufen. Ich habe extra ein bisschen mehr Zeit eingeplant, damit ich kein Geld für ein Taxi verschleudern muss.
Es ist kühl für Anfang September – der Herbst liegt eindeutig in der Luft. Das Navigationssystem auf meinem Smartphone führt mich tiefer und tiefer in eine Gegend, in der ich noch nie zuvor war, auch wenn ich eher geneigt bin, es ein verwunschenes Tal zu nennen. Die Bäume sind riesig und gesund, die Straßen sauber, und die Gebäude umgibt ein märchenhafter Glanz. Wird gleich etwa ein Einhorn aus dem Laub springen?
Ich komme bei der im Brief angegebenen Adresse an, die sich als regelrechte Villa ausgerechnet aus weißem Marmor entpuppt. Ich gehe die Auffahrt entlang, steige die seltsam makellose Treppe hinauf und trete durch eine Tür aus Facettenglas ein.
Im Inneren erwarten mich kostbare Teppiche und kunstvolle Holzschnitzereien, sogar an der Decke. Dort nehme ich Smuckers aus seiner Tasche und trage ihn auf dem Arm, während ich mich auf die Suche nach Zimmer 11 mache. Ich bin froh, dass ich den Brief bei mir habe, denn ich fürchte, sonst würden sie mich vielleicht nicht hereinlassen, obwohl ich ein ultra-vertrauenswürdiges Outfit mit einer zarten Obsidian-Halskette, die ich selbst entworfen habe, anhabe.
Zimmer 11 ist voller illustrer Menschen, die vor einer Kulisse aus Kronleuchtern und geschnitztem dunklen Holz herumstehen und sich unterhalten. Es kommt mir vor, als wäre ich in ein Fotoshooting für Dior gestolpert.
Ich erkenne Henry sofort. Er steht nicht wirklich in der Mitte des Raumes, aber er ist definitiv das Gravitationszentrum und zwingt jeden mit seinem arschlochartigen Machtglanz, um ihn zu kreisen.
Die meisten Menschen hier haben die gleichen blauen Augen und die gold gesprenkelten dunklen Haare wie Henry, genauso wie die gebieterische Haltung, obwohl niemand sie so überzeugend zur Schau stellt wie er. Das Ganze erinnert mich an ein Highschool-Mädchen, das einen neuen Stil für sich entdeckt. Alle ihre Freundinnen versuchen ihn zu kopieren, doch keiner steht der Look so gut wie ihr.
Henry bemerkt mich sofort, oder vielmehr funkelt er mich zornig an, als störte ich sein Gravitationsfeld der Eleganz. Und wie auf einen wortlosen königlichen Befehl von Henry drehen sich alle anderen um und funkeln mich ebenfalls an. Und sehen aus, als könnten sie es nicht fassen.
Es ist Henry, der mich anspricht. »Was machen Sie denn hier?«
Mein Magen verkrampft sich. Mein Hals ist wie zugeschnürt. Ich stehe da, winde mich unter Henrys machtvollem Blick, und auf einmal wird mir übel, übel von mir selbst. Wie kommt es, dass ich jetzt wieder hier stehe und mich vor der überwältigenden Kraft von Reichtum und Macht ducke?
Ich bin dankbar dafür, dass ich Smuckers auf dem Arm habe, er ist ein niedlicher Schutzschild in Hundegestalt. Ich drücke ihn fest an mich. »Ich wurde herbestellt. Oder vielmehr Smuckers. Der Brief ging an Smuckers, wohnhaft bei mir. Eine Vorladung, nehme ich an, ist das Wort. Ich weiß es nicht. Es sah so offiziell aus …«
Hör auf, dich um Kopf und Kragen zu reden, sage ich mir. Du hast nichts Unrechtes getan. Er kann dir nichts tun. Halt den Kopf oben.
»Mit anderen Worten, Sie glauben, jetzt sei endlich Zahltag für Sie«, höhnt Henry.
Ich straffe den Rücken. »Tut mir leid, Richie McRichface, wir wurden herbestellt, genau wie Sie alle wahrscheinlich auch.«
Schweigen erfüllt den Raum. Ich blicke mich um.
»Was ist? Hat jemand den Butler mit einem goldenen Kerzenhalter erschlagen?«
Henrys Augen funkeln. Er ist mit jeder Faser der Löwe vor den Toren des Palastes, genau die Art von Mensch, von der ich mich nie wieder herumschubsen oder einschüchtern lassen wollte.
Mit klopfendem Herzen strecke ich ihm den Brief entgegen und fühle mich wie eine Maus, die am Schwanz aus Henrys mächtigem Maul baumelt. Aber das werde ich mir auf keinen Fall anmerken lassen.
Er bleibt vor mir stehen und nimmt mir den Brief ab.
»Wer ist das?«, fragt ein anderer Typ. Noch einer von den Verwandten. Jünger als Henry, so wie es aussieht – vielleicht siebenundzwanzig, während ich Henry auf etwa dreißig schätze.
Henry antwortet nicht, stattdessen prüft er den Brief eingehend.
»Er ist echt«, beteuere ich.
Er dreht das Papier um. Hält es ans Licht. Und plötzlich bin ich wieder sechzehn, alle behandeln mich wie eine Lügnerin und versuchen, mich einzuschüchtern. Werfen mir Dinge vor, die man keinem normalen Menschen vorwerfen würde.
»Also, bitte.« Ich nehme ihm den Brief aus der Hand. »Sie wissen, dass er echt ist, also sparen Sie sich die Mühe.«
»Kennst du sie, Henry?«, fragt der jüngere Verwandte noch einmal.
»Sie war bei Mom im Krankenhaus.« Henry schaut mich an. »Hat behauptet, sie könnte die Gedanken des Hundes lesen.«
Ähm … Was soll ich dazu sagen? Genau das habe ich schließlich getan. Ich nehme Smuckers auf den anderen Arm. »Der Hund hat einen Namen«, sage ich. »Er heißt Smuckers.«
Henry schaut herrisch auf mich herab. »Und jetzt glaubt sie, es sei Zahltag. Also, seit wann hatten Sie meine Mutter in den Fängen?«
Manchmal ist eine Frage nur eine Frage. Und manchmal ist eine Frage ein Finger, der einem kampflustig in die Brust gestoßen wird. So eine Frage ist das, ein herrischer Fingerstoß.
»Ich habe sie weder getäuscht noch hatte ich sie in den Fängen«, erkläre ich. »Ich habe nie irgendetwas von ihr verlangt. Ich habe Smuckers an mich genommen, weil ich ihn mag.«
Der jüngere Verwandte schnaubt, als hätte ich etwas vollkommen Lächerliches gesagt, doch ich bleibe dabei.
»Hat sie mich für einen Hundeflüsterer gehalten? Ja, obwohl ich ihr immer wieder versichert habe, dass ich das nicht bin. Verzeihen Sie, wenn ich das hin und wieder dazu benutzt habe, um ihr zu helfen.«
»Sie meinen wohl, sich selbst zu helfen«, widerspricht Henrys jüngerer, aber ebenso aalglatter Verwandter. »Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass Sie sie mit Ihrer zwielichtigen Hundepsychologie manipuliert haben …« Der Verwandte macht ein Gesicht, als wären die Konsequenzen zu schwerwiegend, um sie laut auszusprechen.
»Was?«, frage ich, mein Herz rast wie verrückt. Ich will es nicht wirklich wissen, allerdings habe ich gelernt, dass man einen Tyrannen festnageln muss. Man darf nicht einfach nur Angst haben. »Was dann?«
Der Henry-Klon zieht die Augenbrauen hoch, als wollte er sagen: