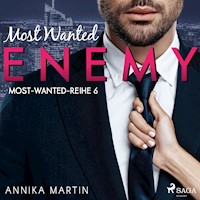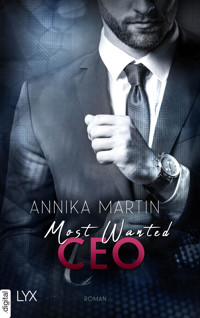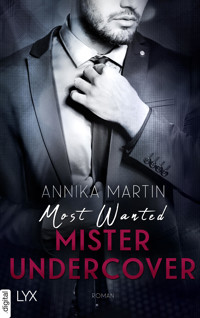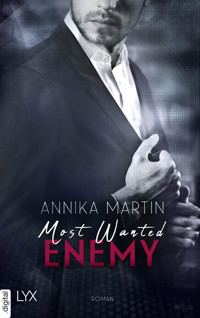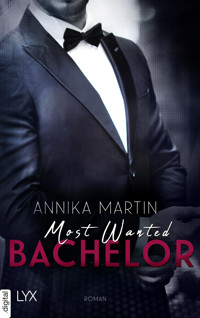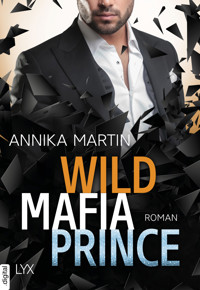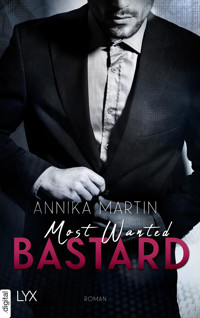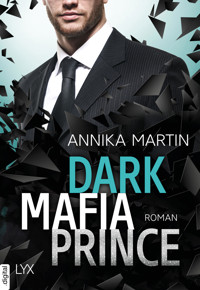6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Most-Wanted-Reihe
- Sprache: Deutsch
Verwechslung mit gewissen Vorzügen ...
Als Briefträgerin Noelle allen Mut zusammen nimmt, um sich bei Malcolm Blackberg zu beschweren, weil ihr Wohngebäude durch das neueste Projekt des einflussreichen CEOs in Gefahr ist, konnte sie nicht ahnen, dass dieser Besuch ihr Leben verändern wird. Statt von seiner Assistentin abgewimmelt zu werden, wird die schüchterne junge Frau für Malcolms Coach zur Aggressionsbewältigung gehalten und direkt in sein Büro durchgelassen. Noelle sieht ihr Chance gekommen, Malcolm auf sanfte Weise doch noch von der Idee abzubringen, ihr Wohnhaus abzureißen, und lässt sich auf ein Spiel ein, das auch noch ihr Herz in Gefahr bringt ...
Band 5 der MOST-WANTED-Reihe von New-York-Times-Bestseller-Autorin Annika Martin
"Ich habe mich völlig in diesem Buch verloren!" PP'S BOOKSHELF
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Annika Martin bei LYX
Impressum
ANNIKA MARTIN
Most Wanted Boss
Ins Deutsche übertragen von Michaela Link
Zu diesem Buch
Als Briefträgerin Noelle allen Mut zusammennimmt, um sich bei Malcolm Blackberg zu beschweren, weil ihr Wohngebäude durch das neueste Projekt des einflussreichen CEOs in Gefahr ist, konnte sie nicht ahnen, dass dieser Besuch ihr Leben verändern wird. Statt von seiner Assistentin abgewimmelt zu werden, wird die schüchterne junge Frau für Malcolms Coach zur Aggressionsbewältigung gehalten und direkt in sein Büro durchgelassen. Noelle sieht ihre Chance gekommen, Malcolm auf sanfte Weise doch noch von der Idee abzubringen, ihr Wohnhaus abzureißen, und lässt sich auf ein Spiel ein, das auch noch ihr Herz in Gefahr bringt …
Auf Jess, Tam und Sandy, meine ursprüngliche Girl Gang!
Global Girls FTW!!
1
Noelle
»Bist du nervös?«, fragt mich Francine, meine Mitbewohnerin. »Ich wäre nervös.«
Ich stecke einen Stift in seinen Halter in der Messenger Bag. Ich drehe ihn, damit er perfekt in die Reihe der anderen Stifte passt, alle in ihren Haltern, schaue lächelnd auf und zeige eine tapfere Miene. »Es ist einfach eine x-beliebige Zustellung, richtig?«
Sie schnaubt. »Ähmmm … ich denke, es ist ein wenig mehr als das!«
Ich zucke die Achseln und betrachte noch einmal meine Stifte-Anordnung, dann lasse ich die Tasche zuschnappen.
Als ich wieder aufsehe, strahlt Francine mich an. Als würde sie denken, ich sei eine Heldin.
Das hilft total.
Ich bin keine Heldin – tatsächlich habe ich Todesangst, aber ich bin unsere letzte Hoffnung. Es wäre wahrscheinlich besser für meine Freundinnen, wenn sie jemand anderen für ihren allerletzten Versuch hätten, unser Zuhause zu retten, aber sie haben mich.
Vielleicht wird er zuhören. Vielleicht wird er seine Abrissbirnen-Pläne noch einmal überdenken. Wenn ich nach sieben Jahren als Briefträgerin eines gelernt habe, dann dass Menschen einen manchmal überraschen, und in den meisten Fällen ist es eine gute Überraschung.
Andererseits geht es bei dem Menschen, über den wir hier reden, um den Geschäftsmogul Malcolm Blackberg – das Böse in Person.
Trotzdem.
Ich öffne meine Tasche wieder und überprüfe sie ein letztes Mal. Zusätzlich zu meinem Portemonnaie und meinem Handy habe ich auch mein iPad dabei, zwei Ersatzladegeräte, zusätzliche Münzen für die U-Bahn und mein Pfefferspray – nicht, dass ich es brauchen würde, aber ich habe mir im Laufe der Jahre angewöhnt, es bei mir zu tragen.
Dann trete ich vor den Spiegel, arrangiere mein sorgfältig gelocktes Haar und binde mir meine braune Lieblingsfliege um.
Francine tritt neben mich. Ihr seidiges schwarzes Haar ist zu einem Ballerina-Dutt frisiert; sie wird heute den ganzen Tag Kurse nehmen und geben. Sie stöhnt beim Blick auf mein Spiegelbild.
»Vergiss es«, sage ich.
Zwei Jahre habe ich hier gelebt, zwei Jahre, in denen meine Freundinnen mich dafür aufgezogen haben, dass ich Fliege trage, wann immer ich in offizieller Funktion etwas zu erledigen habe. Ich weiß, dass sie es total hinterwäldlerisch finden, so etwas hier in der großen Stadt zu tragen. Aber mir gefällt es, weil es praktisch ist – wie eine Kreuzung zwischen einem kleinen Halstuch und einer Krawatte, und ich finde es außerdem hübsch. Vor allem aber bin ich es einfach so gewohnt, und gerade heute muss ich mich unbedingt wohlfühlen.
Ehrlich gesagt, gehe ich nicht gern allein irgendwohin, wo ich noch nie war, wenn ich nicht in meiner Briefträgeruniform des US Post Service stecke. Aber ich habe festgestellt, dass einige andere Outfits für mich genauso gut funktionieren wie meine Uniform – beispielsweise ein Hosenanzug mit einer Fliege. Ich besitze Exemplare in mehreren Farben.
Es gefällt mir, dass eine Uniform das ganze Rätselraten zum Thema Kleidung unnötig macht. Um auszugehen, habe ich einen erwiesenermaßen süßen Rock und ein Twinset, wie es auch meine Freundin Mia trägt – ebenfalls in verschiedenen Farben. Und für daheim habe ich Yogahosen und T-Shirts einer speziellen Marke.
»Ein Modeumerziehungslager mit Armeen von Tyra-Banks-Klonen, die rund um die Uhr nichts anderes tun, als dir diese seltsamen Schleifen austreiben! Das ist es, was wir brauchen.«
»Wir werden sehen«, erwidere ich. »Vielleicht, wenn all das vorüber ist …«
Francines zarte Züge sind voller Traurigkeit und wecken in mir den Wunsch, ich hätte das nicht gesagt.
Alles, was wir über die Zukunft sagen, ist durchdrungen von Traurigkeit – und zwar wegen Malcolm Blackberg. Er hat uns allen letzte Woche Räumungsbescheide geschickt. Der Termin für seine gefürchtete Abrissbirne steht. Unser geliebtes Gebäude wird bald nur noch Schutt sein.
Bewohner des Gebäudes haben versucht, sich mit ihm zu treffen, haben ihn angerufen, E-Mails geschickt und sogar Briefe; wir haben mit Anwälten gesprochen und eine Petition bei der Stadt eingereicht.
Nichts. Niemand scheint in der Lage zu sein, an Mr Blackberg heranzukommen.
Ich bin fest entschlossen, es zu versuchen.
»Vergiss es, du siehst süß aus«, sagt Francine. »Du siehst aus wie die junge Sissy Spacek.« Sie umarmt mich und wünscht mir viel Glück.
Eine U-Bahnfahrt und fünf Häuserblocks später hat die Augustfeuchtigkeit meine Locken geplättet – das kann ich in der glänzenden Reihe von Glastüren auf der Blackberg Plaza deutlich erkennen. Ich halte inne und schaue zu dem sechsstöckigen Gebäude aus poliertem schwarzen Marmor auf. Vom Dach aus erwidern tatsächlich gotische Wasserspeier meinen Blick.
Ich gehöre ebenso sehr hierher wie alle anderen, mache ich mir Mut, obwohl ich wünschte, ich hätte meine Uniform an. Eine Briefträgerin gehört überall hin.
Ich richte mich auf und recke das Kinn vor, dann nehme ich die Schultern zurück – die Pose, zu der ich Zuflucht nehme, wenn ich versuche, mir ins Gedächtnis zu rufen, dass ich mit allem fertig werden kann – und trete in die Lobby.
Innen ist das Gebäude wie eine Kathedrale aus schwarzem Marmor. Die glatten glänzenden Wände werden von Licht aus eleganten schwarzen Wandlampen liebkost, und in der Mitte des Raums befindet sich ein großer Springbrunnen mit einem riesigen gezackten schwarzen Felsbrocken, der vielleicht zwei Stockwerke hoch ist. Ist er ebenfalls aus schwarzem Marmor? Hat Malcolm Blackberg überhaupt etwas Marmor für den Rest der Welt übrig gelassen? Wie hat er den Steinbrocken überhaupt hier hereinbekommen? Hat ein Riese das Dach des Gebäudes abgenommen und den Steinbrocken vom Himmel heruntergelassen? Wasser strömt in glänzenden Bächen an den Seiten des Felsens herab. Stimmen und Schritte erzeugen ein widerhallendes Getöse.
Ich umklammere meine Tasche und marschiere über den polierten schwarzen Marmor. Größeren Menschengruppen weiche ich aus und versuche dennoch, zielstrebig hinüber zu den Aufzügen gegenüber dem Eingang zu gelangen.
Auf halbem Weg bleibe ich vor der Wand mit der Infotafel stehen, um neuen Mut zu fassen und zu zeigen, dass ich hier etwas zu tun habe.
Ich brauche mir die Info-Tafel natürlich nicht anzusehen. Die Adresse gehört zwar nicht zu meiner Route, aber ich weiß, dass es hier sechs Stockwerke gibt. Ich weiß, dass Malcolm Blackbergs Firma, Blackberg Inc., sie alle belegt. Ich kenne ihre Poststelle und ihre Postleitzahl: Ich weiß, dass sie sogar eine eigene vierstellige Ergänzung dazu haben.
Ganz plötzlich verstummt der Lärm. Ist etwas passiert? Ist jemand mit einer Waffe eingedrungen? Hat der Riese erneut das Dach des Gebäudes abgehoben und will seinen Steinbrocken wiederhaben? Ich wirble herum, auf alles gefasst.
Und dann sehe ich ihn.
Sein düster-elegantes Äußeres kenne ich von den wenigen Fotos, die wir von ihm finden konnten. Aber ich glaube, ich hätte ihn auch einfach daran erkannt, dass seine Leute ein kleines Stück hinter ihm gehen, wie Kampfjets, die den grimmigsten und wichtigsten Flieger flankieren.
Dumm und mit rasendem Herzen stehe ich da.
Die Fotos werden ihm nicht gerecht. Sie haben mich nicht auf seine Schönheit vorbereitet. Oder sagen wir besser: seine Furcht einflößende Schönheit.
Sein zurückgekämmtes Haar glänzt schwarz wie die Mitternacht, und die Haut seines aerodynamisch gemeißelten Gesichts scheint vor Gesundheit nur so zu strahlen oder vielleicht vor Ärger – das ist schwer zu unterscheiden. Seine Augen in der Farbe von Tee leuchten mit einer beeindruckenden Intensität, wild entschlossen geht er auf den Aufzug zu. Als sei es nicht genug für ihn, ihn mit seinen zwei Füßen zu erreichen, wie ein Normalsterblicher das tun würde – nein, er muss ihn auch noch mit seinen dunklen, verführerischen Raubtieraugen hypnotisieren.
Er schreitet weiter, seine Beine lang, seine Schritte stark und zielstrebig.
Ich sollte wegschauen, aber ich kann nicht. Das Selbstvertrauen, das er verströmt, fühlt sich wie etwas Körperliches an, ein Phänomen mit Masse und Gewicht, die Selbstsicherheit eines Mannes, der seine Umgebung restlos beherrscht.
Nervös umklammere ich meine Tasche. Warum habe ich gedacht, ich könnte mit einem solchen Mann auch nur sprechen, geschweige denn, ihn dazu bringen, sich etwas auf meinem iPad anzusehen?
Hat mir etwa die Fliege den Blutstrom ins Gehirn abgeklemmt, wie Francine mich immer warnt?
Ich stelle fest, dass ich irgendwo anders sein will, nur nicht hier. Idealerweise bei der Arbeit, meinem Ort des Glücks.
Im Gegensatz zu den meisten meiner Freundinnen liebe ich meinen Job. Ich liebe seine Routine – am Morgen hole ich meine Post ab, plane meine Strecke, entwickle eine Strategie für die Auslieferung der Päckchen, lege Briefe und Wurfsendungen in die richtigen Kästen und richte sie so ein, dass man leicht hineingreifen kann.
Mein Boss konnte nicht glauben, dass ich tatsächlich einen Urlaubstag genommen habe. Ich nehme niemals Urlaub. Warum auch?
Eine wichtig wirkende, eine Aktentasche schwingende Frau kommt Malcolm entgegen. Er hält sie an und äußert einen Befehl; daraufhin zeigt sie ihm etwas auf ihrem Handy, dann ist der Austausch vorbei und die Gruppen ziehen in entgegengesetzte Richtung weiter, wie bei Holiday on Ice. Und Malcolm ist der Star, der Großmeister der Zeremonien, der harsche und unversöhnliche Gott, der unter zitternden Massen wandelt.
Er kommt näher.
Das ist meine Chance – meine Chance, ihn anzusprechen. Ihn um einige Minuten seiner Zeit zu bitten.
Aber meine Füße sind wie auf dem Boden festgewachsen. Malcolm Blackberg kommt mir zu groß vor, zu grimmig, nicht ganz von dieser Welt.
Ich rufe mir ins Gedächtnis, dass wir einfach zwei menschliche Wesen sind, aber das nutzt nichts.
Auf dem Rücken bricht mir Schweiß aus.
Diese ganze Aktion scheint zum Scheitern verurteilt zu sein. Wer hat sie sich bloß ausgedacht? Moment mal, das war ich.
Ich denke an den Trick, den ich anwende, wenn ich es während einer Zustellung mit der Angst zu tun bekomme, zum Beispiel, wenn ein Bereich superdunkel ist oder ein Gebäude unheimlich aussieht. Ich rufe mir ins Gedächtnis, dass die Menschen darin sich auf mich verlassen. Ich stelle mir ihre Gesichter vor, während sie auf einen wichtigen Brief warten.
Also stelle ich mir die Gesichter meiner Freundinnen vor, die auf eine Erfolgsmeldung von mir warten.
Ich denke daran, dass ich unsere letzte Hoffnung bin. Wenn ich Malcolm Blackberg nicht daran hindere, unser Gebäude zu zerstören, werden meine Freundinnen und ich voneinander getrennt weiß Gott wohin umziehen müssen. Sicher, wir werden uns bemühen, uns weiterhin zu treffen. Es wird nur nicht mehr dasselbe sein, wie einfach ins nächste Zimmer zu treten und die Einzelheiten eines Tages abzuladen in dem Wissen, dass immer jemand da ist, der mit dir fühlt wegen des Typen, der in der Bahn Platz für drei beansprucht hat, oder jemanden zu finden, der mit einem eine Folge Bachelor sieht.
Die kleine Gemeinschaft, die wir quer über die Flure unseres siebenstöckigen Gebäudes aufgebaut haben, ist wie eine Familie. Ganz besonders für mich. Und die arme alte Maisey – sie wird die mietpreisgebundene Wohnung verlieren, in der sie seit fünf Jahrzehnten lebt. Das Gleiche gilt für John, der immer seine Armee-Kappe trägt und sich auf seinen Gehstock stützt, und Kara im Erdgeschoss – wer wird auf ihr Baby aufpassen, wenn sie plötzlich wegmuss?
Keiner von uns wird jemals wieder eine Gemeinschaft finden wie die in der Nummer 341 auf der 45. Straße West.
Gespeichert auf meinem iPad ist ein Video, das Jada als digitales Andenken für uns alle zusammengestellt hat, um uns zu helfen, das Haus in Erinnerung zu behalten. Das Video dreht sich größtenteils um uns, wie wir der Kamera von den Dingen erzählen, die wir am meisten an unserem Leben in dem Gebäude und wie wir einander lieben. Sie hat Aufnahmen aneinandergereiht, die sie auf Partys und Hausbewohner-Versammlungen gemacht hat, dazu historisches Bildmaterial, alles Mögliche. Sie hat uns das Video neulich abends mal vorgeführt, und es hat alle weinerlich zurückgelassen. Es könnten allerdings sprudelnde Getränke beteiligt gewesen sein.
Aber es war wirklich so emotional, dieses süße Video über alles, was wir verlieren werden, wenn unser geliebtes Haus abgerissen wird. Ich bin erst seit drei Jahren dort, und nicht einmal ich kann mir vorstellen, es zu verlieren.
Und irgendwann während des Abends bin ich aufgestanden und habe erklärt, dass, wenn Malcolm Blackberg das Video sähe und wir ihn dazu brächten, sich das ganze Ding anzusehen, er das Gebäude nie und nimmer abreißen lassen würde.
»Du bist soooo niedlich«, sagte Vicky. Mia erklärte, ich müsse definitiv noch ein Weilchen länger in der Stadt leben. Tabatha und Francine fanden einfach, dass das Video süß und traurig war.
Ich dachte nicht, dass das auch nur im Geringsten süß oder traurig oder niedlich war. Es war mir todernst, und ich war definitiv mordsmäßig in Fahrt. Tatsächlich bin ich aufgestanden wie Winston Churchill, wenn er das Wort an das Oberhaus gerichtet hat. »Wenn Menschen genug voneinander wissen, verändern sich ihre Herzen. Und Malcolm Blackberg ist da keine Ausnahme. Ich meine es ernst, Leute – wenn wir ihn dazu bringen, sich das Video anzusehen, würde sein Herz sich verändern, garantiert.«
Sie alle lächelten spöttisch, aber ich war mir sicher. Wer konnte sich dieses Video ansehen und nicht gerührt sein?
»Hat Rex nicht sogar gesagt, es gebe andere Möglichkeiten für ihn, seinen Plan umzusetzen, ohne dieses Gebäude abzureißen?«, fragte ich. »Wenn Malcolm Blackberg wüsste, was dieses Gebäude uns bedeutet, bin ich mir sicher, dass er seinen Plan noch einmal überdenken würde. Ich würde jede Summe darauf setzen.«
»Okay, Professor Higgins«, hatte Francine gesagt und mich mit Popcorn beworfen.
»Es muss einfach klappen«, hatte ich hinzugefügt. »Tatsächlich werde ich ihn dazu zwingen, es sich anzusehen.«
Lizzie scherzte, dass es nur eine Methode gebe, ihn dazu zu bringen, es sich anzusehen, nämlich wenn ich ihn fesseln und mit Zahnstochern seine Augenlider offen halten würde. Die Leute haben bei der Vorstellung gelacht, ich könnte so etwas tun.
»Ich weiß nicht, wie ich ihn dazu bringen werde, es sich anzusehen«, antwortete ich ihnen, »aber auf keinen Fall werdet ihr mich auf der anderen Seite dieser Straße stehen und zuschauen sehen, wie die Abrissbirne fliegt, ohne dass ich alles Menschenmögliche dagegen unternommen habe. Mehr, als dass er uns ein Nein gibt, kann ja nicht passieren, richtig?« Und ich machte ein großes Getue darum, Jada darum zu bitten, mir eine Kopie für mein iPad zu schicken. Ich würde ihn dazu zwingen, sich Jadas Erinnerungsvideo direkt auf meinem iPad anzusehen.
Ich öffne meine Tasche. Darin ist eine kleine Notizkarte, auf der ich meine leidenschaftliche Ansprache aufgeschrieben habe, die ihn dazu bringen wird, sich Jadas Video anzusehen. Aber als Malcolm näher kommt, fühlen sich die Worte auf der Karte so irrelevant an wie außerirdische Hieroglyphen.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Ich drehe mich um und finde mich von Angesicht zu Angesicht einem Security-Mitarbeiter mit buschigem Bart gegenüber. Kann er erkennen, dass ich nicht hierher gehöre? »Nein, danke«, antworte ich.
»Haben Sie in diesem Gebäude etwas zu erledigen?«, fragt er.
»Ich … ich bin hier, um mich mit jemandem zu treffen«, sage ich.
Der Security-Mitarbeiter deutet auf die Aufzüge. »Besucherempfang ist auf der Zwei.« Ich scheine seinen Argwohn geweckt zu haben. »Sie werden sich dort anmelden und sich einen Besucherausweis geben lassen.«
Ich weiche zurück. »Danke«, sage ich.
»Miss!« Er setzt seinen alarmierten Gesichtsausdruck auf. »Passen Sie auf …«
Den Rest höre ich nicht mehr, denn ich pralle mit jemandem zusammen.
Ich wirbele herum. Sachen quellen aus meiner offenen Tasche. »Oh mein Gott, ich bin so …« Die Entschuldigung erstirbt mir auf der Zunge, als ich plötzlich dem düsteren Obsidianblick von Malcolm Blackberg persönlich ausgesetzt bin. »E-Entschuldigung«, murmele ich. »Ich habe nicht aufgepasst, wo ich hinging …«
»Das ist zu erwarten, wenn man rückwärtsgeht«, knurrt er mit einem geschliffenen britischen Akzent und erinnert mich daran, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass er aus England stammt. Der Akzent verstärkt seine seltsame Bösartigkeit und auch die Beschleunigung meines hämmernden Pulses.
Malcolm Blackberg ist aus der Ferne schön, aber aus der Nähe ist er herzzerreißend heiß und voller dunkler Anziehungskraft. Mit edler Raubvogelnase und dunkel umränderten Augen, die die Farbe von Eistee haben.
Ich gehe in die Hocke, um meine Sachen einzusammeln.
Zu meiner großen Überraschung hockt er sich ebenfalls hin und hilft mir. Ich hyperventiliere fast, denn er wirkt überlebensgroß präsent – und auch wahnsinnig maskulin, nach der Art zu urteilen, wie seine Hose sich um seine Oberschenkel spannt.
Das hier – das hier ist meine Chance, etwas zu sagen. Doch mein Kopf ist leer.
Ich stecke meine Sachen mit geübten Griffen genau in ihre Halterungen in meiner Tasche, denn selbst wenn ich ausflippe, verstößt es gegen mein hyperorganisiertes Herz, einfach nur alles reinzustopfen.
Ich schaue auf, und wieder treffen sich unsere Blicke. Er mustert mich mit einem Ausdruck, der mich bis ins Mark versengt, und dann wandert sein Blick – langsam – zu meinem Hals hinunter. Was will er von meinem Hals?
Er betrachtet natürlich meine alberne Fliege. Gott, warum habe ich nicht auf Francine gehört, was die Schleife betrifft? Was ist los mit mir?
Er hat mein Handy in der Hand und schiebt es in die dafür vorgesehene Handyhalterung meiner Tasche.
Ich keuche auf, und mein Puls rast.
Woher hat er das gewusst?
Dann lächle ich, weil ich nicht anders kann. »Bingo«, flüstere ich inbrünstig.
Danach denke ich, habe ich gerade zu Malcolm Blackberg »Bingo« gesagt? Aber es war einfach unglaublich aufmerksam von ihm. Und süß.
Ich stehe auf und drücke meine Tasche an mich. »Danke, das war sehr freundlich von Ihnen«, platze ich heraus.
Er betrachtet mich und meinen Hals nur grimmig und finster, jemand hinter ihm schnieft, und er dreht sich um und geht.
Und lässt mich zitternd in meinen abgetragenen, braunen Slippern stehen, überflutet von seiner machtvollen, maskulinen Energie.
Erst zu spät begreife ich, dass ich gerade meine Chance vermasselt habe, mit ihm zu sprechen. Ich versuche, ihn einzuholen, aber die Aufzugtüren schließen sich schnell. Ich suche nach dem Knopf, doch da ist nur eine leere Metallscheibe.
»Das ist nicht der öffentliche Aufzug, Miss.« Es ist wieder der Sicherheitsposten mit dem buschigen Bart. Er deutet auf einige andere Aufzüge.
»Oh. Danke.«
»Zweiter Stock.«
Ich nicke.
2
Malcolm
Im mittelalterlichen London hat man Köpfe auf Piken gespießt, als Warnung für Menschen, die sich vielleicht über die Brücke wagen würden. Seid auf der Hut. Passt auf, wo ihr hintretet. Verschafft euch ein Bild von den Bräuchen und befolgt sie.
Oder es setzt was.
Die Köpfe gehörten manchmal Kriminellen, obwohl es sich bisweilen auch einfach um vom Pech verfolgte Mitglieder des ungewaschenen Pöbels handelte, die zur falschen Zeit am falschen Ort aufgetaucht waren – nicht besonders feinfühlig, aber es herrschten eben raue Sitten damals.
Auf jeden Fall Köpfe auf Piken. Als Beschilderung gab es wirklich nichts Besseres als Köpfe auf Piken, oder? Bei Köpfen auf Piken sind keine weiteren Worte nötig. Es ist nicht nötig, auch nur einen einzigen Satz auszusprechen. Zum Beispiel, seid auf der Hut. Es wäre nicht nötig, etwas Derartiges auszusprechen, wenn in der Nähe Köpfe auf Piken steckten. Tatsächlich ist es eine perfekte Kommunikationsmethode, die allen, die auftauchen, nahelegt, den Leuten aus dem Weg zu gehen. Und mit Leuten meine ich mich.
»Sie sind sehr freundlich«, echot mein Assistent Ted trocken, als die Türen sich schließen.
»So überaus freundlich«, pflichtet Lynette ihm bei. »Falsches Gebäude, Rotkäppchen.«
Ich schaue auf mein Handy und scrolle durch meine Nachrichten. Ich fühle mich verunsichert.
Im vierten Stock steigt Kaufenmeier ein, und der Aufzug fährt weiter.
»So überaus freundlich«, wiederholt Lynette. Sie ist eine meiner Anwältinnen, eine meiner besten, aber trotzdem. Ich werfe ihr einen düsteren Blick zu, denn ich habe sie schon beim ersten Mal verstanden. Das Grinsen verschwindet von ihrem Gesicht.
»Was ist los?«, fragt Kaufenmeier.
»Mal musste ein Fräulein in Nöten retten«, berichtet Ted. »Ein kleiner grauer Vogel ist gegen ihn geflattert und hat all seine Federchen verloren.«
»Und Mal hilft, sie aufzuheben, und sie sagt: ›Sie sind sehr freundlich!‹«, sagt Lynette schon wieder. »Ich schätze, sie hat ihn nicht erkannt.«
»Sehr freundlich«, meint Kaufenmeier, der das ebenfalls amüsant findet. »Freundlich wie der große böse Wolf vielleicht.«
»Freundlich wie der Skorpion, bevor er die Schildkröte sticht«, fügt Lynette mit hochgezogenen Brauen hinzu und schafft es, ihren Hinweis auf die Fabel durch und durch schmutzig klingen zu lassen.
»Bezahle ich nicht ein kleines Vermögen für Wachposten, damit sie die Öffentlichkeit aus der Lobby fernhalten?«, brumme ich. »Wie wär’s, wenn mal jemand überprüft, wie ihr Konzept aussieht. Einfach Leute dort unten ohne klares Ziel umherstreichen zu lassen!«
»Ich kümmere mich sofort darum«, verspricht Ted.
Ich schaue auf mein Handy, aber in Gedanken bin ich wieder bei dem Mädchen in der Lobby. Es war ärgerlich, dass sie nicht aufgepasst hat, wo sie hingetreten ist, aber Ted schätzt sie falsch ein, wenn er sagt, sie habe nicht gewusst, wer ich bin. Sie hat genau gewusst, wer ich bin.
Ich halte mich so viel wie möglich aus dem Rampenlicht fern, aber bisweilen werde ich trotzdem erkannt; ich kann es immer feststellen an der Art, wie sie sich zurückziehen, wie ihr Gesichtsausdruck sich verhärtet. Es ist nur ein kleines Klicken in der Leitung, aber eins, das ich sehr gut kenne, weil ich es so oft erlebt habe.
Manchmal ist es etwas in ihrer Haltung. Manchmal treten sie tatsächlich einen Schritt zurück, ohne zu bemerken, dass sie es tun.
Leute wissen selten, was sie tun. Sie sehen selten, was sie vor der Nase haben. Das ist der Grund, warum ich so reich bin, und warum alle anderen so armselig sind.
Genauso wie die Frau. Ich habe das Erkennen in ihren Augen gesehen, aber sie ist einfach dortgeblieben, mit einem weit offenen, freimütigen Blick. Sie hat nicht dichtgemacht, als ich ihr nahe gekommen bin und nah genug neben ihr gekniet habe, um sie zu überwältigen.
Sie sind so freundlich.
Es war weniger Freundlichkeit. Es ist einfach so, dass sie so zugeknöpft war, bis hin zu der Schleife um ihren Hals, während sie ihre verstreuten Siebensachen genau in der richten Reihenfolge eingeordnet hat. Ich hatte dieses überwältigende Gespür für sie – ich kann es nicht recht beschreiben –, aber ich fühlte mich genötigt, nach ihrem Handy zu greifen, und wusste instinktiv, in welcher Tasche sie es würde haben wollen, eine Theorie, die ich dann auch getestet habe. Und natürlich lag ich richtig.
Ich bin gern wachsam bei Menschen. Auf diese Weise gewinne ich.
Ein Test einer Theorie: Mehr nicht. Und sie, sie war ein offenes Buch und hat sich kaum vor Leuten wie mir geschützt.
Sie sind sehr freundlich.
Ein Mangel an Überlebenskunst. Was einer Frau nicht gut steht.
Mit dieser Überlegung verbanne ich sie aus meinen Gedanken.
Obwohl ich sagen muss, dass die Einschätzung meiner Kollegen, sie sei ein grauer Vogel, nicht zutreffend ist und zeigt, wie jämmerlich schlecht deren Lesart von ihr war. Ein grauer Vogel ist ein alltäglicher Vogel, und sie war alles andere als alltäglich. Mehr noch, sie hatten sich in der Farbpalette vollkommen geirrt. Diese Frau war mehr wie Sandstein, blass und von einem subtilen Goldton, ihr Haar nur eine Schattierung dunkler als die Sommersprossen, die ihr Gesicht wie braune Sternbilder bedeckten. Ihre Nase war genau richtig gewölbt, die schwächste Form einer Skipiste. Und die schnelle Effizienz, mit der sie ihre starken schlanken Finger bewegt hat – das wäre ihnen nicht aufgefallen. Ihr Duft – Himbeere und Kokosnuss. Wahrscheinlich Shampoo.
Und wirklich, die gezierte kleine Schleife an ihrem Kragen. Für einen einzigen langen, seltsamen Moment habe ich mir vorgestellt, diese Schleife zu öffnen.
Die Schleife zu öffnen. Die Frau zu öffnen. Wie die Öffnung eines arglosen kleinen Geschenks. Ihren Hals auspacken, blass und nackt. Und dann ein Knopf. Noch ein Knopf. Sommersprossige, von Hitze gerötete Haut. Finger auf blasser Haut, noch das letzte ihrer kleinen Geheimnisse ausstreuen, aus der letzten ihrer kleinen verborgenen Täschchen.
Sie sind sehr freundlich.
Was wäre nötig, um sie zu knacken? Wie würde dieser offene, aufrichtige Blick aussehen, wenn sie erregt wäre?
Oder genauer gesagt, warum denke ich immer noch an sie? Ich habe eine Million Dinge, über die ich nachdenken kann, und die schließen sie nicht ein. Im Moment muss ich über eine bestimmte Fusion nachdenken – tatsächlich war dieser Gang dafür eingeplant.
Ich halte mir mein Handy vors Gesicht. Wenn ich irgendeine Art von Bildschirm vor dem Gesicht habe, ist das ein Zeichen, dass ich nicht angesprochen werden will, meine eigene Version von einem Kopf auf einer Pike. Denn das andere Geheimnis meines Erfolges ist rigides Zeitmanagement.
Ich lasse mein Handy sinken und greife mir an den Hals. »Und was zur Hölle war das genau? Was hat sie da um den Hals getragen?«
»Man nennt es Schleife«, erklärt Lynette. »Es ist eine Fliege für Frauen.«
Ich warte auf mehr. Als nichts mehr kommt, sage ich: »Eine Fliege für Frauen.« Das Geheimnis, Menschen dazu zu bringen, einem Dinge zu erzählen, liegt darin, dass man ihre letzten Worte wiederholt. Es gibt für Menschen nichts Anregenderes als ihre eigenen Worte.
Als eine meiner Anwältinnen hat Lynette mich diese Technik Hunderte von Malen anwenden sehen, aber sie fällt trotzdem darauf herein. »Eine Fliege für Frauen, wie von Woolworth, circa 1989. Ein klein wenig koreanisches Schulmädchen, ein klein wenig Landmaus-geht-zur-Sonntagsschule. Niemand sollte so etwas jemals tragen.«
»Frauen tragen jetzt Fliegen?«, fragt Kaufenmeier. »Könnt ihr uns denn gar nichts lassen?«
»Nein, sie hat keine Fliege getragen, wie Männer sie tragen«, erläutert Lynette. »Eine Schmetterlingsfliege ist eine große Schleife, an der die Enden herabhängen. Stellen Sie sich einen ziemlich schmalen Schal vor, der zu einer Schleife um ihren Hals gebunden ist, obwohl ich jede Summe darauf wetten würde, dass die Schleife vorgebunden ist und sie sie nur ansteckt. Das wäre total wie ein grauer Vogel.«
Ich runzle die Stirn. Das Anheften ruiniert definitiv meine Fantasie – man kann nicht langsam am Ende einer angehefteten Schleife ziehen und sie aufbinden. Man kann sie nicht mit langsamer, neckender Bedächtigkeit vom Kragen ziehen.
Wenn sie mir gehörte, würde ich verlangen, dass sie sich ein echtes langes Stückchen Stoff um ihren Kragen bindet, das ich öffnen könnte, so wie man die Schleife auf einem Geschenk öffnet, wobei das Geschenk in diesem Szenario ihr vollständiges Entkleiden wäre. Ich würde diese Schleife langsam unter ihrem Kragen hervorholen. Sie weglegen. Und dann die Knöpfe. Einer, zwei, drei. Ein Fetzchen von einem BH, weiß, ohne Schnickschnack.
Der Aufzug hält im sechsten Stock. Wir steigen aus und ich gehe zu meinem Büro, während mir die Landmaus dort unten nicht aus dem Kopf will.
Ist es ein Clip oder eine gebundene Schleife? Eine gebundene Schleife wäre auch besser, denn sobald sie geöffnet war, würde die Krawatte da sein. Immer nützlich für ausgelassene Sexspielchen. Ich würde sie hoch in die Luft halten, um sie ihr zu zeigen. Würde ihr Blick sich dann verändern? Würde sie endlich vorsichtig sein?
Obwohl manches für die vorgebundene Schleife spricht. Jede Frau, die ich als menschliches Wesen ernst nehmen könnte, würde eine vorgebundene Schleife benutzen. Mode ist eine unglaubliche Zeitverschwendung. Eine Frau, die ich ernst nehmen würde, wüsste das. Sie würde sich für Effizienz und Ordnung interessieren und keine Zeit darauf verschwenden, die Schleife zu binden.
Also habe ich jetzt zwei Sexfantasien zu viel über eine Landmaus, die ich nie wieder sehen werde.
Oder werde ich sie wiedersehen?
Wer ist sie? Was hat sie hier zu tun? Mein Geschäft hat viele verschiedene Segmente. War sie auf dem Weg zur Personalabteilung?
Ich greife nach den Papieren auf meinem Schreibtisch. Es sind Dinge, die ich unterzeichnen muss. Bei den Veränderungen im Vertrag sind Lücken freigelassen worden.
Ich greife nach meinem Stift und stelle mir vor, mit der Zunge über diese kecke Wölbung ihrer Nase zu fahren. Ich stelle mir sie unter mir ausgebreitet vor, ihr Haar ein sandsteinfarbener Heiligenschein um ihren Kopf, sie ist erschöpft und keucht, nackt in meinem Bett. Oder nackt bis auf die Schmetterlingsschleife.
Ich schlucke gegen die Trockenheit in meinem Mund an.
Einer der Verwaltungsleute kommt herein. »Oh, Entschuldigung«, sagt er. Er ist wegen des Vertrags hier.
»Nein, warten Sie.« Ich sehe mir die Veränderungen an und unterschreibe, dann reiche ich ihm die Papiere. »Sagen Sie mir, führt die Personalabteilung heute Vorstellungsgespräche durch?«
»Vorstellungsgespräche wofür?«, fragt er.
»Vorstellungsgespräche für neue Angestellte«, sage ich. »Finden Sie es heraus.«
3
Noelle
Der Aufzug, den ich benutzen darf, fährt nur bis in das zweite Stockwerk. Ich steige aus und gehe zur Rezeption. Eine Frau, die gerade telefoniert, hebt einen Finger und bedeutet mir zu warten. Sie hat rotes Haar, das sie sich stramm zu einem Knoten auf dem Kopf frisiert hat, mit einem kleinen, hineingeflochtenen Zopf. Ihrem Schildchen nach zu urteilen heißt sie Anya.
»Ich muss mit Mr Blackberg sprechen, bitte.«
»Haben Sie einen Termin bei Mr Blackberg?«
»Ich muss ihm etwas zeigen«, erwidere ich. »Bezüglich einer Immobilie.«
»Termin?«, wiederholt sie.
»Nein«, antworte ich.
»Ohne einen Termin können Sie ihn nicht sprechen. Sie werden die Zentralnummer wählen müssen.«
Ich umklammere meine Tasche und ertaste die Umrisse des iPads mit dem abspielbereiten Film. »Ich denke, dass er sehen wollen wird, was ich habe.«
»Sie müssen mit seinem Personal reden. Die Nummer finden Sie auf unserer Website.«
»Es muss zeitnah sein. Es betrifft die 45. Straße West Nummer 341, eine Immobilie, die er jüngst gekauft hat.«
»Und inwiefern muss das zeitnah besprochen werden?«, fragt Anya.
Ich hole Luft. »Sozusagen wegen dieser Immobilie. Er muss es sehen.«
»Ich brauche schon etwas mehr als das«, entgegnet sie.
»Es ist nur für seine Augen bestimmt. Und extrem wichtig.«
Sie mustert mich kurz und greift nach einem Telefon. »Ich habe eine Frau mit irgendetwas über die 45. Straße West 341«, sagt sie und mustert mich. Dann: »Sie will es nicht sagen. Nur für Mr Blackbergs Augen? Ich weiß nicht. Sie hält es für dringend, aber sie will es nicht sagen.«
Sie legt das Telefon beiseite. »Hier entlang.« Sie führt mich durch einen Flur vorbei an einer Reihe von Büros. Wir kommen an einem weiteren Aufzug vorbei. Auch dieser hat eine schwarze Metallscheibe. Führen die Aufzüge mit den schwarzen Metallscheiben zu den oberen Büros? Wir kommen zu einer Tür, an der der Name Janice West steht. Die Frau mit dem roten Haarknoten klopft an.
»Moment mal«, sagte ich. »Es ist Mr Blackberg, den ich sprechen muss. Er muss es sein.«
Eine Frauenstimme. »Ja.«
Anya bedeutet mir, durch die offene Tür zu treten.
Janice West ist eine vornehme Frau in den Vierzigern, mit einem langen Hals, schwarzem Haar und leuchtend roten Lippen. »Was wollen Sie Mr Blackberg zeigen?«
»Es ist ausschließlich für Mr Blackberg gedacht.«
»So funktioniert das nicht«, entgegnet Janice. »Ich werde einen Blick auf das werfen, was immer Sie da haben, das so überaus dringend ist, und anschließend entscheiden, ob es wichtig genug ist, um nach oben weitergereicht zu werden.«
»Es ist für ihn allein bestimmt …«
»Dann lautet die Antwort Nein.« Sie bedeutet Anya und mir zu verschwinden.
»Kommen Sie«, sagt Anya.
»Nein, warten Sie«, bitte ich. »Es ist von den Mietern. Dinge, die er über das Gebäude wissen muss.«
»Er braucht nichts über das Gebäude zu wissen. Er reißt es ab, und das führt normalerweise dazu, die Probleme mit einem Gebäude loszuwerden«, stellt Janice fest.
»Nein, es ist wichtig für uns, dass er es weiß … hören Sie, wir verlieren unser Zuhause. Es ist nur dieser kleine Film, den ich ihm zeigen wollte. Er zeigt, was das Gebäude für uns bedeutet …«
»Das wäre dann ein hartes Nein«, sagt Janice. »Das härteste der harten Neins.«
»Sie gehen«, bestimmt Anya.
»Aber wir verlieren unser Zuhause.«
Janice ergreift erneut das Wort. »Daran kann niemand etwas ändern.«
Ich weiß nicht, was mich so wütend macht, aber es macht mich wirklich wütend. »Mr Blackberg könnte etwas daran ändern. Er könnte seine Meinung ändern – ich habe gehört, dass es andere Möglichkeiten gibt, die er bei diesem Projekt anwenden könnte. Wenn er es nur sehen könnte. Hören Sie … es sind nur wir, die ihm sagen …« Ich öffne das kleine Portfolio und schalte den Bildschirm ein, dann drücke ich auf Play und halte das iPad so, dass beide Frauen es sehen können. Ich habe es zu dem Part mit Maisey vorgespult. Sie ist die überzeugendste von uns. Sie redet darüber, was Nummer 341 ihr bedeutet.
»Gütiger Gott«, stöhnt Janice.
»Nun kommen Sie schon«, sagt Anya.
»Eine Minute von seiner Zeit?« Ich schließe das Portfolio und schneide Maiseys Geschichte ab.
»Folgendes müssen Sie verstehen«, sagt Janice. »Bambi und Mutter Teresa könnten sich an dieses Gebäude ketten, und Mr Blackberg würde die Abrissbirne nicht stoppen. Tatsächlich würde er, wenn Bambi und Mutter Teresa sich an das Gebäude gekettet hätten, die Abrissbirne mit größtem Vergnügen selbst schwingen.«
Ich greife nach meinem iPad. Was für ein Mensch würde ein Gebäude noch fröhlicher demolieren, wenn Mutter Teresa und Bambi sich daran gekettet hätten? Ist das der Mann, der unser Schicksal in den Händen hält?
»Das werde ich nicht glauben«, sage ich und erinnere mich daran, wie Malcolm Blackberg mein Handy genau in die richtige kleine Tasche gesteckt hat, eine winzige, freundliche Geste mir gegenüber, als ich dort auf dem Boden gehockt habe und vor Nervosität gestorben bin. Ich habe den verrückten Gedanken, dass diese Frauen ihn einfach nicht verstehen.
»Es würde ihm zusätzliches Vergnügen bereiten, das Gebäude abzureißen«, wiederholt Janice. »Ob es Ihnen gefällt oder nicht, ich erweise Ihnen einen Gefallen. Denn wenn ich Sie nach oben geschickt und man sie durch irgendein Wunder – und glauben Sie mir, es müsste schon ein Wunder gewesen sein – durchgelassen hätte, und Sie ihm diese paar Sekunden Ihres kleinen Videos gezeigt hätten? Er würde den Termin vorziehen. Wenn es eines gibt, was Mr Blackberg hasst, dann sind es Leute, die mit solchen Dingen seine Zeit verschwenden.«
»Kommen Sie jetzt mit, sonst wird die Security Sie hinausbringen«, sagt Anya.
Mutlos folge ich Anya und ihrem leuchtenden Haarknoten zurück zur Rezeption. Sie begleitet mich bis zum Aufzug und drückt auf den Knopf nach unten. Es gibt nur einen Knopf nach unten.
Der Aufzug kippt mich zurück in die große Lobby.
Das kann es nicht gewesen sein. Es kann jetzt nicht vorbei sein.
Ich verweile einige Minuten und tue so, als würde ich auf einen Aufzug warten. Ich kann nicht mit eingezogenem Schwanz nach Hause kommen.
Ich beobachte eine Person, die eine Karte vor den Aufzug mit der schwarzen Metallplatte hält, der in die höheren Büros fährt. Die Karte hängt um ihren Hals. Wie wäre es, wenn ich mich neben sie stelle? Und einfach mit ihr nach oben fahre? Ich beobachte, wie die Türen sich öffnen. Sie merkt es und runzelt die Stirn. Ich verliere den Mut und sehe zu, wie die Türen sich wieder schließen.
Ich entscheide mich dafür, es bei der nächsten Person noch einmal zu versuchen. Jemand anderer wedelt mit einer Karte vor der Metallplatte. Ich stehe auf, trete neben ihn und versuche so auszusehen, als würde ich dorthin gehören.
Er sieht mich an und dann nach vorn. Dann wieder mich. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragt er.
Ich lächle strahlend. »Ich fahre nach oben in den Sechsten.«
»Wo ist Ihr Besucherausweis?«, fragt er.
Ich greife mir an die Brust. »Oh … ich habe ihn nicht dabei.«
»Sie arbeiten auf der Sechs?«
»Ahh … nein«, sage ich.
Er schüttelt den Kopf. »Etage Nummer zwei.« Er zeigt auf den anderen Aufzug.
»Vielen Dank«, sage ich.
Ich bemerke, dass der Sicherheitsposten mich beobachtet. Er hat zu seinem Handy gegriffen und spricht hinein, während er mich weiterbeobachtet.
Ich gehe um den Felsspringbrunnen herum auf den Ausgang zu.
Eine Briefträgerin kommt mit ihrem Wagen herein. Etwas in mir beruhigt sich. Ich halte ihr die Tür auf, und sie bedankt sich bei mir und geht weiter. Ich beobachte sie, wie sie durch die Lobby marschiert. Der Sicherheitsposten trifft sie an den Aufzügen. Er wedelt mit einer Karte vor der schwarzen Metallplatte. Die Türen öffnen sich. Sie steigt mit ihrem Wagen ein und lächelt.
Die Türen schließen sich.
Und jetzt sieht er in meine Richtung.
Er wird mich wirklich hinauswerfen. Ich drehe mich um und setze mich in Bewegung. Ich stürme hinaus auf den hellen Gehsteig … und in meinem Kopf formt sich eine schockierende neue Idee.
4
Noelle
Ich habe mir noch einen Tag freigenommen, aber ich trage meine Uniform und habe mir meine treue blaue Tasche über die Schulter gehängt.
Ich beobachte mich selbst, wie ich auf die Blackberg Plaza schlendere. Ich könnte dafür Probleme kriegen, aber ich rufe mir ins Gedächtnis, dass das Leben zu kurz ist, um wichtige Dinge nicht zu tun, selbst wenn diese Dinge Furcht einflößend und wahrscheinlich idiotisch sind.
Und es gibt nichts Wichtigeres als meine Freunde. Sie sind meine Familie.
Francine und Jada waren erstaunt, als ich ihnen von meinem neuen Plan erzählt habe. Sie finden, ich sei mutig.
Wohl eher verzweifelt.
Ich umrunde den Springbrunnen und gehe zum Sicherheitspult. Der Wachposten mit dem buschigen Bart kommt heraus. Er erkennt mich nicht wieder – noch nicht. Die Leute erkennen Briefträger in ihrer Zivilkleidung selten und umgekehrt. Wenn du die Uniform anlegst, ist deine Identität die amerikanische Post, und du bist überall willkommen.
Ich zeige ihm das kleine Päckchen, das ich an Malcolm Blackberg adressiert habe. Heute Morgen habe ich einen roten Sticker für »Einschreiben« draufgeklebt, und dann habe ich einen leeren Sticker hinzugefügt, auf den ich geschrieben habe: »Rückschein« und »Eigenhändig« in kühner schwarzer Tinte.
Eigenhändig zuzustellende Sendungen dürfen nur dem Adressaten übergeben werden – oder an einen von diesem autorisierten Vertreter. Ich hoffe, dass sie mit diesem Teil der Regel nicht vertraut sind.
Er begleitet mich zum Aufzug, öffnet ihn mit seiner Karte und schenkt mir ohne einen Hauch von Wiedererkennen ein Lächeln.
»Danke«, sage ich und umklammere meine Tasche. Ich betrachte die Knöpfe und drücke auf Stockwerk sechs.
»Entschuldigung.« Eine hübsche Frau in einem eleganten roten Kostüm zeigt dem Wachposten eine Karte. »Ich komme von Bexley Partners. Ich habe einen Zehn-Uhr-Termin im sechsten Stock und bin schon spät dran und man hat mir gesagt, ich solle mich bei Ihnen melden.«
»Jepp, der Anruf ist gerade gekommen.« Der Wachposten schiebt die Hand zwischen die sich schließenden Türen und drückt sie wieder auf. »Bitte sehr.«
»Danke«, antwortet sie, tritt ein und schenkt mir ein zaghaftes Lächeln. Sie hat kurzes blondes Haar und trägt wunderschöne rotweiße Highheels.
Ich nicke und ziehe meine Tasche höher auf die Schulter. Mein Puls rast, als die Tür sich schließt und der Aufzug nach oben gleitet.
Wir fahren schweigend hinauf.
Die Sekretärinnen und Assistenten werden wahrscheinlich versuchen, dafür zu unterschreiben, aber ich habe vor zu behaupten, es müsse Mr Blackberg persönlich übergeben werden. Ich werde einfach darauf bestehen und nicht aufhören darauf zu bestehen. Die Uniform macht eine Menge aus, und darauf zähle ich.
Der Aufzug scheint sich zu verlangsamen, während die Knöpfe träge von Stockwerk eins zu Stockwerk zwei aufleuchten. Kurz bevor der Aufzug das vierte Stockwerk erreicht, ertönt über uns ein lautes Krachen. Ich klammere mich an das Geländer, während der Aufzug heftig zittert.
Er neigt sich schräg und kommt knirschend zum Stehen. Im ganzen Aufzug wird es dunkel, dann blinkt plötzlich ein anderes Licht – eine Art Notfallbeleuchtung aus der Ecke.
»Oh mein Gott«, sagt die Frau und hält sich auf ihrer Seite am Geländer fest.
Ich höre nur noch den Puls in meinen Ohren wummern. »Okay«, sage ich, »er stürzt nicht ab.«
»Noch nicht«, erwidert sie.
»Es gibt eine Menge Sicherheitsvorkehrungen für diese Dinger«, tröste ich sie.
Ein weiteres Knarren folgt.
»Es sollte einen Notruf geben, richtig?«, meint sie.
Sie sieht mich an, als müsste ich es wissen. Ich bin eine Briefträgerin aus New York City. Sie denkt, ich sollte Dinge über Aufzüge wissen. Sie wäre überrascht zu erfahren, dass ich erst vor zwei Jahren zum ersten Mal in meinem Leben einen Aufzug benutzt habe.
Ich gehe zu der Bedienplatte hinüber und blinzle in dem fahlen Licht. Der oberste Knopf – ein roter – hat ein geprägtes Bild von einem Telefon und daneben stehen einige Worte in Braille. Ich drücke einmal darauf. »Hallo?«
Nichts.
Die Frau holt ihr Handy hervor und macht einen Anruf. Sie sagt zu der Person am anderen Ende, dass sie sich verspäten würde, gerade als eine knisternde Stimme aus der Bedienplatte kommt. »Hey, hier ist die Haustechnik. Sind alle da drin okay?«
»Ja«, bestätige ich. »Wir sind zu zweit, und es geht uns gut. Was ist los?«
»Kein Grund zur Sorge«, antwortet die Stimme. »Nur etwas Elektrisches. Ihnen droht keine Gefahr. Ein Team arbeitet bereits daran. Es wird nur ein paar Minuten dauern. Kommen Sie klar?«
Ich schaue zu der Frau hinüber. »Wie lange?«, fragt sie die unsichtbare Person am anderen Ende der Sprechanlage.
»Ein Weilchen.«
Sie stößt einen besorgten Atemzug aus.
Der Mann fragt nach unseren Namen, und wir sagen sie ihm. »Okay, Noelle und Stella, bleiben Sie ruhig. Wir arbeiten an diesem Problem. Rufen Sie an, falls sich bei Ihnen etwas verändern sollte, okay?« Mit diesen Worten legt er auf.
»Falls sich etwas verändert«, sagt sie. »Was denkt er denn, was sich hier drin verändern kann? Dass uns die Luft ausgehen kann?«
»Das wird nicht passieren«, antworte ich mit mehr Zuversicht, als ich empfinde. »Er meint wahrscheinlich für den Fall, dass eine von uns medizinische Behandlung oder so etwas braucht.«
»Nicht direkt tröstlich.« Stella lässt sich zu Boden gleiten und schlingt die Arme um ihre Knie.
Über uns ertönt ein Klirren. Stella zuckt bei jedem Klirren zusammen und richtet ihren zu Tode geängstigten Blick auf die Decke des Aufzugs.
»Oder im Falle einer Verwandlung zum Werwolf«, füge ich hinzu.
Sie richtet einen erschrockenen Blick auf mich.
Ich schenke ihr ein freches kleines Lächeln. »Das Auftauchen von Vampir-Reißzähnen?«
Sie lacht erleichtert. »Oh mein Gott, für eine Sekunde habe ich gedacht, das sei Ihr Ernst«, antwortet sie. »Entschuldigung. Nicht mein Tag. Und ich liebe Aufzüge nicht gerade.«
Ich gewinne den Eindruck, dass das eine Untertreibung ist. »Es wird schon gut gehen«, sage ich. Ich lege meine Tasche auf den Boden und setze mich darauf. »Es gibt wirklich Sicherheitsvorkehrungen.«
Das Klirren hört auf. Ein Bohrer beginnt zu sirren.
»Obwohl ich das Gefühl habe, dass es ›ein bisschen‹ mehr sein wird als einige Minuten«, ergänze ich.
Sie seufzt. »Tatsächlich sitze ich lieber hier drin fest, anstatt zu dem Meeting zu gehen, an dem ich teilnehmen soll. Ich würde Eispickel in meinen Ohren bevorzugen. Blutegel, die mich aussaugen. Kid Rock in Endlosschleife.«
»Nein«, flüstere ich. »Nicht den.«
Sie lehnt den Kopf an die Bedienplatte. »Sie müssen eine Route absolvieren. Wird Sie das hier zurückwerfen?«
Ich zucke die Achseln. »Ich werde schon zurechtkommen. Also, arbeiten Sie hier?«
»Nein«, antwortet sie trübselig. »Oder ich beginne gerade mit einem einmonatigen Auftrag, also schätze ich, ich arbeite doch hier.«
»Klingt so, als würden Sie sich nicht direkt darauf freuen«, bemerke ich.
»Die Untertreibung des Jahres«, seufzt sie. »Sagen Sie nichts.«
»Natürlich nicht.«
Sie nickt. Die Leute neigen dazu, der Uniform zu vertrauen. »Und so fängt der erste von vielen langen Tagen an. Vielen langen und qualvollen Tagen.«
»So schlimm?«
»Schlimmer«, murmelt sie. »Sechs Stunden hat der Verkehr gebraucht, um mich heute Morgen hierherzubringen, und jetzt das. Und die Hölle hat noch nicht mal angefangen.«
Ich zucke mitfühlend zusammen. »Ist ihr Job immer so ätzend?«
»Irgendwie, ja«, bestätigt sie. »Man sollte meinen, es wäre nicht so. Ich bin Trainerin für Führungskräfte, was im Prinzip ein supercooler Beruf ist.«
»Trainerin für Führungskräfte?«
»Wir helfen Führungskräften beim Ausbau ihrer Fähigkeiten. Mein Fachgebiet ist Sozialkompetenz, wie emotionale Intelligenz, der Aufbau positiver Beziehungen, Leiten durch Inspiration, Sie wissen schon. Die Fähigkeiten, die eine Führungspersönlichkeit in die Lage versetzt, geschäftlich erfolgreich zu sein, sind nicht die gleichen, die sie braucht, um ihr Personal gut zu führen. Die Geschäftstätigkeit verlangt transaktionsorientierte Fähigkeiten; beim Personalmanagement dagegen geht es mehr um Führungstalent. Also helfen wir ihnen dabei.«
»Das klingt, als wäre es wirklich erfüllend«, sage ich, obwohl es mich überrascht, wie eine so junge Frau Führungskräften beibringen kann, wie man führt. Sie ist definitiv einige Jahre jünger als ich – höchstens sechsundzwanzig.
»Das sollte man meinen, richtig? Und ich bin bei einer wirklich guten kleinen und dadurch exklusiven Agentur in Trenton. Sehr angesehen.« Sie drückt sich die Knie noch fester an die Brust. »Okay. Jetzt könnte der Aufzug meinetwegen wieder in Gang kommen. Inzwischen graut mir noch mehr davor, hier einfach herumzusitzen. Mein erstes Meeting hätte bereits anfangen sollen. Und anschließend wäre ich draußen, könnte in die Freiheit laufen. In den Sonnenschein.«
»Ach du Schande«, sage ich.
»Nein, ich bin zu negativ. Ich liebe diese Arbeit.«
Über uns sirrt ein Bohrer.
»Also, wo liegt das Problem? Wenn Ihnen die Frage nichts ausmacht.«
»Es geht um Folgendes«, antwortet sie. »Es gibt zwei Arten von Managern, die ein Training unserer Firma buchen. Die eine findet es aufregend, ihre Fähigkeiten zu verbessern, es sind erfolgreiche Geschäftsleute, die hochmotiviert sind, zu effektiveren Führungskräften zu werden. Sie wollen lernen und wachsen. Bedauerlicherweise darf ich nicht mit dieser Art Kunden arbeiten. Diese Jobs erledigen meine Bosse.«
»Welche Jobs bekommen Sie?«
»Mich schicken sie, wenn die Führungskraft einen Gerichtsprozess verloren hat und von einem Gericht dazu verpflichtet worden ist, ein von einem akkreditierten Führungskräftetrainer entwickeltes Programm zur Förderung emotionaler Intelligenz zu absolvieren.« Sie seufzt. »Und raten Sie mal, wer diese glückliche Trainerin ist?«
»Autsch.«
»Es ist das Letzte«, sagt sie. »Wenn beispielsweise irgendein wütender Kerl in eine Rauferei gerät und das Gericht ihn zu einem Aggressionsbewältigungs-Seminar verdonnert. Was meinen Sie, ob er da gern hingeht? Ob er das Übungsmaterial liebt?«
»Ähm, nein?«
»Richtig. Die Leute, die ich trainiere, wollen mich nicht. Wenn ich aktiv werde, hat jemand aus dem Führungsteam problematisches Verhalten an den Tag gelegt, und ein Vermittler oder Richter wurde hinzugezogen. Mein Training erlaubt es der Firma zu sagen, dass sie sich um das Problem kümmere, aber im Allgemeinen schert es niemanden, ob ich etwas bewirke. Also, ich bin einfach die Strafe. Ich bin diejenige, auf die sie ihren Groll fokussieren.«
»Oh«, sage ich.
»Ja, es ist wirklich haarsträubend. Und mir würde es auch nicht mehr viel ausmachen, wenn ich demnächst gefeuert würde«, murmelt sie und checkt ihr Handy.
»Schweigekodex«, sage ich. »Alles bleibt in diesem Aufzug … bis auf uns. Hoffentlich.«
Es folgt weiteres Gehämmer und Gesirre über uns. Stimmen brüllen hin und her.
»Man muss einmal erlebt haben, mit welcher Verachtung die Leute, mit denen ich arbeite – die Typen, mit denen ich arbeite, denn es sind Typen, über die ich rede – an die ganze Sache herangehen. Inzwischen versuche ich nur noch, das Minimum zu schaffen, damit wir beide sagen können, die Schulung habe stattgefunden. Meine Firma wird bezahlt … ich weiß nicht, warum ich Dampf ablassen muss. Es ist einfach … nicht der Job, den ich mir während meiner Ausbildung vorgestellt habe. Ich dachte, ich würde Menschen helfen und nicht ihre verhasste Bestrafung sein.«
Ich nicke mitfühlend. War jemand aus Mr Blackbergs Führungsteam aus der Reihe getanzt?
»Als sie mich damit betraut haben, ein persönliches Training mit einem so hohen Tier zu machen, war ich schockiert. Ich habe natürlich meinen Abschluss in Psychologie und hatte jede Menge Trainer-Fortbildungen, aber keine Erfahrung, und sie schicken mich los, diesen Typ aus dem Vorstand zu trainieren? Sie setzen mich direkt auf die Crème de la Crème an? Ich hatte auf einen guten Job gesetzt, aber wie sich herausstellt, bin ich einfach nur ein Kanonenfutter.«
»Gibt es denn gar nichts an Ihrer Arbeit, das Ihnen Spaß macht?«, frage ich. »Vielleicht einen einzigen schönen Aspekt?«
»Nein. Man muss einfach irgendwie damit klarkommen. Ich denke, ich habe mir den falschen Job ausgesucht.« Sie seufzt. »Sind Sie gern Briefträgerin?«
»Ja«, bestätige ich. »Ich liebe meine Arbeit.«
»Das muss sich so gut anfühlen«, murmelt sie. »Zu lieben, was man tut.«
»Das ist richtig«, antworte ich. »Es ist toll, einen Job zu haben, den man liebt. Und wenn das Leben hart wird, bedeutet es alles, diesen einen kleinen Bereich zu haben, in dem man das Gefühl hat, etwas Positives zu erreichen.«
Sie sieht mich sehnsüchtig an. »Ich wünschte, ich würde etwas Positives machen können.«
»Können Sie keine anderen Jobs bekommen?«, frage ich.
»Ich habe das Gefühl, dass es dafür zu spät ist.«
»Machen Sie Witze? Es ist nie zu spät, um etwas zu verändern. Es ist mir egal, ob Sie dreißig oder fünfzig oder siebzig sind«, sage ich. »Wie alt sind Sie eigentlich, sechsundzwanzig?«
»Siebenundzwanzig.«
»Na bitte!« Ich erzähle ihr meine Geschichte – wie lange ich in einer ländlichen Kleinstadt festgesteckt habe, die ich gehasst habe, dass ich so inbrünstig von einem anderen Leben geträumt habe, einem besseren Leben, und irgendwie habe ich es nie durchgezogen. Vielleicht liegt es daran, dass sie eine Fremde in einem Aufzug ist, aber ich gestehe ihr sogar meinen sehr spezifischen Traum, einen Clan von Freundinnen im Big Apple zu haben und dass dieser inspiriert worden ist von Wiederholungen von Sex and the City.
Ich erzähle ihr, dass ich auf Craigslist Annoncen gelesen habe, in denen MitbewohnerInnen für New York und Brooklyn gesucht werden, und dass ich davon träumte, auf eine davon zu antworten. Ich habe sogar die Adressen gegoogelt und mir die Gebäude angesehen, aber ich hatte solche Angst, ernst zu machen, weil ich niemanden kannte und außerdem einen festen Freund hatte, mit dem ich manchmal zusammen war und manchmal auch nicht, und außerdem eine Mutter daheim in Mapleton. Dann bekam meine Mom Krebs.
Ich erzähle ihr, wie ich mit den Versicherungen kämpfen musste, um die Versorgung zu bekommen, die meine Mom verdient hatte, diese Spezialbehandlung, die ich mir für sie gewünscht hatte, aber die Versicherung hatte abgelehnt. Und sie ist gestorben.
»Und Ihr Dad?«, fragt sie.
»Samenbank. Meine Mom war superunabhängig – sie war umwerfend. Es gab nichts, das sie nicht tun konnte. Bis … Sie wissen schon.«
»Es tut mir leid«, sagt sie.
»Danke«, erwidere ich. »Der Punkt ist, es hat mir klargemacht, wie kurz das Leben ist und obwohl ich Angst hatte, bin ich nach der Beerdigung nach Hause gegangen und habe mir die Annoncen in Craigslist angesehen. Und da war diese eine Annonce, die nach einer Mitbewohnerin suchte. Die Annonce erwähnte Gourmet-Popcorn und Bachelorette gucken mit den Frauen aus den anderen Zimmern, und ich habe mich dafür gemeldet. Nach all den Jahren, die ich damit verbracht habe, mir die Mitbewohner-Annoncen auf Craigslist anzusehen, ohne jemals eine davon zu beantworten, nachdem ich all diese Zeit an einem Ort verschwendet hatte, von dem ich weg wollte, musste erst meine Mutter sterben, um mich dazu zu bringen, den Sprung zu wagen. Und ich bin so froh, dass ich es getan habe.«
»Ich weiß nicht, ob ich so viel Mut habe.«
»Ich auch nicht. Ganz und gar nicht! Sie müssen es einfach tun. Das Leben ist kurz, Stella.«
»Ich glaube nicht, dass ich meinen Job aufgeben kann, nachdem ich so viel Zeit investiert habe.«
»Aber Sie hassen ihn«, wende ich ein. »Und Sie haben gesagt, selbst wenn Sie die guten Jobs bekämen, dächten Sie nicht, dass Sie Ihre Sache auch gut machen würden.«
»Stimmt.« Sie knibbelt an einem Sticker auf ihrer Aktentasche. »Und ich hasse meine Bosse dafür, dass sie mich mit dem Training dieser Arschlöcher beauftragen. Und dafür bekomme ich noch nicht einmal eine Krankenversicherung.«
»Ernsthaft?« Ich runzle finster die Stirn. »Keine Krankenversicherung? Sie arbeiten Vollzeit ohne Krankenversicherung?«
»Ich bin im Prinzip selbstständig. Eine Möglichkeit für sie, sich davor zu drücken, soziale Leistungen zu zahlen. Gott, es ist kein sehr guter Job, nicht wahr?«
»Erzählen Sie mir, Stella, wenn Sie machen könnten, was sie wollten. Was würden Sie gern machen?«
»Kündigen. Ihnen den Mittelfinger zeigen und meinen ganzen Gehaltsscheck für Schuhe verplempern. Oder vielleicht ein neues Outfit. Nein – eine verdammte Diamant-Tiara, und die würde ich im Plaza Hotel tragen und ganz allein eine Flasche von ihrem besten Champagner leeren und mir dann einen heißen Typen suchen.«
»Ich habe von einem Job gesprochen. Überlegen Sie, was für eine Tätigkeit Sie gern ausüben würden. Morgen. Wenn Sie aufwachen und jeden Beruf haben könnten.«
»Ich weiß es nicht.«
»Alles geht«, sage ich. »Auch die unrealistischste Hoffnung.«
»Na jaaa … eines gibt es tatsächlich, das ich gern machen würde«, antwortet sie.
»Was denn?«
»Meine Freundin Jaycee geht nach Estland, um dort Englisch zu unterrichten. Sie fliegt diese Woche hin. Sie hat mich eingeladen, weil sie noch mehr Lehrer brauchen dort. Ich schätze, das ist irgendwie meine Craigslist-Annonce, weil sie mich schon früher eingeladen hat, und ich immer abgelehnt habe, aber ich arbeite gern mit Kindern, und ich denke, es würde wirklich Spaß machen. Es ist eine Mädchenschule. Ich habe sie sogar auf Google Maps nachgeschlagen. Es ist eine süße kleine Schule. Und ich unterrichte wirklich gern.«
»Moment mal«, sage ich. »Sie erzählen mir, dass Sie eine echte Chance haben, diese coole Sache zu machen, statt irgendeinen Typen zu trainieren, der sich Ihnen gegenüber wie ein Mistkerl benehmen wird, und Sie wählen den Mistkerl?«
»Nun, ich habe einen Mietvertrag. Rechnungen zu bezahlen.«
»Strecken Sie die Hände aus«, sage ich.
Sie mustert mich argwöhnisch. »Warum?«
»Strecken Sie die Hände aus. Zeigen Sie mir Ihre Hände.«
Sie hält sie hoch.
»Das ist witzig«, fahre ich fort. »Ich sehe gar keine Handschellen. Sie vielleicht? Ich sehe keine Leine um Ihren Hals. Für mich sieht es so aus, als seien Sie eine freie Gestalterin Ihres eigenen aufregenden Lebens.«
Sie verschränkt die Hände erneut auf ihrem Schoß, aber ich habe ihre Aufmerksamkeit erregt.
»Das Leben ist kurz«, sage ich erneut. »Ich weiß, das ist ein Klischee, aber es gibt einen Grund dafür, dass es ein Klischee ist.«
Sie dreht sich um und starrt blinzelnd ins Leere.
»Ich meine es ernst, Stella.« Ich spüre, wie ich mich da hineinsteigere. Manchmal werde ich übertrieben leidenschaftlich, aber die Sache mit Stella scheint so glasklar zu sein. »Wenn dieser Aufzug nach oben fährt, könnten Sie sich dafür entscheiden, nicht im letzten Stock auszusteigen. Sie könnten auf diesen Knopf für die Lobby drücken und stattdessen dort aussteigen. Wäre das nicht schön?«
»Jaaaaa«, sagt sie.
»Nun?«
Sie betrachtet sehnsüchtig den Knopf mit der Aufschrift L. »Das kann ich nicht tun.«
»Stella, Sie haben ein echtes Jobangebot. Sie haben eine Wohnung? Schön. Schaffen Sie Ihre Sachen in ein Lager. Besorgen Sie sich einen Untermieter oder verzichten Sie auf die Kaution. Buchen Sie einen Last-Minute-Flug zu Ihrer Freundin. Bezahlen Sie die Rechnungen von Estland aus. Ich meine, es wartet tatsächlich ein Job auf Sie, um diese coole Sache zu machen? Und stattdessen werden Sie die nächsten wunderschönen Tage Ihres Lebens mit einem Vollidioten verbringen, der Sie herumschubst? Und dafür bekommen Sie nicht einmal eine Krankenversicherung?«
Sie betrachtet mich mit großen Augen. »Und er wird mich wirklich herumschubsen.«
Ich schüttle den Kopf. »Sie verdienen Besseres.«
Sie blinzelt. »Ich könnte mir tatsächlich einen Untermieter suchen. Mein Arschloch von Ex-Freund braucht eine Wohnung.«
»Na bitte«, erwidere ich.
Sie zieht die Nase hoch. »Die Bezahlung dort wäre beschissen, aber man bekommt ein kostenloses Zimmer und Verpflegung.« Sie sieht mich an. »Ich könnte dort glücklich sein.«
»Nun?«, sage ich.
»Scheiße«, lacht sie. »Ich kann nicht.«
»Sie wollen lieber da raufgehen und das Arschloch trainieren?«
»Nein«, flüsterte sie, klammert ihre Aktentasche an sich und blinzelt noch ein wenig mehr. »Oh mein Gott, Noelle, werde ich das wirklich tun?«
»Ja!« Ich schreie praktisch.
»Ja!« Sie greift nach meiner Hand. »Denn, warum nicht?«
»Richtig!«, stimme ich ihr zu.
»Ich könnte diesen ganzen Albtraum hinter mir lassen«, überlegt sie laut.
Ich stehe auf und zeige auf den Knopf für die Lobby. »Das könnte ihr nächster Halt sein.«
»Lassen Sie mich sehen, ob noch ein Platz frei ist.« Sie holt ihr Handy hervor, ruft ihre Freundin an und teilt ihr mit, dass sie darüber nachdenke, sie zu begleiten. Ich zittere vor Aufregung um ihretwillen. Denn ihr Job klingt so, als wäre er überaus ätzend. Ihre Freundin kreischt – ich kann es durch das Telefon hören.
Sie legt auf und sagt mir, dass ihre Freundin einige Anrufe tätigen würde. Es herrscht immer noch Bedarf an Lehrern, und es könnte sogar freie Plätze in ihrem Anschlussflug nach Amsterdam geben. Die Freundin überprüft das.
»Ich kann nicht glauben, dass ich mit einer Briefträgerin in diesem Aufzug festsitze und Sie mir raten, meinen Job zu kündigen.«
»Warum kann eine Briefträgerin Ihnen nicht raten zu kündigen?«, frage ich.
Ihr Handy klingelt. Es ist ihre Freundin, und es klingt nach guten Nachrichten. »Alles klar, ich bin dabei.«
Sie steckt ihr Handy weg. »Oh mein Gott, ich werde es tun. Ich – ich werde es einfach tun.«
»Yay!«, sage ich.
»Und ich werde ohne Kündigung aufhören. Ich werde einfach gehen, ohne auch nur ein einziges Mal zurückzuschauen, als Bestrafung für sie, dafür, dass sie mir die Mistkerle aufgehalst haben.«
»Sind Sie sich sicher, dass Sie es ihnen nicht mitteilen sollten?«
»Nein«, antwortet sie wohlgelaunt. »Sollen sie es doch allein herausfinden, wenn ich einfach nicht mehr auftauche.«
Innerlich zucke ich zusammen – ich bin total regelfixiert; ich würde nicht im Traum daran denken, einen Job aufzugeben, ohne in irgendeiner Form zu kündigen.
Wir sitzen noch gute zwanzig Minuten länger fest. In dieser Zeit sucht sie nach einem Lagerraum und ruft einige Leute an, die ihr dabei helfen sollen, ihre Sachen dorthin zu transportieren. Die Leute in Estland, die Englischlehrer suchen, arbeiten bereits an einem beschleunigten Visum.
Die Techniker oben sagen uns, dass sie bald fertig sein werden.
Sie dreht sich zu mir um. »Ich danke Ihnen. Ich bin wieder glücklich.«
»Gern geschehen. Aber Sie haben den Plan geschmiedet. Sie wagen den Sprung.«
»Aber Sie haben mir den Stoß gegeben.« Sie wühlt eine Visitenkarte aus ihrer Aktentasche und reicht sie mir. »Diese E-Mail-Adresse wird nicht mehr aktiv sein, sobald sie herausfinden, dass ich in der Versenkung verschwunden bin, aber die Handynummer bleibt die gleiche. Falls sie jemals irgendetwas brauchen, bekommen Sie es. Sollten Sie je nach Estland kommen, haben Sie einen Platz, wo Sie pennen können, Schwester.«
»Schicken Sie mir eine Postkarte«, sage ich. Ich greife nach einem Stück Papier und schreibe meine Privatadresse und meine Telefonnummer auf.
»Super.« Sie nimmt das Stück Papier entgegen.
Schließlich schlingert der Aufzug in den nächsten Stock, und die Türen öffnen sich. Wir steigen aus. Es ist der fünfte Stock, und Männer mit Werkzeugkisten und Handys warten dort. Sie entschuldigen sich überschwänglich. Einer gibt uns Wasserflaschen. Ein anderer arbeitet an der Bedienplatte.
Wir sollen in den anderen Aufzug steigen, um in den sechsten Stock hinaufzufahren, aber Stella informiert die Männer, dass sie zurück in die Lobby will.
Ich umarme sie und wünsche ihr viel Glück.
Das Gespräch mit Stella war eine perfekte Ablenkung, aber zehn Minuten später bin ich zurück in der Wirklichkeit und steige im sechsten Stock allein aus mit meiner erfundenen Lieferung. Ich gehe zur Rezeption und bin dankbar dafür, dass keine Spur von Janice oder Anya zu sehen ist.
Wie alles andere hier ist die Rezeption elegant und poliert und besteht wahrscheinlich aus schwarzem Marmor. Die beiden Männer und die Frau, die dahinterhocken, sind emsig bei der Arbeit.
»Du schaffst das«, sage ich mir und drücke mir meine Tasche auf den Bauch. Wenn Stella alles stehen und liegen lassen kann, um nach Estland zu gehen, kann ich behaupten, ich bräuchte Malcolm Blackbergs eigenhändige Unterschrift für eine Zustellung.
Mein neuer Plan sieht vor, ihm mitzuteilen, dass er sich das Video als Teil der Lieferung ansehen müsse, dass es etwas gebe, das er darin sehen müsse. Ich hoffe, dass ihn das neugierig genug macht, um am Bildschirm zu kleben. Neugier bringt Menschen dazu, sich Dinge für eine ziemlich lange Zeit anzuschauen, oder zumindest ist es mir so gegangen, als wir uns Stranger Things angesehen haben.
Ich lächele den Mann am Ende an, der einzige der drei, der Blickkontakt mit mir herstellt. Sein dunkles Haar ist kurz geschoren auf seinem kantigen Kopf, und er trägt eine Drahtbrille.
»Noch eins?«, fragt er.
»Jupp. Nur für den Empfänger«, erwidere ich.
»Geht klar.« Er streckt die Hand nach dem elektronischen Klemmbrett aus, das ich nicht habe.
»Tut mir leid«, sage ich. »Nur für den Empfänger.« Ich zeige ihm die Vorderseite. »Mister Malcolm Blackberg.«
»Wir sind alle autorisiert, Post für Mr Blackberg entgegenzunehmen.« Er streckt die Hand nach dem Klemmbrett aus.
»Nein, das ist eine Lieferung speziell für Mr Blackberg. Nur er kann unterschreiben.«