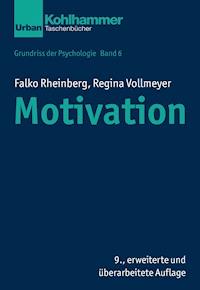
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
This book provides an introduction to motivational research on the basis of everyday phenomena and self-awareness. The discussion leads from explanations based on instinct and drive theory through the analysis of situational stimuli towards classic motivational psychology. Aspects drawn from current research that are discussed include volitional research, risk motivation and pleasurable absorption in activity (flow experience). The concept of motivational competence is then drawn out. The final chapter deals with ways of measuring motivation (motivational diagnosis). Using selected examples, the authors succeed in making typical forms of behaviour and model conceptions comprehensible. For this ninth edition, the content has been updated and educational aspects have been revised.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autoren
Prof. em. Dr. Falko Rheinberg leitete bis 2007 die Abteilung Allgemeine Psychologie am Institut für Psychologie der Universität Potsdam.
Prof. Dr. Regina Vollmeyer ist Professorin am Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt.
Falko Rheinberg Regina Vollmeyer
Motivation
9., erweiterte und überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Als italienische Lizenzausgabe liegt dieses Werk unter dem Titel »Psicologia della Motivazione« vor (2. Auflage 2003; Societa Editrice Il-Mulino, Bologna, Italien).
Als kroatische Lizenzausgabe ist das Werk bei Naklada Slap, Jastrebarsko, Kroatien, erschienen (1. Auflage 2004).
Als polnische Lizenzausgabe ist das Werk bei Wydawnictwo WAM, Krakau erschienen (1. Auflage 2006).
Als chinesische Lizenzausgabe ist das Werk bei Shanghai Academy of Social Science Press, Shanghai erschienen (1. Auflage 2012).
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
9., erweiterte und überarbeitete Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-032954-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-032955-3
epub: ISBN 978-3-17-032956-0
mobi: ISBN 978-3-17-032957-7
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Vorwort
1 Einführung
1.1 Fragestellungen der Motivationspsychologie
1.2 Was ist Motivation?
1.3 Zwei Analyseperspektiven: Druck und Zug
1.4 Zusammenfassung
2 Frühe Erklärungskonzepte: Instinkte und Triebe
2.1 Instinkte
2.2 Triebe als Erklärungskonzepte: Beispiel S. Freud
2.3 Zusammenfassung
3 Motivation als Person-Umwelt-Bezug
3.1 Beiträge des Behaviorismus
3.2 Bedürfnisspannung und Aufforderungscharakter: K. Lewin
3.2.1 Gespannte Systeme in der Person
3.2.2 Feldkräfte in der Situation
3.3 Klassifikation von Person-Umwelt-Bezügen
3.3.1 Individuelle Analyse und allgemeine Aussagen
3.3.2 Person und Situation als need and press: H. A. Murray
3.3.3 Der Thematische Apperzeptionstest (TAT)
3.4 Zusammenfassung
4 Leistungsmotivation
4.1 Das Phänomen leistungsmotivierten Verhaltens
4.2 Motiv und Motivation
4.2.1 Konzeption und Erfassung des Leistungsmotivs
4.2.2 Leistungsmotivation auf gesellschaftlicher Ebene
4.2.3 Das Risikowahl-Modell
4.3 Die »kognitive Wende« und das Selbstbewertungsmodell
4.3.1 Ursachenerklärungen von Erfolg und Misserfolg
4.3.2 Das Selbstbewertungsmodell
4.3.3 Motivtrainingsprogramme und Unterricht
4.3.4 Bezugsnorm-Orientierung im Unterricht
4.4 Verwandte Theoriekonzepte
4.4.1 Motivationale Orientierungen
4.4.2 Selbstkonzept der Begabung
4.4.3 Erlernte Hilflosigkeit
4.5 Zusammenfassung
5 Machtmotivation
5.1 Machtthematik als soziale Grundsituation
5.2 Die Struktur des Machthandelns
5.3 Die Suche nach dem Machtmotiv
5.4 Entwicklungsstadien der Machtorientierung
5.5 Motivstruktur von Führungskräften
5.6 Zum Stand der Machtmotivationsforschung
5.7 Zusammenfassung
6 Die Analyse komplexer Motivationsstrukturen
6.1 Die Anreizvielfalt des Alltagshandelns
6.2 Instrumentalitätstheorie
6.3 Das Erweiterte Kognitive Motivationsmodell
6.4 Die Unterscheidung von Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartungen
6.5 Eigenanreize von Tätigkeiten
6.6 Ziele im Dienst motivspezifischer Tätigkeits- vorlieben
6.7 Ein schillernder Begriff: extrinsische vs. intrinsische Motivation
6.7.1 Verschiedene Verständnisse von intrinsischer Motivation
6.7.2 Interesse und intrinsische Motivation
6.8 Flow-Erleben als universeller Tätigkeitsanreiz
6.9 Freude an riskanten Aktivitäten und Erlebnissuche
6.10 Zusammenfassung
7 Motivation und Wille
7.1 Merkmale von Willensprozessen
7.2 Handlungskontrolle
7.3 Das Rubikonmodell des Handelns
7.4 Grit – Durchhaltevermögen als simplifizierendes Praxiskonzept
7.5 Zusammenfassung
8 Aktuelle Entwicklungen: Motive, Ziele und Wohlbefinden
8.1 Zur Notwendigkeit von Willensprozessen
8.2 Basale Motive und motivationale Selbstbilder
8.3 Motivpassende Ziele und Wohlbefinden
8.4 Motivationale Kompetenz
8.4.1 Das theoretische Konzept
8.4.2 Erste Befunde
8.5 Zusammenfassung
9 Wie misst man Motivation?
9.1 Besonderheiten der Motivationsdiagnose
9.2 Ein Diagnoseschema
9.3 Zur Anwendung des Diagnoseschemas
9.4 Zusammenfassung
Literatur
Weiterführende Literatur
Vertiefende Literatur zu speziellen Bereichen
Verwendete Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Dieses Buch gibt eine Einführung in die Motivationspsychologie. Es wendet sich an Studierende im Bachelorstudium der Psychologie und an »interessierte Laien«, also etwa an Erziehungs-, Sozial-, Wirtschaftswissenschaftler und Lehrkräfte. Voraussetzungsfrei und anknüpfend an Alltagserfahrungen werden zunächst Fragestellungen und Arbeitsweisen der Motivationspsychologie erläutert. Mit wachsendem Kenntnisstand werden den Lesern dann nach und nach differenziertere Betrachtungen motivationspsychologischer Ansätze im Fortgang des Buches möglich.
Dieser Darstellungslogik ließ sich recht zwanglos auch die historische Entwicklung der Motivationsforschung zuordnen. In den Anfangsteilen geht das Buch auf die eher einfachen und historisch früh entwickelten Instinkt- und Triebkonzepte ein. Es folgen dann differenziertere Ansätze, in denen motiviertes Verhalten aus der Wechselwirkung von Person und Situation verstanden wird. Auf dieser Grundlage entwickelte sich die »klassische« Motivationspsychologie, die hier im Mittelteil des Buches am Beispiel der Leistungs- und Machtmotivation dargestellt wird. In den letzten Kapiteln werden dann komplexere Ansätze behandelt. Hier geht es um handlungstheoretische Motivationsmodelle, um Anreizanalysen des Alltagshandelns, um willensgesteuerte Handlungskontrolle, um Motivationale Kompetenz und Flow und anderes mehr. Da diese Ansätze den aktuellen Forschungsstand und seine noch offenen Fragen wiedergeben, werden sie etwas ausführlicher behandelt. Abschließend werden diese verschiedenen Motivationskomponenten in einem Diagnoseschema so aufeinander bezogen, dass sie eine Einzelfallanalyse der aktuellen Motivation einer bestimmten Person erlauben.
Natürlich muss ein Einführungsbuch aus didaktischen Gründen vereinfachen und vor allem: sich inhaltlich beschränken. Manches hätte viel ausführlicher diskutiert werden können. Einige Forschungsfelder sind gar nicht behandelt. Diese Beschränkung fiel jedoch relativ leicht, weil es eine sehr gute weiterführende Literatur gibt, auf die man bei den hier erworbenen Vorkenntnissen dann zurückgreifen kann. Hinweise auf diese Literatur werden nach dem letzten Kapitel 9 gegeben.
Gladbeck und Frankfurt am Main, im Sommer 2018
Falko Rheinberg und Regina Vollmeyer
1 Einführung
1.1 Fragestellungen der Motivationspsychologie
Wie kommt es dazu, dass Sie gerade jetzt diese Zeilen lesen, statt irgendetwas anderes – vielleicht viel Schöneres – zu tun? Die Antworten hierauf werden höchst verschieden ausfallen. Vielleicht erhoffen Sie sich eine leichte Einführung in ein Gebiet, zu dem Sie ein Referat halten, eine Arbeit anfertigen oder später eine Prüfung ablegen wollen; vielleicht interessieren Sie sich generell für Psychologie und wollen deshalb auch etwas zum Teilbereich Motivation wissen; vielleicht lesen Sie einfach gerne, und dieses Buch fiel Ihnen gerade in die Hände; vielleicht wollen Sie sich im Moment auch nur irgendwie beschäftigen, weil es Ihnen sonst schrecklich langweilig würde oder anderes mehr. Wie auch immer die Antwort in Ihrem speziellen Fall ausfallen mag, Sie betreiben gerade aktiv Motivationspsychologie. Immerhin tun Sie ja nichts Geringeres, als ein bestimmtes Verhalten (Ihr Lesen) zu erklären. »Erklären« meint hier, dass Sie bestimmte Gründe für Ihr Verhalten ausfindig machen. »Gründe« wiederum sind das, was Sie sich als positive Folge bzw. Begleiterscheinung Ihrer Aktivität versprechen.
So gesehen wäre Motivationspsychologie im Prinzip ja eine recht einfache Sache: Suche und finde die Gründe, um derentwillen jemand handelt. Abgesehen davon, dass dies lediglich eine (wichtige) Teilaufgabe der Motivationspsychologie wäre, werden die Dinge bei genauer Betrachtung doch schnell schwieriger und komplexer. Eine nur scheinbare Schwierigkeit ist die, dass wir mitunter vergeblich nach angestrebten Zielzuständen unseres Verhaltens suchen würden. So etwas ist häufig bei reflexhaftem Verhalten oder bei Routinehandlungen der Fall. Hier vollziehen sich Aktivitäten quasi automatisch, ohne dass wir die Anziehungskraft eines bestimmten Zielzustandes spüren und ohne das Erlebnis, etwas Bestimmtes zu wollen. Solche Verhaltensweisen sind üblicherweise nicht Gegenstand motivationspsychologischer Betrachtung, wenngleich in ihrer zurückliegenden Entstehungsgeschichte motivationale Prozesse durchaus wichtig gewesen sein können.
Ein anderer Fall ist der, dass wir sehr genau ein spezifisches Ziel nennen können, das wir mit unserer Aktivität zurzeit verfolgen. Trotz der möglichen Präzision bei der Angabe des Handlungsziels sind wir uns oft aber weit weniger klar darüber, was denn genau das Anziehende, also der eigentliche Grund (Fachterminus: der Anreiz) der Zielerreichung ist. Sicherlich, man kann mitunter ein weiteres Ziel nennen, für das die jetzige Zielerreichung hilfreich wäre. Aber was genau ist dann der Anreiz dieses weiteren Ziels? Sind es innere Zustände der Zufriedenheit, des Glücklichseins, der Entspannung, der angenehmen Erregung etc. – Dinge also, die den Bereich der affektiv/emotionalen Befindlichkeit betreffen? Oder sind es eher Gedankenketten (Kognitionen), die das jetzige Ziel mit höchsten/letzten Werten unseres Selbst- und Weltverständnisses verbinden oder vielleicht sogar beides: Kognitionen und Affekte? Um das Eingangsbeispiel aufzugreifen: Was im Einzelnen macht das Ziel »Von Psychologie mehr zu wissen« oder »Ein gutes Referat zu halten« so attraktiv, dass es in diesem Moment Ihr Verhalten lenkt? Vielleicht spielen Sie die beiden gerade skizzierten Erklärungsstrategien der kognitiven und/oder affektiven Folgen für Ihren Fall einmal durch.
Insbesondere wenn man Aussagen nicht nur über einzelne Personen, sondern über viele machen will, kommt ein zusätzlicher Gesichtspunkt ins Spiel. Schon aus ökonomischen Gründen kommt es darauf an, möglichst allgemeine Klassen von Anreizen zu bilden. Anreizklassen sollen so definiert sein, dass sie bei vielen Personen den Anreiz vieler spezifischer Einzelziele abdecken. Welche Qualität, welche Struktur und welche Breite solche Anreizklassen haben sollen und wie man sie erfasst, das sind schon schwierigere Fragen der Motivationspsychologie.
Noch komplexer werden die Dinge, wenn wir zur Erklärung von Verhaltensunterschieden kommen. Solche Unterschiede sind es ja, die in besonderer Weise zu motivationsbezogenen Überlegungen anregen. Wie kommt es beispielsweise, dass Sie immer noch aufmerksam lesen, während jemand anderes bereits unruhig oder gelangweilt im Buch vor- und zurückblättert, ein Zweiter es schon weggelegt hat, während ein Dritter beschließt, es aus der Bibliothek mit nach Hause zu nehmen, um es dort gründlich durcharbeiten zu können? Am Buch selbst können diese Unterschiede ja kaum liegen. Es muss etwas mit der jeweiligen Person zu tun haben und ihrem momentanen Zustand (aktuelle Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, Handlungsmöglichkeiten etc.). Wie gut sich der momentane Zustand seinerseits auf überdauernde Personmerkmale und/oder auf die jeweilige Lebenssituation des Einzelnen zurückführen lässt und wie weit beides zusammenhängt, das ist eine der zentralen Fragen der Motivationspsychologie.
Aber nicht nur Unterschiede zwischen Personen, sondern auch solche innerhalb derselben Person wollen erklärt sein. Vielleicht lesen Sie jetzt noch aufmerksam und sind gespannt, wie das hier weitergehen soll. Im Verlauf der nächsten Stunden ist es aber doch wahrscheinlich, dass Sie das Buch zur Seite legen und etwas Anderes tun. Vielleicht drängt sich ein Hungergefühl in Ihr Aufmerksamkeitsfeld und lässt die Möglichkeit der Nahrungsaufnahme immer attraktiver werden; der Uhrzeiger könnte sich einer Position nähern, bei der Sie das Lesen abbrechen müssen, um einen Termin einzuhalten; Sie können auf Textpassagen stoßen, die – je nach Vorwissen – für Sie langweilig oder zu schwierig sind, so dass »vagabundierende Gedanken« Ihnen andere Ziele und Handlungsmöglichkeiten ins Aufmerksamkeitsfeld transportieren und vieles andere mehr. Solche Verhaltensänderungen im zeitlichen Längsschnitt lassen sich unter motivationspsychologischer Perspektive analysieren, sofern diese Änderungen etwas mit angestrebten Verhaltensfolgen zu tun haben.
Motivationspsychologie befasst sich damit, Richtung, Dauer und Intensität von Verhalten zu erklären. Dabei ist der motivationspsychologische Zugriff dadurch charakterisiert, dass angestrebte Zielzustände und das, was sie attraktiv macht, die erklärenden Größen sind. Insbesondere Verhaltensunterschiede zwischen verschiedenen Personen sowie Kontinuität und Wechsel im zeitlichen Längsschnitt sind typische Anlässe, um aus motivationspsychologischer Perspektive nach Verhaltenserklärungen zu suchen (vgl. Vollmeyer 2005).
1.2 Was ist Motivation?
Bislang wurde etwas zur Motivationspsychologie gesagt, aber noch wenig dazu, was unter Motivation selbst zu verstehen ist. Alltagssprachlich bezieht sich der Motivationsbegriff auf eine Größe, die in ihrer Stärke variieren kann: Tennisspieler X ist »hoch motiviert«, die Spitze der Weltrangliste zu erreichen; Schüler Y ist »wenig motiviert«, die Hausaufgaben zu erledigen. Obwohl in dieser Weise als Einheit behandelt, kann dieser Motivationsbegriff qualitativ verschiedene Verhaltens- und Erlebnismerkmale betreffen. »Hoch motiviert zu etwas« kann bedeuten, dass jemand alle Kräfte mobilisiert, um etwas Bestimmtes zu erreichen, sich durch nichts davon abbringen lässt, nur noch das eine Ziel vor Augen hat und darauf fixiert ist und nicht eher ruht, bis er es erreicht hat. Es geht also darum, dass jemand (1) ein Ziel hat, dass er (2) sich anstrengt und dass er (3) ablenkungsfrei bis zur Zielerreichung bei der Sache bleibt (Ausdauer). Im Selbsterleben können Zustände des Angezogenseins, ja Gefesseltseins, des Verlangens, Wollens und Drängens, der Spannung, Aktivation und Ruhelosigkeit gemeint sein. DeCharms hat dieses Begriffsverständnis recht prägnant damit umschrieben, dass Motivation »so etwas wie eine milde Form der Besessenheit« sei (DeCharms 1979, S. 55). Als zugehörigen Situationsprototypen kann man sich eine Person vorstellen, die höchste Begehrlichkeiten unmittelbar vor Augen und in greifbarer Nähe hat, gleichwohl noch etwas tun muss, um zugreifen zu können. Bemerkenswerterweise scheint es uns im Alltag nicht zu stören, dass wir »Motivation« bei anderen Personen als Gegenstand nie unmittelbar wahrnehmen können, sondern immer nur über Anzeichen erschließen. Motivation ist hier eine gedankliche Konstruktion, eine Hilfsgröße (Fachterminus: hypothetisches Konstrukt), die uns bestimmte Verhaltensbesonderheiten erklären soll (Heckhausen & Heckhausen 2018; Heider 1958; Thomae 1965a). Aber wie kommt es dann, dass uns Motivation nicht folgerichtig als kognitives Kunstprodukt, sondern durchaus als reale Gegebenheit erscheint?
Wir vermuten, das liegt daran, dass uns die Binnenzustände des zielgebundenen Strebens, Wollens, Wünschens, Hoffens etc. einschließlich ihrer Verhaltensauswirkungen (Anstrengung und Ausdauer) aus dem Selbsterleben wohl vertraut sind. Wenn man einen motivierten Zustand und seine typischen Verhaltensauswirkungen quasi von innen kennt, hat man kaum Zweifel, etwas Ähnliches »hinter« dem Verhalten anderer Personen zu vermuten, wenn bestimmte Anzeichen darauf verweisen. Dies erscheint uns auf Dauer um so weniger fragwürdig, je öfter wir damit zu richtigen Vorhersagen oder sinnmachenden Interpretationen fremden Verhaltens gekommen sind.
Allerdings gibt es hier eine wichtige Einschränkung: Die Motivation ist uns auch aus dem Selbsterleben nicht gegeben, sondern immer nur bestimmte Motivationsphänomene in bestimmten Kontexten. Wie schon gesagt, kennen wir Zustände, die wir mit Streben, Wollen, Bemühen, Wünschen, Hoffen etc. bezeichnen. Aber sind das wirklich identische Phänomene von gleicher Struktur und Qualität? Wohl kaum. Gemeinsam ist ihnen aber die Komponente einer aktivierenden Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand.
Man kann diese gemeinsame Komponente als Rechtfertigung dafür nehmen, auch in der wissenschaftlichen Psychologie die verschiedenen Phänomene unter einen Begriff, nämlich Motivation, zu fassen. Wichtig ist allerdings dabei, im Auge zu behalten, dass man es tatsächlich nur mit einer Sammelkategorie zu tun hat, in der viele verschiedene Teilprozesse und Phänomene zusammengefasst sind. Weiterhin ist zu bedenken, dass es neben der aufsuchenden Motivation ja auch eine meidende gibt: Man schreckt vor etwas zurück, man flieht etc. Hier besteht der »positive« Zielzustand darin, etwas Aversives abgewendet zu haben. Auf diesen komplizierteren Fall gehen wir später näher ein.
Der Begriff Motivation spiegelt nicht eine homogene Einheit wider, von der man mal mehr oder weniger hat. Es gibt also nicht so etwas wie einen einheitlichen »Motivationsmuskel«, für den sich im Organismus ein spezieller Zellverband finden ließe. Der Motivationsbegriff ist vielmehr eine Abstraktionsleistung, mit der von vielen verschiedenen Prozessen des Lebensvollzuges jeweils diejenigen Komponenten oder Teilaspekte herausgegriffen und behandelt werden, die mit der ausdauernden Zielausrichtung unseres Verhaltens zu tun haben (Heckhausen & Heckhausen 2018; Thomae 1965a). Aufgabe der wissenschaftlichen Motivationspsychologie ist es, diese verschiedenen Komponenten und Teilprozesse in ihrem Zusammenspiel zu beschreiben und zu erfassen, ihre Abhängigkeiten und Beeinflussbarkeiten zu bestimmen und ihre Auswirkungen im Erleben und nachfolgendem Verhalten näher aufzuklären.
Bezogen auf das Einführungsbeispiel müssten wir also diejenigen Prozesse und Größen ausfindig machen und spezifizieren, die dafür sorgen, dass Sie trotz des momentan eher langweiligen Allgemeinheitsgrades der Darstellung immer noch lesen. Weiterhin sollten wir herausfinden, wovon diese Prozesse ihrerseits abhängig sind und was man machen könnte, um sie zu beeinflussen. Also was genau müsste man tun, um etwa eine Person, die lediglich zur Abwehr von Langeweile in diesem Buch liest, in den Zustand zu bringen, dass sie von Motivationspsychologie begierig mehr wissen will? (Mit langatmigen Definitionsdarlegungen gelingt das sicher nicht.) Schließlich sollten wir auch noch sagen können, wie sich verschiedene Motivationszustände und die sie ausmachenden Teilprozesse z. B. auf die Art des Lesens, die Verarbeitung des Inhalts und nachfolgende Gedächtnisleistungen auswirken. Um keine unrealistischen Erwartungen zu wecken: Diese Leistungen kann die heutige Motivationspsychologie noch nicht zur vollen Zufriedenheit erbringen, gleichwohl sind Teilbereiche hierzu recht gut erforscht (s. u.).
Zusammenfassend lässt sich zum Motivationsbegriff also sagen, dass er sich nicht auf eine fest umrissene und naturalistisch gegebene Erlebens- oder Verhaltenseinheit bezieht, sondern in gewisser Weise eine Abstraktion ist.
Genauer bezeichnen wir mit Motivation die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand bzw. auf das Vermeiden eines negativ bewerteten Zustandes.
An dieser Ausrichtung sind unterschiedlichste Prozesse im Verhalten und Erleben beteiligt, die in ihrem Zusammenwirken und ihrer Beeinflussbarkeit wissenschaftlich näher aufgeklärt werden sollen.
1.3 Zwei Analyseperspektiven: Druck und Zug
Versucht man, Motivation in der eben definierten Weise näher zu fassen und zu verstehen, so kann man unterschiedliche Strategien verfolgen und entsprechend verschiedene Vorstellungen entwickeln. Je nach theoretischen Grundpositionen und Menschenbildern finden sich in der Psychologie und ihren Nachbarfächern ganz verschiedene Versuche, die aktivierende Zielausrichtung zu beschreiben und zu erklären. Die vielleicht augenfälligste Unterscheidung, die man hier treffen kann, ist die, ob man sich motiviertes Verhalten eher als angetrieben/»gedrückt« oder als angezogen vorstellt.
Im ersten Fall werden Triebe oder Instinkte für die Ausführung von Aktivitäten verantwortlich gemacht. Man stellt sich vor, dass solche innerorganismischen Größen in einer Art Eigenleben über die Zeit Spannungen oder Energien aufbauen, die nach befriedigender Entladung verlangen. Dabei muss erklärt werden, warum es in der Regel nicht zu diffusen Aktivitätsäußerungen kommt, sondern der Organismus zu ganz bestimmten Aktionen gedrängt wird. Anders formuliert: Woher ›weiß‹ der drängende Trieb, was ihn befriedigt? Hierzu kann man entweder eine angeborene Koppelung von Trieb und Befriedigungshandlungen annehmen (z. B. Hunger drängt zur Nahrungsaufnahme) oder eine Koppelung aufgrund zurückliegender Lernprozesse. In letzterem Fall hat der Organismus wiederholt erfahren, dass bestimmte Triebreize durch bestimmte Aktivitäten in befriedigender Weise reduziert werden. Das Denkmodell eines getriebenen/gedrängten Verhaltens findet sich in höchst unterschiedlichen Konzepten – so in dem psychoanalytischen Ansatz von Freud (1905, 1915), dem ethologischen Ansatz von Lorenz (1942, 1963) oder in bestimmten behavioristischen Ansätzen (z. B. Hull 1943, 1952). In Kapitel 2 werden diese Konzepte teilweise genauer dargestellt.
Das Denkmodell von verhaltenswirksamen Kräften, die sich im Organismus periodisch entwickeln, passt wohl am besten auf körpernahe Bedürfnisse, deren Befriedigung den Lebenserhalt sichert – also Hunger, Durst, Bedürfnis nach Atemluft etc. Man charakterisiert solche Bedürfnisse auch als Mangelbedürfnisse (z. B. Maslow 1954). Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass diese Bedürfnisse in der Regel erst dann in die Ausrichtung des Verhaltensstroms eingreifen, wenn bestimmte innerorganismische Defizite signalisiert werden. Diese Mangelzustände drängen sich in meist unlustgetönter Empfindungsqualität in unser Wahrnehmungsfeld und können – wenn stark genug – andere Aktivitäten unterbrechen, abändern oder verschieben.
Ohne Frage lässt sich die momentane Stärke solcher Bedürfnisse weitgehend aus zurückliegenden Ereignissen erklären. So ist Durst abhängig davon, wann, wie viel und was man zuletzt getrunken hat, welche Speisen man zu sich genommen hat (Salzgehalt), von Klimafaktoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit), von körperlichen Anstrengungen (Transpiration) und anderen Dingen mehr. Bekannt sind auch die wesentlichen innerorganismischen Besonderheiten und die zugehörigen Rezeptoren, die Durstsignale aussenden (s. Schmalt & Langens 2009). Wir haben es hier also in fast perfekter Weise mit einem innerorganismisch verankerten Motivationssystem zu tun, bei dem aufgrund zurückliegender Geschehnisse aktuelle Mangelzustände entstehen, die hier und jetzt zu Trinkaktivitäten drängen.
Aber selbst dieses körpernahe und höchst überlebenswichtige Motivationssystem ist nur ein fast perfektes Beispiel für die Vorstellung rein innerorganismisch gedrängter Aktivitäten. Es lässt sich nämlich leicht zeigen, dass auch hier Anreize aus der Umwelt, also von außen herangetragene Größen, mit wirksam sind. So kann an einem heißen Sommertag der Anblick eines kühlen Getränkes den Drang zur Trinkaktivität deutlich stärker werden lassen, als es ohne diesen Anblick gewesen wäre.
Neben solchen Mangelbedürfnissen passen vielleicht auch noch allgemeine Antriebsphänomene zur Modellvorstellung des Gedrängten/Getriebenen. Unsere Alltagspsychologie hat hier einige Begriffe parat wie den »Tatendrang« oder den »Erlebnishunger«. Gemeint sind stark ausgeprägte Aktivitätsbereitschaften, denen aber noch das konkrete Ziel fehlt, um aus Bereitschaft Aktivität werden zu lassen. Gerade wegen der fehlenden Richtungskomponente würden wir diese Zustände aber (noch) nicht als Motivation im engeren Sinne auffassen. Genaugenommen ist hier nur eine Teilkomponente des Motivationsgeschehens betroffen, nämlich die der Aktivation und Energetisierung.
Schwieriger wird es, die Modellvorstellung des angetriebenen Verhaltens auf komplexere Verhaltensbereiche zu übertragen – also etwa auf das Lesen einer Studentin, die dieses Buch durcharbeitet, weil sie eine Prüfung machen will. Hier müsste man einen Lesetrieb/-instinkt postulieren, der sich von Zeit zu Zeit aufbaut und nach Befriedigung verlangt, oder aber zeigen, wie basalere Triebe/Instinkte durch zurückliegende Lernprozesse mit den jetzigen Leseaktivitäten fest verknüpft sind. Ersteres dürfte wenig Plausibilität besitzen, Letzteres würde wohl recht spekulativ, aber vor allem umständlich werden, ohne für die Besonderheiten der gegenwärtigen Lesemotivation Erklärungsgewinn zu besitzen. Aktivierende Zielausrichtung der jetzigen Art lässt sich weitaus besser nach der Modellvorstellung des Anziehens und nicht des Antreibens von Verhalten analysieren. Hier fragt man nach dem zukünftigen Zustand, den die Person herbeiführen will. Nicht zurückliegende Ereignisse treiben und drängen, sondern Erwartetes zieht und richtet aus.
Im jetzigen Fall wäre der Zielzustand eine möglichst gut bestandene Prüfung. Die Zuordnung von Ziel und Aktivität ist dabei nicht (oder nur zu geringen Teilen) starr programmiert, sondern abhängig von Erwartungen und Zweckmäßigkeitseinschätzungen. So wird unsere prüfungsmotivierte Leserin jetzt immer noch dem Text folgen, weil sie erwartet, dass die nächsten Seiten Dinge klären oder Informationen liefern, die sie bei der anstehenden Prüfung braucht. Bestimmte Abschnitte wird sie dann überschlagen, wenn sie vermutet, dass der Prüfer dazu kaum fragen wird. Natürlich beschränkt sich die aktivierende Zielausrichtung bei ihr nicht nur auf das Lesen, sondern auch auf andere Dinge, wie das Anfertigen von Notizen und Skripten, das Wiederholen von Gelesenem, auf Diskussionen mit anderen Studierenden, auf das probeweise Beantworten vermuteter Prüferfragen und vieles mehr.
All diese verschiedenen Aktivitäten sind auf einen Zielzustand gerichtet (Fachausdruck: Äquifinalität des Verhaltens, Brunswik 1952) und werden über ihn sehr viel besser verständlich, als würde man versuchen, für jede einzelne Aktivität spezifische innerorganismische Antriebsstrukturen zu rekonstruieren, die aufgrund einer bestimmten Verkoppelungsmechanik dafür sorgen, dass unsere Kandidatin gerade dieses Kapitel noch liest, das nächste überschlägt, mit anderen über das Gelesene diskutiert, bei Unklarheiten ein anderes Buch zu Rate zieht und anderes mehr. Ohne die Motivationsrekonstruktion über einen angestrebten Zielzustand wäre auch schwer erklärlich, warum all diese Aktivitäten plötzlich enden, wenn die Prüfung bestanden ist, und warum das Lesen vielleicht ganz anders verlaufen wäre, wenn unsere Studentin nur aus einem eher unspezifischen Interesse an Motivationspsychologie mit diesem Einführungstext begonnen hätte.
Die Frage nach dem Wozu, also die Suche nach angestrebten Zielzuständen, ist die typische Analyseperspektive der Motivationspsychologie, wenn sie komplexer organisierte Handlungsstrukturen erklären will.
Damit wird keineswegs negiert, dass sich Teile unseres Verhaltens durchaus nach der Vorstellung des Antreibens verstehen lassen. Dies gilt besonders für physiologisch basierte Aktivitäten mit lebenserhaltendem Funktionscharakter oder für vitale Antriebserlebnisse. Es wird nur der Tatsache Rechnung getragen, dass sich bei komplexeren und höher organisierten Handlungsweisen die aktivierende Zielausrichtung von Verhalten besser aus der Perspektive anziehender Zukunftsereignisse erklären lässt.
Natürlich kommt man auch bei einer solchen Erklärungsperspektive nicht ohne Annahmen zu Besonderheiten der Person aus. Vordringlich ist zu klären, warum denn ein bestimmter Zielzustand überhaupt erstrebenswert ist, also Anreiz besitzt. So etwas geht nicht ohne Rückbezug zur Person. Ein Stück trockenes Brot wird sich erheblich in seinem Anreiz unterscheiden, je nachdem, wie hungrig vs. übersättigt eine Person gerade ist. Ein zu mähender Rasen kann von einer Person, die voller Tatendrang steckt, ganz anders erlebt werden als von jemandem, der sich erschöpft und überfordert fühlt. Bei den höher organisierten Handlungen, die vorzugsweise Untersuchungsgegenstand der Motivationspsychologie sind, operiert man hierbei mit eher zeitüberdauernden Vorlieben für bestimmte Klassen von Zuständen. So ist es für manche Person über Jahrzehnte hinweg besonders anziehend, genussvoll und wichtig, sich im Lösen herausfordernder Aufgaben als kompetent und tüchtig erleben zu können (Leistungsmotiv), während es für andere besonders attraktiv ist, sich in der Beeinflussung anderer Menschen groß, mächtig, stark und wichtig zu fühlen (Machtmotiv). Solche und ähnliche überdauernden Vorlieben der Person werden Motive genannt.
In der Motivationspsychologie bezieht sich der Begriff Motiv auf die relativ zeitstabile Bevorzugung einer Person für eine bestimmte Inhaltsklasse von Anreizen (z. B. Leistung, Macht, freundschaftliche Beziehungen etc.).
Natürlich sind auch Motive nicht direkt beobachtbar, sondern hilfreiche Gedankenkonstruktionen (hypothetische Konstrukte), die uns das Handeln von Personen besser verständlich machen. Wir werden später darauf noch sehr genau eingehen. Zum jetzigen Zeitpunkt soll es genügen, klarzustellen, dass der verhaltenslenkende Anreiz angestrebter Zielzustände mit abhängig ist von Bewertungsvorlieben (Motiven) der Person. Gleichwohl ist er ein Bestandteil einer künftigen Situation, auf die man durch eigenes Handeln zielförderlich Einfluss nehmen will.
Fällt mit diesem Rückbezug zur Person der Unterschied zwischen druck- und zugmotivierter Verhaltensmodellierung letztendlich zusammen? Das nicht. Im ersteren Fall müssten die allein über Triebe/Instinkte herausgebrachten Aktivitäten in mehr oder weniger fixierter Form abgespeichert und auslösbar sein. Sie müssen ihre spezifische Zielausrichtung in schematischer Version schon in sich haben. Im zweiten Fall besorgt die Personvariable (Motiv) zunächst lediglich die Bewertung und Akzentuierung eines Zustandes, der sich im künftigen Lebensvollzug der Person durch eigenes Eingreifen ergeben könnte. Ob und wann daraus welche Handlung wird und welche richtunggebenden Teilprozesse auftreten, das ist als relativ flexibel, insbesondere als situationsangemessen reguliert gedacht.
1.4 Zusammenfassung
Im ersten Kapitel haben wir uns gefragt, womit sich Motivationspsychologie beschäftigt, und auf welche Weise sie versucht, Motivationsphänomene zu analysieren. Dazu haben wir zwei zentrale Konzepte, nämlich »Motivation« und »Motiv« näher bestimmt, sowie zwei unterschiedliche Erklärungsstrategien, nämlich »Druck« und »Zug« skizziert.
Übungsfragen
1. Wie lässt sich Motivation definieren?
2. In welcher Beziehung stehen Motiv und Motivation zueinander?
3. Wie unterscheiden sich die beiden Analyseperspektiven »Zug« und »Druck«?
Leseempfehlung:In den beiden nachfolgenden Kapiteln werden frühe theoretische Konzepte beschrieben, auf deren Fundament sich die heutige Motivationspsychologie entwickelt hat. Wer sich für solche Grundlagen nicht interessiert, kann gleich bei Kapitel 4 zur Leistungsmotivation weiterlesen.
2 Frühe Erklärungskonzepte: Instinkte und Triebe
Wie schon angesprochen, gibt es Anteile unseres Verhaltensrepertoires, die in ihrer motivationalen Grundstruktur angeboren sind. Das schließt nicht aus, dass auch erworbenes Wissen/Kognitionen und Gewohnheiten Einfluss nehmen. Gleichwohl ist hier die Kopplung von Anregungsbedingungen und Verhaltenstendenz schon vor der Lernerfahrung und dem Wissensaufbau gegeben. Trivialerweise gilt dies für unmittelbar lebenserhaltende Aktivitäten wie Essen oder Trinken. Organismen ohne einen genetisch gesicherten Antrieb zu solchen Verhaltensweisen hätten kaum eine Chance, mehr als einige Tage zu überleben.
Sieht man einmal vom Einfluss erlernter, situativer Anreize (»Appetitanregung«) und kognitiver Bewertungsprozesse ab, so ist etwa der Hunger abhängig von innerorganismischen Zuständen (z. B. dem Glukosegehalt an Rezeptoren in der Leber oder dem Druck auf die Magenwände; s. im Einzelnen Schmalt & Langens, 2009, S. 120 – 137). Der erlebte Drang zur Nahrungsaufnahme nimmt im Allgemeinen mit der Dauer der Fastenzeit zu und kann alle anderen Wünsche, Vorstellungen und Zielsetzungen dominieren. Die Tatsache, dass der sog. Mundraub straffrei bleibt, zeigt, dass die gebieterische Kraft solcher Mangelzustände auch der »naiven« Psychologie in der Gesetzgebung bekannt ist. Hinreichend großer Hunger kann kognitive Bewertungsprozesse bei der Nahrungsauswahl soweit relativieren, dass Hungernde Ratten, Mäuse, Insekten und andere ekelerregende Dinge essen. Auch wenn es in Einzelfällen Abweichungen gibt (z. B. lebensgefährdende Hungerstreiks von Inhaftierten zur Durchsetzung bestimmter Ziele), haben wir es im Regelfall also mit einem mächtigen Motivationssystem zu tun, das angeborenermaßen unser Verhalten in aktivierender Weise auf bestimmte Ziele lenkt und so das Überleben sichert. Solche Systeme haben wir offenkundig mit anderen Lebewesen gemein.
2.1 Instinkte
Nun gibt es bei Tieren noch eine Vielzahl weiterer, auf bestimmte Endzustände zulaufende Verhaltenssysteme, etwa im Sexual-, Brut- und Aufzuchtverhalten oder im innerartlichen Sozialverhalten, für die eine genetische Basis anzunehmen ist. Für Letzteres spricht die Stereotypie der Ausführung sowie die systematische innerartliche Verbreitung und vor allem die Lernunabhängigkeit bestimmter Verhaltenssequenzen.
So beginnen isoliert aufgezogene und erstgebärende Rattenweibchen ein bis zwei Tage bevor sie gebären, Papierschnitzel in ihrem Käfig zusammenzutragen und eine Art Nest zu bauen, obwohl sie es nie bei anderen Tieren beobachtet haben oder sonstwie erfahren haben konnten. Auch das Reinigen des Nestes, Wärmen und Säugen der Jungen erfolgt ohne vorherige Lerngelegenheiten (Hebb 1975).
Solche Zweckmäßigkeitsstrukturen wirken auf uns verblüffend, weil klar ist, dass das fragliche Lebewesen den jeweiligen Zweck nicht vorhersehen kann. So wird den Ameisen das System ihres Zusammenlebens schon aus Kapazitätsgründen kognitiv kaum repräsentiert sein können – gleichwohl agieren sie in einer Art, als wäre es so. Ein gerade geschlüpfter Kuckuck wirft die anderen Jungvögel aus dem fremden Nest, ganz so, als ob er wüsste, dass er mehr Nahrung braucht, als die versorgenden und körperlich kleineren Elternvögel für alle liefern könnten, und ganz so, als ob er wüsste, dass diese Elternvögel aufgrund ihrer eigenen genetischen Festlegung nicht anders können, als ihn (statt ihres eigenen eliminierten Nachwuchses) aufzuziehen.
Wenn man sich einen bestimmten Instinkt vorstellt als eine Zusammensetzung vieler einzelner angeborener Reflexeinheiten, die jede für sich dem Prinzip der genetischen Zufallsvariation folgt, so kann eine Vielzahl von Reflexsequenzen entstehen. Diejenigen Reflexsequenzen, die unter gegebenen Bedingungen (Umwelt, Körperbau etc.) einen Anpassungsvorteil bewirken, begünstigen Lebewesen mit der entsprechenden genetischen Ausstattung. Das wiederum führt zu einer Ausbreitung des jeweiligen Instinktes in der Art.
Wegen der feinen Anpassung an komplexe Bedingungskonstellationen wirken die Verhaltensweisen scheinbar beabsichtigt, ja manchmal fast trickreich und raffiniert – wie oben beim Beispiel des frisch geschlüpften Kuckucks. Gleichwohl sind es starre Verhaltenssequenzen, die mitunter nicht einmal bis zum Erreichen des nützlichen Effektes durchgehalten werden (Lorenz 1937). Trotz oberflächlicher Ähnlichkeit ist solch instinktgelenktes Verhalten qualitativ höchst verschieden von einer Handlungsstruktur, bei der ein künftiger Zustand als Ziel kognitiv vorweggenommen und wegen seiner positiven Bewertung auf jeweils situationsangepasste Weise angestrebt wird.
Auch wenn Menschen mit Hilfe ihrer kognitiven Möglichkeiten Zielzustände vorwegnehmen, bewerten und flexibel anstreben können, so schließt das ja nicht aus, dass auch wir aus unserer Evolutionsgeschichte genetisch basierte Verhaltenstendenzen besitzen, die sich aus (früheren) Instinkten herleiten. Insbesondere nachdem Darwin die gemeinsame Systematik in der Entwicklung der Arten (inklusive des Menschen) überzeugend dargelegt hatte, sprach im Prinzip nichts dagegen, auch bei Menschen instinktive Verhaltensanteile oder Instinktrudimente zu vermuten. Diese Vermutung lag umso näher, als es Verhaltensweisen gibt, die bei vielen Menschen in ähnlicher Form beobachtbar sind – also eine hohe innerartliche Verbreitung haben.
Das betrifft etwa das Ausdrucksverhalten. So ist der mimische Ausdruck von Gefühlen für unterschiedlichste Völker in gleicher Weise verstehbar: Ureinwohner Neuguineas konnten auf Portraitfotos die ausgedrückte Emotion richtig zuordnen, obwohl die Fotos von Menschen aus gänzlich fremden Kulturkreisen stammten. Umgekehrt konnten amerikanische Studenten den Emotionsausdruck dieser Ureinwohner richtig zuordnen, obwohl auch sie nie Kontakt zu diesem Kulturkreis hatten (Ekman 1972).
Universell sind auch bestimmte Grundtendenzen wie Flucht, Angriff, Orientierung etc., die im Verhalten schon auftreten können, bevor wir in der jeweiligen Situation detaillierte Zielbewertungen und Mittelabwägungen vorgenommen haben. So wundert es nicht, dass schon recht früh in der wissenschaftlichen Psychologie mit dem Instinktkonzept gearbeitet wurde.
Bereits 1890 benutzte William James den Begriff Instinkt und charakterisierte damit die Möglichkeit von Lebewesen, ohne vorheriges Anlernen und ohne Voraussicht bestimmte Endzustände zu bewirken (James 1890, S. 383).
Den größten Einfluss bekam das Instinktkonzept in der Psychologie aber etwas später durch McDougall (1908). McDougall ging von einem relativ komplexen Instinktkonzept aus. Als angeborene Struktur sollte der Instinkt (1) eine Akzentuierung der Wahrnehmung besorgen: man wird bevorzugt auf bestimmte Gegenstände oder Ereignisse aufmerksam und beobachtet sie. Die so wahrgenommenen Objekte führen dann (2) zu ganz bestimmten Qualitäten emotionaler Erregung, die wiederum (3) die Tendenz erzeugen, in einer bestimmten Weise gegenüber diesem Wahrnehmungsobjekt zu handeln – zumindest liefert sie den Impuls dazu. Nach McDougall gehört also zu jedem Auftreten instinktiven Verhaltens ein Erkennen von etwas, ein Gefühl ihm gegenüber und ein Streben hin oder weg von ihm (1908, S. 26).
Als unveränderlichen Kern des jeweiligen Instinkts sah McDougall die spezifische Emotion an. Die Klassen von Objekten/Ereignissen, die diese instinkttypische Emotion auslösen, können in Abhängigkeit von Erfahrung ebenso modifiziert werden wie die motorische Aktivität, zu der die Emotion drängt. Auf diese Weise konnte McDougall der unabweislichen Plastizität menschlichen Verhaltens Rechnung tragen und gleichzeitig annehmen, dass sich eine breite Variation unseres Verhaltens auf eine begrenzte Zahl von Instinkten zurückführen lässt. Allerdings hatte er sich mit diesem Konzept deutlich entfernt von dem eher starren Instinktbegriff, wie er von Darwin oder James und vor allem in der Ethologie verwandt wird (s. u.). Genau genommen bleibt vom Instinkt nur noch das Rudiment einer angeborenen Möglichkeit zu bestimmten Emotionen in vitalen Grundsituationen. So war es dann auch folgerichtig, wenn er später statt von Instinkten von » Propensities« (Neigungen) als Disposition zu bestimmten Verhaltenstendenzen oder Impulsen sprach (McDougall 1932).
McDougalls allgemeines Instinktkonzept ist durchaus mit Vorstellungen aus der jüngeren Emotions- und Motivationspsychologie vereinbar (s. u.). Die Resultate der dadurch angeregten Forschung waren allerdings weniger hilfreich. Sie bestanden in unterschiedlich langen Listen von Instinkten. Verhaltensweisen, die man häufiger bei sich und anderen in ähnlicher Weise beobachtete, wurden mehr oder weniger scharf als Kategorien gefasst, mit Begriffen belegt, und ihnen dann der Status von Instinkten verliehen. Die theoretisch interessante Zuordnung zu Emotionen als Kern des Instinktes konnte dabei leider nicht mehr durchgängig geleistet werden. Die folgende Tabelle gibt als Beispiel die letzte Instinktsammlung von McDougall (Tab. 2.1; der Begriff Propensity wird hier mit Instinkt, Trieb, Streben, Impuls, Bedürfnis etc. übersetzt.)
Die Systematik der Kategorienbildung ist wenig überzeugend. Im Unterschied zur theoretisch klar gefassten dreigliedrigen Instinktdefinition bietet McDougall hier eine bunte Sammlung an, die zum Teil aus direkten Bezeichnungen von Emotionen/Affekten besteht (z. B. Ekel, Angst), zum Teil aus Verhaltenstendenzen mit emotionalem Kern (z. B. Sexualität, Elterninstinkt) sowie aus Verhaltenstendenzen, bei denen eine Emotionszuordnung kaum möglich erscheint (z. B. Herstellungsbedürfnis, Besitzstreben).
Tab. 2.1: Instinktive Tendenzen (sog. Propensities) im Verhalten von Menschen (nach McDougall 1932)
Gleichwohl findet sich in dieser Aufstellung viel »allgemein Menschliches«, das zum Teil in ähnlicher Weise auch bei uns näher verwandten Tierarten beobachtbar sein dürfte. Und das ist zweifellos ein gewisser Erkenntnisgewinn. Man könnte mit solchen Katalogen vielleicht einem Besucher eines fernen Planeten sagen, womit man bei diesen aufrecht gehenden Lebewesen von Zeit zu Zeit rechnen muss. Aber wie hilfreich sind solche kategorisierenden Bestandsaufnahmen häufig auftretender Verhaltensweisen? Sind sie nicht (a) zu allgemein und (b) unvollständig?
In der Folge wurde versucht, diesen scheinbaren Mangel dadurch zu beheben, dass man immer mehr höchst spezifische Verhaltensweisen beschrieb, die man bei vielen Menschen häufiger beobachtete. Der Soziologe Bernard behauptete 1924, nach einer Inspektion der einschlägigen Literatur auf mehr als 14 000 Instinktnennungen gestoßen zu sein. So kam es dann zu solchen Kategorien wie »Trieb, möglichst nicht innerhalb der eigenen Plantage einen Apfel zu essen« (nach Thomae 1965b, S. 433).
Hierbei wird deutlich, dass bei solchen Entwicklungen das theoretische Konzept seinen Erklärungswert verloren hat. Das, was zu erklären wäre (hier: das unterlassene Apfelessen innerhalb der eigenen Plantage), wird im Kurzschluss mit der Erklärung gleichgesetzt, indem das Wort »Instinkt« oder »Trieb« angehängt wird. Dem ohnehin beobachteten Verhalten wird also ein Instinkt gleichen Namens zugeordnet, womit es als »erklärt« gilt. Individuelle Lebensvollzüge wandeln sich damit von einer Sequenz unerklärter Verhaltensweisen zu einer ebensowenig erklärten Serie von Instinktäußerungen. Das ist sicherlich kein Erkenntnisfortschritt. Diese Kritik betrifft allerdings weniger McDougall selbst, der durch seine reduzierte Zahl von Instinkten zumindest eine abstrahierende Ordnungsleistung erbracht hat – selbst, wenn die Systematik der Kategorienbildung verbesserungswürdig erschien (s. o.).
Zudem hat er dem Instinktkonstrukt mit der Trias aus erfahrungsabhängiger Wahrnehmungsakzentuierung, der instinktspezifischen Emotion und der resultierenden Verhaltenstendenz eine Binnenstruktur verliehen, die auch mit jüngeren Konzepten zu basalen Verhaltensweisen vereinbar ist. So gehen in der heutigen Emotionsforschung verschiedene Autoren von sechs bis neun Grundemotionen aus (Ekman 1972; Izard 1971; Plutchik 1980; Tomkins 1970). Zu diesen Emotionen (die übrigens bereits von Darwin 1872 aufgeführt wurden) zählen:
• Überraschung/Interesse,
• Freude/Glück,
• Trauer/Kummer,
• Ekel,
• Furcht,
• Ärger,
• Scham.
Solche Emotionen lassen sich in dem Sinne als rudimentäre Motivationssysteme auffassen, als sie in vitalen Grundsituationen eine schnelle Interpretation/Bewertung ermöglichen und bestimmte Handlungstendenzen (Zuwendung, Flucht etc.) nahelegen (Heckhausen & Heckhausen 2018).
Diese Möglichkeit zu emotionsgesteuerten Lebensvollzügen lässt sich durchaus als Anpassungsvorteil in unserer Evolutionsgeschichte begreifen und eine entsprechende genetische Verankerung annehmen. Diese Position wäre von McDougalls Instinktkonzeption dann nicht mehr weit entfernt (vgl. Schmalt & Langens 2009).
In beiden Fällen darf man natürlich nicht dem Fehlschluss erliegen, als würde sich alles Verhalten quasi als Kombination oder Mixtur einer begrenzten Zahl von Instinkten/Emotionen wie in einem Baukastensystem erschöpfend rekonstruieren lassen. Das würde die lebensgeschichtliche Plastizität unseres Verhaltens ignorieren. Vor allem wäre der breite Verhaltensbereich nicht abgedeckt, bei dem kognitive Prozesse unser Handeln so nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten lenken, dass unsere Aktivitäten in unterschiedlichsten Situationen und bei unterschiedlichsten Zielen immer wieder neu angepasst werden. Diese Handlungsmöglichkeit schließt aber andererseits nicht aus, dass wir in wichtigen Situationen, die schnelles Reagieren erfordern, auch auf emotionalem Verarbeitungsniveau operieren, also einem Instinktrudiment die Verhaltenssteuerung überlassen. Überdies sollte man im Auge behalten, dass auch bei kognitiv ausgewählten und intelligent realisierten Zielen der letztlich wirksame Anreiz häufig emotional-affektiv verankert ist. So können kognitive Leistungen höchster Komplexität und Werke von größter Bedeutung dadurch zustande kommen, dass der Urheber einfach sehen will, was er schaffen kann, um mit sich und seiner Tüchtigkeit zufrieden zu sein, oder weil er es genießt, von anderen beachtet und wertgeschätzt zu werden.
Eine theoretische Weiterentwicklung und Präzisierung erfuhr das Instinktkonzept innerhalb der Ethologie durch Lorenz (1937, 1942). Aufgrund von Verhaltensbeobachtungen an frei lebenden Tieren (besonders an Graugänsen und ihren Eirollbewegungen) traf Lorenz die Unterscheidung zwischen einer starr ablaufenden Endhandlung des Instinktes (die sog. Erbkoordination) und einem vorgeschalteten »Appetenzverhalten«, mit dem das Tier aktiv nach Gelegenheiten sucht, um die starre Instinkthandlung ablaufen zu lassen. Diese angeborene Endhandlung hat arterhaltende Effekte, sofern sie vollständig und mit dem richtigen Objekt durchgeführt wird. Sie ist durch situative Besonderheiten oder Erfahrung nicht modifizierbar und wird durch fest umrissene Schlüsselreize wie ein Automatismus ausgelöst. Das Appetenzverhalten, bei dem sich das Lebewesen sozusagen auf die Suche nach Schlüsselreizen begibt, ist dagegen situations- und lernabhängig und damit wechselnden Lebensbedingungen anzupassen. Motivationspsychologisch übersetzt wäre die Möglichkeit, ein bestimmtes Verhalten (die Endhandlung) ausführen zu können, der Anreiz, um ein anderes Verhalten (das Appetenzverhalten) auszuführen. Dabei spielt der evolutionsbiologisch rekonstruierbare Zweck der reizvollen Aktivität auf der Ebene der individuellen Motivation offenbar kaum eine Rolle. Es kommt nämlich häufiger vor, dass diese Aktivitäten vor Erreichen des arterhaltungsrelevanten Effektes abgebrochen werden oder auch an ungeeigneten Objekten erfolgen (z. B. Eirollbewegungen mit einem Stein).
Diese Struktur, dass ein Anreiz im Ablaufenlassen bestimmter Aktivitäten selbst liegt und nicht erst in deren vorhersehbarem Effekt, war schon zuvor von Woodworth (1918) als » behavior-primacy« und von Bühler (1919) als » Funktionslust« bei Menschen beschrieben worden. Im Spiel von Kindern oder im Freizeitverhalten Erwachsener findet sich eine Fülle von Beispielen dafür, dass eine Tätigkeit vornehmlich deshalb ausgeführt wird, weil ihr Vollzug Spaß macht, und nicht etwa, weil man die Ergebnisfolgen der Tätigkeit anstrebt (Oerter 1993).
Schon fast ein Standardbeispiel wäre der Skiläufer, der sicher nicht deshalb eilig den Hang herunterfährt, weil er so gerne am Lift steht und wartet, sondern einfach den Vollzug der Tätigkeit samt ihrer Begleiterlebnisse genießt (tätigkeits- vs. zweckzentrierte Anreize, Rheinberg 1989; 1993). Diese Anreizstruktur ist bis heute in unterschiedlichen Versionen und Akzentsetzungen meist unter dem Stichwort »intrinsische Motivation« immer wieder aufgegriffen worden (Kap. 6.7).
Eine andere, sehr viel schlechter belegbare Annahme in der Instinktkonzeption von Lorenz war und ist heftig umstritten. Lorenz (1937) unterstellt jedem Instinkt eine » aktionsspezifische Energie« , also ein eigenes Antriebszentrum. Diese Energie soll im Organismus laufend produziert werden und drängt auf Abführung. Ist die jeweilige Endhandlung längere Zeit nicht abgelaufen, so steigt im Organismus das reaktionsspezifische Energiereservoir an. Damit nimmt die Empfindlichkeit für Schlüsselreize zu. Im Extremfall werden die Schlüsselreize frei halluziniert, oder es kommt zu Endhandlungen bei unpassenden Gelegenheiten bzw. Objekten (sog. Leerlaufreaktion wie z. B. Eirollbewegungen mit einem Stein).
Dieses hydraulische Modell mit dem hypothetischen Konstrukt einer sich innerorganismisch aufbauenden Energie wurde von Lorenz (1963) auch auf aggressives Verhalten von Menschen übertragen. Dieses Verhalten wurde damit als spontan und unausweichlich konzipiert, es sei denn, die sich laufend aufbauende aggressionsspezifische Energie würde von Zeit zu Zeit in gesellschaftlich akzeptabler Form abgeführt (sog. Katharsis). Eine ganz ähnliche Vorstellung findet sich bereits bei Freud (1926, 1934), als er neben dem Lebenstrieb Eros den Todestrieb Thanatos postulierte. In späteren Abhandlungen dehnt Lorenz seine Überlegungen sogar auf die angeborene »kollektiv-aggressive Begeisterung« als Grundlage von Kriegen aus (Lorenz 1983, S. 188 f.), so wie es Freud (1934) in seinem Briefwechsel mit Albert Einstein schon vor ihm gemacht hatte.
Diese problematischen Annahmen von Lorenz zogen Kritik auf sich (z. B. Boyce 1976; Krahé 2013; Montagu 1968, 1976). Das hydraulische Modell der Aggression blieb in der Motivationspsychologie zu Recht ohne Wirkung. Dort wurde Aggression als zielgerichtetes Verhalten einer »wirklich ärgerlichen« Person modelliert, das sich, vermittelt über Erwartungs- und Bewertungsprozesse, gegen die Ärgerquelle richtet. Eine Abnahme der Aggressionsbereitschaft soll nur dann eintreten, wenn durch die Handlung das Ziel des Verärgerten, nämlich die Beseitigung der Frustration, erreicht wurde (Kornadt 1982). Diese Konzeption ist mit der Empirie weit besser im Einklang als das Modell einer sich endogen zwangsläufig aufbauenden Energie, die in mehr oder weniger beliebigen Ersatzhandlungen wieder abgebaut werden muss, soll es nicht zu spontan aggressivem Verhalten kommen (Zumkley 1978).
Wertet man insgesamt den Beitrag, den die instinktorientierten Konzepte zur Klärung von Motivationsphänomenen geleistet haben, so ist es sicher ein Verdienst, darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass bei aller lernabhängigen Plastizität und allen kognitiven Zwischenprozessen Teile unserer Verhaltenssteuerung in unserer Evolutionsgeschichte verankert sind. Verbunden damit wird klar, dass die Anregung zum Handeln sich nicht allein als Ergebnis analytisch kühl kalkulierender Ratio verstehen lässt. Vielmehr sind (a) vorgeformte Handlungstendenzen in vitalen Grundsituationen mit in Rechnung zu stellen (z. B. Flucht oder Angriff bei Bedrohung), und es ist (b) zu berücksichtigen, dass Emotionen in die Bewertung angestrebter Zielzustände eingehen. Schließlich wurde (c) auf die Spontaneität von Verhalten aufmerksam gemacht sowie (d) auf die Tatsache, dass Aktivitäten in sich selbst befriedigend sein können. Gerade die Annahme evolutionär basierter Motivationssysteme spielt in neueren Motivationskonzeptionen wieder eine zentrale Rolle (McClelland 1985b; Kap. 8).
Wenig hilfreich waren die Versuche, mit umfassenden Instinktsammlungen nahezu alles Verhalten auf eine instinktive Grundlage stellen zu wollen. Irreführend war dabei die Idee, Verhalten im Kurzschluss damit zu »erklären«, dass man ihm einen gleichnamigen Instinkt zuordnete. Schlichte Direktübertragungen ethologischer Konzepte auf menschliches Verhalten genügen häufig nicht jenen Kriterien, die man an ernstzunehmende Motivationsforschung anlegen muss, und sind etwa im Fall der Aggression eher mit Anekdoten als mit empirischen Befunden vereinbar.
2.2 Triebe als Erklärungskonzepte: Beispiel S. Freud
Dem Instinktkonzept eng verwandt sind Modellvorstellungen, in denen sog. Trieben die zentrale Rolle beim Verständnis menschlichen Verhaltens zugewiesen wird. Wie bei den Instinkten wird auch bei Trieben zumeist eine angeborene biologische Grundlage angenommen. Beide Konzepte beziehen sich auf basale verhaltensenergetisierende Kräfte, die von ganz anderer Qualität sind als etwa die Handlungsentschlüsse, die wir nach sorgsamer Situationsanalyse und rationalem Abwägen treffen. Angeregte Triebe und Instinkte erscheinen im Selbsterleben mitunter fast fremd, zumindest schwer kontrollierbar. Es ist ganz so, als ob innerhalb der eigenen Person Kraftzentren aus sich selbst heraus aktiv werden können und dann unabhängig von kühl kalkulierten Abwägungen, Vornahmen und Plänen in drängender Weise Einfluss auf unser Wollen, Denken und Handeln gewinnen.
Die starke Ähnlichkeit von Instinkten und Triebkonzepten wurde bereits vom Begründer der wissenschaftlichen Psychologie, nämlich W. Wundt, in seinen »Vorlesungen über die Menschen und Thierseele« (1892, S. 423) konstatiert (s. Graumann 1969). Von daher überrascht auch nicht, wenn etwa in der ersten englischen Fassung freudscher Schriften der Triebbegriff nicht mit »drive«, sondern mit »instinct« übersetzt wurde.
Legt man allerdings das präzisierte Instinktverständnis der Ethologie zugrunde, so wird gerade zum freudschen Triebkonzept ein substantieller Unterschied deutlich. Die ethologische Forschung ist bei ihren genauen Beobachtungen frei lebender Tiere darauf gestoßen, dass das Auftreten von Instinkthandlungen an spezifizierte Schlüsselreize gebunden ist, die einen » Angeborenen Auslösemechanismus« betätigen (AAM; Tinbergen 1951). Erst bei extrem langem Ausbleiben von Schlüsselreizen werden diese »frei halluzinatorisch vorgegaukelt« (Lorenz 1942, S. 393), und die Instinkthandlung erfolgt als sog. Leerlaufreaktion situationslosgelöst und nur noch innengesteuert. Dies ist aber im natürlichen Lebensraum ein Ausnahmefall. Im Regelfall wird die Verhaltenssteuerung explizit auch von Merkmalen der jeweils aktuellen Situation abhängig gemacht – eben dem Vorhandensein geeigneter Schlüsselreize. Demgegenüber kommt die Triebkonzeption Freuds (1915, 1938) weitestgehend ohne spezifischen Bezug zur aktuellen Handlungssituation aus. Verhalten wird hier in erster Linie als Ergebnis höchst dynamischer und konfliktreicher Binnenprozesse verstanden. Was jemand tut oder lässt, hängt davon ab, welche Triebabkömmlinge nach langem Ringen oder geschickten Täuschungsmanövern im »psychischen Apparat« gerade den Zugang zur Motorik erhalten haben. Die jeweils aktuelle Situation mit ihren Handlungsmöglichkeiten, Anreizen und Erreichbarkeiten hat Freud nur wenig interessiert – allenfalls in dem Sinne, dass die (ohnehin als bedrohlich gedachte) Umwelt häufig einer Triebbefriedigung im Wege steht. Dem Sprichwort »Gelegenheit macht Diebe« würde bei seiner Analyseperspektive der Satz entsprechen: »Wer den Drang zu stehlen hat, wird auch Diebesgut finden«. In dieser Weise ist die freudsche Konzeption der Prototyp der Vorstellung eines von innen (an)getriebenen Verhaltens, der im Einführungskapitel die Vorstellung eines von situativen Anreizen (an)gezogenen Verhaltens gegenübergestellt wurde.
Trotz der situationsignoranten Einseitigkeit freudscher Analysestrategie wird im Folgenden auszugsweise auf sein Triebkonzept eingegangen, weil einige Annahmen die spätere Motivationspsychologie beeinflusst haben. (Für das Verständnis des Folgenden wird es hilfreich sein, im Auge zu behalten, dass sich Freud im Wesentlichen für mehr oder weniger unterdrückte sexuelle Bedürfnisse interessiert hat.)
Ausgangspunkt (nicht nur) freudscher Theoriebildung ist die Überzeugung, dass uns vom »Seelenleben« zweierlei bekannt ist: (1) das Gehirn als das zugehörige Organ und (2) die uns unmittelbar gegebenen »Bewusstseinsakte«. Um die enorme Kluft zwischen diesen beiden Ansatzpunkten zu überbrücken, konstruiert Freud einen »psychischen Apparat«, den er sich wohl durchaus in materieller Form vorstellte: »Wir nehmen an, dass das Seelenleben die Funktion eines Apparates ist, dem wir räumliche Ausdehnung und Zusammensetzung aus mehreren Stücken zuschreiben, den wir uns also ähnlich vorstellen wie ein Fernrohr, ein Mikroskop und dergleichen« (Freud 1938; Gesammelte Werke 17, S. 67).
Dieser zwischen Körperlichem und Bewusstseinsakten platzierte »psychische Apparat« besteht in seiner Grobgliederung aus drei Instanzen oder »Provinzen«: dem » Es«, dem » Ich« und dem » Über-Ich«.
Der älteste und wichtigste Teil ist dabei das »Es«. Diese Instanz beinhaltet alle angeborenen Funktionen und steht den biologisch körperlichen Vorgängen am nächsten. (In der Terminologie unserer Computerzeit liegt hier also die Schnittstelle zwischen Körperlichem und Psychischem.) Insbesondere greifen von hier aus die Triebe in das psychische Geschehen ein: »Die Macht des Es drückt die eigentliche Lebensabsicht des Einzelwesens aus. Sie besteht darin, seine mitgebrachten Bedürfnisse zu befriedigen« (Freud 1938, Gesammelte Werke 17, S. 70). Allerdings ist nicht das Es selbst der Erzeuger dieser Triebe. Quelle der Triebe sind vielmehr bestimmte Prozesse in einem Organ oder Körperteil, die im Es einen Reiz erzeugen. Diese Reize treten dann auf psychischer Ebene als Triebe bzw. Bedürfnisse in Erscheinung.
In der freudschen Theoriebildung ist der Trieb





























