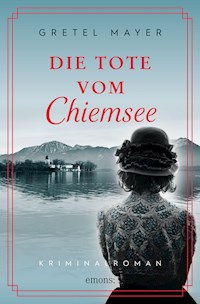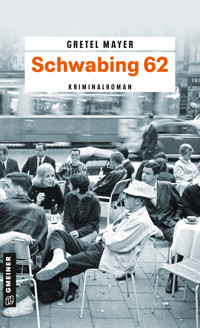Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalbeamte Korbinian Hilpert und Siegfried Breitner
- Sprache: Deutsch
München 1954. In der Schleißheimer Straße wird der 59-jährige Albrecht Gruber ermordet aufgefunden. Der junge Polizist Korbinian Hilpert, der in der berühmten Münchner Ettstraße gerade erst seine Ausbildung zum Kriminalbeamten begonnen hat, wird in seinem ersten Mordfall vor eine große Herausforderung gestellt. Da das Opfer eine äußerst schillernde Vergangenheit - sowohl während der Nazizeit als auch später in der Münchner Schwarzmarktszene - hatte, ist die Liste der Verdächtigen lang. Hilpert und sein altgedienter Kollege Siegfried Breitner haben eine harte Nuss zu knacken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gretel Mayer
Münchner Vergangenheit
Kriminalroman
Zum Buch
München 1954 In der Schleißheimer Straße wird der 59-jährige Albrecht Gruber tot aufgefunden. Er wurde durch etliche vehement ausgeführte Messerstiche in die Brust brutal ermordet. Der junge Polizist Korbinian Hilpert aus dem Chiemgau, der gerade seine Ausbildung zum Kriminalbeamten in der berühmten Ettstraße begonnen hat, wird in seinem ersten Mordfall vor eine große Herausforderung gestellt. Gemeinsam mit seinem altgedienten, erfahrenen Kollegen Siegfried Breitner muss er in die verschiedensten Richtungen ermitteln, denn das Mordopfer hatte eine äußerst schillernde dunkle Vergangenheit. Albrecht Gruber war während der Nazizeit ein gefürchteter Blockwart in der Münchner Maikäfersiedlung und in der Nachkriegszeit einer der führenden Köpfe in der Schwarzmarktszene. Die Liste der Verdächtigen ist lang, hatten doch viele unter ihm zu leiden. Das Ermittlerduo hat eine äußerst harte Nuss zu knacken …
Gretel Mayer, geboren 1949 in München, war als Fremdsprachensekretärin, Übersetzerin und jahrelang als Buchhändlerin tätig, bevor sie ihre Leidenschaft fürs Schreiben entdeckte. Obwohl ihr Lebensmittelpunkt schon seit Jahrzehnten in Unterfranken liegt, schlägt ihr Herz noch immer für das Alpenvorland und ihre Geburtsstadt München.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Ullstein Bild – United Archives
Verkehrsleiter auf dem Karlsplatz, genannt Stachus, mit Karlstor und den Türmen der Frauenkirche, 1957
ISBN 978-3-8392-7590-0
Zitat
»Der Münchner hat einen gemächlichen, gemütlichen Puls. Man kann damit sehr alt werden.«
Erich Kästner
1
Jeden Dienstag putzte Fanny Silberschneider bei drei Parteien eines Hauses in der Münchner Schleißheimer Straße. Wie durch ein Wunder hatte das gutbürgerliche Haus mit der etwas abweisenden dunkelgrauen Fassade den Weltkrieg unbeschadet überstanden, und auch ein Großteil der Herrschaften, bei denen Fanny sauber machte, war einigermaßen durch die schreckliche Zeit gekommen. Vermögen war bei der Hauseigentümerin, Fräulein von Wagner, einer Dame schon etwas gehobenen Alters, die aus fränkischem Adel stammte, sicher ebenso vorhanden wie bei dem ebenfalls schon in die Jahre gekommenen Ehepaar Schmitzer, er emeritierter Professor für bayerische Geschichte, sie frühere Konzertpianistin. Lediglich Fannys dritte Putzstelle konnte derart gehobene Lebensumstände nicht bieten. Herr Gruber, ein alleinstehender Mann Ende 50, lebte in einer fast schon ärmlich wirkenden, wesentlich kleineren Wohnung als die Wagner und die Schmitzers, und Fanny war jedes Mal von Neuem erstaunt, wenn der Gruber im Gegensatz zu den Schmitzers ihr ihren Lohn pflichtgetreu auf Heller und Pfennig auf die Küchenkommode legte. Auch zu putzen gab es bei Gruber viel weniger als bei den anderen; es herrschte eine fast pedantische Ordnung und Sauberkeit in der spärlich möblierten Wohnung, und Fanny beschlich manchmal der Verdacht, dass Gruber immer vor ihrem Kommen noch einmal extra sauber machte.
Zuerst putzte Fanny zwei bis drei Stunden bei Fräulein von Wagner, bei der es immer Unmengen von Nippes zu polieren gab; dann, nach einer kurzen Kaffeepause, weiter zu den Schmitzers, bei denen sie sich immer wunderte, wie zwei Personen innerhalb einer Woche Bad und Klosett derart verschmutzen konnten. Am Treppenhausfenster, neben zwei vor sich hin kümmernden Farnen, aß Fanny dann ihr Butterbrot und rauchte eine Pall Mall, die ihr ihre Tochter Trudi immer aus einer ihrer Tändeleien mit verschiedenen Besatzungssoldaten – Fanny wollte gar nicht mehr darüber wissen – mitbrachte. Dann ging es weiter zu Gruber, den ihr die von Wagner vermittelt und den sie noch nie persönlich kennengelernt hatte. Bei ihm war sie meistens in eineinhalb Stunden fertig.
Es war der erste Dienstag im September des Jahres 1954. Der Münchner Sommer hatte noch nicht richtig Abschied genommen und Fanny war bei ihren beiden ersten Putzstellen schon richtig ins Schwitzen geraten. Die klein geblümte Kittelschürze klebte ihr am Rücken, und ihre Haare unter dem Kopftuch waren feucht. Herr Gruber war während ihrer Anwesenheit nie zu Hause, den Schlüssel zur Wohnung hatte er immer unter dem rechten Farn im Treppenhaus versteckt. Beim Öffnen seiner Wohnung im Erdgeschoss des Hauses stellte Fanny erstaunt fest, dass nicht wie sonst zweimal abgesperrt war. Das war bei dem pedantischen Gruber äußerst verwunderlich. Fanny trat in den Flur, und sofort fiel ihr auf, dass ein alter Trachtenhut und eine graue Joppe an der Garderobe hingen. Fanny sorgte sich. Ob Gruber möglicherweise krank im Bett lag?
»Herr Gruber, ich bin’s, die Fanny«, rief sie. »Ich komm zum Putzen.«
Es blieb still in der Wohnung. Fanny beschloss, zuerst einmal einen Blick in die Wohnküche zu werfen, bevor sie ins Schlafzimmer schaute. Als sie die Küchentür öffnete, stieg ihr ein seltsamer Geruch in die Nase, der sie an die Schlachttage auf dem Bauernhof ihres Großvaters bei Erding erinnerte. Eine Mischung aus dem leicht metallischen Geruch frischen Blutes und dem bestialischen Gestank der letzten Ausscheidungen der Schlachttiere. Zögernd öffnete Fanny die Tür, trat in etwas Feuchtklebriges und wäre fast ausgerutscht. In der Küche, die zum schattigen Innenhof des Hauses hinausging, war es düster. Nur ein paar vereinzelte Sonnenkringel tanzten auf dem Küchenbuffet.
Neben dem Küchenstuhl lag Gruber – Fanny nahm zumindest an, dass er es war – er trug eine Schlafanzughose, die ein wenig heruntergerutscht war und einen schwammigen weißen Bauch entblößte. Seine Brust war nackt und wies einige große klaffende Wunden auf, aus denen wohl sehr viel Blut geströmt sein musste, das nun jedoch langsam anfing zu gerinnen. In kleinen Bächen hatte es sich dunkelrot über den Küchenboden geschlängelt und am Ende kleine Tümpel gebildet. In einen dieser kleinen Blutseen war Fanny getreten, und nun sah sie, dass die Spitze ihres rechten Schuhs blutverklebt war. Grubers Mund war weit aufgerissen, seine Augen starrten Fanny blicklos an, und seine Wangen waren nass, so als hätte er geweint. Ein Schrei, der jedoch seinen Weg nicht fand, blieb Fanny in der Kehle stecken und machte stattdessen einem keuchenden Würgen Platz.
Sie wankte aus der Küche und der Wohnung hinaus ins Treppenhaus, und nun bahnte sich der Schrei doch seinen Weg aus ihrer Kehle, er gellte durch das ganze Haus und rief sofort Fräulein von Wagner auf den Plan, die gerade dabei gewesen war, ihre Nippes wieder richtig zu platzieren. Die gute Fanny polierte sie zwar immer wunderbar, stellte sie aber nie wieder ganz an den richtigen Platz zurück.
Fanny ließ sich auf eine der Treppenstufen fallen, und einen Augenblick überlegte sie, ob sie ihr gerade erst zu sich genommenes Butterbrot wieder von sich geben und in den trostlosen Farn erbrechen sollte.
»Der Gruber, der Gruber …«, stammelte sie, und als sie zu Fräulein von Wagner, die oben im Treppenhaus vor ihrer Wohnungstür stand, hinaufblickte, wurde ihr schwindlig.
»Der ist tot, ich glaub, der is umbracht worn!«
Fräulein von Wagners eh schon blasse Gesichtsfarbe wandelte sich in kalkiges Weiß, und ihre schmalen langgliedrigen Hände umklammerten ihre Wangen, als müsste sie ihren Kopf festhalten.
Mit krächzender, zittriger Stimme brachte sie ein »Um Himmels willen, der Albrecht« hervor, und bevor Fanny sich wundern konnte, wieso der Gruber für die von Wagner »der Albrecht« war, trat Herr Schmitzer im blassgrünen Hausmantel an das Treppengeländer und verkündete, dass er sofort die Polizei verständigen werde.
»Sie bleiben da, Frau Silberschneider«, befahl er Fanny. »Schließlich sind Sie eine wichtige Zeugin.«
Weder die von Wagner, die schon wieder in ihrer Wohnung verschwunden war, noch Schmitzer machten Anstalten, einen Blick in die Grubersche Wohnung zu werfen oder Fanny in ihre Wohnungen zu bitten. So blieb sie auf dem Treppenabsatz sitzen und schaute durch das ungeputzte Treppenhausfenster, für das sie sich noch nie zuständig gefühlt hatte, hinaus auf die Kastanie im Hinterhof. Die Blätter des großen alten Baumes zeigten vereinzelt bereits das erste herbstliche Gelbbraun. Langsam wurde Fannys Atem ruhiger, und sie überlegte, ob sie es wohl schon wagen konnte, sich eine Pall Mall anzuzünden.
2
Korbinian Hilpert verstaute seinen Koffer im Gepäcknetz und war froh, dass er für den Augenblick noch der Einzige im Abteil war. Denn seine Hände zitterten, und seine Augen waren feucht. Der Zug ruckelte an, und schnell zog Korbinian das Fenster nach unten und sah gerade noch seine Mutter und seine Schwester winkend auf dem Bahnsteig der kleinen Chiemseegemeinde Prien stehen. Schnell wurden sie kleiner und kleiner, und als der Zug sich in eine sanfte Kurve legte, waren sie und mit ihnen auch der Blick auf das Glitzern eines winzigen Stücks des Sees verschwunden. Korbinian schalt sich einen gefühlsduseligen Esel. Schließlich war er 23 Jahre alt, und es war wirklich an der Zeit, sein eigenes Leben zu beginnen. Gestern, beim sonntäglichen Abendessen, hatte er noch gescherzt, dass er nur froh darüber sei, endlich der Weiberwirtschaft im Hause Hilpert zu entfliehen. Die Weiber, das waren seine Großmutter, seine Mutter Therese und seine Schwester Franziska. Außer Korbinian gab es seit 1944 im Hause Hilpert kein männliches Wesen mehr; nur das Foto auf der Anrichte, das einen fröhlich lachenden, bärtigen Mann in Polizeiuniform zeigte, erinnerte an Gustav Hilpert, der im letzten Kriegsjahr in Russland gefallen war. Fast jeden Tag standen frische Blumen vor dem Bild, und oft hatte Korbinian gesehen, wie seine Mutter im Vorübergehen nur ganz kurz zärtlich über das Foto strich. Korbinians Vater war jahrelang der Dorfpolizist einer kleinen Gemeinde am Ufer des Chiemsees gewesen, und bis 1944 hatte ihn dieses Amt vor den Gräueln des schrecklichen Krieges bewahrt. Dann jedoch wurde er doch noch eingezogen und ein nicht mehr kriegstauglicher älterer Polizist in seine Position berufen. Korbinian erinnerte sich noch gut, wie er als 13-Jähriger mit Mutter und kleiner Schwester auf demselben Bahnsteig wie heute gestanden und den Vater verabschiedet hatte.
»An Weihnachten bin i wieder da!«, hatte der Vater aus dem Zugfenster gerufen, und Korbinian glaubte sich zu erinnern, dass auch dessen Augen feucht gewesen waren und seine Hände ebenfalls leicht gezittert hatten. Er, Korbinian, hatte damals ein starkes Würgen im Hals und ein heftiges Brennen in den Augen verspürt und mit aller Gewalt versucht, es zu unterdrücken. Denn es wäre doch eine Schande gewesen, wenn er, ein 13-jähriger, schon hoch aufgeschossener Bub mit den ersten Anzeichen des Stimmbruchs, angefangen hätte zu weinen.
Er erinnerte sich noch genau an einen Spaziergang mit dem Vater in den letzten Tagen vor dessen Abreise. Es war in den Abendstunden gewesen, und nachdem sie auf der kleinen Wiese vor dem Haus noch eine Runde Fußball gespielt hatten, waren sie zum See hinuntergegangen und den Uferweg entlangspaziert.
»Du musst nicht Polizist werden wie ich«, hatte Gustav Hilpert zu seinem Sohn gesagt. »Mach das, was dein Herz dir sagt.«
Doch für Korbinian hatte es schon damals festgestanden, dass er den gleichen Beruf wie sein Vater ergreifen wollte. Es kam nichts anderes für ihn infrage.
»Dann schau, dass d’ nicht im Dorf hängen bleibst«, hatte der Vater gemeint. »Geh in die Stadt! Vielleicht hast auch das Zeug zum Kriminaler!«
Korbinian wusste, dass der Vater mehrfach das Angebot, nach München zu wechseln, ausgeschlagen hatte und das nun möglicherweise doch ein wenig bedauerte.
Das Weihnachten 1944 fand ohne den Vater statt. Zehn Tage vor dem Fest, das traurigste in der Familiengeschichte der Hilperts, war die Nachricht von seinem Tod eingetroffen.
Korbinian schloss das Fenster und bemerkte erst jetzt, dass eine dicke Bauersfrau mit zwei großen Körben sich im Abteil niedergelassen hatte. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und erzählte ihm ungefragt, dass sie unterwegs nach Rosenheim zum Markt sei.
»Mei Blaukraut is des beste im ganzn Kreis, des wird mir aus der Hand grissn«, berichtete sie stolz und wollte natürlich ganz genau wissen, wohin Korbinian denn unterwegs sei.
»Nach München«, erwiderte dieser einsilbig.
Doch die Bäuerin ließ nicht locker.
»Und was machst da? Die hübschen Madln anschaun?«
»Ich mach a Ausbildung«, antwortete Korbinian vage und blickte angelegentlich aus dem Fenster auf die vorüberziehende Landschaft.
»Soso, was denn?«, hakte die Frau sofort ein. »Hast scho a Unterkunft?«
Korbinian überging ihre erste Frage. Dass er junger Polizist war und ab übermorgen seine Ausbildung bei der Kriminalpolizei in der berühmten Münchner Ettstraße antreten sollte, wollte er der Neugierigen nicht auf die Nase binden. Er konnte es ja selbst immer noch nicht recht glauben, dass sie ihn in München genommen hatten. Zuerst einmal, so hatte es geheißen, sollte er für drei Monate alle wichtigen Abteilungen des Hauses durchlaufen, bevor dann die richtige Ausbildung losging.
»Ich wohn bei meiner Großtante«, murmelte Korbinian, zog den Münchner Stadtplan aus seiner Tasche, vertiefte sich darin und biss in den Apfel, den ihm seine Mutter noch zugesteckt hatte.
Die Bauersfrau verstummte.
Korbinian fühlte Vorfreude, Neugier, aber auch eine gehörige Portion Angst in sich. Wie es wohl in den heiligen Hallen der Ettstraße zugehen würde, dem bekannten Münchner Polizeipräsidium, das seinen Namen nach der kleinen Seitenstraße der Neuhauser Straße hatte, an der es lag? Während seiner Polizeiausbildung hatte Korbinian immer in kleinen dörflichen Wachstuben in der Gegend um den Chiemsee gearbeitet und jeden Abend mit seinem Motorrad nach Hause fahren können. Wie es in der Großstadt zuging, konnte er sich gar nicht recht vorstellen. Über die Ettstraße wusste Korbinian nur ein wenig aus den Berichten des Vaters, der dort in einigen Chiemgauer Mordfällen, bei denen die Untersuchungen bis nach München reichten, ermittelt hatte. Der Münchner Kommissar, von dem sein Vater immer mit Hochachtung sprach, war Ende der 30er-Jahre mit seiner Familie in die Schweiz gegangen. Er hatte sich immer einem Parteieintritt widersetzt, und so war ihm am Ende nichts anderes übrig geblieben, als zu emigrieren.
War eigentlich sein Vater Parteimitglied gewesen? Korbinian wusste es nicht, nie war davon in der Familie die Rede gewesen. Doch ziemlich genau konnte er sich an abfällige Bemerkungen seines Vaters beim Abendessen in Bezug auf die Nationalsozialisten und deren Machenschaften erinnern und daran, dass seine Mutter immer versucht hatte, den Vater zu beschwichtigen. Ihm, Korbinian, hatte sie schon als kleinem Buben eingeschärft, niemandem davon zu erzählen.
»Des könnt arg gefährlich werden«, hatte sie immer beschwörend zu ihm gesagt, und Korbinian, der nur leise ahnte, was sie damit meinte, hielt sein Wort.
Der Zug nach München hatte in Rosenheim gehalten, die Bäuerin mit dem Blaukraut war unter Ächzen und Stöhnen ausgestiegen, und Korbinian blieb zu seinem Erstaunen allein im Abteil. Das spätsommerliche Voralpenland glitt vorüber; große, aber freundliche Wolken trieben über den Himmel, und hin und wieder blitzte die markante Spitze eines Kirchturms auf. Korbinian war ruhiger geworden und schloss ein wenig die Augen. Ganz kurz musste er an die Evi denken, an ihre helle Haut mit den zahllosen Sommersprossen, an ihr Lachen, das die kleine Lücke zwischen ihren Schneidezähnen aufblitzen ließ, und an die zuerst sehr sanften und zärtlichen, dann immer leidenschaftlicher werdenden Küsse, die sie getauscht hatten. Sie hatte geweint beim Abschied, und es hatte Korbinian sehr viel Kraft gekostet, ihr nichts für die Zukunft zu versprechen. Doch zuerst einmal sollten da München und die Ausbildung bei der Kriminalpolizei kommen; wer weiß, was alles geschehen würde, und er wollte nicht, dass die lebenslustige Evi zu Hause saß und auf ihn wartete und er sie vielleicht später umso schmerzvoller enttäuschen musste.
Die Großtante, Natalie Pirkner, eine jüngere Schwester seiner Großmutter, bei der Korbinian vorerst unterkommen sollte, hatte er nur zweimal in seinem Leben gesehen. Zu seiner Firmung im letzten Kriegsjahr hatte sie eine Buttercremetorte mitgebracht, die schon leicht säuerlich geschmeckt hatte, und noch einmal war sie zum 80. der Großmutter dagewesen. Eine kleine, hagere, sehr unruhige Person, die viel sprach und kaum eine Minute stillsitzen konnte. Die Großmutter hatte ihrer Schwester sofort geschrieben, als feststand, dass Korbinian nach München gehen sollte, und postwendend war eine Karte gekommen.
»Freilich kann der Bub bei mir wohnen, er ghört doch schließlich zur Familie!«
Dann teilte eine scheppernde Lautsprecherstimme mit, dass man in wenigen Minuten die Landeshauptstadt München pünktlich erreichen werde. Korbinian warf den angebissenen Apfel seiner Mutter in den Abfalleimer vor seinem Abteil, stellte seinen Koffer zurecht und schlüpfte in das dunkelgraue Sakko, das er sich extra für die Großstadt gekauft hatte. Das neue Leben konnte beginnen.
3
»Warn die Putzweiber wieda do und ham ois durcheinanderbracht«, stöhnte Siegfried Breitner und versuchte, wieder die Ordnung auf seinem Schreibtisch herzustellen.
»Und gibt’s heut koan Kaffee, Conni?
Cornelia Pringerl, die Sekretärin der Mordkommission I, zog enerviert ihre schmal gezupften Augenbrauen hoch.
»Glei, Sigi, du wirst as no dawarten können!«
Nichts hasste sie so sehr wie die Chefallüren, die der Sigi manchmal an den Tag legte.
Gerade als sie die Filtertüte in den dicken Porzellanfilter auf der bauchigen Kaffeekanne einlegen wollte, wurde die Tür aufgerissen.
Helmut Ostermeier, der wahre Chef der beiden Mordkommissionen in der Ettstraße, rauschte herein und klatschte in die Hände.
»Wir haben einen Mord in der Schleißheimer Straße, meine Herren«, rief er, und es klang so erfreut, als würde er die Geburt eines Stammhalters verkünden.
»Welche Herren meinen S’ denn, Chef?«, konterte Siegfried Breitner süffisant. »Bin nur i da; der Mayer is doch seit der Woch auf Kur, und die Pringerl is ja wohl a eindeutiges Weib«, wobei er angelegentlich auf Connis üppigen Busen und ihre schlanken Beine schielte.
Ostermeier räusperte sich ungehalten.
»Und der Neue?«, fragte er und blickte sich suchend um.
»Was? Der soll als Erstes zu uns kommen? Zum Mord?«, rief Conni entsetzt und goss den Kaffee auf.
»Der hat doch von Tutn und Blasn no koa Ahnung, der kommt doch vom Land«, spottete Breitner. »Der wird an Schock kriagn, dass er schon als Erstes beim Mord eingsetzt wird. Der muss doch zerst amoi richtig einglernt werden!«
Ostermeier, wie immer im dunkelgrauen Einreiher, heute mit violettem Einstecktüchlein, hüstelte erneut.
»Der sollte doch dieser Tage in München ankommen, vielleicht ist er schon vor Ort. Versuchen Sie, ihn aufzutreiben, so eine Tatortbegehung ist doch der beste Einstieg in die Ausbildung.«
»Soviel ich weiß, wohnt der bei einer Tante in der Sophienstraße; ich kann ja mal den Bullauer hinschicken«, meinte Conni.
Der Bullauer war das Faktotum der Ettstraße, der alle einfachen Dienstgänge erledigte, die Brotzeit holte und morgens die Post verteilte.
»Na, wunderbar«, stöhnte Sigi Breitner. »Dann kann i mi ja zuerst amoi alloa aufn Weg machn.«
Ostermeier hüstelte zustimmend.
»Albrecht Gruber, 59 Jahre alt, ledig, Beruf unbekannt. Mehrere heftige Stichverletzungen im Brustbereich. Näheres weiß dann Lippl, der hat sich auch gerade auf den Weg gemacht«, schnarrte er stichwortartig herunter und entfernte sich dann mit diskretem Räuspern.
Lippl war der Rechtsmediziner des Amts, ein riesiger Zweizentnermann, der sommers wie winters über seinem Arztkittel einen wehenden schwarzen Mantel trug.
»Dann renn i dem amoi hinterher«, beschloss Breitner gottergeben und verbrühte sich an dem heißen Kaffee die Lippen. Er schlüpfte in seinen altgedienten Trachtenjanker, der am Rücken schon speckig war und abgewetzte Taschen hatte, und machte sich auf den Weg. Doch die zwei zur Verfügung stehenden Dienstwagen waren natürlich schon weg.
»Kruzitürkn«, schimpfte Sigi vor sich hin und holte sein Fahrrad, mit dem er jeden Tag zum Dienst fuhr.
Schon nach etwa 100 Metern spürte er, wie sich seine Stimmung besserte. Leise pfiff er vor sich hin und erfreute sich wieder einmal an seiner Heimatstadt. Hier war er zur Welt gekommen, hier hatte er, bis auf die zwei Jahre, die er im Krieg gewesen war, immer gelebt und nicht um alles in der Welt wollte er woanders hin. Er verstand seine Kolleginnen und Kollegen, darunter auch Conni, nicht, die von der Sommerfrische in Österreich oder gar an der Adria träumten. Was gibt’s Schöners ois mein Hirschgarten, dachte er sich, der von seiner Wohnung in der Wendl-Dietrich-Straße im Münchner Stadtteil Neuhausen nur wenige Minuten dorthin hatte. Er war hier Stammgast, kannte jede Bedienung und jeden Hirsch und jede Hirschkuh im Wildgehege. Es gab nichts Schöneres als eine Maß und einen geräucherten Steckerlfisch direkt von der Holzkohle.
Während Sigi Breitner pfeifend dahinradelte und sich über jede hübsche noch sommerlich gekleidete Münchnerin freute, an der er vorbeifuhr, öffnete Conni die Tür zum Amtskorridor und rief mit singender Stimme: »Bullauer!«
Umgehend erschien dieser, als hätte er nur um die Ecke auf den Zuruf gewartet, und machte einen formvollendeten Diener vor Conni. Schon des Öfteren hatten unkundige Besucher des Präsidiums Bullauer für ein hohes Tier im Amt gehalten. Groß, aufrecht, mit streng gescheiteltem Haar, immer mit Anzug und vor allem mit den vornehmsten Manieren ausgestattet, glaubte keiner, einen schlichten Büroboten vor sich zu haben.
»Bullauer, Sie müssten mal in die Sophienstraße 26«, bat Conni.
Wie alle im Amt siezte sie ihn.
»Dort wohnt der junge Mann, der morgen als Kriminalanwärter anfangen soll. Der wird jetzt dringend gebraucht, wir haben einen Mord in der Schleißheimer Straße. Vielleicht ist er schon in München. Ach, könntn S’ mir auf dem Weg zwei Brezn mitbringen?«
Bullauer verbeugte sich erneut, er war kein Freund großer Worte, doch man wusste bei ihm sicher, dass er pflichtgetreu und rasch seine Aufträge ausführte.
Bullauer war gerade um die Ecke gebogen, als Ostermeier mit elastischem Schritt, der immer ein wenig wirkte, als würde er ihn jeden Abend daheim trainieren, hüstelnd daherkam.
»Es muss rasch gehen, Fräulein Pringerl!« rief er. »Ist Breitner schon unterwegs? Wann kommt der Neue?«
Conni nahm eine eindeutig ironische Habachtstellung an.
»Alles in die Wege geleitet, Chef.«
Insgeheim dachte sie voller Mitleid an den Neuen; das war ja ein ganz schlechter Anfang für den armen Kerl. Ein ekelhafter Mord und dazu noch der grantige Breitner und der unheimliche Leichenfledderer Lippl!
4
Korbinian schreckte hoch. Er hatte von Winnetou geträumt und wusste nicht so recht, wo er sich befand. Ein schweres kariert überzogenes Federbett lastete auf ihm, und von draußen hörte er eigenartiges Rumpeln und Quietschen. Ganz langsam kam er zu sich, und ihm wurde klar, dass er im Bubenbett des jüngsten Pirkners lag, dass er am Abend vor dem Einschlafen noch kurz in Winnetou I aus dessen vollständiger Karl-May-Sammlung gelesen hatte, und dass das Rumpeln und Quietschen von den Straßenbahnen kam, die zahlreich und nahezu ohne Unterbrechung über den nahe gelegenen Stachus fuhren.
Korbinian war, nachdem er aus dem Zug ausgestiegen war, zuerst noch etwas durch den großen Münchner Hauptbahnhof geschlendert, der im Krieg stark zerstört, nun aber fast zur Gänze schon wiederaufgebaut war. Die große Schalterhalle war bereits vollständig fertig, und bei einem kleinen Blumenstand vor dem Ausgang kaufte Korbinian einen Strauß Dahlien für die Großtante Natalie. Beim Weitergehen wäre er fast über einen Mann gestolpert, der direkt neben dem Blumenverkauf auf einer schmutzigen Decke saß. Seine Hosenbeine waren bis zu den Oberschenkeln aufgerollt und dort mit Sicherheitsnadeln befestigt. Vor sich hatte der Mann einen umgedrehten Hut liegen, und auf einem Pappkarton stand mit ungelenker Schrift: »Schwer kriegsversehrt. Bitte um eine milde Gabe.« Korbinian warf ihm das Wechselgeld in den Hut und verspürte, ihm war nicht recht klar warum, so etwas wie ein schlechtes Gewissen.
Vom Bahnhof war es nicht weit zur Sophienstraße. Korbinian ging links am großen Warenhaus Hertie, das im Krieg kaum Schäden erlitten hatte, vorbei und durchquerte bald darauf den Alten Botanischen Garten, in dem ältere Herrschaften und Mütter mit Kinderwägen auf den Bänken saßen und die Sonne genossen. Die Luft war spätsommerlich mild und der Himmel bis auf ein paar kleine fedrige Wolken strahlend blau.
Als Korbinian aus dem Park trat und gerade nach dem Haus der Großtante Ausschau halten wollte, bemerkte er eine kleine Person in Kittelschürze, die aufgeregt winkte. Obwohl Natalie Pirkner schon auf die 70 zuging, eilte sie mit großer Geschwindigkeit auf ihn zu.
»Da bist ja, Bua«, rief sie. »Mei, du bist ja a Mannsbild worn, seit i di as letzte Mal gseng hab!«
Etwas grob entriss sie ihm den Blumenstrauß und schwenkte ihn derart hin und her, dass Korbinian um die Dahlienblüten fürchtete.
»Mei, des hätts aber ned braucht. Komm eini«, rief sie und sprang ihm voraus.
In der sauberen, schlichten Wohnküche wurde er mit starkem Kaffee und selbstgebackenem Gugelhupf empfangen.
»Nimm doch no«, drängelte Natalie und hüpfte ständig um ihn herum, um ihm noch zusätzlich Milch und Zucker für den Kaffee und Limonade zu kredenzen. Korbinian wurde fast etwas schwindlig davon. Er musste von daheim erzählen, von der Großmutter, der Mutter und der Schwester und natürlich von seiner Polizeiausbildung.
»Mei, des wenn der Kaidan no erlebt hätt, mit dem hättst nichts zum Lachen ghabt«, rief Natalie amüsiert. »Der war koa Freund von der Polizei, der war Kommunist, manchmal sogar Anarchist.«
Auf der Kommode standen Fotografien des verstorbenen Kajetan Pirkner, eines etwas melancholisch und verbittert aussehenden Mannes, des ebenfalls verstorbenen zweiten Ehemanns Georg Hartl und der zwei im Krieg gebliebenen Söhne Kajetan der Jüngere und Ludwig. Korbinian überlegte gerade, wieso die Großtante denn eigentlich immer noch Pirkner und nicht Hartl hieß, doch er konnte den Gedanken nicht zu Ende führen, weil Natalie ihm Fotos von ihrer Tochter Thea und deren zwei Töchtern – Mann dazu wurde keiner erwähnt – und vom jüngsten der Pirkners, dem Germanistikstudenten Theo mit fescher schwarzer Haartolle, zeigte.
»Du kriegst sei Zimmer«, erklärte Natalie. »Der wollt weg von der Mama und wohnt jetzt mit seine Studentenfreund in der Hiltenspergerstraß.«
Als Korbinian auf dem Bett des jüngsten Pirkners saß und seinen Koffer auspackte, fielen ihm wieder die Geschichten zur Natalie und ihrer Familie ein, die ihm die Großmutter vor seiner Abreise erzählt hatte.
Natalie Pirkner hatte in den 20er-Jahren nach München geheiratet, doch die Ehe mit dem aus dem Österreichischen stammenden Kajetan Pirkner war nicht sehr glücklich gewesen und hatte vor allem tragisch geendet. Kajetan war von Beruf Schreiner, hatte sich aber immer zu Höherem berufen gefühlt. In seinem winzigen Atelier im Speicher des Hauses in der Sophienstraße in München, wo die sechsköpfige Familie Pirkner wohnte, hatte er große Ölgemälde seiner österreichischen Heimat und der Stadt München gefertigt. Stets war »Kaidan«, wie ihn Natalie nannte, unverbrüchlich überzeugt von seiner Begabung, und zuweilen konnte er auch das eine oder andere Bild an eine Münchner Bürgersfamilie verkaufen, die sich Kärntner Berge oder eine Münchner Straßenszene ins Wohnzimmer hängen wollte.
Doch als 1931 in München die große Kunstausstellung im Glaspalast, in dessen unmittelbarer Nähe die Pirkners wohnten, stattfinden sollte, war Kajetan übers Ziel hinausgeschossen und hatte sich mit zwei Gemälden dort beworben. Sehr rasch jedoch bekam er eine eindeutige schriftliche Ablehnung mit der Bitte, seine Werke doch so rasch wie möglich wieder abzuholen. Dann brannte der Glaspalast einen Tag nach der Eröffnung der großen Ausstellung vollständig ab und zahlreiche wertvolle Kunstwerke gingen unwiederbringlich verloren. Auch Kajetans Bilder wurden, da er sich nicht um deren Abholung gekümmert hatte, ein Raub der Flammen. Einige Tage nach dem Brand nahm Kajetan eine große Menge Schlafpulver zu sich, und Natalie fand ihn am Abend leblos und mit weißem Schaum vor dem Mund in seinem Atelier. Sie war zu spät gekommen, und nie konnte sie ihren Verdacht, dass es Kajetan gewesen war, der den Glaspalast angezündet hatte, ganz überwinden. Wochenlang wurde nämlich in den Münchner Zeitungen unter anderem über mutmaßliche Brandstiftung eines abgewiesenen Künstlers als Brandursache spekuliert.
So mussten Natalie und ihre vier Kinder, der Jüngste war Theo mit gerade mal vier Jahren, ohne Vater auskommen. Natalie hatte nicht viel Zeit, um ihren Kaidan zu trauern, denn sie musste nun die fünfköpfige Familie irgendwie über Wasser halten.
Was in erster Linie nach Kajetans Tod fehlte, war natürlich das Geld. Natalie, die schon Jahre vor seinem Tod für einige Familien der Nachbarschaft Flick- und Bügelarbeiten erledigt hatte, war nun gezwungen, etliche Putzstellen anzunehmen und daher oft außer Haus. Die älteste Pirkner, die damals 14-jährige Thea, wurde nun angehalten, sich während der Abwesenheit der Mutter um ihre Geschwister zu kümmern. Das war nicht einfach, denn Thea hatte schon eine Lehrstelle in einer Schneiderwerkstatt am Sendlinger Tor und außerdem in ihrer freien Zeit ganz anderes im Sinn, als Mutterersatz zu spielen.
Meist saß sie, wenn Natalie erschöpft und gebeugt von der Putzerei heimkam, mit irgendeinem Galan auf einer Bank im Alten Botanischen Garten. Die beiden mittleren Buben, Kajetan »der kloa Kaidan« und Ludwig verwahrlosten zusehends, schwänzten kräftig die Schule und klauten in den Geschäften der Umgebung wie die Raben. Nur der kleine Theo ging schon im zarten Alter von fünf Jahren gern zur Schule, einfach weil er es da so schön fand, und schon mit sieben Jahren las er sich durch den Bestand der Leihbücherei der Maxvorstadt. Ohne sich anzustrengen, wurde er der Beste in seiner Klasse und durfte anlässlich des 50. Geburtstags des Schulleiters ein langes Gedicht aufsagen. Natalie war unbändig stolz auf ihren Jüngsten.
Nach einem Jahr Trauerzeit heiratete Natalie ganz pragmatisch, wie es schon immer ihre Art war, ihren Nachbarn, den Witwer Hartl, der ihr schon früher den Hof gemacht hatte. Zweimal die Woche schloss sie die Augen, wenn sich der Hartl ächzend und seufzend über ihr abmühte, und dachte an die zwar nicht sehr hohe, doch sichere Beamtenbesoldung des Hartl, der beim Finanzamt auf mittlerer Ebene tätig war. Die Ehe mit Hartl sollte jedoch auch nicht von langer Dauer sein. Im Vorweihnachtstrubel geriet der Hartl, der gedanklich wohl noch bei seinen amtlichen Zahlenkolonnen war, am Marienplatz unter eine Trambahn und verstarb noch an der Unfallstelle. Natalie hatte nun zwei Gräber auf dem Nordfriedhof zu pflegen, erhielt aber als Beamtenwitwe eine kleine Pension, die es ihr erlaubte, einige ihrer Putzstellen zu kündigen.
Korbinian hatte sich nach seiner Ankunft gerade ein wenig auf dem Bett ausgestreckt, als Natalie, ohne zu klopfen, hereinplatzte.
»D’ Thea kommt no schnell vorbei, die will di doch auch kennenlernen«, rief sie.
Zehn Minuten später erfüllten helle Kinderstimmen die Wohnung, und als Korbinian in die Küche trat, saßen zwei kleine Mädchen am Küchentisch und machten sich über die Reste des Gugelhupfs her. Die beiden hätten vom Aussehen her nicht unterschiedlicher sein können. Die kleinere der beiden war schwarzlockig, hatte dunkle Augen und ein äußerst apartes Gesicht, die ältere war pausbäckig und semmelblond. Thea stand mit ihrer Mutter an der Spüle und wusch Geschirr ab.
Korbinians Herz begann zu klopfen, denn Thea glich der Frau, von der er zuweilen träumte, fast aufs Haar. Träume, die er niemandem, nicht einmal seinem besten Freund Sepp, erzählen konnte, denn sie waren äußerst wild und ausgesprochen schamlos. Träume, in denen sich das abspielte, was er mit der Evi gerne getan hätte, es aber nie gewagt hatte.
Thea ging auf ihn zu, lachte und umarmte ihn spontan. »Der Cousin vom Chiemsee«, sagte sie, und in ihrer dunklen Stimme lag etwas, das Korbinian nun vollends aus der Fassung brachte.
Dann setzte sie sich an den Küchentisch und zündete sich ganz selbstverständlich eine Zigarette an. Ein heftiges Zittern durchströmte Korbinian, und er konnte den Blick nicht abwenden von ihren äußerst weiblichen Formen, dem Einblick, den ihr Blusenausschnitt bot, und dem strahlenden Lachen in ihrem hübschen rotwangigen Gesicht. Thea strich ein paar vorwitzige dunkle Locken aus der Stirn.
»Jetzt kann uns nix mehr passieren«, meinte sie. »Jetzt haben wir ja die Polizei im Haus. Erzähl doch, wann fangst an? Bist aufgregt?«
Korbinian stammelte eine äußerst lapidare Antwort, kam sich saudumm dabei vor und verstummte wieder.
»Mama, ich glaub, der braucht jetzt a bisserl sei Ruh«, meinte Thea lächelnd.
»Wir sehen uns ja bald wieder, Korbinian, dann kannst von der Ettstraß erzählen und vom ersten Einbrecher, den du gfangen hast.«
»A bissl kannst di ausruhen, Bua, dann gibts an Wurstsalat«, ergänzte Natalie und sie begann, ihrer Tochter eine längere Geschichte vom Metzger, bei dem sie die Regensburger gekauft hatte, zu erzählen. Korbinian zog sich zurück und nickte tatsächlich ein wenig ein.
Der Rest des Abends allein mit der Tante Natalie blieb für ihn in etwas verschwommener Erinnerung; zum Wurstsalat erzählte sie ihm eine Menge vom Studium Theos, vom sagenhaften Brand des Glaspalasts vor über 20 Jahren, von der Nachbarin, die einen Liebhaber hatte, und wieder von besagtem Metzger, zu dem sie anscheinend eine sehr enge Beziehung pflegte. Dann fiel Korbinian todmüde ins Bett und las vorsichtshalber noch ein kleines Stück Winnetou, um sich von eventuell aufkommenden Gedanken an die verführerische Cousine Thea abzulenken.
Nachdem Korbinian sich wieder einigermaßen in seiner neuen Umgebung zurechtgefunden hatte, war er aufgestanden, hatte auf dem Küchentisch eine Kanne Kaffee und zwei Brezn vorgefunden und einen Zettel, auf dem stand: »Bin beim Butzn, komme bald. Butter in der Speis.«
Gerade als er anfing, die zweite Brezn zu verspeisen, klingelte es. Korbinian wusste nicht recht, ob er öffnen sollte, doch da klingelte es noch einmal, und jemand klopfte dezent an die Wohnungstür.
Vor der Tür stand ein vornehm gekleideter Herr mit gepunktetem Einstecktuch in der Sakkotasche, der sich leicht verneigte.
»Bullauer, Polizeipräsidium. Guten Tag. Sind Sie der Herr Hilpert?«
Korbinian wusste nicht, wie ihm geschah. War es in München üblich, dass die Vorgesetzten ihre neuen Mitarbeiter zu Hause begrüßten? Er nickte und bat den vornehmen Herrn, doch einzutreten. Dieser jedoch schüttelte den Kopf.
»Ich bin nur ein Abgesandter der Abteilung Mord«, erklärte er. »Sie werden dringend schon heute benötigt. Ein Mord in der Schleißheimer Straße.«
Korbinian erstarrte. »Ein Mord? Und ich soll …?«
Der Herr strich sich über seine akkurate Frisur, und mit einer ganz leichten Ungeduld in der Stimme sagte er bestimmend: »Machen Sie sich bitte unverzüglich fertig, ich warte vor dem Haus auf Sie.«
So hatte Korbinian auf seinem ersten Gang durch München keinen Blick für den Justizpalast, den größten Platz Münchens, den Stachus, das Karlstor und andere Sehenswürdigkeiten der Stadt, die nach den verheerenden Kriegsschäden fast alle schon wieder in neuem Glanz aufgebaut worden waren. Ein Mord, ging es ihm gebetsmühlenartig durch den Kopf, und er wusste nicht, welche Empfindung stärker in ihm war: die Neugier oder die Angst.
5
Zwei junge Polizisten standen vor der Haustür zur Schleißheimer Straße Wache. Einer war sehr blass um die Nase und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Auf dem Gehsteig hatten sich schon eine Menge Schaulustige eingefunden, zwei Frauen, die eifrig miteinander tuschelten, rückten immer näher an das Haus heran. Sigi Breitner lehnte sein Fahrrad an die Hauswand, scheuchte die neugierigen Frauen und auch alle anderen zurück, grüßte kurz angebunden die Kollegen und betrat das Haus. Das Treppenhaus, vielleicht etwas großzügiger gehalten, erinnerte ihn an das seines Zuhauses in der Wendl-Dietrich-Straße, dort, wo er geboren, aufgewachsen, mit seinen Eltern und dann mit seiner Maria gelebt und nun immer noch, jetzt ohne die Eltern und Maria, lebte. Sigi Breitner schüttelte sich und trat in den Flur der Wohnung, nicht ohne sich zuvor ein Taschentuch mit leichtem Eau de Cologne-Duft, das er immer bei sich führte, vor Nase und Mund zu halten. Lippl kniete wie ein riesiger schwarzer Vogel vor der Leiche. Er hatte die starr aufgerissenen Augen Albrecht Grubers mittlerweile geschlossen und inspizierte nun die Einstiche am Oberkörper.
Ohne Breitner zu begrüßen, wandte er seinen Kopf zu diesem und blinzelte ihn aus seinen immer etwas geröteten, leicht entzündeten Augen an.
»Schaut euch das an, wertester Kollege«, murmelte er, und Sigi, der sich weiter zu ihm hinabbeugen musste, um ihn zu verstehen, bemerkte, dass Lippls Atem nach Alkohol roch. Im Amt ging das Gerücht, dass Lippl den Alkohol, den er für seine Obduktionen brauchte, zwischendurch auch selbst zu sich nahm.
»Sieben Einstichverletzungen, wahrscheinlich ein scharfes Messer, es wurde mit großer Vehemenz von oben auf den schon am Boden Liegenden eingestochen. Vermutlich an inneren Blutungen verstorben. Spuren von vorausgegangenem Kampf hauptsächlich am Rücken und am Hinterkopf. Etwa acht bis zehn Stunden tot. Alles Weitere, nachdem er bei mir zu Gast war.«
Dann deutete Lippl hinter sich auf den Küchenschrank. Dort lag ein Holzbrett, das offensichtlich zum Brotschneiden benutzt wurde. Eine Kommodenschublade darunter war leicht geöffnet.
»Vielleicht kommt das Messer daher. Die Frau Putzerin weiß es womöglich. Spurenermittlung und Fotograf sind auf dem Wege.«
Breitner blickte noch einmal auf den Toten mit dem weißen schwammigen Bauch und der grau-grün karierten Schlafanzughose und konnte sich des seltsamen Gefühls nicht erwehren, dass ihm dieser einfach unsympathisch war.
»So a Schmarrn« murmelte er vor sich hin. »Kopf einsetzn, Sigi, neds Gfühl.«
Doch wusste er aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass sein Gefühl sich gerade am Anfang einer Mordermittlung oft nicht täuschte. Dann ging er langsam durch die Wohnung, die ihm merkwürdig leblos vorkam, fast so als hätte der Tote gar nicht richtig darin gewohnt. Sicher, ein paar wenige Lebensmittel in der Küche, ein ordentlich zurückgeschlagenes Bett im kahlen Schlafzimmer. Doch kein Bild an der Wand, keine Grünpflanzen, keine Fotos und kein einziges Buch. Lediglich auf dem Schränkchen im Gang lag die Ausgabe der Münchner Neuesten Nachrichten vom Tag zuvor.
Als Breitner aus der Wohnungstür trat, kam der etwas lebendiger wirkende Polizist auf ihn zu.
Er salutierte zackig, was Breitner zurückschrecken ließ, und berichtete.
»Der Tote heißt Albrecht Gruber, geboren 23.3.1895 in München, ledig, zurzeit arbeitslos. Ist seit 1949 hier in der Schleißheimer Straße gemeldet, vorher wechselnde Adressen, zumeist in München. Strafregistereinträge überprüft gerade der Kollege auf dem Revier.«
»Danke, Kollege, bitte bleiben Sie noch etwas vor Ort, um die Schaulustigen und vor allem die Presse, die sicher gleich da sein wird, abzuhalten. Gibt es Zeugen im Haus?«
Der Polizist salutierte wieder, und Breitner wäre ihm fast in den Arm gefallen, um dieses blöde Gehabe zu unterbinden.
»Die Leute, die zurzeit im Haus sind, halten sich in ihren Wohnungen auf. Frau Gertraud von Wagner, zweiter Stock – sie hat einen Schwächeanfall erlitten, der Arzt ist bei ihr – und Gottlieb und Agathe Schmitzer, ebenfalls zweiter Stock. Bei den anderen Parteien hat niemand aufgemacht. Ach ja, und im Treppenhaus sitzt die, die ihn gefunden hat, eine Fanny Silberschneider, die macht bei ihm sauber.«
Breitner trat näher an den Mann heran.
»Hat sich jemand um sie gekümmert? Die hat doch sicher einen Schock?«
Der Polizist schaute ihn verständnislos an.
»Anstatt dass S’ hier immer blöd rumsalutiern, hätten S’ mal nach der Frau schaun können«, belferte Breitner und spürte, wie die schlechte Stimmung vom Morgen wieder in ihm hochstieg.
Der Polizist senkte beschämt den Kopf und konnte das Salutieren gerade noch unterdrücken.