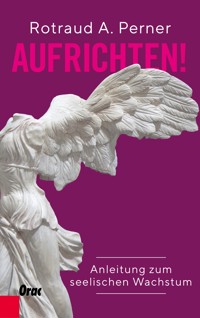Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Zur Ermutigung - denn Mut kann man lernen Wann müssen wir risikofreudig und wann dürfen wir feige sein? Was hat Wagemut mit Zivilcourage zu tun und Schwermut mit dem Alter? Ist Kleinmut eine Charakterschwäche und Edelmut angeboren? Psychoanalytikerin Rotraud A. Perner zeigt, wie wichtig Mut im Leben ist: vom Mutwillen in der Kindheit, dem Übermut in der Pubertät, bis zum Freimut, seinen eigenen Weg zu gehen, und der Demut, das Sterben als Teil des Lebens anzunehmen. Sie weiß: Mut ist keine Eigenschaft, sondern ein Prozess. Und sie weist Wege, wie wir den Mut finden, zu uns selbst zu stehen. Mit Anleitung und Tipps zum Selbstcoaching
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rotraud A. Perner
Mut
Rotraud A. Perner
Mut
Das ultimativeLebensgefühl
AMALTHEA
Die Ratschläge in diesem Buch wurden von Autorin und Verlag sorgfältig geprüft, dennoch kann keine Garantie übernommen werden. Sie ersetzen keine eventuell notwendige psychologische oder therapeutische Begleitung und ihre Anwendung erfolgt in eigener Verantwortung. Jegliche Haftung der Autorin bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Gesundheitsschäden sowie Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Das Zitat S. 6 (aus R. Kammer, Zen in der Kunst, das Schwert zu führen, S. 68) erfolgt mit freundlicher Genehmigung: © 2010 O. W. Barth Verlag in derVerlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG, München.
Besuchen Sie uns im Internet unter: www.amalthea.at
© 2016 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker, OFFBEAT
Umschlagmotiv: iStock.com
Herstellung und Satz: Gabi Adébisi-Schuster, Wien
Gesetzt aus der Elena 10,6/14 pt
ISBN 978-3-99050-030-9
eISBN: 978-3-903083-16-5
Inhalt
Zum Geleit
Lernaufgaben
Gleichschaltungen • Mut als »Mannestugend« • Suggestionen • Zivilcourage • Helfer Angst • Wankelmut • Gleichmut
Unser Gemüt
Prägungen • Paarungen • Ansteckungsgefahren • Mut zur Kraftanstrengung • Die gleichen Wellenlängen • Das Geheimnis der Spiegelnervenzellen • Die Standortfrage • Bewusstes und Unbewusstes • Pseudoharmonie
Aufwachsen
Sprachmut • Ur-Vertrauen • Wagemut • Mutlosigkeit • Kleinmut • Mutwillen • Ermutigung
Wachstumsschmerzen
Unmut • Anmut • Mutproben • Übermut
Endlich erwachsen!
Freimut • Zumutungen • Wankelmut • Vermutungen • Langmut • Frohgemut
Zeit der Reife
Hochgemut • Hochmut • Kampfmut • Demut • Reumut • Edelmut • Mut zu den Wurzeln • Mut zum Weggehen • Mut zur Verantwortung • Mut zur Anzeige • Mut zur Ethik • Mut zur Liebe • Mut zur Gleichheit • Mut zur Religion
Erntezeit
Schwermut • Missmut • Wehmut • Wohlgemut • Mut zum Eigensinn • Mut zur Selbstfürsorge • Sanftmut
Ermutigung – ein Selbstcoaching zur ganzheitlichen Gesundheit
Das Prinzip Salutogenese • Bewusstheit • Ganzheitlich denken • Focusing • »Kopfbewohner« • »Schurken schrumpfen« • »Exorzismus-Technik« • PROvokativpädagogik • Transaktionsanalyse • Drehbuch schreiben • Dolmetschen • Das Du-Ich-Bitte-Modell • Self-Modeling
Literaturangaben
»Das Leben des Herzens im Fluidum gleicht dem Herumschwimmen eines Fisches im Wasser. Der Fisch ist so frei, wie das Wasser tief ist. Wenn große Fische nicht tiefe Gründe zur Verfügung haben, können sie nicht herumschwimmen. Und wenn das Wasser austrocknet, geraten die Fische in Not, wenn das Wasser schwindet, dann sterben sie. Das Herz ist so frei, wie das Fluidum stark und gesund ist. Wenn das Fluidum dürftig ist, verkümmert das Herz, und wenn das Fluidum erschöpft ist, kehrt das Herz ins Nichts zurück. Deshalb erschrecken die Fische, wenn das Wasser in Bewegung gerät, und das Herz wird unruhig, wenn das Fluidum in Bewegung gerät.
Nicht nur im Kampfe, sondern in allen Dingen gibt es die Möglichkeit, sich entweder dem Himmel oder dem Schicksal anheimzugeben. In der Schwertkunst bemüht man sich unablässig um das Prinzip von Sieg und Niederlage, und im menschlichen Bereich hält man fest an den natürlichen sittlichen Verpflichtungen und wendet keine selbstsüchtigen Schliche an; in seinem Handeln ist man unabhängig, und in seinem Denken klebt man nicht an Vorstellungen. Das nennt man ›sich dem Himmel anheimgeben‹. Seine menschlichen Verpflichtungen erfüllen, das ist, sich dem Himmel anheim geben. Es gleicht dem Mühen des Bauern bei der Feldbestellung: er pflügt und sät und jätet und erfüllt dabei den Weg, auf dem er bewandert ist. Flut und Dürre und Sturm aber, auf die des Menschen Kraft keinen Einfluss hat, bei diesen verlässt er sich auf den Himmel. Aber gesetzt den Fall, dass man sich dem Himmel anvertraut, ohne vorher seine menschlichen Verpflichtungen erfüllt zu haben, dann wird man des himmlischen Weges nicht teilhaftig.«
Shissai Chozan, Zen in der Kunst, das Schwert zu führen (Diskurs über die Kunst der Bergdämonen)
Zum Geleit
Der, den Gott nicht mit seiner gewaltigen Hand zum Ritter schlägt, ist und bleibt in tiefster Seele feig, wenn nicht aus einem anderen Grund, dann, weil er zu stolz war, den Ritterschlag auszuhalten, da er wie jeder Ritterschlag das Bekenntnis der eigenen Unwürdigkeit fordert.
SÖREN KIERKEGAARD
Ein Mut-Buch zu schreiben erfordert Mut.
Jedes Buchvorhaben braucht schon einiges an Mut, werden nun wohl manche einwenden, ebenso Reden vor großem Publikum zu halten oder überhaupt in einer ungewohnten Rolle vor ein Publikum zu treten. Sogar erfahrene Schauspieler gestehen immer wieder, dass sie von Lampenfieber ergriffen werden, ehe sie die Bühne betreten ... Aber dann! Dann verfliegen diese fieberartigen Zustände, man wird ganz ruhig und man »funktioniert«: Man übt seine Funktion aus.
Ich nenne diese energetische Aufladung gerne »bräutliche Erregung«: Man hat eine Vorstellung davon, was nun geschehen soll, und ahnt doch auch, dass vieles schiefgehen kann – daher bringt man sich in einen kraftvolleren Zustand, um besser gegensteuern bzw. improvisieren zu können. Nach dieser besonderen Befindlichkeit kann man süchtig werden: Man sucht dann den Adrenalinstoß durch geplante Inszenierungen (und nicht alle davon sind »jugendfrei«). Aber was ist, wenn Unvorhergesehenes, Unplanbares über einen hereinbricht?
Wenn man sich mit einem bestimmten Thema befasst, kann man sehr häufig beobachten, wie themengleiche Situationen entstehen, gleichsam wie von Zauberhand inszeniert, in denen man viel Mut braucht.
Bevor ich diese Zeilen zu schreiben begonnen habe – außer Atem und mit einem zum Zerspringen klopfenden Herzen, und mich andauernd vertippend –, musste ich gerade zwei kämpfende Hunde trennen, meine sanfte Laika und die hochaggressive Cora, die vorübergehend bei uns in Kost ist, weil ihr Besitzer in Vorarlberg einen Film dreht. Wir wissen, dass Cora nicht mit anderen Hunden zusammentreffen darf: Sie nennt Pitbull-Gene ihr Eigen und hat ihren Besitzer schon viel Geld gekostet, wenn er Tierarztrechnungen zahlen musste. Nun hatte mein Mitarbeiter etwas Schweres aus dem Haus getragen, dabei die Haustür weiter und länger offen gehalten als üblich, und vergessen, dass Cora im Garten war – und Laika dachte wohl, jetzt kommt ihr gewohnter Abendspaziergang, und ist an ihm vorbeigehuscht und Cora hat sich voll Kampflust auf sie gestürzt – und dann haben wir zwei Erwachsenen in den Kampf eingegriffen und versucht, die beiden Hunde zu trennen.
In solchen Augenblicken reagiert man spontan – aber eben auch ohne viel vorauszudenken. Während meiner Aktion schoss mir schon durch den Kopf: Was ist, wenn ich jetzt schwer verletzt würde? Ich habe am nächsten Tag wichtige Termine in über 100 km Entfernung – ich muss Auto fahren können ... Und werde ich jetzt zum Tierarzt fahren müssen? Mit welchem Hund zuerst? (Allerdings war die Angreiferin, wie sich nach der Trennung gezeigt hat, überhaupt nicht blessiert – im Gegensatz zu meiner Hündin und meinem Mitarbeiter.) Jedenfalls habe ich eine Entscheidung getroffen: Cora darf nicht mehr ohne Beißkorb in den Garten und muss auch dort im Zwinger (einem abgeteilten großen Gartenstück) bleiben, wenn man sie nicht im Auge behalten kann. Immerhin kann sie in etwa drei Meter hoch springen … So süß sie auch anzusehen ist, so gefährlich ist sie. Ich werde ihr zur allgemeinen Warnung ein gelbes Halstuch verpassen.
Laika liegt nun erschöpft auf ihrem weichen Platz und leckt ihren linken Vorderlauf. Ich konnte keine Blutspuren entdecken1 – nur die meines unachtsamen Mitarbeiters, und den habe ich gleich verarztet.
Mein Pulsschlag hat sich wieder normalisiert. Ich kann daher dort ansetzen, wo ich unterbrechen musste.
In der psychoanalytischen Sozialtherapie sprechen wir von Parallelprozessen, wenn sich im Unterricht oder Training zwischen Menschen genau das abspielt, was das Thema des Lehrinhalts ist. So habe ich des Öfteren erlebt, dass sich Männer und Frauen in zwei einander befehdende Gruppen gespaltet haben, wenn es um das Thema Konkurrenz ging, oder dass eine Nachzüglerin bei Themen wie Eifersucht, Neid oder Exklusion und Solidarität große Schwierigkeiten erlebte, sich in die gerade erst gebildete Gemeinschaft einzufügen.
Für mich stellt auch das Verfassen dieses Buches eine große Herausforderung dar: Zuerst bin ich von der Verlegerin gebeten worden, möglichst auf lange Zitate und Fußnoten zu verzichten und viele Alltagsbeispiele zu beschreiben – und das bedeutet für mich nicht nur Abstand von meinem gewohnten Schreibstil nehmen (den ich ohnedies für sehr leserfreundlich halte, denn selbst Hochgebildete wollen sich am Abend entspannt fortbilden und nicht erst in Normalsprache übersetzen müssen), sondern auch damit rechnen zu müssen, dass Personen, deren Ego verlangt, sich anderen »überheben« zu wollen, nicht meinen Gedanken folgen, sondern nur auf Gelegenheiten lauern werden, mir eins auszuwischen (eine Lebenserfahrung von mir – und nicht nur von mir!).
Wir nehmen Menschen meist in ihren sozialen Rollen wahr – als ExpertInnen in Landwirtschaft, im Gewerbe, in Wissenschaft und Kunst, in Politik und Wirtschaft oder als Menschen mit Familie. Oder als solche, die sich »am Rand der Gesellschaft« befinden – wohin wir alle auch geraten können. Aber egal, in welche Schublade oder Rangordnung wir jemanden (oder uns selbst) einordnen – wir sind immer auch »nur« Menschen, im Jenseits alle gleich, und im Diesseits vielfach Sklaven unserer Wünsche und Ängste, Stärken und Schwächen. Wir werden mit Bewertungen eingeordnet: Das, was gesellschaftlich erwünscht ist, wird hoch bewertet, was unerwünscht ist, wird verachtet, geächtet und oft auch sanktioniert. Dazu dienen Vorbilder, und die kommen vielfach aus den Medien (und dabei die traditionellen wie Ansprachen, Lieder, Gedichte und Druckwerke insgesamt mitgemeint).
In meiner vierzigjährigen Ehe mit einem Journalisten und PRBerater habe ich immer wieder erlebt, wie anders Angehörige seiner Berufswelt – Verlegerschaft inklusive – denken als meine Kollegenschaft. »A G’schicht«, dozierte er oft, ist nur etwas, das das erste oder letzte Mal geschieht, oder ein Wunder oder ein Skandal. Und Skandale kann man herbeischreiben ... Vor welcher Zielgruppe sich hüten – und welcher sich beim Verfassen eines Mut-Buches anschließen? Meiner psychotherapeutischen Kollegenschaft, der Zuhörerschaft meiner Vorträge und Seminare, den Erwartungen potenziell übelwollender Rezensenten oder meiner Verlegerin und meinen LeserInnen? Da ich mich aber nicht nur für mutig halte, sondern auch für grundsätzlich kooperativ, entscheide ich mich für Letztere und bereite mich darauf vor, dass andere von mir den Mut zum Widersprechen einfordern werden, den sie selbst nicht aufbringen.
Aber wie der Vorarlberger Rundfunkjournalist Dr. Franz Köb als Moderator einer Podiumsdiskussion bei den Goldegger Dialogen aufzeigte: Jeder Mensch ist eine gefährliche Gelegenheit – und eine gelegentliche Gefahr … Ich wage also den Weg in die soziale Gefahrenzone.
Mut wird meist als Tapferkeit vor dem Feinde – wer auch immer das sei – verstanden. Bedenkt man aber, in wie vielen Wortkombinationen Mut steckt, merkt man, dass er eigentlich nur eine der vielen Formen von Gemüt darstellt. Auch wird Mut meist positiv bewertet – aber auch das ist nur die eine, die lichte Seite – es gibt auch eine dunkle.
Zu Beginn sollen dazu einige Fragen aufgeworfen und beantwortet werden wie etwa die, was genau unter dem Wort Mut verstanden wird, wer als mutig gilt und in welchen Situationen – und ob es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Später folgen dann ausführliche Überlegungen, wie sich Mut aber auch Mutlosigkeit im Laufe der Lebensphasen entwickeln können – und wie man Gemüt und Mut selbstbestimmt fördern kann.
Deswegen soll aufgezeigt werden, dass man Mut – oder ebenso Mutlosigkeit – »lernt« und auch, wie jegliches Lernen konkret vor sich geht.
Lernaufgaben
Der Mensch muss schon früh versuchen, das zu wollen, was möglich ist, damit er auf das, was nicht sein kann (als nicht erstrebenswert), verzichtet und in dem Glauben leben kann, dass er das will, was vom Gesetz und der Notwendigkeit her unvermeidlich ist.
ERIK H. ERIKSON
Es war einmal … eine Plakataktion der Firma Palmers unter dem Schlagwort »Trau dich doch!«. Da ging es darum, der österreichischen Biederfrau Lust auf sogenannte Reizwäsche zu machen – und Mut. Denn damals galt es noch als unmoralisch, andere Materialien als Baumwolle an den durchwegs »vollschlanken« Frauenkörper zu lassen, und auch die industriell gefertigten Spitzen durften höchstens eine Breite aufweisen, wie sie Mädchen im Handarbeitsunterricht zwecks Verschönerung an quadratische Leinenflecke platzieren mussten (und die für den geplanten Einsatz als Taschentücher eigentlich viel zu derb waren). Apropos »Reiz«Wäsche: Wen sollte diese »reizen«? Mollige Wienerinnen oder Hiatamadeln mit »strammen Wadeln« (© Hubert von Goisern), die sich mit überschlanken Models in halbseidenen Posen identifizieren und dazu die passende Umrahmung kaufen sollten? Oder müde Alpinhengste oder Mundl Sackbauers daran erinnern, dass nicht nur Bier den Unterleib aktiviert? Oder ging es einfach nur um das »Sich-trauen«, den Mut, tief schlummernde Sehnsüchte ins Bewusstsein aufsteigen zu lassen, anstatt sie sofort als ungehörig bei sich selbst zu unterdrücken oder bei anderen zu bekämpfen?
Sich »trauen« hat viel mit Vertrauen, Zutrauen und Zutraulichkeit zu tun: Wenn man sich etwas traut, traut man sich die Bewältigung dieses Vorhabens zu – oder man traut sich den Widerstand gegen die jeweilige Auftraggeberschaft nicht zu; dann hat man zu dieser kein Vertrauen, und das macht meist auch Sinn – denn viele setzen listig unerwünschte Vertraulichkeit ein, um Bedenken oder Zweifel zu zerstreuen … Und oft erproben sie mit über-raschenden Vertraulichkeiten, ob sich das Gegenüber traut, sich zur Wehr zu setzen. Das potenzielle Opfer soll gar nicht zum Nachdenken kommen … Mut wird deshalb oft als Abwesenheit von Vernunft bezeichnet.
In der Zeit, in der ich noch Kommunalpolitikerin war (1973–1987), sagte mir einmal ein übergeordneter Kollege »im Vertrauen«, ich wäre vielen Funktionären zu »risikofreudig«, was er dann präzisierte als »ich würde zu oft meine Gedanken offenbaren« und damit die Konservativen – oder wohlwollender formuliert: Vorsichtigen – vor den Kopf stoßen. (Viele dieser meiner »zu progressiven« Gedanken2 wurden Jahre später dennoch verwirklicht – allerdings immer auf den medial verstärkten Druck der Oppositionsparteien hin.)
Wie sinnvoll es ist, Mut nicht als spontanes Draufgängertum hoch zu schätzen, wurde mir erst Jahre später bewusst. Es war Hochsommer, den meine Familie und ich in unserer kleinen Hütte in der Steiermark verbrachten; wir mussten damals über einen Tag kurz mal nach Wien, und als wir abends unser Häuschen erreichten, fiel mir sofort auf, dass ein Fenster offenstand. Dass unser Hund sich zitternd nicht aus dem Auto wagte, fiel mir nicht auf – denn nach der Frage an Mann und Kinder, ob jemand das Fenster schlecht zugemacht oder offenstehen gelassen habe, war ich schon flugs aus dem Auto heraus und über das offene Fenster ins Haus hineingeklettert – es dauerte mir zu lange, drei Schlösser aufzusperren. Den Platsch, den der Einbrecher machte, als er bei einem anderen Fenster hinaus und in den dort von uns für die Kleinen angelegten Spielteich hineinsprang, hörte ich nicht – nur die heftige Kritik meines Ehemannes, dass ich mich unnötig gefährdet hätte: Im Haus befand sich auch ein Gewehr. In den Tagen darauf erfuhren wir, dass der bereits von der Polizei gesuchte Mann in mehrere Hütten eingebrochen war und sich mit Lebensmitteln versorgt hatte – bei uns war der vollgepackte Rucksack am Küchentisch stehen geblieben – und dass er ein ehemaliger Fremdenlegionär und als gefährlich einzustufen war.
An all das hatte ich nicht gedacht. Ich hatte wohl irgendeinem filmischen Vorbild nachgeeifert – und in Filmen laufen die Bilder so schnell ab, dass man während des Zuschauens kaum zum Nachdenken kommt, sondern höchstens zum Mitfühlen – und zwar mit der Person, mit der man sich identifiziert, und das ist meistens die, aus deren Blickwinkel die Kamera geführt wird. Damit »erlernt« man aber auch unbewusst ein Verhaltensrepertoire.
Gleichschaltungen
In dieselbe Richtung zu schauen, bedeutet, sich mental gleichzuschalten, sofern man sich nicht bewusst kritisch distanziert.
Gleichschaltung ist eine Methode, ein Korps zu gestalten – eine Masse, in der der Einzelne untergeht und damit auch seine individuelle Verantwortlichkeit. Der Filmemacher Peter Hartl etwa verweist auf die Formationen zum Gleichschritt als ersten Schritt zur Verherrlichung soldatischer Tugenden. Außerdem schafft der produzierte Gleichklang einen besonderen Ton von Kraft. All das scheint logisch: Wenn man will, dass niemand aus der Reihe tanzt, dass sich alle im Kollektiv geborgen fühlen, dass niemand über seine Gefühle nachdenkt und womöglich andere mit seiner Angst ansteckt, dann wird man krass unterscheiden zwischen dem belobigungswürdigen Mutigen und dem verdammenswerten Feigen. Der französische Maler und Schriftsteller Roland Topor verteidigt Feigheit allerdings als »Technik des individuellen Überlebens«. Aber sind nicht alle unsere Handlungen mehr oder weniger am Überleben ausgerichtet – vor allem am sozialen Überleben?
Mut wird oft als Abwesenheit von Vernunft bezeichnet.
Sozial überlebt, wer nicht aus der Peergroup herausfällt bzw. hinausgedrängt wird. Alltägliche Mut-Tests dienen insgeheim dazu, nicht nur die Rangordnung zu prüfen – bei Hühnern wird sie »Hackordnung« genannt, weil die »nicht Gleichen« mit scharfen Schnäbeln gepeckt, vertrieben oder andernfalls verletzt oder gar getötet werden, denn ein winziges Hühnergehirn kann den Vorteil von »Diversity« nicht begreifen –, sondern auch, um herauszufinden, wo jemand seine Schmerzgrenze hat, ab der er nicht mehr »mitspielt«. (Der Neurobiologe Joachim Bauer weist darauf hin, dass unterdrückte Aggressionsimpulse »für einen eventuellen späteren Gebrauch wie eine Konserve« aufbewahrt werden – zwecks Wiedererlangung von »Respekt«.) Leider beschränkt sich bei manchen Menschen die Akzeptanz, ja sogar Toleranz, nur auf »ihresgleichen«. Daher werden Mutproben als nützliche Beweise eingefordert, um die Widerstandskraft der »Ungleichen« zu prüfen, und überdies, um herauszufinden, wer mit wem sympathisiert. Zusätzlich entdeckt man dabei auch, wer sich zum Sündenbock/zur Sündenziege eignet.
Es ist wichtig zu erkennen, wie sehr mit dem Appell, mutig zu sein, manipuliert wird.
Deswegen ist es wichtig zu erkennen, wie sehr mit dem Appell, mutig zu sein, manipuliert wird. Besonders sichtbar wird dies bei den sogenannten Mutproben Jugendlicher, die in Wirklichkeit Unterwerfungstests sind: Wie existenziell wichtig ist jemandem die Zugehörigkeit zur Gruppe, wie sehr ist jemand bereit, für diese Zugehörigkeit sein Leben aufs Spiel zu setzen? Und wo soll er danach in der Hackordnung platziert werden?
Mut als »Mannestugend«
Die erste Manipulation besteht bereits darin, dass Mut als männliche Tugend definiert wird. Schon die alten Griechen nannten Mut andreia: Darin steckt das Wort aner, der Mann. Das beweist den Zusammenhang mit der traditionellen militärischen Erziehung: Jahrhundertelang teilte sich der männliche Bereich in wenige Befehlshaber und massenhaft Gehorsamspflichtige, denen Bildung und Information vorenthalten wurde, wohingegen der weibliche Teil der Menschheit bestenfalls in Küche und Kinderstube kommandieren durfte – sofern der »Herr des Hauses«, Ehemann oder Vater, in manchen Rechtssystemen noch dazu Bruder oder Vatersbruder, dies erlaubte. In Österreich wurde erst durch die Familienrechtsreform Ende der 1970er-Jahre diese juristische Vorrangstellung des Ehemannes durch eine auf Gewaltverzicht ausgerichtete partnerschaftliche Rechtskonstruktion ersetzt – aber eingehalten wird sie noch immer nicht überall; das zeigt mir meine Beratungstätigkeit leider immer wieder.
Der Mut, den viele Frauen aufbringen müssen, um ungerechte Verhältnisse aufzuzeigen, dagegen zu protestieren und sich davon zu befreien, egal ob es private, berufliche oder gesellschaftliche sind, wird hingegen weder als psychische Kraftleistung, noch als Tugend der Selbstfürsorge anerkannt, sondern ganz im Gegenteil: Frauen werden eher als überanspruchsvolle Störenfriede bezeichnet, wenn sie Widerstand leisten – außer es wurde ihnen das von einer übergeordneten Instanz »angeschafft«.
Im militärischen Modell gilt Gehorsam wesentlich mehr als etwa Eigenaktivität, selbst wenn diese zum Sieg führt.3 Ähnlich toben oft herrische Menschen, wenn jemand ohne zu fragen den Mut besitzt, notwendige Handlungen zu setzen: Sie fühlen sich dann in ihrem Führungsanspruch nicht respektiert – was enttarnt, dass ihr Ziel nicht der jeweilig angepeilte Erfolg ist, sondern ihre persönliche Dominanz. Darin sehe ich einen Grund, weswegen Mut bei Frauen und Kindern ignoriert, abgewertet, verboten oder auch verspottet wird: Sie werden immer noch von vielen Menschen nur als Untergeordnete von Männern »erwünscht« und dementsprechend mittels Angstmache bedroht, wenn sie keinen »Beschützer« aufzuweisen haben, vor dem man(n) sich vorauseilend vorsehen muss. So höre ich immer wieder Klagen von frisch geschiedenen Frauen, dass sie sich kaum der einschlägigen Anträge von Arbeitskollegen oder Nachbarn erwehren könnten, die wähnen, eine Frau brauche unbedingt einen, der zu ihr hält – also einen »Zuhälter«.
Aristoteles sah Mut als Mitte zwischen Furcht und Zuversicht und hielt ihn für lehrbar bzw. erlernbar. Zuversicht – das bedeutet vor allem auch Selbstvertrauen, und das gewinnt man erst aus der Erfahrung gelungener Wagnisse. Aber ist dieses gesellschaftlich überhaupt erwünscht? Im militärischen Modell sollen die Angehörigen der jeweils bewusst uninformiert gehaltenen untergeordneten Dienstgrade ihren Übergeordneten »blind« – das bedeutet »ohne nachzudenken« – vertrauen, daher ist aus dieser Sicht Selbstvertrauen unnötig, ja sogar gefährlich: Es könnte sich jemand für klüger halten als seine Vorgesetzten.
Dieses hierarchische Herrschaftsmodell kann bis in die Antike zurückverfolgt werden: Bevor die Menschen sesshaft wurden, fungierten Männer auch als Wachtrupp Vieh hütender Nomaden, immer vorbereitet auf Überfälle von organisierten Viehdieben oder Frauenräubern. Frauen hatten vor allem die Aufgabe, für Zuwachs an Kämpfern zu sorgen und nebenbei noch die Verwundeten oder Kranken zu pflegen, alles andere war unnötiger Aufputz, denn hochwertiges Essen bereiteten sich Jagende traditionell selbst zu, gesammelte Kräuter, Beeren, Obst und Feldfrüchte galten ohnedies nichts gegenüber eiweißhaltiger Kraftnahrung (wie ja auch heute noch viele Männer diese gesunde Kost als »Babynahrung« verweigern). Erst mit der Sesshaftwerdung und ausgeklügeltem Ackerbau samt Bewässerungssystemen ging die hierarchische Herrschaft vom Clanältesten bzw. Familienoberhaupt auf Älteste als Ortsvorsteher über, bildeten sich Ortsverbände als Kampf- und Verteidigungsbündnisse und mit zunehmender Größe Fürstentümer und Königreiche – immer mit Befehlsgewalt von der einsamen Spitze oben nach unten zur breiten Masse.
Mein Jungianischer Lehranalytiker erzählte mir (als Mahnung!) einmal von einem Naturvolk, bei dem alle Männer »in Reih und Glied« der Jagdbeute gegenüberstehend erst dann ihre Pfeile abschießen dürfen, wenn sie dazu den Befehl erhalten; ist aber einer schneller und wartet nicht die Gleichschaltung mit den anderen ab, wird er sofort von diesen erschossen – selbst wenn er die Jagdbeute erlegt hat (und die anderen das nicht geschafft hätten, weil allein das Schießkommando das Tier möglicherweise bereits vertrieben hätte). Er ist zum »Outlaw« – zu einem außerhalb des Gesetzes – geworden. Nur wenn er allein – ohne konkurrierendes Nebeneinander – eine beängstigende Gefahr (es gibt ja auch andere) bezwingt, wird er zum Helden … Und da dürfen dann auch Frauen Heldentaten begehen, denken wir nur an Judith im Alten Testament, die den feindlichen Feldherrn Holofernes im Doppelsinn des Wortes »berauschte« und dem Betäubten statt sexuelle Wohltaten zu gewähren den Kopf abschlug.
Aristoteles sah Mut als Mitte zwischen Furcht und Zuversicht.
Suggestionen
Die Anerkennung als Heldentum ist immer von der nachträglichen Genehmigung durch »obere Instanzen« – Männer! – abhängig. Alltagsfrauen dürfen nur Kinder loben. Erst wenn eine die Spitze einer Hierarchie erklommen hat, gilt ihr Wort richtungweisend – aber das auch nicht immer, denn alle, die ihre Position selbst bekleiden wollen (oder für »Besserwisserei« bezahlt werden wie Lohnschreiber), werden auf Ansatzmöglichkeiten für Kritik lauern und gegebenenfalls zur Attacke schreiten. Jemanden aus der Masse hervorzuheben – eben etwa durch die Bezeichnung als Held oder gar Heldin –, suggeriert nicht nur besondere Hochachtung, sondern auch Nachahmungsaufforderung für das ausgezeichnete Verhalten, und das nicht nur in der Hochkultur, sondern auch in den jeweiligen Subkulturen.
Auszeichnung besitzt Doppelsinn: Man kann jemanden positiv oder negativ »markieren« – so wie es auch von alters her Tätowierungen als Königs- oder als Sträflings-Marker gab. Manchmal kann diese Usance aber durcheinandergebracht werden. Ich kann mich noch gut erinnern, wie beeindruckt ich war, als ich als Kind in dem dänischen Familienmagazin Hjemmet (zu Deutsch »Heim«, vergleichbar etwa mit Frau im Spiegel oder Die ganze Woche) eine Rückenansicht des damaligen Königs Frederik, des Vaters der gegenwärtigen Königin Margarethe, sah, denn da gab es nicht nur die eine oder andere abgegrenzte Tätowierung, sondern er hatte sich als Marineoffizier gleich die ganze Rückenfläche voll bebildern lassen.
Belobigungsinstanzen waren früher die staatliche oder kirchliche Obrigkeit, heute sind dies vor allem die Medien. Ihr Lob lässt Nachahmung wachsen – und als Lob gilt vielen bereits, in Bild oder Text aufzuscheinen, egal ob positiv oder negativ. Deswegen sollten sozial unerwünschte Handlungen nicht explizit beschrieben werden. Als ich im Jahr 2010 für die Katholische Medienakademie ein Seminar zum Thema »Wie schreiben über sexuellen Missbrauch?« abhielt, plädierte ich aus den soeben genannten Gründen dafür, so unemotional wie möglich zu formulieren – ich wusste aus meiner beratenden und therapeutischen Praxis, dass gerade pädophil veranlagte Männer solche Zeitungsberichte sammelten und gleichsam als Pornoliteratur »genossen«. »Aber wir haben doch gelernt, möglichst emotional zu texten!«, protestierte die Seminarteilnehmerschaft. »Ja, schon – bei all den Themen, die zur Nachahmung herausfordern dürfen!«, konterte ich und erklärte: Beim Lesen von Sexualstraftaten werden bei manchen Menschen spontan sexuelle Phantasien ausgelöst, und viele registrieren dies auch unangenehm berührt und distanzieren sich von der »Quelle« – aber gar nicht so wenige bekommen die dadurch ausgelösten Gefühle nicht weg, sondern tragen sie als Zwangsgedanken tagelang mit sich herum (wie wir das von sogenannten Ohrwürmern kennen), und manche glauben, einzig durch Ausagieren ihrer Phantasien sich von diesen befreien zu können – so wie es Oscar Wilde im Bildnis des Dorian Gray formulierte: »Der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist ihr nachzugeben.«
Unabhängig davon, ob es sich um Berichterstattung über Selbsttötungen handelt oder Gewalt (egal ob triviale, familiäre oder sexuelle), werden durch Worte geistige Bilder geschaffen; wenn es zu diesen keine Gegenbilder gibt, besteht die Gefahr (oder Chance), dass in entsprechenden Situationen das jeweils entsprechende »Vor-Bild« nachgespielt wird.
Wir alle lernen an Vorbildern, durch Einübung und durch »Lob«. Wenn wir für unser Verhalten Anerkennung – »Anerkennungsenergie« – bekommen, neigen wir zu Wiederholungen, und je öfter man etwas wiederholt, desto stärker ist es in unserem Verhaltensrepertoire verankert. »Semantisches Gedächtnis« heißt dies in der Fachsprache – im Gegensatz zum »episodalen« Gedächtnis, das durch schockierende oder ekstatische Erlebnisse gespeist wird; dabei ist zu bedenken, dass solch eine traumatisierende oder euphorisierende »Episode« durch Wiederholungen vom episodalen ins semantische Gedächtnis wandern kann. Damit lassen sich manche zwanghafte strafbare oder andere sozial problematische Verhaltensweisen erklären.
So hat eine meiner StudentInnen in dem von mir konzipierten und geleiteten Masterstudium PROvokativpädagogik an der Donau-Universität Krems ihre Masterarbeit dem Thema Heldentum gewidmet und dazu mit OberstufenschülerInnen nach Geschlecht getrennt jeweils einen Kurzfilm konzipieren und realisieren lassen und diese Prozesse begleitet, kommentiert und dokumentiert. Bei den Burschen kam eine Art Action-Movie mit all den traditionellen Männlichkeitsklischees heraus, bei den Mädchen eine Lovestory mit einem Retter für die ungerecht behandelte Heldin. Beides bewahrheitete neuerlich die Erfahrung, dass lieber Altgewohntes multipliziert wird, anstatt etwas Ungewohntes zu wagen.
Zivilcourage
Wenn also immer wieder der Ruf nach mehr Zivilcourage laut wird, so braucht dies alltagstaugliche Vorbilder, und diese könnten durchaus auch die audiovisuellen Medien liefern – anstatt immer nur Negativbeispiele von altmodischem Heldentum bestehend aus Kampfszenen (und List und Tücke). Denn bei aller Wertschätzung gegenüber dem Mann und der jungen Frau, die sich beide in Deutschland in Raufereien eingeschaltet hatten und dabei zu Tode kamen und in »Nachrufen« in den Medien wegen ihrer Zivilcourage belobigt wurden – die Öffentlichkeit hat nur erfahren, was im Fall des Mannes die Kamera am Bahnhof aufgezeichnet hat bzw. was in beiden Fällen in der Tagesberichterstattung publiziert wurde, nicht aber, was konkret gesprochen wurde. Genau das – Sprache – aber ist der Angelpunkt, ob eine »Kommunikation« gelingt oder misslingt.
Sprache ist der Angelpunkt, ob eine »Kommunikation« gelingt oder misslingt.
Da Resümee meiner jahrzehntelangen Forschungen zu Gewalt gegen andere wie auch gegen sich selbst lautet: Sie wurzelt immer in einem – meist unbewussten – Vergleich. Entweder man vergleicht sich mit jemand anderem und fühlt sich unterlegen – dann versucht man den anderen oder die andere klein oder zu Nichts zu machen, also als bedrohliche Gefahr zu »vernichten«; oder man vergleicht sich in der augenblicklichen Situation mit dem eigenen Idealbild (das kann auch von einer Autorität vorgegeben und verinnerlicht worden sein) und versucht, das eigene Negativbild wegzubekommen. Zu dieser Entschlüsselung zählt auch die Identifikation mit jemand anderem, dem oder der Unrecht geschieht: Auch in diesem Fall folgt man einem Vorbild, mit dem man sich vergleicht, und ist dementsprechend entweder zurückhaltend oder vorpreschend, aber kaum »besonnen«. Die Augenblicksdynamik läuft so schnell ab, dass man kaum mit dem Denken nachkommt … Außer man hat dies »erlernt«, was bedeutet: wiederholt eingeübt und damit neuronal verfestigt.
In Krisenberufen, wo es darum geht, einem minutiösen Zeitplan zu folgen (wie beispielsweise in der Chirurgie, bei Feuerwehr, Militär, Polizei, aber auch in den »darstellenden« Berufen, ganze Orchester mitgemeint), werden die einzelnen Verhaltensschritte immer wieder eingeübt. Alle anderen Menschen kennen meist nur den Probe-Feueralarm aus ihrer Schulzeit: in Zweierreihen anstellen und eine bestimmte Wegstrecke diszipliniert, d.h. ohne zu drängen, und nach Anweisung gehen. Heute, wo der internationale Terrorismus zunimmt, braucht es aber für uns alle ein situationsgemäßes Verhaltensrepertoire. Die »Dornröschen-Strategie« – alle Spindeln verbieten, Dornröschen könnte sich ja stechen und den Fluch der bösen Fee erfüllen – nützt nicht, es kann ja immer jemand heimlich eine neue Spindel basteln. Es hilft nur umfassende Aufklärung und Bewältigungsmethoden einzuüben. Deswegen bin ich auch dafür, dass Landesverteidigung nicht mehr nur darin bestehen darf, körperlich für Notfallszenarien vorzubereiten, sondern Männer wie Frauen gleichermaßen umfassend auf Achtsamkeit und kreative Problemlösungen für jedwede Gefährdung unserer Sicherheit – Strom- und Wasserleitungen mitbedacht, aber auch psychotische Reaktionen traumatisierter Menschen berücksichtigend – zu trainieren.
Es gibt für alles immer noch eine zweite, dritte oder sonstwie andere Methodik; eine findet man in den sogenannten östlichen Kampftechniken: sich in die Gefahr – und die Gefahrenquelle – einfühlen und sie »von innen her« verstehen. So wie der Zen-Bogenschütze mit seinem Ziel »blind«, d.h. ohne einseitig »technischen« Denk-Akt, verschmilzt und daher auch im Dunkeln treffen kann, kann man auch mit jedem anderen Gegenüber »eins werden«. Der japanisch-amerikanische Professor der Buddhistischen Philosophie Daisetz Teitaro Suzuki schreibt im Vorwort zu Eugen Herrigels Zen in der Kunst des Borgenschießens: »Um wirklich Meister des Bogenschießens zu sein, genügen technische Kenntnisse nicht. Die Technik muss überschritten werden, so dass das Können zu einer ›nicht gekonnten Kunst‹ wird, die aus dem Unbewussten erwächst.« Schütze und Scheibe sind dann nicht mehr zwei entgegengesetzte Dinge, sondern eine einzige Wirklichkeit. Im Christentum nennen wir das »lieben«. In diesem Sinne könnte man daher auch formulieren: Mut besteht darin, der jeweiligen Angst liebend zu begegnen.
Helfer Angst
Nun sagt man zwar, Mut erwachse aus der Überwindung von Angst, aber eigentlich ist solch ein »Sieg« nicht wirklich Mut, sondern nur ein Schritt weiter von dem Hängenbleiben in der Angst hin zu ihrer Integration. Diese beinhaltet immer auch Vernunft und Selbstfürsorge. Andernfalls würde es sich um Risikoblindheit handeln.
Das Wort Angst stammt von dem lateinischen angustus, »eng«. Wenn man Angst bekommt, pflegt man unwillkürlich den Atem anzuhalten – der Feind soll einen ja nicht hören und orten können – und die Schultern hoch und nach vorne zu ziehen – es soll ja einerseits die Halsschlagader, andererseits Herz, Lunge und Gedärm geschützt werden. Überhaupt werden die Angriffsflächen des Körpers verkleinert. Dass der Herzschlag stockt und Adrenalin ausgeschüttet wird, gehört auch zu diesem Totstellreflex – er soll die augenblicklich unnütze Reizwahrnehmung ausblenden, damit man die Gefahrensignale besser hören und spüren kann. Kurz darauf fällt dann die Entscheidung, ob man flüchten will oder sich der Gefahr stellen – und diese Wahl hängt davon ab, was man »gelernt«, d. h. welche neuronalen Muster man im Nervengeflecht für solche Herausforderungen »verankert« hat. Wer keine derartigen Erfahrungen besitzt, pflegt sich urtümlich wie ein Tier zu verhalten: Dann kämpft oder flüchtet man nicht, sondern »stellt sich tot«: Man ist in »Schockstarre« gelähmt.
Viele kennen das aus Prüfungssituationen: Da haben die einen das Gefühl, der Herzschlag sei gestockt und der Kopf mit Beton ausgefüllt, während die anderen mit Herzrasen und Schwindel reagieren. Dann liegt es an der Sensibilität und Humanität der Prüfenden, durch winzige Fragen in die angepeilte Richtung der dissoziierten – ohne Fachausdruck: »weg getretenen« – Person zu helfen, »wieder zu sich zu kommen«.
Mut besteht darin, der jeweiligen Angst liebend zu begegnen.
Mut ist keine militärisch oder quasimilitärisch eintrainierte Eigenschaft (wie uns vielfach weisgemacht wird) – das wäre nur gedankenlose Befehlstreue –, sondern ein Prozess. Mut beginnt mit der Wahrnehmung, dass etwas nicht »stimmt« – dass unsere innere Stimme uns sagt, dass etwas nicht so sein sollte wie es sich augenblicklich darstellt, und dass es geändert gehört. Wie, ist in diesem Moment noch nicht klar. Das Warum ist jeweils auch kritisch zu hinterfragen – es könnte ja bloß in eigenen Dominanzbedürfnissen wurzeln. Beides zu erkennen, braucht Zeit – aber diese verkürzt sich, je öfter man sich mit dieser Thematik problemlösend beschäftigt. Ich sage meinen Klientinnen oft, wenn sie meinen, schnelle Mut-Entscheidungen treffen zu sollen: »Der Graf von Monte Christo hat auch 14 Jahre für seine Flucht aus dem Château d’If gebraucht.«
Um Mut zu entwickeln – so wie ein Schmetterling sich aus seiner Verpuppung befreit –, braucht es nicht nur Eigenzeit und Eigeninitiative, sondern auch günstige Umstände. Die Notwendigkeit von Vorbildern wurde als Beispiel dafür bereits angeführt; sie sind wichtig nicht nur als Modell zum Abschauen, sondern auch für das Bewusstsein, nicht der oder die Einzige zu sein, die sich so oder so verhält. Die meisten dieser »Verhaltensentwürfe« sind allerdings nicht zur Nachahmung zu empfehlen: Papa Mundl Sackbauer (aus der Fernsehserie »Ein echter Wiener geht nicht unter«) traut sich zwar in der Familie herumzubrüllen, aber sonst schon gar nichts, und den Outlaws in den Westernfilmen bleibt oft nichts anderes übrig, als wild gegen Gesetz und Gesellschaft draufloszuagieren, das besagt ja schon diese Bezeichnung: Wer sich in der Gemeinschaft weder wertgeschätzt noch aufgehoben fühlt, erlebt sie logischerweise als Feind.
Zählt man die wöchentlichen Angebote an Kriminalfilmen allein im deutschsprachigen Fernsehen, drängt sich die Vermutung auf, Otto Normalverbraucher sollte einem Mentaltraining zum Kleinkriminellen unterzogen werden – denn er wird kaum Jurisprudenz studieren um Rechts- oder Staatsanwalt zu werden. Darüber hinaus besteht umgekehrt die Gefahr, dass sich Angst vor Gewalttätern immer und überall ausbreitet – denn Angst, die nicht bearbeitet wird, bleibt als geistiges Gift im Unbewussten und lähmt. Mich hat einmal der autosuggestive Satz eines Klienten sehr beeindruckt, der sich mit »Dort, wo die Angst ist, liegt der Weg!« selbst Mut machte. Darin liegt nämlich tiefe Wahrheit: Dort, wo man spürt, dass man zögert, liegt der nächste Entwicklungsschritt.
Wankelmut
Zögern, zaudern, abwarten – all das wird oft abgewertet; zu sehr ist allein das kämpferische Vorwärtspreschen das, was gelobt wird. Lob schafft aber auch Abhängigkeit von den Lobenden. Besser statt Lob ist die einfache Feststellung, dass etwas gut ist. Deshalb benütze ich gerne die Aussage »Das ist eben noch nicht entscheidungsreif!«, wenn meine Klientinnen sich selbst für angebliche Entscheidungsschwächen oder auch Unsicherheit kritisieren.
Man braucht oft viel Geduld, das eigene Wachsen und Reifen abzuwarten, denn eine grundsätzlich mutige Person zu sein, ist das Ergebnis eines kreisartigen Entwicklungsprozesses.
Als Neugeborenes hat man noch eine ungeminderte Portion Mut in sich – man kennt ja weder Situationen der Angst noch der Straffolgen, man hat noch die Kraft, sich gegen Widriges/Widerliches zu wehren, aber eben nur mit Schreien und Zappeln. Dann folgt Erziehung und damit das Bemühen um Anpassung an die gesellschaftliche Forderung nach Pflegeleichtigkeit. Danach wechseln die Personen und Gruppen, an die man sich anpasst – und oft stehen die in großer Opposition zueinander. Und irgendwann wächst die innere Widerstandskraft, weil all die unterdrückten Wünsche und Sehnsüchte endlich verwirklicht werden wollen – gleichsam in einer dritten »Pubertät«. Pubertät heißt ja eingedeutscht auch nicht anderes als Reifungszeit (eigentlich Mannbarkeit).
»Dort, wo die Angst ist, liegt der Weg!«
Geduld braucht man aber auch, um das Gefühl sicherer »Stimmigkeit« zu verspüren. Deswegen formulieren wir ja »Der Entschluss ist gereift« als Gegenüber zum »Sich-kopflos-in-etwas-Hineinstürzen«.
Wiederum zeigt sich das militärische Gehorsamsmodell: Es soll immer nur eine richtige Verhaltensweise, nämlich die gehorsame, geben; jedes Schwanken zwischen Alternativen, ja sogar das bloße Aufzeigen, dass es solche gibt, gefährdet den Korps-Geist. Es könnte »ansteckend« wirken. Doch auch in Alltagssituationen wird Mut von irgendwelchen ungefährdeten anderen gefordert, und nicht nur in der Form von Zivilcourage, in der insgeheim das militärische Heldenideal mitschwingt: allein gegen das (soziale) Universum. Man erwartet oder lobt im Nachhinein, wenn jemand in einer Kampfsituation »Paroli« geboten oder sich getraut hat, »es jemandem zu sagen«. Weniger gelobt wird, wer die Stätte seiner Gesundheitsgefährdungen verlässt – kündigt, sich scheiden lässt oder gar ins Ausland geht. Man identifiziert sich lauthals und oft anbiedernd mit Personen, die scheinbar stellvertretend für die eigenen, tief im Herzen Gerechtigkeit liebenden, aber aus Angst vor den Ungerechten zaudernden Seelenanteile gehandelt haben. Man schmäht hingegen diejenigen, die Situationen verlassen, aus denen man selbst nicht auszubrechen wagt.
Tiefenpsychologisch entschlüsselt »verschieben« wir beim Loben meist ungelebte ethische Idealvorstellungen auf jemand anderen – was nicht heißt, dass diese Idealvorstellungen klug, gesund oder auch rechtlich erlaubt sind, und hoffen insgeheim, dass wir nun für das Loben gelobt werden … Oder wir »verkehren ins Gegenteil«, nämlich ins Verdammenswerte, wofür wir andere insgeheim beneiden, weil sie sich das trauen, was uns von klein auf verboten wurde.