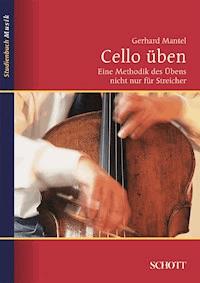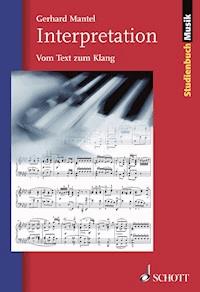Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schott Music
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Lampenfieber ...! Für viele Menschen ist dieser Begriff gleichbedeutend mit Angst, Lähmung, Bedrohung. Und manch hochbegabter Musiker hat aus diesem Grund seinen Berufswunsch als auftretender Künstler aufgegeben. Aber: Hat Lampenfieber nicht auch "seine guten Seiten?" Kann es gelingen, die lähmende Form des Lampenfiebers in eine positive Variante umzuwandeln? Gerhard Mantel nennt in seinem Buch Ursachen des Lampenfiebers und beschreibt Strategien zur Erlangung einer Podiumssicherheit - ohne Rückgriff auf "simple Tricks". Checklisten am Ende jedes Kapitels fassen die wichtigsten Aspekte zusammen. Ziel des Buches ist es "meine persönliche Art des Lampenfiebers - mein Lampenfieberprofil" besser zu verstehen und kreativ zu bewältigen. Die Instrumentalisierung des Lampenfiebers als einen künstlerischen Anreiz schafft Selbstbewusstsein und bessere Lebensqualität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lampenfieber …! Für viele Menschen ist dieser Zustand gleichbedeutend mit Nervosität und Angst. Manch hochbegabter Musiker gab aus diesem Grund schon seinen Berufswunsch als auftretender Künstler auf. Muss das wirklich sein? Oder kann es gelingen, die lähmende Form des Lampenfiebers in eine anspornende, ja inspirierende umzuwandeln?
Aus der Beschreibung der Ursachen des Lampenfiebers gewinnt der Autor mentale Strategien zu dessen Bewältigung bei öffentlichen Auftritten. Checklisten am Ende jedes Kapitels fassen die wichtigsten Aspekte zusammen. Ziel des Buches ist es, die jeweils persönliche Wirkungsweise des Lampenfiebers zu verstehen, das eigene »Lampenfieberprofil« zu erkennen und kreativ einzusetzen.
Gerhard Mantel (1930–2012), international erfahrener Cellist und Pädagoge, lehrte an der Musikhochschule Frankfurt und war Ehrenpräsident der deutschen Sektion der »European String Teachers Association« (ESTA). 1993 gründete er das Forschungsinstitut für Instrumental- und Gesangspädagogik e. V. und führte Kurse und Seminare im In- und Ausland durch. Weitere Veröffentlichungen bei Schott Music: »Cello üben«, »Einfach üben.185 unübliche Überezepte für Instrumentalisten«, »Intonation. Spielräume für Streicher« und »Interpretation. Vom Text zum Klang«.
Gerhard Mantel
Mut zum Lampenfieber
Mentale Strategien für Musiker zur Bewältigung von Auftritts- und Prüfungsangst
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Bestellnummer SDP 53
ISBN 978-3-7957-8601-4
© 2014 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Als Printausgabe erschienen unter der Bestellnummer SEM 8385
© 2008, 2013 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
www.schott-music.com
www.schott-buch.de
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung kopiert und in ein Netzwerk gestellt werden. Das gilt auch für Intranets von Schulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen.
Inhalt
Vorwort
Teil A: Das Phänomen Lampenfieber
I. Lampenfieber – warum?
1. Biologische Betrachtungen
2. Gründe – für das Musizieren und das Lampenfieber
3. Angst – Einbildung
4. Lampenfieber und dessen Folgen
5. Lampenfieber akzeptieren
II. Lampenfieber-Situationen
1. Lampenfieber – allein mit dem Publikum
2. Lampenfieber im Ensemble
3. Lampenfieber im Orchester
4. Lampenfieber für andere
III. Phasen des Lampenfiebers
1. Die Bedeutung des Lebensalters
2. Gewöhnung
3. Lampenfieberkurven
IV. Künstler und Hörer als System
1. „Moloch“ Publikum
2. Das einzelne Individuum
3. Was nimmt der Hörer wahr? – Interpretatorische Aspekte
3.1 Dynamik
3.2 Rhythmus und Zeitgestaltung
3.3 Das Zeitfenster
3.4 Tonansatz und Artikulation
3.5 Klangfarben
4. Langeweile oder Risiko?
5. Innen- und Außenwahrnehmung
Teil B: Die langfristige Vorbereitung des Auftritts
I. Die Verantwortung des Lehrers
1. Das „Richtig-falsch-Syndrom“
2. Selbstwertgefühl
3. Spieltechnik
4. Schamgefühl
5. Selbstständigkeit
6. Wettbewerb
7. Vorspielgelegenheiten
II. Mut
1. Mut zur eigenen Einrichtung eines Werks
2. Mut zum Ausdruck
3. Mut zur Mitteilung
4. Mut zur Einmaligkeit
5. Mut zur Charakterisierung
6. Mut zur Variation
7. Mut zur Dynamik
8. Mut zur freien Tempogestaltung
9. Mut zur Geste
10. Mut zur Übertreibung
11. Mut zur Improvisation
12. Mut zur Sprache
13. Mut zur Rolle
14. Mut zur Unabhängigkeit
III. Lernkanäle: Vielfachrepräsentation im Gehirn
1. Das motorische Gedächtnis
2. Das kognitive Gedächtnis
2.1 Notennamen
2.2 Intervalle
2.3 Notenbild
3. Das strukturelle Gedächtnis
4. Das semantisch-syntaktische Gedächtnis
5. Das emotionale Gedächtnis
IV. Überituale
V. Umgang mit Fehlern
1. Einstellung zum Fehler
2. „Fehlerfreundlichkeit“ und Perfektion
3. Absichtliche Fehler
4. Fehlerwiederholung und Einprägung
VI. Mentales Training
VII. Zeit und Raum
1. Zeitgestaltung
2. Pausen
3. Langsames Üben und Tempovarianten
4. Raum beanspruchen
VIII. Programmgestaltung
Teil C: Vor dem Konzert
I. Der Tag des Auftritts
1. Ausgeschlafen?
2. Kleidung
3. Arbeitswiderstand
4. Akustik, Beleuchtung – und mehr
5. Essen
6. Mitmenschen
7. Einspielen
8. Keine kurzfristigen Änderungen
9. Selbsteinschätzung
10. Keine negativen Selbstanweisungen
11. Das Ritual
11.1 Das Ritual und seine Regeln
11.2 Atemübungen
11.3 Die Bedeutung der Langsamkeit
11.4 Der Countdown
II. Der Gemütszustand vor dem Konzert
1. Wie übt man einen bewegten Zustand?
2. Gedanken schaffen Fakten
3. Geduld
4. Gegen den Kontrollzwang
5. Vertrauen – Misstrauen – Fehlertoleranz
6. Ablenkbarkeit
7. Medikamente
Teil D: Das Konzert
I. Auftreten
1. Haltung und Selbstbewusstsein
2. Spannung – Entspannung
3. Raumgefühl
4. Mimik und Gestik
II. Während des Spiels
1. Selbstlob
2. Die Macht des Musikers
3. Der Dialog mit dem Publikum
4. Lauschen
5. Sensibilisierungsbewegungen
6. Ausdrucksbewegungen
Schlussbemerkung
Anhang
Checkliste: Was ist bei einem Probespiel zu beachten?
Der Kenner
Literaturhinweise
Mensch zu sein bedeutet Angst zu haben.
(C. Arrau)
Angst ist das Schwindelgefühl der Freiheit.
(S.A. Kierkegaard)
Vorwort
Lampenfieber…! Für viele Menschen ist dieser Zustand gleichbedeutend mit Nervosität und Angst. In Umfragen bestätigen 70 Prozent aller Musikstudierenden, dass sie immer oder doch zeitweise Probleme mit dem Phänomen „Lampenfieber“ haben, und manch hoch begabter Musiker musste aus diesem Grund seinen Berufswunsch als auftretender Künstler aufgeben. Muss das wirklich sein?
Im vorliegenden Buch wird der Versuch unternommen, aus der Sicht des ausübenden Künstlers und des Pädagogen, der dem Lampenfieber in vielen Formen begegnet ist, Gründe aufzuzeigen und Methoden zum Umgang mit dem Lampenfieber, ja zu seiner Meisterung darzustellen. Es sollen Wege beschrieben werden, wie die lähmende, bedrohliche Form des Lampenfiebers in seine „anstachelnde“ Variante umgewandelt werden kann – wie ein „Anzünder“ bei einem Grillfeuer. Nicht jede Methode ist für jeden Menschen gleich wirksam, doch scheinen einige der angeführten Aspekte beim Lampenfieberempfinden und -verhalten fast aller Menschen eine Rolle zu spielen.
Das Buch soll nicht den Eindruck erwecken, als gäbe es ein paar billige und garantierte Tricks zur Überwindung des Lampenfiebers. Dafür ist Angst eine zu umfassende und zu tief verankerte Eigenschaft des Menschen. Jeder Mensch hat Angst. Angst zu haben ist keine Schande. Bei Bewerbungen zur Pilotenausbildung z. B. haben „angstfreie Draufgänger“ keinerlei Chancen. Angst hat eine zur jeweils eigenen Biographie gehörende ganz individuelle Ausprägung. Das Adrenalin bewirkt offensichtlich bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Reaktionen, die in ihrer milderen Ausprägung einen Anreiz, im stärkeren Fall lähmende Angst produzieren. In letzterem Fall ist Lampenfieber eine subjektive Überbewertung des Risikoaspekts gegenüber dem Anreizaspekt einer Herausforderung. (Die Angstform kann bei manchen Musikern sogar einen so hohen Grad erreichen, dass nur psychologisch-therapeutische Hilfe möglich und sinnvoll erscheint. In extremen Fällen sollte deshalb keine Scham bestehen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um schweren beruflichen und sozialen Schaden zu verhindern.)
Wir beschäftigen uns hier aus nahe liegenden Gründen in erster Linie also mit den leider so verbreiteten negativen, leistungshemmenden Wirkungen des Lampenfiebers. Denn die positiven Wirkungen bedürfen ja keiner speziellen Therapie; es reicht, wenn wir uns darüber freuen! Und da, wo wir uns darüber freuen können, sollten wir diese Freude als jederzeit verfügbare Erinnerung fest in unserem Gedächtnis verankern!
Die möglichen Strategien zur Meisterung des Lampenfiebers basieren ebenso wie die Angst auf biographischen Wurzeln – schädlichen wie nützlichen. Es steht also nicht die Frage im Vordergrund, wer warum wann wie viel Lampenfieber hat, sondern: Was kann ich als Individuum unternehmen, um meine ganz persönliche Art des Lampenfiebers, mein „Lampenfieberprofil“, besser zu verstehen und kreativ zu bewältigen?
Ein wichtiger Aspekt im vorliegenden Buch ist die gedankliche Aufarbeitung des Phänomens Lampenfieber. Gedanken sind Fakten und schaffen daher auch Fakten im emotionalen Bereich wie dem des Lampenfiebers. Eine Änderung des Blickwinkels, unter dem eine Konstellation – etwa ein Vorspiel, ein Probespiel oder ein Konzert, ja selbst ein Vortrag – gesehen wird, kann eine emotional und damit geradezu körperlich spürbare Erleichterung in einem Stresszustand wie dem des Lampenfiebers bewirken.
Es ist für jeden, der ins Rampenlicht tritt, eine tröstliche Tatsache, dass gerade die größten Musiker oft unter erheblichem Lampenfieber gelitten haben bzw. leiden und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb – kaum auf der Bühne angekommen – wunderbare künstlerische Leistungen vollbracht haben und vollbringen! Deshalb kann ich zu mir sagen: „Genau so fühlte sich Vladimir Horowitz oder Pablo Casals oder Svjatoslav Richter oder Dietrich Fischer-Dieskau vor jedem Konzert, wie ich mich vor diesem Auftritt heute fühle!“ Casals z. B. berichtete, dass ihm bei einem leichten Unfall, bei dem seine Hand minimal verletzt wurde, zunächst durch den Kopf schoss: „Nie mehr Lampenfieber!“ Erst der zweite Gedanke ließ ihn erschrecken: Er könnte vielleicht nicht mehr Cello spielen! – Ich habe also eine ganz tiefe, gefühlsmäßige Gemeinsamkeit mit diesen Künstlern. Ich bin nicht allein mit meinem Lampenfieber! Selbst wenn ich jetzt Svjatoslav Richter wäre, so hätte ich doch Lampenfieber.
Auch wenn nicht jeder ein großer gefeierter Podiumskünstler werden kann, mit oder ohne Lampenfieber, so bedeutet doch die Meisterung des Lampenfiebers, der „Sieg über das Lampenfieber“, ja seine Instrumentalisierung als künstlerischer Anreiz einen gewaltigen Schritt in Richtung eines größeren Selbstbewusstseins und damit einer höheren persönlichen Lebensqualität.
Ziel muss es also sein, die psychische Energie des Lampenfiebers von ihrer negativen Erscheinungsform (Angst als „Fluchtimpuls“) in positive Aktivität („Angriff“) umzumünzen. Dann erfahren wir das Lampenfieber sogar als Notwendigkeit für Höchstleistungen. In einem Zustand, in dem Lampenfieber vor einem Konzert völlig fehlt, kann es manchmal (z. B. bei einer Konzertreise, bei der die gleichen Programme oft wiederholt werden müssen) zu einem Zustand kommen, bei dem man sich sogar dringend „etwas mehr Lampenfieber“ wünscht – sonst fehlt der „Biss“. Artur Rubinstein erzählte, dass er für ein Konzert unbedingt ein bisschen Lampenfieber brauchte, sonst langweilte er sich und das Publikum.
Die in diesem Buch dargestellten Erfahrungen zum Lampenfieber kommen aus dem künstlerischen und pädagogischen Bereich eines Streichers. Einige Beispiele sind daher vielleicht etwas „streicherlastig“. Der kein Streichinstrument spielende Leser wird die Überlegungen unschwer übertragen und seine eigenen Erfahrungen ergänzen können.
Teil A: Das Phänomen Lampenfieber
I. Lampenfieber – warum?
1. Biologische Betrachtungen
Der Begriff Lampenfieber wird in unterschiedlicher Bedeutung gebraucht. Physiologisch gesehen ist Lampenfieber eine Form von Angst. Für diesen Zustand stellt unser Körper zusätzliche (psychische und körperliche) Energie bereit – durch eine erhöhte Ausschüttung von Adrenalin bei gleichzeitiger Herabsetzung der Großhirnaktivität, also des differenzierten Denkens. Angst ist Teil der genetischen Ausstattung jeder höheren Spezies; sie gehört zu mir nicht individuell, sondern zu mir als Mensch. Zum Überleben des „Tiers Mensch“ in gefährlichen Situationen stehen als Folge der Angst zwei Verhaltensalternativen zur Verfügung: Flucht und Angriff.
Der Psychologe und Angstforscher Gerald Hüther betrachtet Angst als die wichtigste Voraussetzung von Entwicklung überhaupt, auch im übergeordneten entwicklungstheroretischen Sinne. Er beschreibt sie als das verunsichernde Gefühl eines Lebewesens, für eine neu auftretende Situation im Gehirn nicht die geeigneten neuronalen Verschaltungsprogramme, d. h. Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu haben. Aus der Angst, nämlich diesem stark empfundenen Defizit heraus wächst dann die Suche nach geeigneteren Verschaltungen. So kann man Angst sogar als eine Bedingung für allgemeinen und persönlichen Fortschritt definieren. Angst ist in diesem Sinne ein zum Menschen gehörendes natürliches und für das Überleben notwendiges Gefühl. Es besteht also kein Grund, die Angst auch noch mit einem Schuldgefühl zu potenzieren. Niemand ist schuld an seiner Angst!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!