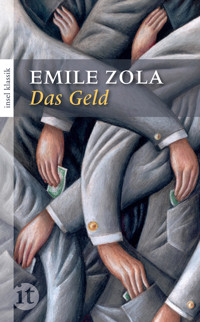Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Emile Zolas Werk 'Mutter Erde' ist ein bahnbrechender Roman, der die sozialen und politischen Probleme des 19. Jahrhunderts in Frankreich beleuchtet. Mit seinem naturalistischen Schreibstil porträtiert Zola das harte Leben von Bergarbeitern und deren Familien in den Minen der Provinz. Der Autor verwendet detaillierte Beschreibungen und realistische Dialoge, um die harten Arbeitsbedingungen und die Armut der Arbeiterklasse darzustellen. 'Mutter Erde' ist ein Meisterwerk des sozialen Realismus und ein wichtiger Beitrag zur französischen Literaturgeschichte. Emile Zola, bekannt für seine kritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen Missständen, setzt sich in diesem Roman mit Themen wie Arbeiterrechten, sozialer Ungerechtigkeit und der Ausbeutung natürlicher Ressourcen auseinander. Als Schriftsteller des Naturalismus hat Zola eine einzigartige Fähigkeit, realistische Szenarien zu schaffen, die den Leser zum Nachdenken anregen. 'Mutter Erde' ist ein fesselndes und erkenntnisreiches Buch, das die Leser dazu anregt, über die sozialen und politischen Probleme ihrer Zeit nachzudenken und die Menschlichkeit in einer harten Welt zu erkennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 843
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mutter Erde
Books
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil.
Erstes Kapitel.
Das Sätuch aus blauer Leinwand um den Leib gebunden, hielt Hans mit der Linken den Schlitz geöffnet; die Rechte schöpfte daraus alle drei Schritt eine Handvoll Getreide und schleuderte es in einem Bogen übers Feld. Die schweren Stiefel des Burschen stampften den Abdruck ihrer Sohlen in den Boden und schleppten das fette Erdreich mit sich fort; bei jedem Wurf aber schimmerten durch die regnende blonde Saat die roten Borten eines alten Soldatenrockes, den der Sämann trug. So schritt er mit wiegenden Körperbewegungen über den Acker; hinter ihm zog die doppeltbespannte Egge einher und verscharrte das Saatkorn. Mit regelmäßig wiederholtem Schwung knallte die Peitsche des Fuhrknechtes um die Köpfe der Rosse.
Das kaum an fünfzig Ar messende Stück Feld hatte Herrn Hourdequin, dem Besitzer der Borderie, nicht die Herführung seiner andernorts arbeitenden Sämaschine verlohnt. Hans, der jetzt von Süden nach Norden zu das Feld durchschritt, befand sich so den zwei Kilometer entfernten Gebäuden den Gutes gegenüber; an dem Grenzrain des Feldes rastete er einen Augenblick und warf einen Blick dort hinaus.
Es war ein bräunlicher Streifen schiefergedeckter Häuschen, der sich am Ausgang des Bezirkes Beauce in die nach Chartres sich erstreckende Ebene verlor. Zehn Meilen weit dehnte sich dort das Land unter dem weiten, bewölkten Oktoberhimmel; gelbe Stoppelfelder und frisch bestellte Äcker wechselten mit dem grünen Teppich des Klees; ohne Hügelung, ohne einen Baum dehnte sich die glatte Flur dahin und floß mit sanft abdachender Rundung bis hinter die Linie des Horizonts wie ein Meer. Nur gegen Westen grenzte ein rotbrauner Waldrand das Firmament ab. In der Mitte zog sich kreideweiß die von Chauteaudun nach Orleans führende Straße dahin, eine vier Meilen lange gerade Linie, eingesäumt von den in regelmäßigen Abständen errichteten Telegraphenstangen. Sonst nichts als drei, vier Windmühlen mit unbeweglichen Flügeln auf dem Gebälk. Einzelne Dörfer bildeten gleichsam steinerne Inseln. Weit hinten guckte wie aus einer Versenkung die Spitze eines Kirchturmes über die welligen Schollen.
Hans wandte sich um und lenkte seinen wiegenden Schritt wieder nach Süden; die Linke straffte das Sätuch, die säende Rechte teilte mit sausendem Hieb die Luft. Jetzt buchtete sich unmittelbar vor ihm gleich einer Grube das schmale Aigretal; dahinter wieder weitete sich die Beauce unabsehbar bis Orleans. Wie niedriges Buschwerk blickten die Wipfel einer Pappelallee gelbgrün über die Rundung des tieferen Gebietes; das am Hang lagernde Dörfchen Rognes schaute nur mit wenigen Giebeln hervor, und daneben ragte der altersgraue Kirchturm, den ein Volk Krähen umschwärmte. Im Osten jenseits des Loiretales, in dem zwei Meilen entfernt, sich Cloyes barg, der Hauptort des Bezirks, wölbten sich die bläulichen Hügelungen der Perche unter dem grauen Himmel. Man befand sich im ehemaligen Dunois, dem heutigen Kreise Chateaudun zwischen dem Perchelande und dem Beaucelande, ja am Saume des letzteren, an jener Stelle, wo die Gegend wegen der weniger fruchtbaren Felder die »lausige Beauce« genannt wird. Als Hans am Ende des Feldes angelangt war, hielt er abermals inne und warf einen Blick auf das Aigreflüßchen hinab, das hell und hurtig sich durch die Wiesen und Felder schlängelte neben der nach Cloyes führenden Straße, die jetzt mit Bauernkarren bedeckt war, welche zu Markte fuhren. Dann schritt er wieder das Feld hinan.
Immer mit den nämlichen Schritten und den nämlichen Bewegungen ging er von Norden nach Süden und von Süden nach Norden, in den lebenden Staub der Saat eingehüllt; während hinter ihm die Egge unter dem Peitschenknallen des Kutschers das Korn langsam, fast bedächtig in den Boden versenkte. Lange Regengüsse hatten den Herbstanbau verzögert; im August hatte man noch gedüngt, und die Felder standen seit langem bereit, tief aufgeackert, von allem Unkraut gesäubert, geeignet zum Getreidebau, nachdem sie im dreijährigen Wechsel Klee und Hafer gebracht hatten. Die Furcht vor den nahen Frösten, die nach den langen Regengüssen drohten, feuerte die Landwirte zu großer Eile an. Es war plötzlich ein kaltes, trübes, windstilles Wetter eingetreten von einem gleichmäßigen, düsteren Lichte über diesem unbeweglichen Feldermeer. Auf allen Seiten wurde gesät; links war noch ein Sämann in einer Entfernung von etwa dreihundert Metern und rechts ebenfalls einer noch etwas weiter entfernt; und noch andere und wieder andere verloren sich in der Ebene. Es waren kleine Schattenbilder, einfache, immer dünner werdende Striche in meilenweiter Entfernung. Alle machten dieselben Bewegungen, mit denen die Saat ausgestreut wurde, und die sich ausnahmen, wie eine Lebenswoge ringsumher. Die Ebene erbebte gleichsam bis in die verschwimmenden Fernen, wo die Sämänner nicht mehr zu unterscheiden waren.
Hans schritt zum letztenmal südwärts das Feld ab; da erblickte er eine große rotweiße Kuh, die von einem ganz jungen Mädchen am Strick geführt, von Rognes daherkam. Das Kind leitete sein Tier den Pfad entlang, der auf der Höhe am Rande des Tales dahinlief. Der Bursch aber drehte sich um; wie er jetzt an der Nordseite des Feldes seine Arbeit beendet hatte und im Begriff stand, das Sätuch abzubinden, um sich auf den Heimweg zu machen, hallte ein ängstlicher Schrei über den Saatacker. Hans hob den Blick und sah, wie die Kuh in wildem Galopp in ein Kleefeld stürmte, während die Kleine vergeblich bemüht war, sie zu halten. Er befürchtete ein Unglück und rief: »Laß sie doch los!«
Sie tat es nicht; keuchend trabte sie hinter der Kuh her und schrie mit einer Stimme, in die Zorn und Entsetzen sich mischten:
»Coliche! Steh, Coliche! ... Verwünschtes Vieh, willst du Ruh geben!«
Bisher hatte sie mit dem aufgeregten Tiere Schritt halten können; nun aber strauchelte sie, fiel, sprang noch einmal auf, stürzte wieder; jetzt schleifte das wütende Vieh sie hinter sich her. Das Kind kreischte laut auf.
»Laß sie doch los, mein Gott! Laß sie los!«
Hans wiederholte mechanisch diesen Ruf, während er ebenfalls über den Acker setzte; denn er hatte endlich begriffen: die Leine mußte sich am Handgelenk des Mädchen verschlungen haben. Flink rannte er quer übers Feld und stand so plötzlich vor der fliehenden Kuh, daß diese erschrocken ihren Lauf hemmte. Im Umsehen war der verhedderte Strick gelöst: der Bursch half dem Mädchen auf.
»Hast du dir nichts gebrochen?«
Aber sie hatte nicht einmal die Besinnung verloren. Sie erhob sich und befühlte ihre Glieder, hob ruhig ihre Röcke bis zu den Schenkeln empor, um ihre Knie zu betrachten, die ihr schmerzten, und sagte noch ganz atemlos:
»Sehen Sie, dort am Knie schmerzt es mich ... aber es macht nichts, ich kann das Bein bewegen ... Mir ist angst und bange geworden! ... Hätt' sie mich bis auf die Straße gezogen, ich wäre verloren gewesen!«
Die große Aufregung, die sie überstanden, ließ sie nicht recht zu Atem kommen; sie sprach in abgerissenen Sätzen. Jetzt untersuchte sie ihr rotumrandetes Handgelenk und benetzte es mit Speichel; dann fuhr sie nach einem tiefen Seufzer beruhigter fort:
»Die Coliche ist nicht bös, wissen Sie. Aber seit gestern macht sie uns viel zu schaffen. Sie will zum Stier, und darum bringe ich sie nach der Borderie.«
»Zur Borderie?« wiederholte Hans. »Das trifft sich gut: ich kehre grad heim, da kann ich dich begleiten.«
Er duzte sie: die schmächtige Dirne erschien ihm ein Kind trotz ihrer vierzehn Jahre. Sie blickte ernst zu ihm auf. Der kräftige Bursch mit dem kurz geschorenen, kastanienbraunen Haupthaar, mit dem vollen, regelmäßigen Gesicht war, ob er auch erst neunundzwanzig zählte, ein alter Mann ihr gegenüber.
»Ich kenne Sie, Sie sind Korporal, der Tischler, der sich bei Herrn Hourdequin als Knecht verdungen hat.«
Dieser ihm von den Bauern gegebene Beiname rief ein Lächeln bei ihm hervor. Er betrachtete jetzt seinerseits das junge Mädchen aufmerksam und war überrascht, sie entwickelter zu finden, als er vermutet hatte. Mit dem festen, kleinen Busen, dem länglichen Oval ihres Gesichtes, darin zwei schwarze, ungemein tiefe Augen glänzten, mit den frischen, rosigen Wangen sah sie durchaus keinem Kinde gleich. Sie trug einen grauen Rock und ein schwarzwollenes Leibchen; ihren Kopf schmückte eine runde Haube; Arme und Nacken waren goldbraun von der Sonne angehaucht.
»Aber bist du nicht die Jüngste von Papa Mouche?« fragte er plötzlich. »Richtig! ich habe dich nicht gleich erkannt! ... Nicht wahr, die Geliebte von Buteau, der im letzten Frühling mit mir in der Borderie arbeitete, ist deine Schwester?«
Sie erwiderte:
»Ja, ich bin Franziska ... Meine Schwester, die mit dem Vetter Buteau das Verhältnis gehabt, heißt Lise. Jetzt, nachdem er sie ins Unglück gestürzt und sie im sechsten Monat schwanger ist, ist er auf und davon; er dient in der Chamade nach Orgères zu.«
»Ja, ja,« bestätigte Hans. »Ich habe sie beisammen gesehen.«
Sie verstummten einen Augenblick. Er erinnerte sie lachend, wie er einst die Lise mit ihrem Schatz hinter einem Heuschober überrascht. Sie feuchtete immer noch ihr schmerzendes Handgelenk. Die Kuh graste im Klee; der Roßknecht fuhr seine Egge zur Landstraße hinaus; zwei Raben umschwebten mit krächzendem Rundflug den Kirchturm. Die drei Glockenschläge des Angelus hallten durch die ruhige Luft.
»Wie? schon Mittag?« rief Hans. »Da haben wir keine Zeit zu verlieren.« Mit einem Blick nach Coliche fügte er hinzu: »Und deine Kuh! Es könnte dir übel bekommen, wenn man sie sähe ... Wart', ich werd' dich naschen lehren!«
»Nein, laßt sie!« fiel sie ihm ins Wort. Dies Feld gehört uns! Das böse Ding hat mich auf eigenem Grund und Boden geschleift! ... Unsere Familie besitzt den ganzen Strich bis nach Rognes: wir haben das Stück hier, das daneben gehört Onkel Fouan, dann kommt meine Tante, die Große ...«
Sie wies ihm die einzelnen Parzellen mit der Hand; dabei führte sie die Kuh wieder auf den Steig hinaus. Erst jetzt, als sie das Tier von neuem furchtlos bei der Leine hielt, fiel es ihr ein, sich bei dem jungen Manne zu bedanken:
»Ohne Ihre Hilfe wär's mir übel ergangen vorhin. Ich dank' Ihnen, wissen Sie, ich dank' Ihnen von ganzem Herzen!«
Sie machten sich auf den Weg den schmalen Pfad entlang, der sich erst am Rande des Tales hinzieht und dann seitwärts zwischen den Feldern verläuft. Das Geläute der Gebetglocke war verstummt; nur die Raben krächzten immerfort. Mit der Kuh an dem straff gezerrten Seile voran schritten jetzt beide in dem wortlosen Schweigen dahin, in welchem die Landleute oft auf meilenweiter Wanderung nebeneinander verharren. Zur Rechten warfen sie einen Blick auf eine Sämaschine, deren Pferde dicht am Wege ihren Rundgang machten. Der fremde Knecht rief ihnen ein »Guten Tag« zu; sie gaben ein ernstes »Guten Tag!« zurück. Links auf der Landstraße zogen noch immer die Wagen der Bauern nach Cloyes, wo erst um ein Uhr der Markt beginnt. Auf ihren beiden Rädern holperten die Karren die Chaussee entlang, in der großen Entfernung einer Karawane hüpfender Insekten vergleichbar, und nur die weißen Hauben der Bäuerinnen blinkten herüber.
»Da ist mein Onkel Fouan mit Tante Rose!« rief Franziska plötzlich und deutete auf einen der Karren, der wie eine Nußschale groß in einer Entfernung von einem Kilometer die Straße dahinschaukelte. Sie fahren zum Notar.«
Sie besaß den scharfen Blick der Matrosen, dies den Bewohnern flacher Landstriche eigene, ungemein weitschauende Auge, das in dem kleinsten Punkte, der sich am Horizont bewegt, einen Menschen oder ein Tier zu erkennen vermag.
»Ach, richtig! ich hab' davon gehört,« versetzte Hans. »Also ist es entschieden? der Alte verteilt seine Habe zwischen der Tochter und den beiden Söhnen?«
»Ja, es ist bestimmt, heute kommen sie alle bei Herrn Baillehache zusammen.«
Sie blickte dem schwanken Fuhrwerk nach und setzte hinzu:
»Uns ist's egal, wir werden nicht fetter, nicht magerer davon ... Doch meiner Schwester wegen mag's gut sein; sie meint, Buteau heiratet sie vielleicht, wenn er seinen Anteil erhält ... Er hat immer gesagt, mit nichts kann man nicht Hochzeit machen.«
Hans lachte:
»Dieser verflixte Kerl, der Buteau! ... Wir waren Kameraden ... Der redet gar bald den Mädeln was vor! Er muß immer seine Bandeleien haben; er ist imstande und nimmt die Dirnen mit Gewalt, wenn er sie nicht anders bekommen kann.«
»Gewiß, er ist ein schlechter Kerl,« gab Franziska überzeugt zurück. »Man läßt nicht seine Base sitzen, nachdem man ihr den Bauch angefüllt hat.«
Sie brach ab und riß mit kräftigem Ruck die seitwärts zerrende Kuh auf den Weg zurück:
»Vorwärts, Coliche! ... Sie fängt schon wieder an; es ist nicht auszuhalten mit dem Vieh, wenn es mal wild wird.«
Jetzt lenkte der Steig seitwärts ein; sie verloren die Marktwagen aus dem Auge. Die flachen Gefilde weiteten sich nach rechts und links. Zwischen den frisch bestellten Äckern, den grünenden Kleewiesen strich der Pfad ohne eine Steigung, ohne Strauch und Baum dahin bis zum Gutshof, den man mit der Hand meinte berühren zu können, und der sich doch immer weiter in den aschgrauen Himmel zurückschob. Die beiden waren wieder verstummt; ohne ein einziges Wort zu wechseln, schritten sie fürbaß, als habe die ernste Landschaft der Beauce ihr Sinnen verdüstert.
Der Hof der Borderie war leer. Doch kaum hatte das Paar das große Viereck zwischen den Ställen, Scheunen und der Schäferei betreten, so erschien auf der Schwelle der Küche eine kleine, junge Frau mit keckem, hübschem Gesicht:
»Nun Hans, kommst du heute nicht zum Essen?«
»Gleich, Frau Jacqueline!«
Seit die Tochter Cognets, des Chausseearbeiters von Rognes, auf dem Bauerngut, wo die zwölfjährige »Cognette« einst als Geschirrwäscherin gedient, zum Range der Haushälterin und Geliebten des Herrn aufgestiegen war, verlangte sie, als Dame behandelt zu werden.
»Ah, du bist's, Franziska,« fing sie wieder an. »Du kommst wegen des Stieres. Da wart nur! Der Hirt ist mit Herrn Hourdequin in Cloyes, muß aber bald zurück sein.«
Hans wollte an ihr vorüber in die Küche treten; sie griff ihn lachend um den Leib, unbekümmert um die Kleine, die wohl wissen mochte, daß Frau Jacqueline sich nicht mit der Liebe des Bauern begnügte. Dann verschwanden die beiden im Hause.
Eine halbe Stunde später kam Hans wieder zum Vorschein und gesellte sich zu dem Mädchen. Er aß den Rest eines Butterbrotes und sagte, als er die Kuh unruhig mit dem Schweife um sich schlagen sah:
»Es ist verdrießlich, daß der Kuhhirt noch nicht zurückkommt.«
Franziska zuckte die Achseln. »Es hat keine Eile,« meinte sie. Dann fragte sie nach einem neuerlichen Schweigen:
»Also, Korporal, Sie heißen Hans schlechtweg?«
»Aber nein, Mans Macquart.«
»Sie sind nicht aus unserer Gegend?«
»Nein, ich bin Provençale aus Plassans, einem Städtchen dort unten.«
Erstaunt, daß man so weit her sein könne, hob sie das Köpfchen und blickte ihn an.
»Nach Solferino bin ich aus Italien zurückgekehrt; ein Kamerad nahm mich hierher mit, –das war vor achtzehn Monaten. Mein altes Gewerbe, die Tischlerei, gefiel mir nicht mehr, und dann hat es sich so gemacht, daß ich hier geblieben bin.«
»Ach!« versetzte sie und schaute ihn immer noch mit ihren großen Augen an. »Sonderbar!«
Doch die Coliche hörte mit ihrem brünstigen Gebrüll nicht auf, und man vernahm jetzt aus dem verschlossenen Stalle ein heiseres, rauhes Schnaufen.
»Aha, der vertrackte Stier Cäsar hat sie gehört ... Hörst du, er fängt drin schon zu reden an ... Der kennt sein Geschäft; kaum führt man eine Kuh in den Hof, wittert er schon die Sache und weiß, was man von ihm will.«
Nach kurzer Weile fuhr er fort:
»Es scheint, der Kuhhirt hat bei Herrn Hourdequin bleiben müssen. Wenn du willst, führe ich dir den Stier heraus, damit du nicht zweimal kommen mußt ... Wir beide werden mit der Sache auch fertig.«
»Ja, das ist ein guter Einfall,« sprach Franziska und erhob sich.
Er öffnete die Stalltüre und fragte das Mädchen noch: »Sollen wir die Kuh anbinden?«
»Anbinden? Nein ... sie ist bereit und wird sich nicht rühren.«
Durch die offene Tür des Stalles, wo die Kühe langsam ihr Futter fraßen, sah man in einer Ecke einen schwarzen, weißgefleckten Stier holländischer Rasse. Seines Dienstes gewärtig, streckte das Tier den Hals.
Als Cäsar losgebunden war, verließ er den Stall. Vor der Türe blieb er unter dem Eindrucke der freien Luft und des hellen Tageslichtes einen Augenblick stramm auf den Beinen stehen und peitschte ungeduldig mit dem Schwänze seine Flanken; sein Hals blähte sich auf und seine vorgestreckten Nüstern witterten. Die Coliche stand unbeweglich und wandte ihre großen, starren Augen nach ihm, wobei sie ein leiseres Brüllen vernehmen ließ. Da näherte sich der Stier, preßte sich an die Kuh und legte den Kopf auf ihre Croupe; seine Zunge hing heraus; er schob den Schwanz der Kuh beiseite und leckte sie ab bis zu den Schenkeln hinab. Die Kuh rührte sich nicht und ließ ihn gewähren; nur ihre Haut wurde von einem leichten Zittern gefaltet. Hans und Franziska standen mit ernsten Mienen und herabhängenden Händen da und warteten.
Als der Stier fertig war, bestieg er die Coliche mit einem plötzlichen Sprunge und mit einer mächtigen Wucht, daß der Erdboden erzitterte. Die Kuh hatte unter dem Anlauf sich nicht gerührt; der Stier hielt sie zwischen seinen beiden Beinen fest. Allein er war von kleinerer Rasse, und darum die Kuh zu hoch und zu breit für ihn, so daß er nicht ans Ziel gelangte. Als er dies sah, machte er eine vergebliche Anstrengung, höher zu steigen und näher heranzukommen.
»Er ist zu klein,« bemerkte Franziska.
»Ja, ein wenig,« erwiderte Hans; »aber das tut nichts; er wird doch hineingelangen.«
Sie schüttelte den Kopf; als der Stier weitere nutzlose Anstrengungen machte, faßte sie einen Entschluß.
»Wir müssen ihm helfen,« sprach sie. »Wenn er schlecht eindringt, wird sie es nicht behalten.«
Mit ruhiger und aufmerksamer Miene wie bei einem ernsten Geschäfte trat sie näher, erhob den Arm, ergriff mit voller Hand das Glied des Stieres, richtete es auf, stützte es und brachte es dem Ziele näher. Als der Stier spürte, daß er am Rande sei, sammelte er seine Kräfte und drang mit einer einzigen Anstrengung seiner Lenden voll hinein. Dann sprang er ab, daß der Boden erzitterte. Es war geschehen: die Kuh hatte, ohne sich zu rühren, die Befruchtung durch das Männchen empfangen.
Franziska ließ jetzt den Arm sinken und sprach:
»Das sitzt.«
»Ja und fest dazu,« bemerkte Hans zufrieden.
Er dachte nicht daran, einen jener saftigen Spaße zu machen, wie sie die Knechte des Hofes anzubringen pflegten zur Erheiterung der Mägde, die Kühe zum Belegen auf den Hof brachten. Die Kleine schien die Sache so einfach zu finden, daß nichts zu lachen war. Es war eben die Natur.
Seit einer Weile stand Jacqueline wieder auf der Türschwelle. Mit einem ihr eigentümlichen girrenden Tone rief sie der Gruppe die scherzenden Worte zu:
»Ei, überall die Hand dabei! Dein Liebhaber scheint an jenem Ende kein Auge zu haben!«
Hans brach in ein Gelächter aus, Franziska aber errötete tief. Während der Stier allein nach dem Stalle zurückkehrte und die Kuh am Rande der Düngergrube nach verlorenen Haferstrohhalmen suchte, kramte das Mädchen, um seine Verlegenheit zu verbergen, in seiner Tasche herum, zog ein Schnupftuch hervor, knüpfte die verknotete Ecke auf und nahm daraus vierzig Sous.
»Hier ist das Geld!« rief sie und reichte es der Frau. »Lebt wohl!«
Damit verließ sie samt ihrer Kuh den Hof. Hans ergriff sein Sätuch, erklärte Jacqueline, daß er den am Morgen von Herrn Hourdequin gegebenen Befehlen gemäß zum Poteau, einem benachbarten Ackerstrich hinübergehe und folgte dem Mädchen in dem schmalen Steige.
»Verliert euch nicht zusammen!« rief ihnen die kleine Frau scherzend nach. »Übrigens kennt die Kleine den richtigen Weg.«
Keines der beiden lachte; stillschweigend entfernten sie sich, man vernahm nur das Klappern ihrer Schuhe auf den Steinen des Weges. Sie schritt vor ihm dahin; er blickte auf ihren kindlich geformten Nacken und die kleinen schwarzen Löckchen, die unter ihrer Haube hervorschauten.
Nach vielleicht fünfzig Schritt sprach Franziska ruhig:
»Sie hat Unrecht, sich über andere aufzuhalten. Ich hätte ihr antworten können ...« Mit einem schelmischen Lächeln wandte sie sich zu dem jungen Mann herum: »Ist es nicht wahr, daß sie Herrn Hourdequin Hörner aufsetzt, als wenn sie bereits seine Frau wäre? ... Sie wissen es vielleicht am allerbesten!«
Er ward verlegen und versuchte, harmlos zu tun:
»Sie macht, was ihr beliebt; es ist ihre Sache.«
Franziska setzte ihren Weg fort:
»Das ist richtig ... Ich scherze nur, denn ... unter uns beiden ... Sie könnten ja mein Vater sein ... Aber sehen Sie, seit Buteau sich so schlecht mit meiner Schwester aufgeführt hat, habe ich mir geschworen, daß ich mich lieber in Stücke zerschneiden lasse, ehe ich einen Liebhaber nehme.«
Er nickte. Schweigend gelangten sie zum Poteau. Das kleine Feld lag unterhalb des Fußpfades auf der Hälfte des Weges nach Rognes. Die Egge stand bereit, ein Sack Saatkorn lag daneben.
»Also, leb wohl!« rief Hans dem Mädel nach und begann, sein Sätuch zu füllen.
»Leben Sie wohl!« gab sie zurück. »Und noch mal, schönen Dank!« Aber ihm fiel etwas ein.
»Hör, wenn Coliche vielleicht wieder anfängt? ... Soll ich dich nicht lieber heimgeleiten?«
Sie war schon weit, drehte sich um und rief mit ihrer klaren Stimme über den stillen Acker:
»Nicht nötig, sie hat jetzt genug und gibt schon Ruh.«
Hans begann mit dem Sätuch um den Leib wieder, beim Fall der regnenden Körner sein Feld abzuschreiten. Dabei schaute er dem Mädchen nach, das hinter dem wiegenden Körper der rotweißen Kuh zwischen den Äckern dahinstrich. Als er Kehrt machte, verlor er sie aus dem Auge; doch wie er wieder das Feld herabkam, gewahrte er sie von neuem; sie erschien jetzt ganz winzig in der großen Entfernung mit ihrem schlanken Wuchs und dem weißen Häubchen einer Löwenzahnblume vergleichbar. Dreimal fand er sie so wieder, dann suchte er vergeblich: sie mochte bei der Kirche seitwärts abgebogen sein.
Es schlug zwei Uhr. Der Himmel blieb grau, dumpf, kalt; Häuflein feiner Asche schienen die Sonne auf Monate hinaus bis zum Frühjahr vergraben zu haben. In dieser Düsterheit war ein hellerer Fleck nach Orleans zu, als ob dort irgendwo, in meilenweiter Entfernung die Sonne wieder ihren Glanz gezeigt habe. Von diesem fahlen Ausschnitt am Horizont hob sich der Kirchturm von Rognes ab, während das Dorf selbst in der unsichtbaren Erdfalte des Aigretales lag. Im Norden nach Chartres zu hatte die flache Linie des Horizontes die Deutlichkeit eines durch eine Tuschzeichnung gehenden Tintenstriches bewahrt zwischen der grauen Einförmigkeit des weiten Himmels und der endlos sich dahinziehenden Ebene der Beauce.
Seit Mittag schien die Zahl der Säleute sich vermehrt zu haben; jetzt hatte jedes noch so kleine Fleckchen Ackerland den seinen. Gleich tätigen schwarzen Ameisen entwuchsen sie der Flur, alle dem neben ihren winzigen Gestalten übergroß scheinenden Werk sich widmend, alle mit derselben eigensinnig wiederholten Bewegung des Armes; ein Heer von Insekten im siegreichen Kampfe gegen die Mutter Erde.
Bis Abend säte Hans. Nach dem Felde von Poteau begann er das von Rigoles und vom Vierweg. Er kam, er ging mit seinem gleichmäßigen Schritt; das Korn verschwand aus dem Sätuch; hinter ihm befruchtete die Saat die Erde.
Zweites Kapitel.
Die Wohnung des Herrn Baillehache, Notars in Cloyes, lag in der Grouaisestraße links, wenn man nach Chateaudun zu geht. Es war ein einstöckiges, weißes Häuschen, an dessen Ecke die Blechscheide eingemauert war, durch welche das Seil der einzigen, diese Gasse überspannenden Laterne lief. Der breite, gepflasterte Weg war öde in der Woche; nur Sonnabends belebte ihn das Volk der zu Markte kommenden Bauern. Schon aus weiter Entfernung blickten aus der kreidehellen Reihe der niedrigen Gebäude die beiden ovalen Amtsschilder hervor. Hinter dem Hause zog sich ein schmaler Garten bis zum Loir hinab.
An jenem Samstag saß der jüngste Schreiber, ein fünfzehnjähriger, blasser Mensch, am Fenster des rechts von der Treppe gelegenen Büros und blickte hinter dem Musselinvorhang den Leuten in der Gasse nach. Die beiden andern Schreiber, ein wohlbeleibter älterer Mann von schmierigem Aussehen und ein gelbsüchtiges, hageres Wesen arbeiteten an einem doppelten, schwarzgestrichenen Pult, das nebst sieben oder acht Stühlen das ganze Mobiliar des unfreundlichen Raumes ausmachte. Es war noch ein gußeiserner Ofen da, der aber nur im Dezember geheizt wurde. Die Schriftenfächer an den Wänden und die in den Ecken angebrachten grünen Fächer, aus denen vergilbte Akten hervorschauten, atmeten einen Geruch von alter Tinte und von staubmoderndem Papier.
Zwei Bauersleute, Mann und Weib, saßen unbeweglich, respektvoll wartend, nebeneinander. Die vielen Schriftstücke, die sie hier sahen und vor allem die so eilfertig über das Papier kratzenden Federn der Beamten verschüchterten sie und regten allerhand Vorstellungen von Prozessen und von Geld in ihnen an. Die Frau war vierunddreißig Jahre alt; eine große Nase entstellte ihre sonst angenehmen Züge. Sie hielt die knochigen Arbeitshände über der samtverbrämten Tuchjacke gekreuzt; ihre lebhaften Augen durchforschten jeden Winkel des Gemachs; sie grübelte über die zahllosen Besitzurkunden nach, die hier beieinander lagen. Der fünf Jahre ältere Mann in schwarzen Beinkleidern und einer ganz neuen Bluse hielt seinen runden Filz auf den Knien. In dem braunroten, frischrasierten Gesicht spiegelte sich kein Gedanke; die großen blauen Puppenaugen schauten starr und leer gleich dem Blick wiederkäuender Rinder.
Eine Tür öffnete sich. Herr Baillehache, der eben mit seinem Schwager, dem Farmer Hourdequin, gefrühstückt, erschien auf der Schwelle. Das eingenommene Mahl hatte sein Gesicht gerötet, was dem Fünfundfünfzigjährigen ein frisches Aussehen gab. Er hatte fleischige Lippen; die in kleine Fältchen gekräuselten Lider verliehen ihm einen ewig lächelnden Blick. Er trug einen Kneifer; seine Hand streichelte unaufhörlich den langen, ergrauten Backenbart.
»Ach, ihr seid's, Delhomme,« rief er. »Papa Fouan hat sich also zur Teilung entschlossen?«
Die Frau antwortete ihm:
»So ist es, Herr Baillehache ... Wir kommen alle zusammen, um einig zu werden über die Bedingungen, und damit Sie uns sagen, was wir tun sollen.«
»Gut, gut, Fanny, wir werden schon sehen ... Es ist kaum ein Uhr; wir müssen die anderen erwarten.«
Der Notar plauderte noch einen Augenblick, Delhomme mit der freundschaftlichen Wertschätzung behandelnd, auf die ein Bauer, der an zwanzig Hektar Land besaß, der einen Knecht und drei Kühe hielt, Anspruch hatte. Er fragte ihn nach den Preisen des Getreides, die seit zwei Monaten gesunken waren. Dann zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück.
Die Schreiber hatten, ohne den Blick zu erheben, noch lauter und hastiger die Feder übers Papier gejagt. Die Delhommes warteten von neuem unbeweglich und stumm.
Es war ein Glück für Fanny gewesen, daß sie ein ehrenhafter und reicher Liebhaber, von dem sie nicht einmal vorher ein Kind gehabt, zur Frau genommen, trotzdem sie von ihrem Vater, dem alten Fouan, nicht mehr als ungefähr drei Hektar zu erhoffen hatte. Übrigens bereute ihr Gatte seine Wahl nicht, denn er hätte keine gescheitere und rührigere Hausfrau finden können. Darum auch ließ sich der etwas beschränkte, aber ruhige und rechtliche Mann, der in Rognes bei manchem Bauernstreit zum Schiedsrichter gewählt wurde, in allem und jedem von seinem Weibe leiten.
Der jüngste Schreiber, der immer noch hinter den Vorhängen auf die Gasse hinablugte, kicherte plötzlich in die Faust und raunte seinem Nachbar, dem schmutzigen Alten zu:
»Jesus kommt!«
Hastig bog sich Fanny zu Delhomme hinüber und flüsterte ihm ins Ohr:
»Weißt du, laß mich nur machen ... Ich hab' Vater und Mutter sehr gern, aber ich will nicht, daß sie uns übervorteilen; auch vor Buteau und vor dieser Kanaille Hyacinth müssen wir auf der Hut sein.«
Sie meinte ihre Brüder. Durchs Fenster hatte sie den Ältesten kommen sehen. Es war Hyacinth, im ganzen Lande unter dem Beinamen Jesus bekannt: ein Tagedieb und Säufer, der nach seiner Rückkunft aus den afrikanischen Feldzügen jede Arbeit floh und von Wilddieberei und Brandschatzung lebte nicht anders, als beute er noch heute ein Volk zitternder Beduinen aus.
Es trat ein stark gebauter, muskulöser Vierziger ein mit ungepflegtem, in eine Spitze zulaufendem, langem Barte und gelocktem Haar. Er hatte einen Christuskopf; doch seine Züge waren verroht und mahnten gleichzeitig an einen Wegelagerer, an einen Strolch der schlimmsten Art. Seit früh morgens trieb er sich in dem Städtchen herum; er war volltrunken, hatte beschmutzte Beinkleider, eine mit Flecken bedeckte Bluse; seine zerrissene Mütze war bis ins Genick zurückgeschoben. Er rauchte eine feuchte schwarze Sou-Zigarre, welche die Luft verpestete. In seinen verschleierten schönen Augen blitzte ein derber Humor; ein Blick, der verriet, daß der heruntergekommene Patron ein im Grunde nicht böses und nicht jeder bessern Regung verschlossenes Herz besaß.
»Der Vater und die Mutter sind noch nicht da?« ließ er sich vernehmen.
Nachdem der gelbsüchtige Schreiber ihm mit unwirschem Kopfschütteln geantwortet, sah er einen Augenblick stumm auf die Wand, während die Zigarre in seiner Hand qualmte. Mit keiner Silbe begrüßte er Schwager und Schwester, die ihrerseits nicht die geringste Notiz von ihm genommen. Ohne ein Wort hinzuzusetzen, verließ er endlich das Zimmer, um vor dem Hause die Ankunft der anderen Familienmitglieder abzuwarten.
»Dieser Jesus! Dieser Jesus!« brummte der Kleine, bei dem dieser Name die Erinnerung an allerhand Streiche zu wecken schien.
Doch kaum fünf Minuten waren verstrichen, als die Fouans erschienen, zwei alte Leute mit langsamem, bedächtigem Gebaren. Der Vater, einst ein kräftiger Mann, war heute in seinem siebzigsten Jahre so eingetrocknet und zusammengeschrumpft durch ein Leben überharter Arbeit und maßloser Gier nach dem Erwerb von Grund und Boden, daß er vollständig gebückt einherging, als sei er bereits im Begriff, zu der Erde zurückzukehren, nach deren Besitz er so gegeizt hatte. Übrigens war es mit Ausnahme seiner siechen Beine noch ziemlich gesund, auch hatte er ein achtenswertes Aussehen mit seinem weißen, kurzgestutzten Backenbart und der großen Nase, die das magere, wie in Leder gefurchte Antlitz spitzte. Wie sein Schatten, gleichsam an seine Sohle geheftet, stand die Alte neben ihm. Sie war kleiner, rund und fett; ein Ansatz von Wassersucht schwellte ihren Leib; aus dem hafergelben Gesicht blickten zwei runde Augen, und eine Unzahl von Falten und Fältchen umzog den runden Mund gleich der Börse eines Geizhalses. Ihr stumpfer Sinn hatte sie in der Ehe zu einem gefügigen Arbeitstier verurteilt, das gewohnt war, vor der harten Faust des Gatten zu zittern.
»Ah, da seid ihr!« rief Fanny und erhob sich.
Delhomme war ebenfalls aufgestanden; hinter den Alten trat jetzt Jesus wieder in das Büro. Schweigend wiegte er sich in den Hüften, zerdrückte das Feuer seiner Zigarre und schob den übel riechenden Stummel in eine Tasche der Bluse.
»Da sind wir ja beisammen,« sagte Fouan. »Es fehlt nur Buteau ... Niemals pünktlich, immer anders als alle anderen, dieser Mensch!«
»Ich hab' ihn auf dem Markte gesehen,« erklärte Jesus mit rauher Branntweinstimme. »Er wird kommen.«
Buteau, der Jüngste, verdankte diesen Beinamen seinem eigensinnigen Schädel, der mit niemandem gemeinsame Sache machen, stets seine besonderen Wege gehen wollte. Schon als Knabe hatte er sich nicht mit den Eltern vertragen können; nachdem er sich vom Militär freigelost, verließ er das elterliche Gehöft und verdingte sich zuerst in der Borderie, danach in der Chamade.
Während der Vater noch schalt, trat er munter und guter Dinge in die Amtsstube. Die große Nase der Fouans hatte sich bei dem siebenundzwanzigjährigen Burschen platt gedrückt; dafür wuchsen mächtige Kinnladen aus seinem Gesicht hervor, während wieder die Schläfe und der ganze obere Teil des Kopfes zurücktraten. Aus seinen grauen lachenden Augen blickten List und Heftigkeit; er hatte mit seinem Vater die Habgier gemein und das zähe Festklammern an erworbenem Besitz, das durch den von der Mutter ererbten Geiz noch verschärft wurde. Stellten ihn die alten Leute wegen seines Wesens zur Rede, so pflegte er zu antworten: Warum habt ihr mich so gemacht? »Hört mal,« warf er in das Murren der andern ein, »es, sind fünf Meilen von Chamade nach Cloyes. Und dann, was wollt ihr eigentlich? Ich komme ja fast mit euch zugleich ... Soll die Hetzerei schon wieder angehen?«
Jetzt fielen alle aufeinander los, schrien sich an mit ihren an die freie Luft gewöhnten, durchdringenden Stimmen, stritten und schimpften, als seien sie bei sich zu Hause. Der Lärm hinderte die Schreiber bei der Arbeit, und sie warfen ärgerliche Blicke zu ihnen herüber. Doch der Notar öffnete, durch den Wortwechsel angelockt, die Seitentür.
»Seid ihr alle beisammen? So kommt herein!«
Das Arbeitszimmer schaute auf den schmalen Gartenstreif, der bis zu den blätterlosen Pappeln am Rande des Loire hinabstieg. Auf dem Kamin stand zwischen Aktenbündeln eine Stockuhr in schwarzem Marmor; ein Mahagonipult, ein Schriftenfach, mehrere Stühle bildeten die Ausstattung des Raumes.
Herr Baillehache hatte sich ohne weiteres wie der Präsident eines Gerichtshofes auf dem Polsterstuhl an seinem Schreibtisch niedergelassen. Die Bauern schoben sich hintereinander in das Zimmer; dann schielten sie zögernd zur Seite, weil sie nicht wußten, wo und wie sie sich setzen sollten.
»Nehmt Platz!«
Von den anderen vorgedrängt, gelangten Fouan und Rose zu den beiden vordersten Sesseln; Fanny und Delhomme nahmen ebenfalls eines neben dem andern die nächsten Sitze ein, während Buteau sich abseits stellte und Hyacinth aufrecht am Fenster lehnte, so daß seine breiten Schultern den Raum verdunkelten.
»Setzt euch doch, Jesus!« ermunterte ihn der Notar ungeduldig. Dann ging er auf den Gegenstand der Zusammenkunft über: »Also, Papa Fouan, Ihr habt Euch entschieden, Eure Habe bei Lebzeiten unter Eure beiden Söhne und Eure Tochter zu verteilen?«
Der Alte antwortete nicht. Die anderen blieben unbeweglich, wie in Stein gehauen. Es herrschte tiefes Schweigen. Der Notar, an die Schwerfälligkeit seiner Klienten gewöhnt, drängte nicht. Seit zweihundertfünfzig Jahren vererbte sich die Notariatskanzlei in seiner Familie von Vater auf Sohn; die überlegende Denkschwere der bäuerlichen Kundschaft, dieses versteckte Vonhinterherumkommen, das die geringste Erörterung in lange Pausen und in einen überflüssigen Wortschwall ertränkt, war den Baillehaches in Fleisch und Blut übergegangen. Er nahm ein Messer und schnitt seine Nägel.
»Nicht wahr, es scheint, Ihr seid entschlossen?« wiederholte er endlich und blickte den Alten fest an.
Der Angeredete sah sich um, schaute die Mitglieder der Familie an, dann versetzte er, mühsam die Worte suchend:
»Ja, es ist wohl möglich, Herr Baillehache ... Ich hatte Ihnen zur Erntezeit davon gesprochen ... Sie sagten mir, ich solle mir's noch überlegen ... ich hab' überlegt und seh', daß wir's doch wohl so machen müssen.«
In abgerissener, fortwährend unterbrochener Rede erklärte er, warum. Doch was er nicht aussprach, was man nur aus der großen Bewegung heraushörte, die er gewaltsam in sich zurückdrängte, das war die unendliche Bekümmernis, das waren der verbissene Groll, der sein Herz zerfleischende Schmerz, sich von diesem Gute trennen zu müssen, das er vor dem Tode seines Vaters so heiß ersehnt, das er später mit so hartnäckiger Mühe bebaut, mit einem sich selbst abtötenden Geize Stück um Stück vermehrt hatte. Jeder Strich Acker war mit monatelangem Darben bei Käse und Brot erkauft, mit frostigen Wintertagen in ungeheizter Wohnung, mit übermenschlicher Fronarbeit in brennender Sonnenglut, ohne Rast, ohne andere Labung als einen Trunk Wasser. Er hatte die Mutter Erde geliebt wie ein Weib, das uns das Herzblut aussaugt und für das man zu töten imstande ist. Ihm hatten nicht Frau und Kind gegolten, kein Freund, kein menschliches Wesen: nur die Erde! Jetzt war er alt geworden und mußte im rasenden Schmerze über sein Unvermögen diesen Schatz seinen Kindern abtreten, wie er ihn einst von seinem Vater übernommen.
»Sehen Sie, Herr Baillehache, man muß sich fügen ... die Beine wollen nicht mehr vorwärts, die Arme sind nicht viel besser, und das Land leidet darunter ... Es wär' noch eine Weile gegangen, wenn man sich mit den Kindern verständigt hätte.
Er warf einen Blick zu Buteau und Jesus hinüber, die ins Leere starrten, als vernähmen sie kein Wort von dem, was der Vater sprach.
»Aber, was soll ich tun? Soll ich Knechte aufnehmen, Fremde, die mich bestehlen? Nein, das frißt einem den Verdienst vom Munde weg, wie heut die Verhältnisse sind ... Ich kann nicht mehr! Denken Sie, von den neunzehn Sester, die ich besitze, hab ich heuer knapp den vierten Teil zu bestellen vermocht, gerade genug, um Brot zu schaffen für uns und Heu für die beiden Kühe ... Es geht nicht mehr ... Es bricht mir das Herz, das gute Land so verderben zu sehen; lieber will ich alles hergeben als zuschauen, wie es zugrunde geht.«
Seine Stimme versiegte; ein tiefer Seufzer voll Schmerz und Entsagung hob ihm die Brust. Die durch ein halbes Jahrhundert in Gehorsam und Arbeit verschüchterte Frau horchte wortlos seiner Rede.
»Letzthin,« fuhr er fort, »ist Rose beim Käsemachen ohnmächtig zusammengestürzt. Wenn ich nur zum Markte fahre, tun mir alle Glieder weh ... Man kann die Erde nicht mitnehmen, wenn man stirbt ... Man muß sie hergeben, es hilft nichts ... Wir haben genug gearbeitet und wollen in Frieden unsere Tage beschließen ... Nicht wahr, Rose?«
»Gewiß, das ist der Grund, so wahr der liebe Gott uns hier sitzen sieht,« bestätigte die Alte.
Eine neue Pause trat ein. Der Notar putzte noch an seinen Nägeln herum; dann legte er das Messer auf den Schreibtisch und sagte:
»Ja, das sind Gründe, die eine Schenkung erklären ... Ich füge hinzu, daß sie für die Familie eine Ersparnis bedeutet; denn die Abgaben an den Staat sind beträchtlicher bei einer Erbschaft, als bei einer Teilung zu Lebzeiten.«
»Ist das wahr, Herr Baillehache?« fragte Buteau, seine angenommene Gleichgültigkeit vergessend.
»Zweifelsohne. Ihr gewinnt ein paar hundert Franken dabei.«
Auch die anderen wurden bei diesen Worten lebhaft; selbst Delhommes Züge erhellten sich, und die beiden Alten teilten ebenfalls die allgemeine Genugtuung. Sobald es weniger kostete, mußte die Sache gut sein, das unterlag keinem Zweifel.
»Es bleibt nur noch übrig,« nahm der Notar wieder das Wort, »euch die Erwägungen vorzutragen, die solch ein Fall geboten erscheinen läßt. Viele tüchtige Männer tadeln die Übertragung des Vermögens an die Familie zu Lebzeiten der Eltern; sie nennen sie ein Vergehen gegen die allgemeine Moral, weil, wie sie behaupten, dadurch die Bande der Familie gelockert werden ... Man kann in der Tat beklagenswerte Beispiele anführen, könnte von Kindern sprechen, die sich sehr ungebührlich benehmen gegen die Eltern, die sich zu jener Vorteil alles Besitzes entäußern.«
Die beiden Söhne und die Tochter horchten offenen Mundes mit unwillkürlichem Zucken ihrer Lider.
»Papa soll alles behalten, wenn er kein Vertrauen hat,« warf Fanny empfindlich drein.
»Wir sind immer auf dem Wege der Pflicht geblieben,« rief Buteau.
»Und scheuen uns nicht vor der Arbeit,« schloß Jesus.
Mit einer Armbewegung erbat Herr Baillehache Schweigen.
»Laßt mich doch ausreden! Ich weiß, daß ihr gute Kinder und tüchtige Arbeiter seid; bei euch kann, des bin ich gewiß, der Befürchtung kein Raum gegeben werden, daß eure Eltern eines Tages bereuen sollten, was sie heute zu tun im Begriffe stehen.«
Er sprach es ohne die mindeste Anzüglichkeit, wiederholte einfach die liebenswürdige Redensart, die eine fünfundzwanzigjährige Tätigkeit auf seiner Zunge abgerundet. Doch die Mutter ließ, obwohl es geschienen, als fasse sie kaum die gesprochenen Worte, ihre umrunzelten kleinen Augen über die Tochter und die beiden Söhne gleiten. Ohne ein Gefühl der Zärtlichkeit hatte sie die drei aufgezogen, hatte keine Stunde zu berechnen vergessen, wieviel sie verzehrten von dem, was sie ersparte. Gegen den Jüngsten hegte sie einen nie verwundenen Groll, weil er das Elternhaus verlassen, sobald er für den Verdienst arbeiten konnte. Mit ihrer Tochter hatte sie sich niemals verstanden: sie war in dieser ihrem eigenen Fleisch und Blut begegnet, sah ein rühriges Geschöpf sich entwickeln, das der vom Vater überkommene Verstand stolz und herrschsüchtig machte. Der Blick der alten Frau entwölkte sich erst, wie er jetzt auf ihrem Ältesten ruhte, diesem Taugenichts, der weder mit ihr, noch mit dem Vater etwas gemein hatte, der wie wildes Unkraut zwischen ihnen aufgewachsen war und den sie vielleicht deshalb entschuldigte und vorzog.
Auch Fouan betrachtete seine Kinder eines nach dem andern mit dem grübelnden Gedanken in seinem forschenden Auge, was sie wohl mit seiner Habe anfangen würden. Die Faulheit des Ältesten beunruhigte ihn weniger als die habsüchtige Begehrlichkeit der beiden andern. Doch er schüttelte sein wackelndes Haupt: wozu sich sorgen? er konnte sich doch nicht anders helfen!
»Nachdem also die Teilung beschlossen ist,« griff der Notar wieder zum Wort, »handelt es sich darum, die Bedingungen festzusetzen. Seid ihr eins über die Höhe der Lebensrente?«
Mit einem Schlage verstummten alle und verharrten von neuem in unbeweglicher Ruhe. Ihre gerbharten Gesichter bekamen einen starren Ausdruck, etwas von dem undurchdringlichen Ernst von Diplomaten, die ein Königreich abschätzen. Dann schielten sie mit lauernden Seitenblicken eines zum andern hinüber; immer hatte noch niemand geantwortet. Endlich stand der Vater dem Notar Rede:
»Nein, Herr Baillehache, wir haben noch nichts darüber gesprochen; wir wollten es lassen, bis wir alle hier bei Ihnen zusammen wären ... Aber, nicht wahr, es ist sehr einfach? Ich habe neunzehn Sester oder neunundeinhalbes Hektar, wie man heute sagt. Würde ich es verpachten, so machte es, das Hektar zu hundert Franken gerechnet, neunhundertfünfzig Franken ...«
Buteau, der leidenschaftlichste von allen sprang auf:
»Wie? hundert Franken das Hektar! Hast du uns zum besten, Vater?«
Es entwickelte sich eine ernste Auseinandersetzung. Da war zunächst ein Sester Weingarten; das, ja, das könnte man mit fünfzig Franken verpachten. Doch würde man jemals diesen Preis für die zwölf Sester Feld bekommen oder gar für die Sester Naturwiese am Aigreufer, deren Heu nichts wert ist? Ist doch selbst der Ackerboden nicht von besonderer Güte, zumal der Streif am Rand der Anhöhe; denn je näher man dem Tal kommt, um so schwächer wird die Ackerkrume.
»Höre, Vater,« meinte Fanny vorwurfsvoll, »du mußt uns nicht übervorteilen wollen.
»Mein Grund ist hundert Franken wert,« wiederholte der Greis hartnäckig und schlug sich mit der Hand auf den Schenkel. »Ich kann ihn morgen für hundert Franken verpachten, wenn ich will ... Was meint denn ihr, welchen Preis er gilt? Laßt mal hören, was ist er wert nach eurer Ansicht?«
»Sechzig Franken,« erklärte Buteau.
Fouan geriet in Zorn. Heftig verteidigte er seine Schätzung, lobte in übertriebenen Worten den Boden: ein Land, auf dem das Korn ganz von selbst wächst ... Plötzlich schnitt Delhomme, der bisher geschwiegen, die wortreiche Rede ab:
»Das ist achtzig Franken wert,« versicherte er mit seiner ehrlich tönenden Rede, »nicht einen Sou mehr noch weniger.«
Sofort beruhigte sich der Alte:
»Gut, sagen wir achtzig; ich will gern für meine Kinder ein Opfer bringen.«
Doch Rose zupfte ihn an der Bluse; ihr knausernder Geiz verlangte das Wort. »Nein, nein!« stieß sie hervor.
Jesus hatte sich nicht an der Auseinandersetzung beteiligt. Seit seinem fünfjährigen Aufenthalt in Afrika lag ihm nichts mehr am Besitz von Grund und Boden. Ihm kams nur einzig und allein darauf an, so rasch wie möglich seinen Anteil zu erhalten, gleichgültig, wie er ausfiel, um daraus Geld schlagen zu können. Mit spöttisch überlegenem Blick wiegte er sich hin und her.
»Ich habe gesagt, achtzig!« schrie Fouan, »es bleibt bei achtzig! Ich habe nie in meinem Leben mein Wort widerrufen, so wahr mir Gott helfen soll! ... Neunundeinhalb Hektar, haltet mal ... das macht ... siebenhundertsechzig Franken, in runder Zahl achthundert. Gut, die Rente soll achthundert Franken betragen: so ist es gerecht.«
Buteau schlug ein schallendes Gelächter auf, während Fanny mit verdutztem Blick den Kopf schüttelte. Herr Baillehache aber, der während des Wortwechsels leeren Auges zum Fenster hinausgeschaut hatte, wandte sich wieder zu den Anwesenden. Mit einer mechanischen Bewegung streichelte er den Bart und streckte sich in der müden Schlaffheit der Verdauung auf dem Sofa.
Zwar war es klar, der Alte hatte diesmal Recht. Doch hingerissen von dem leidenschaftlichen Verlangen, den Handel zu ihrem größtmöglichsten Vorteil zu schließen, ereiferten sich seine Kinder, fluchten, schworen, logen, feilschten wie Bauern, die ein Schwein kaufen.
»Achthundert Franken!« spöttelte Buteau. »Sie möchten wohl wie Bürgersleut' leben? ... Achthundert Franken! das ist für vier genug! Sagen Sie doch lieber gleich, daß Sie sich auf unsere Kosten zuschanden fressen wollen!«
Fouan wurde nicht böse. Er fand dieses Feilschen natürlich, war darauf vorbereitet gewesen und begnügte sich, ruhig standzuhalten; gleichzeitig aber reizte dieser Wortstreit auch seine Kampflust auf, und er rückte mit den übrigen Forderungen ins Feld:
»Das ist nicht alles; halt! ... Wir werden selbstredend bis zu unserem Tode das Haus und den Garten bewohnen ... Ferner: da wir nichts mehr ernten und die beiden Kühe nicht mehr halten, verlangen wir jährlich ein Stückfaß Wein, hundert Bund Holz, dann wöchentlich zehn Liter Milch, ein Dutzend Eier und drei Käse.«
»O, Papa! o Papa!« seufzte Fanny ganz niedergeschmettert.
Buteau sprach nicht mehr; mit einem Satze sprang er von seinem Stuhle empor und durchmaß heftig fuchtelnd das Zimmer, während er gleichzeitig seine Mütze aufsetzte, als wolle er fortgehen. Jesus war ebenfalls aufgestanden; ihn beunruhigte der Gedanke, daß diese Streitereien die Schenkung rückgängig machen könnten. Nur Delhomme allein blieb ruhig; einen Finger an die Nase gelegt, saß er da, ein Bild tiefer Überlegung und großen Verdrusses.
Jetzt meinte Herr Baillehache die Sache etwas beschleunigen zu sollen. Er schüttelte seine Trägheit ab und strich den Bart.
»Wißt ihr, Freunde, das Altenteil, bestehend aus Wein, Holz, Käse und Eiern ist üblich ...«
Doch heftig fielen die andern ein:
»Eier mit jungen Hühnern darin vielleicht!«
»Trinken wir etwa unsern Wein! Wir verkaufen ihn!«
»Nichts arbeiten und sich gütlich tun, das ist bequem; wir können uns schinden derweil.«
Der Notar, der schon schlimmeres gehört hatte, fuhr ruhig fort:
»Das alles sind unnütze Redereien ... Saperlot! Jesus, setzt Euch doch, Ihr verdunkelt das Zimmer, das ist ja lästig! ... Also es bleibt dabei, nicht wahr, ihr alle? Ihr gebt das Altenteil, denn sonst würde man mit Fingern auf euch zeigen ... Wir haben nur noch die Höhe der Rente zu bestimmen.«
Endlich gab jetzt Delhomme ein Zeichen, daß er zu sprechen verlange. Jeder nahm wieder seinen Platz ein; alle verstummten, und inmitten der allgemeinen Aufmerksamkeit begann der Schwiegersohn langsam:
»Entschuldigt! was der Vater verlangt, scheint gerecht; man könnte ihm achthundert Franken zahlen, weil er für seinen Grund achthundert Franken Pacht bekommen würde ... Aber wir beurteilen es anders. Er verpachtet uns das Land nicht, er tritt es uns ab, gibt es uns zum Eigentum; wir müssen also überschlagen, wieviel brauchen Vater und Mutter zum Leben ... Das werden wir ihnen zahlen; nicht mehr, als sie zu ihrem Unterhalt bedürfen.«
»In der Tat,« bekräftigte der Notar, »es ist dies gemeinhin die Grundlage, auf welcher die Rente berechnet wird.«
Ein neuer Streit setzte ein. Das Leben der beiden Alten wurde in seine Bestandteile zerlegt; ihre Bedürfnisse wurden einzeln in Erwägung gezogen. Man wog das Brot, das Gemüse und Fleisch ab, schätzte die Ausgabe für Bekleidung, wobei Linnen- und Wollstoff in zähem Hin- und Herfeilschen auf das niedrigste Maß heruntergesetzt wurden. Selbst die kleinen Nebenausgaben mußten erörtert werden: die zwei Sous Tabak für den alten Mann wurden nach endlosem Wortgefecht auf einen Sou verringert. Wenn man nicht arbeitet, muß man sich einzuschränken wissen. Kann die Mutter nicht ihren schwarzen Kaffee aufgeben? Ist es nötig, daß der Hund noch gefüttert wird, ein alter zwölfjähriger Köter, der ohne den geringsten Nutzen eine Menge Nahrung verschlingt? Schon längst hätte man ihm eine Gnadenkugel geben sollen.
Nachdem alles durchgerechnet worden, fingen sie wieder von vorne an, suchten heraus, was man noch weglassen könne: zwei Hemden, sechs Taschentücher fürs Jahr weniger. Die für den Gebrauch an Zucker ausgesetzte Summe verringerte man um täglich einen Centime. So zog man aufs sorgfältigste alle Ersparnisse in Betracht, beschnitt jede Ziffer wieder und wieder; endlich gelangten sie zu der Gesamtsumme von fünfhundertundfünfzig Franken, einem Ergebnis, das die Kinder unbefriedigt ließ, denn sie wollten um keinen Preis mehr bewilligen als rund fünfhundert.
Doch Fanny wurde des Haderns müde. Sie war im Grunde kein schlechtes Kind; die rauhe Feldluft hatte ihr Haut und Herz noch nicht so hart ausgedorrt wie den Männern; sie wollte einlenken. Jesus seinerseits zuckte die Achseln; er war nicht kleinlich in Geldsachen; es rührte sich in der Brust des Trunkenboldes sogar etwas wie Mitleid, und er war drauf und dran, den Eltern aus Eigenem eine Extravergütung anzubieten, die er allerdings vermutlich niemals bezahlt haben würde.
»Also hört!« bat die Tochter, »sagen wir fünfhundertfünfzig, ists euch recht?«
»Aber ja, ja!« versetzte Hyazinth, »die Alten müssen sich doch auch hie und da was gönnen.«
Die Mutter warf ihrem Ältesten einen zärtlichen Blick zu, während der Vater mit Buteau den Kampf fortsetzte. Er hatte nur Schritt für Schritt nachgegeben, hatte sich gegen jede Verringerung der Summe gewehrt und sich mit hartnäckiger Zähigkeit an gewisse Ziffern geklammert. Unter der kalten Starre seines Widerstandes begann in ihm ein mächtiger Zorn aufzulodern über seine Kinder, dies Fleisch von seinem Fleische, das ihm das Blut aussaugen wollte. Er vergaß, daß er ebenso mit seinem eigenen Vater verfahren. Seine Hände begannen zu zittern, er fluchte:
»Verwünschte Brut! Das hat man aufgezogen, und das nimmt einem jetzt das Brot von dem Munde weg ... Es ist gemein! Man möchte lieber schon faulen in der Erde als solch einem Frevel zuschauen ... Also ihr wollt so schlecht sein, wollt nicht mehr hergeben als fünfhundertfünfzig?«
Er war im Begriff, diese Summe anzunehmen, aber seine Frau zog ihn von neuem an der Bluse und keuchte:
»Nein! Nein!«
»Wir sind noch nicht zu Ende,« nahm Buteau wieder das Wort, nachdem er einen Augenblick gezögert. Was ist mit dem, was du beiseite gelegt hast? ... Wenn du Ersparnisse besitzt, brauchst du unser Geld nicht, scheint mir.«
Er hatte diesen Trumpf bis zum Schluß aufgehoben; fest blickte er seinen Vater an. Der alte Mann war sehr blaß geworden.
»Welches Geld?« fragte er.
»Nun, das Geld, das du angelegt hast, und wovon du die Scheine bei dir zu Hause verwahrst.«
Buteau mutmaßte diesen Schatz nur; er hätte sich gern Gewißheit verschafft. Eines Abends war es ihm so vorgekommen, als habe sein Vater hinter einem Spiegel eine Rolle hervorgezogen; die folgenden Tage paßte er auf; doch es war umsonst, das Papier kehrte nicht wieder ins Versteck zurück.
Fouans eben noch bleiches Gesicht aber überzog jetzt eine dunkle Röte. Sein verhaltener Unwille brach hervor; er sprang auf und schrie:
»Zum Teufel! Jetzt sucht ihr schon in meinen Taschen! Ich habe nicht einen Sou gespart, nicht einen Liard, daß ihrs wißt! Ihr Bande habt mich zu viel gekostet ...Aber geht's euch denn überhaupt etwas an? Bin ich nicht der Herr, der Vater?«
Er schien förmlich zu wachsen in diesem Erwachen seiner Autorität. All die Jahre hatten seine Frau, seine Kinder, die ganze Sippe vor dem eisernen Willen des Familienoberhauptes gezittert; sie irrten, wenn sie meinten, es sei bereits zu Ende mit ihm.
»Papa!« wollte Buteau spötteln.
»Schweig! Himmel, Kreuz ...« donnerte der Alte mit drohender Faust ... »Schweig! oder ich schlag drein!«
Der Sohn verlor die Sprache und schrumpfte auf seinem Stuhle zusammen. Er hatte die Ohrfeige des Alten in der Luft gefühlt; die Knabenfurcht seiner Kinderjahre dämmerte wieder in ihm auf, unwillkürlich hob er den Arm, um den Schlag des Vaters zu parieren.
»Und du, Hyazinth, tu nicht so, als wenn's hier was zum Lachen gibt! ... Schau mich nicht so keck an, Fanny! ... So wahr uns die Sonne bescheint, ich werd' euch kirre machen!«
Hochaufgerichtet stand er mitten unter ihnen; keines der Kinder muckste sich, bezwungen ließen sie die Köpfe hängen, während die Mutter wie ein Espenlaub zitterte, als fürchte sie, einer der angedrohten Fausthiebe könne sich bis zu ihr verirren.
»Jetzt hört: ich verlange, daß meine Pension sechshundert Franken betragen soll, oder ich verkaufe mein Land und stifte mir damit eine Leibrente. Jawohl, eine Leibrente, damit ich alles bis zum letzten Liard verzehren kann und euch nicht ein Pfifferling bleibt ... Gebt ihr die sechshundert Franken?«
»Aber Papa,« murmelte Fanny, »wir geben, was du verlangst.«
»Gut, sechshundert Franken,« bestätigte Delhomme.
»Ich,« erklärte Jesus, »ich will, was die anderen wollen.«
Buteau hielt den Mund grollend geschlossen, schien aber durch Schweigen seine Zustimmung auszudrücken.
Fouan schaute sie alle noch einmal mit herrischem Blicke an, dann setzte er sich:
»Also, wir sind einverstanden,« sagte er.
Herr Baillehache hatte schläfrigen Auges und unbeweglich die Schlichtung des Streites abgewartet. Jetzt hob er die Wimper und sagte ruhig:
»Seid ihr eins? Gut! ... Ich kenne jetzt die Bedingungen und werde den Schenkungsakt aufsetzen ... Ihr laßt den Feldmesser kommen; er soll die drei Anteile ausmessen und mir eine Beschreibung bringen. Sobald ihr dann die Parzellen ausgelost habt, setze ich hinter jeden Namen die gezogene Nummer, und wir unterschreiben.
Er hatte sich erhoben zum Zeichen, daß die Zusammenkunft beendet sei. Doch keiner bewegte sich vom Flecke; sie zögerten, überlegten. War es wirklich zu Ende? war nichts vergessen? Hatten sie nicht einen schlechten Handel geschlossen, den es noch Zeit war, rückgängig zu machen?
Es schlug vier Uhr; seit drei Stunden waren sie hier versammelt.
»Also geht! Andere warten!«
Sie mußten sich zum Aufbruch entschließen; der Notar drängte sie ins Nebenzimmer, wo in der Tat einige Bauern unbeweglich und steif auf ihren Stühlen warteten, während der kleine Schreiber durchs Fenster ein paar Hunden zuschaute, die sich auf der Gasse rauften, und die beiden anderen Beamten immer noch mit hastenden Federn das gestempelte Papier bekritzelten.
Vor dem Hause blieb die Familie einen Augenblick regungslos mitten auf der Straße.
»Wenn ihr wollt,« schlug der Vater vor, »nehmen wir die Ausmessung übermorgen vor, Montag.«
Sie nickten zustimmend, dann gingen sie, ein paar Schritte voneinander getrennt, die Grouaise-Straße hinab.
Der alte Fouan und Rose bogen in die Temple-Straße ein; dann entfernten sich Fanny und Delhomme durch die Große Gasse. Buteau hemmte auf dem Sankt-Lubin-Platz seinen Schritt und grübelte darüber nach, ob der Vater eigentlich Geld besitze oder nicht. Jesus war jetzt allein; er zündete seinen Zigarrenstummel an; dann trat er in das Cafe »Zum wackeren Landmann«.
Drittes Kapitel.
Das Haus der Fouans lag am Eingang des Dorfes Rognes unmittelbar an der von Cloyes nach Bazoches-le-Doyen führenden Straße. Als der Alte am Montag früh morgens um sieben Uhr in die Türe trat, um sich zum Treffpunkt bei der Kirche zu begeben, stand seine Schwester, »die Große«, trotz ihrer achtzig Jahre, bereits auf der Schwelle ihres nebenanliegenden Häuschens.
Die Fouans lebten seit Jahrhunderten in dem Orte. Ehemals Hörige der Rognes-Bouqueval, eines Adelsstammes, von dessen einstigem Ansehen nur noch spärliche Reste eines zerstörten Schlosses zeugten, mochten sie unter Philipp dem Schönen freigegeben sein. Danach wurden sie Grundbesitzer, indem sie einen oder vielleicht zwei Morgen Land, die sie zehnmal schon mit Schweiß und Blut bezahlt, ihrem Herrn abkauften, als er sich gerade in Geldverlegenheit befand. Dann begann der lange Kampf, um diesen Besitz zu festigen und zu mehren; ein vierhundertjähriges leidenschaftliches Ringen, das sich von den Vätern auf die Sohne fortgesetzt. Flecken Acker wurden verloren und wieder erworben; der ganze Grund stand unzähligemal in Frage; gewaltige Steuern drohten die Hinterlassenschaft der Eltern in den Händen der Kinder zu zerschmelzen. Dennoch gelang es dem hartnäckigen Besitzhunger der Leute, nach und nach die Äcker und Wiesen zu vergrößern. Geschlecht auf Geschlecht verblutete in diesem Kampf, ihr Schweiß düngte die Erde. Als die Revolution von 1789 heranbrach, besaß der damalige Fouan, Namens Joseph-Casimir, einundzwanzig Morgen Land, welche die Familie durch vierhundertjährige Anstrengung dem ehemaligen Herrengut abgerungen.
Im Jahre 1793 war dieser Joseph-Casimir siebenundzwanzig Jahre alt. Als die von der Grafschaft übriggebliebenen Ländereien zum Volkseigentum erklärt und auf dem Wege öffentlicher Versteigerung verkauft wurden, war es sein heißester Wunsch, ein paar Hektar dieser Gründe zu erwerben. Die Rognes-Bouqueval waren verschuldet und ruiniert, ihr Schloß war zerfallen, und seit langer Zeit schon befand sich die Farm Borderie in den Händen der Gläubiger, die drei Viertel des Grund und Bodens brachliegen ließen. Neben einem von Casimirs Äckern lag ein großes Stück Feld, nach dem der Bauer ein besonders heftiges Verlangen trug. Aber die Ernten waren schlecht gewesen; er besaß kaum hundert Taler Ersparnisse, die er in einem Topf hinter dem Herde verwahrt hielt; und wenn ihm auch einen Augenblick der Gedanke gekommen war, bei einem Geldleiher von Cloyes ein Anlehen zu machen, hielt ihn doch seine besorgte Vorsicht davon zurück. Dies adelige Gut flößte ihm überdies eine geheime Scheu ein; wer weiß, ob die Edelleute es nicht eines Tages zurückforderten? So zwischen Sehnen und Furcht hin und her schwankend, erlebte er den großen Schmerz, daß die Borderie bei der Versteigerung, Parzelle nach Parzelle, um den fünften Teil ihres Wertes von einem Bürger von Chateaudun, Isidor Hourdequin, einem früheren Beamten des Salzsteueramtes, erstanden wurde.
An seinem Lebensabende verteilte Joseph-Casimir die einundzwanzig Morgen zu gleichen Teilen an drei Kinder: Marianne und die Söhne Ludwig und Michel, während seine zweite Tochter Laura, welche die Näherei erlernt hatte und in Ghateaudun in einem Geschäfte arbeitete, mit Geld entschädigt wurde. Spätere Heiraten hoben die Besitzgleichheit zwischen den drei beteiligten Geschwistern wieder auf. Während Marianne Fouan, die »Große« genannt, einen Nachbar Anton Pechard ehelichte, der ungefähr achtzehn Morgen besaß, heiratete Michel Fouan, »Mouche« mit Beinamen, ein Mädchen, dem sein Vater nur zwei Äcker Weingarten hinterließ. Ludwig Fouan hinwiederum nahm Rose Maliverne zum Weib und bekam mit ihr zwölf Morgen mit, so daß er also die neunundeinenhalben Hektar Land vereinigte, die er jetzt seinerseits unter seine Kinder zu teilen im Begriff stand.
Die Große wurde in der Familie nicht nur wegen ihres höheren Alters, sondern besonders ihres Vermögens halber von allen geachtet. Grad und hoch gewachsen, mager und knochig, trug sie, einem Raubvogel vergleichbar, einen fleischlosen Schädel auf einem langen, welken und blutroten Halse. Die große Familiennase war bei ihr zu einer Art schnabelförmigem Haken gebogen; sie hatte runde, stiere Augen und besaß kein einziges Haar mehr unter dem gelben Kopftuch, das sie niemals ablegte; hatte aber dafür noch alle ihre Zähne, ein furchtbares Gebiß, das befähigt schien, von Kieselsteinen zu leben. Sie hielt stets in der erhobenen Rechten einen Stecken, womit sie auf Vieh und Menschen losschlug. Frühzeitig Witwe geworden, verstieß sie das einzige, ihrer Ehe entsprossene Kind, eine Tochter, weil diese gegen ihren Willen einen armen Burschen, Vinzenz Bouteroue, geheiratet. Selbst jetzt, nachdem die beiden im Elend gestorben waren, vermochte sie nicht zu verzeihen und ließ ihre Enkelkinder, die zweiunddreißigjährige Palmyre und den vierundzwanzigjährigen Hilarion in Not verkommen, ohne nur zu erlauben, daß man ihrer in ihrer Gegenwart Erwähnung tat. Seit dem Tode ihres Gatten leitete sie in Person die Bestellung ihrer Liegenschaften; hielt drei Kühe, ein Schwein und einen Knecht, die sie am gemeinsamen Spülichtfaß nährte, und die ihr alle mit zitternder Furcht gehorchten.
Als Fouan die Schwester unter ihrer Türe erblickte, trat er grüßend hinzu. Sie war zehn Jahre älter als er; ihre Härte, ihr Geiz, ihr halsstarriges Festhalten am Besitz und am Leben zwangen ihm dieselbe Achtung und Bewunderung ab, welche das ganze Dorf der Alten zollte.
»Soeben wollte ich zu dir, Große, um dir die Sache mitzuteilen: Ich hab' mich entschlossen, ich geh' hinauf wegen der Schenkung.«
Sie fuchtelte mit ihrem Stocke durch die Luft, ohne zu antworten.
»Letzthin wollte ich dich noch mal um Rat fragen; aber ich habe angeklopft, und niemand antwortete.«
Jetzt brach sie mit ihrer keifenden Stimme los:
»Dummkopf! ... Ich hab' dir Rat genug gegeben! Man muß gar feig sein und viehdumm, um auf sein Eigentum Verzicht zu leisten, solange man lebt! Ich würde, und wenn man mich umbrächte, nein sagen bis zum letzten Atemzuge ... In anderen Händen sehen, was einem selbst gehört, sich vor die Tür setzen, den Bankerten zulieb! o nein! o nein!«
»Aber,« versetzte Fouan, »wenn man nicht mehr arbeiten kann, und wenn das Land darunter leidet ...«
»Soll's leiden!... Eh' ich ein Ar davon hergäbe, ginge ich jeden Morgen hinaus und schaute zu, wie die Disteln darauf wachsen!«
Sie richtete sich noch höher vor ihm auf und reckte den Hals wie ein alter Geier, der die Federn verloren; und mit dem Stock auf seine Schultern tappend, wie um ihm recht gründlich ihre Worte einzuprägen, rief sie:
»Hör' es und merk's dir: Wenn du gar nichts mehr hast und deine Kinder alles, so werden sie dir selbst einen Bissen Brot verweigern, und du kannst mit einem Bettelsack herumziehen wie ein Lump ... Aber laß dir nicht einfallen, dann etwa an meine Tür zu klopfen; ich hab' dich gewarnt, dir geschieht recht ... Weißt du, was ich täte, wenn du zu mir kämst, he? Willst du's wissen?«
Ruhig und unterwürfig wartete er. Sie aber trat ins Haus, warf die Türe dröhnend hinter sich ins Schloß, indem sie kreischte:
»Das würde ich tun! Krepier' auf der Straße!«
Fouan blieb einen Augenblick unbeweglich vor dieser geschlossenen Türe; dann zuckte er ergeben die Achseln und begann den Fußweg zur Kirche emporzusteigen. Gerade dort stand das alte Stammhaus der Fouans, das sein Bruder Michel, genannt »Mouche«, als Erbteil erhalten, während das Haus, das er selbst unten an der Straße bewohnte, ihm von seiner Frau überkommen war. Mouche war seit Jahren verwitwet und lebte allein mit seinen beiden Töchtern, Lise und Franziska. Verbittert gegen das Geschick, mit fortwährender Reue seiner armen Heirat gedenkend, warf er noch heute nach vierzig Jahren Bruder und Schwester vor, daß sie ihn bei der Verteilung des väterlichen Gutes übers Ohr gehauen. Jedem, der es hören wollte, erzählte er ausführlich, wie ihm die Geschwister bei der Verlosung das schlechteste Los übriggelassen; eine Behauptung, die schließlich wahr geworden schien, denn Mouche war sein Lebtag ein so arbeitsunlustiger Stänkerer gewesen, daß sein Anteil im Laufe der Jahre die Hälfte des Wertes eingebüßt hatte. Der Mann macht die Erde, sagt man in der Beauce.