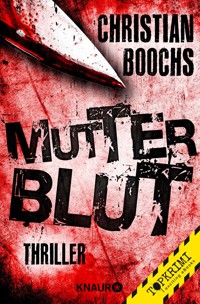
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein brutaler Serienkiller und ein Fall, der persönlich wird: Mordermittler Demski gerät in diesem haarsträubenden Thriller an seine Grenzen. Seit der spektakulären Festnahme eines Serienmörders vor fast zehn Jahren ist Mordermittler Torsten Demski in der Region als erfolgreicher Serienkillerjäger bekannt. Was man von außen jedoch nicht sieht: Er hat mit persönlichen Dämonen, chronischen Rückenschmerzen und Eheproblemen zu kämpfen. Als die grausam entstellte Leiche einer Schwangeren auftaucht, stürzt er sich daher kopfüber in die Ermittlungen, während seine Gesundheit leidet und er sich weiter und weiter von seiner Frau entfremdet. Zusammen mit seinem Partner Frank Theißen und seinem Team muss er den wahnsinnigen Täter schnappen, bevor dieser erneut zuschlägt. Denn wenn Demski den Mörder nicht aufhält, hört dieser mit dem Töten nicht mehr auf. Und das nächste Opfer ist bereits auserkoren ... »Mutterblut« von Christian Boochs ist ein eBook von Topkrimi – exciting eBooks. Das Zuhause für spannende, aufregende, nervenzerreißende Krimis und Thriller. Mehr eBooks findest du auf Facebook. Werde Teil unserer Community und entdecke jede Woche neue Fälle, Crime und Nervenkitzel zum Top-Preis!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Christian Boochs
Mutterblut
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein brutaler Serienkiller und ein Fall, der persönlich wird: Mordermittler Demski gerät in diesem haarsträubenden Thriller an seine Grenzen.
Seit der spektakulären Festnahme eines Serienmörders vor fast zehn Jahren ist Mordermittler Torsten Demski in der Region als erfolgreicher Serienkillerjäger bekannt. Was man von außen jedoch nicht sieht: Er hat mit persönlichen Dämonen, chronischen Rückenschmerzen und Eheproblemen zu kämpfen.
Als die grausam entstellte Leiche einer Schwangeren auftaucht, stürzt er sich daher kopfüber in die Ermittlungen, während seine Gesundheit leidet und er sich weiter und weiter von seiner Frau entfremdet.
Zusammen mit seinem Partner Frank Theißen und seinem Team muss er den wahnsinnigen Täter schnappen, bevor dieser erneut zuschlägt. Denn wenn Demski den Mörder nicht aufhält, hört dieser mit dem Töten nicht mehr auf. Und das nächste Opfer ist bereits auserkoren …
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 1
Wo du bist …«
Seine Stimme hallt dumpf von den gefliesten Wänden wider. Es ist dunkel. Nur das nervöse Flackern unzähliger Teelichte sorgt für etwas Licht.
»Wo du bist …«
Seine Finger schließen sich fester um den Griff seines Messers. Die klamme Kühle bereitet ihm Gänsehaut. Die Härchen an seinem Rücken, auf den Armen und im Nacken richten sich auf.
»Wo du bist, kann ich nicht …«
Er bringt sein Gesicht ganz nah an den Spiegel. Seine Nasenspitze berührt kaum die kalte, glatte Oberfläche. Aber er sieht nicht hin.
»Wo du bist, kann ich nicht sein.«
Ein Tropfen seines Speichels klebt an seiner Unterlippe. Hastig fährt seine Zunge darüber. Die rechte Hand, die das Messer hält, zittert leicht.
»Wo du bist, kann ich nicht sein.«
Er grinst. Sein linker Mundwinkel zuckt. Er legt den Kopf schräg, reißt die Hand mit dem Messer hoch, hält sich die Klinge an den Hals.
»Kann ich nicht atmen.«
Er schluckt. Sein Kehlkopf ruckt auf und ab.
Er spürt seinen Puls, das stetige Pochen in seiner Schlagader. Alle Muskeln sind angespannt. Langsam fokussiert sich sein Blick. Er sieht hin. In den Spiegel. Betrachtet seine Halsschlagader. Das Schlagen. Pulsieren. Nicht höher. Nicht ins Gesicht. Nur auf das Blutgefäß, den Puls. Das Messer.
»Ich kann nicht …«
Die Schneide ist kalt. Erbarmungslos, hart. Der Edelstahl drückt tief in seine Haut. Er atmet schwer. Das Geräusch seiner Atmung füllt seine Existenz aus. Das Zittern der Hand nimmt zu.
Die Gesichtsmuskeln zucken heftig.
Der Spiegel beschlägt. Mit jedem Atemstoß ein wenig mehr.
»Wo du bist …«, sagt er, und er sagt es noch mal. »Wo du bist, kann ich nicht atmen. Ich kann nicht atmen!«
Er setzt das Messer ab, lässt die Hand sinken, öffnet die Finger. Er vernimmt metallisches Klirren, als die Klinge auf den Fliesenboden prallt.
In einem langen Zug stößt er alle Luft aus seinen Lungen. Er stützt sich mit seinen Händen am Waschbecken ab, starrt ins Leere.
Die Kerzen flackern.
Sein Kopf ruckt herum. Sein Blick findet den Eimer. Es ist ein einfacher Eimer aus Plastik, mit Deckel. Matt. Grauschwarz.
Er strafft die Schultern, wendet sich von Becken und Spiegel ab. Langsam geht er hinüber zu dem Eimer. Die Fliesen sind kalt unter seinen Fußsohlen, und mit jedem Schritt scheinen sie feuchter zu werden. Jeden Schritt ein wenig mehr als vorher.
Er kniet neben dem Eimer, greift nach dem Deckel.
Er reißt ihn herunter. Wasser schwappt über den Rand und nässt den Boden.
Einige Herzschläge lang starrt er in den Eimer.
Dann greift er hinein, packt das nasse Bündel, das still im Wasser liegt, nimmt es heraus.
Er hält es hoch.
Das graue Fell ist durch und durch nass. Das Wasser läuft heraus, plätschert zurück in den Eimer und auch daneben.
Sie. Es ist eine … Sie.
Sie zuckt nicht mehr, rührt sich nicht mehr. Macht keinen Mucks. Sie ist kalt, ein wenig steif.
»Wo du bist, kann ich nicht sein. Kann ich nicht atmen.«
Die linke Hand tastet blind die nassen Fliesen ab. Seine Finger finden rasch, wonach er sucht.
»Miezi« atmet nicht mehr.
Er hält sie hoch, wie eine Trophäe. Er betrachtet sie von allen Seiten. Jetzt ist sie seinem Gesicht so nah wie vorhin der Spiegel. Er lächelt. Seine Lippen zittern nur noch wenig.
»Und wo ich bin, kannst du nicht sein.«
Dann setzt er die Klinge an.
Kapitel 2
Das Badezimmer sieht aus wie ein Schlachthaus.
Er schneidet den toten Körper von dem Haken an der Duschkabine, packt die Überreste in einen schwarzen Müllbeutel.
Er hasst es, hinterher aufräumen zu müssen.
Die Plastiktüte legt er neben die Tür.
Er dreht das Wasser am Waschbecken auf. Das Rauschen füllt den Raum, dehnt sich scheinbar noch weiter aus.
Unter fließendem Wasser reinigt er das Messer, wäscht das Blut und die feinen Fasern herunter. Gewebe. Fett. Fleisch.
Er wäscht das Blut von seinen Händen, seinen Armen. Er hantiert an den Wasserhähnen herum, wartet, bis das Wasser etwas wärmer ist. Er wäscht sich zwischen den Beinen. Auch wenn es ihm unangenehm ist.
Dann geht er den einen Schritt hinüber zur Dusche, nimmt den Brausekopf in die Hand und richtet den Wasserstrahl auf den Boden.
Abwesend sieht er zu, wie das Wasser das Blut mit sich nimmt und in den Ablauf, der in die Fliesen eingelassen ist, spült.
Als alles oberflächlich sauber scheint, stellt er das Wasser ab.
Es ist schlagartig still. Nur das Fallen eines einzelnen Wassertropfens in den Abfluss kann er noch hören.
Er steht vor dem Becken. Wasser perlt von seiner Haut, tropft an ihm herab auf die Fliesen. Es wird bald kühl. Es fröstelt ihn ein wenig.
Er sieht in den Spiegel, betrachtet seine Schlagader. Er sieht nur dorthin.
Die Anspannung ist immer noch da.
Sie pulsiert und pulsiert, fließt durch ihn hindurch, und es wird nicht besser.
Er brüllt gedämpft auf, sucht nach einem Ventil. Schlägt mit der flachen Hand gegen die Wand. Ein blasser, rosa-feuchter Handabdruck bleibt an den Wandfliesen zurück.
Verdammt.
Verdammt. Verdammt. Verdammt.
Es wird nicht besser. Wieder nicht.
Er starrt auf seinen Hals. Er nimmt das Zittern seiner Hände, seiner Arme, das Beben seiner Schultern kaum wahr.
Es reicht einfach nicht mehr.
»Wo du bist …« Seine Stimme flackert wie das Licht. »Wo ich bin …« Er zittert. Seine Faust schlägt leicht gegen den Rand des Waschbeckens. Dumpfes Klopfen. Immer wieder.
Die Worte wollen nicht aus ihm heraus. Sie kommen ihm nicht über die Lippen. Nicht richtig.
»Wo …«
Nicht richtig. Nicht richtig.
Aber er will den Satz sagen. Er will ihn so sagen, dass er richtig ist. So, dass ihn jemand hört. Er will gehört werden.
Sie soll ihn hören. Irgendeine Fotze soll ihn hören.
Natürlich.
Vor allem aber … sie.
Er will ihr seinen Satz ins Gesicht schleudern und den Ellbogen hinterher. Dann das Messer.
Aber er kann nicht.
Er will sie anspucken. Sie in seinen Worten ertränken und in ihrem eigenen Blut.
Er ist nicht so weit. Noch nicht.
Er will es sagen. Er muss.
Es reicht einfach nicht.
Er muss es tun.
Er verlässt das Badezimmer. Die Teelichte sind heruntergebrannt. Die ersten verlöschen bereits.
Er schließt die Tür, geht ins Schlafzimmer.
Hastig sucht er seine Klamotten zusammen, zieht Jeans und ein graues T-Shirt an. Es spannt ein wenig um die Schultern.
Mit den Fingern fährt er sich durch sein Haar. Eine Gewohnheit, denn zu tun gibt es dort nichts. Er ist dreißig, aber das Einzige, das wirklich zu seinem Alter passt, sind Haarausfall und Gewichtszunahme.
Er zieht das Shirt aus der Hose, lässt es über den Gürtel fallen und schlüpft in seine Turnschuhe.
Jan Rieper schließt die Wohnungstür ab. Die Schlüssel klimpern leise, aber es hallt im Treppenhaus nach. Genau wie das rasche Klopfen seiner harten Gummisohlen auf dem Weg nach unten.
Zwei Treppen tiefer öffnet sich rechts von ihm eine der Wohnungstüren, von denen jede wie die anderen aussieht. Braunes Holz, mattgoldener Türknauf.
Die Frau im Türrahmen ist grau und klein. Sie geht gebeugt, ihre Schultern fallen ein wenig zu stark nach vorn.
»Herr Rieper …«, sagt sie, und ihre Stimme klingt dünn.
Er bleibt stehen, sieht sie an. Es ist selten, dass ihn jemand »Herr Rieper« nennt, und meist ist der Anlass nicht angenehm.
»Ja?«
»Oh«, sagt sie und nestelt mit der Hand an ihrem Kragen herum. »Ist alles in Ordnung? Sie sehen so gehetzt aus.«
Er blinzelt, schüttelt den Kopf, blickt an ihr vorbei in ihren Flur. Aber der Gang ist dunkel, und Rieper erkennt nichts. »Ja, ja«, meint er. »Ich bin nur spät dran.«
Die Frau nickt langsam. »Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie vielleicht meine Katze gesehen haben?«, sagt sie. »Meine Miezi. Sie ist grau, ganz dunkel, und eigentlich kommt sie immer zum Frühstück, aber sie …«
»Nein«, lügt er und schneidet ihr das Wort ab. Jetzt fällt ihm ein, dass er die Plastiktüte in seinem Badezimmer noch wegwerfen muss. Aber das wird er später tun. Wenn es dunkel ist. »Nein, habe ich nicht.«
»Mhm, danke«, sagt die Frau, und da ist etwas in ihrem Gesicht. Aber Rieper kann es nicht deuten, und es ist ihm auch egal.
Er wendet sich ab, lässt die alte Frau stehen. Noch bevor sie in ihrer Wohnung verschwunden ist, die Tür ins Schloss drückt und abschließt, hat er bereits die letzte Treppe hinter sich gelassen.
Er öffnet die Haustür, tritt ins Freie. Sein erster Blick fällt auf die Müllcontainer vor dem Haus.
Der leichte Nieselregen hört gerade auf.
Die Luft ist frisch. Es riecht nach Frühling und Regen. Klar und intensiv.
Jan Rieper tut einen Schritt, und zum ersten Mal fühlt er sich fast wie er selbst. Jetzt, da er weiß, was er tun will.
Kapitel 3
Der Regen hat aufgehört. Den ganzen Morgen hatte es wieder geregnet, aber jetzt nicht mehr.
Torsten Demski steht am Fenster.
Dicke Tropfen rollen das Glas herab. Noch hängt bleicher Dunst in der Luft. Das Zwitschern der Vögel ist allgegenwärtig. Laut. Irgendwie.
Weit hinten, hinter Bäumen und Feldern, kann Demski die grauen Gebäude der Stadt nur erahnen.
»Ich kann nicht verstehen, was dir an dieser Einöde liegt«, sagt Demski. »Alle sagen, das Landleben ist ruhig. Aber diese Vögel machen einen Heidenlärm.«
Sein Blick fällt auf sein Handy, das aufrecht am Fensterrahmen lehnt. »Und der Empfang ist einfach scheiße. Irgendwie scheinen hier die einzigen paar Zentimeter im ganzen Haus zu sein, wo ich Empfang habe.«
Der Garten sieht noch winterlich aus, aber es riecht schon nach Frühling.
Demski wendet sich vom Fenster ab, schaut zum Bett, das den Raum dominiert. Altes, dunkles Holz, noch einen Tick dunkler als das Holz, aus dem der Fußboden gefertigt ist.
In diesem Bett liegt Bine. Das dünne Laken ist heruntergerutscht. Ihr blondes Haar fließt über ihren nackten Rücken.
Demski kann die Wirbel bis hinunter zu ihrem Po zählen, und aus diesem Winkel sieht sie fast aus wie Kathrin.
Aber sie ist es nicht.
Bine ist nicht Kathrin. Sie ist nicht seine Frau, und das ist genauso falsch, wie es sich manchmal richtig anfühlt.
Für etwa eine Sekunde ist die Ähnlichkeit frappierend – und schmerzhaft.
Bine hebt den Arm, streckt ihn aus. Langsam richtet sie sich auf, dreht sich herum, und die Illusion ist verflogen. Da ist nichts mehr, das noch an Kathrin erinnert.
Er sieht nur Bine.
Die Decke rutscht endgültig nach unten, gibt den Blick auf ihre Brüste frei.
Dort nehmen Frauen immer zuerst zu. Demski weiß das. Aber Bine ist immer noch schlank. Wahrscheinlich ist es die Ruhe hier draußen. Sie tut ihr gut.
Ihn macht sie nervös.
Sie reibt sich die Augen, blinzelt, sieht ihn an. »Du bist schon wieder angezogen«, sagt sie.
»Ja.«
»Dann hast du wohl keine Zeit für ein ausgiebiges Frühstück?« Sie grinst, ihre Augen funkeln ihn an.
Demski zieht den rechten Mundwinkel hoch. »Einen starken Kaffee würde ich nehmen.«
Sie nickt. »Gib mir noch ’nen Moment.« Sie wendet sich nach rechts, dreht sich nach links. Ganz so, als müsste sie sich in ihrem eigenen Schlafzimmer orientieren. Sie lehnt sich hinüber, liegt fast ausgestreckt auf der Matratze. Ihre Finger ziehen eine Schublade am Nachttisch auf, tasten suchend darin herum.
Dann lächelt sie, zieht ein Feuerzeug und eine selbst gedrehte Zigarette heraus.
Demski schlendert durch den Raum, Holzdielen knarren leise unter seinen Schritten. Er setzt sich auf die Bettkante und umfasst Bines Füße.
»Hey!« Sie lacht, zieht ihre Beine zurück, strampelt spielerisch. »Nicht kitzeln.«
Demski grinst. »Nee, keine Sorge.«
Bine setzt sich, zieht die Beine an, lehnt ihren Rücken gegen die Wand. »Na ja«, sagt sie. »Es hat auch Vorteile, nicht erreichbar zu sein.«
»Was?«
»Wie bitte«, sagt sie. »Es heißt ›wie bitte‹. Du hast einfach keine Manieren, Torsten.« Sie zündet die Zigarette an, tut einen Zug. »Du hast dich über den Handyempfang beschwert.«
Der süßliche Geruch von Marihuana verbreitet sich augenblicklich, füllt den Raum bis unter die Decke.
»Und du hast schlechte Angewohnheiten.«
»Hmm?« Bine hält ihm den Minijoint hin. »Willst du auch?«
Er schüttelt den Kopf. »Nee, lass mal. Aus dem Alter bin ich raus.«
Sie seufzt. »Ja, ja, ich weiß schon. Glaubst du ernsthaft, dass das irgendjemand kontrolliert?«
»Darum geht’s nicht«, sagt Demski. »Und das weißt du.«
»Ich weiß«, antwortet Bine. »Torsten Demski spielt nach den Regeln. Meistens jedenfalls.« Sie gönnt sich einen weiteren Zug, hält ihn in ihrer Lunge.
»Meistens?«, fragt Demski und runzelt die Stirn.
Bine bläst langsam den Rauch aus. »Meistens.« Sie hüstelt leicht. »Sonst wärst du nicht hier.«
»Mhm.« Demskis Mundwinkel zucken nach unten. Er wendet sich ab, starrt die Holzdielen an und durch sie hindurch.
»Oh Mann, ich kenne diesen Ausdruck. Sei nicht beleidigt.«
Er schüttelt den Kopf. Aus den Augenwinkeln sieht Demski, dass Bine den Joint im Aschenbecher ausdrückt.
Sie beugt sich vor. Der Geruch nach Frau, Sex und der schwache Rest ihres blumigen Parfums steigen ihm in die Nase. Ihre Finger streicheln seinen Nacken.
»Ich bin nicht beleidigt«, sagt Demski. »Du weißt das.«
Bine seufzt. »Ja, und ich weiß, dass sie es weiß, und es scheint sie auch nicht zu kümmern.«
Bine zieht sich langsam von Torsten zurück, lehnt sich wieder rücklings gegen die Wand. Sie wickelt sich die Decke wieder um ihren Körper, sodass nur noch ihre Schultern herausgucken. Die Spitzen ihrer Haare berühren gerade eben die Haut.
»Es kümmert sie schon, aber, verdammt, es ist kompliziert.« Es schmerzt. Jedes Mal, wenn Bine anfängt, über Kathrin zu reden, tut es weh. Er kann nichts dagegen tun. Man kann sich seine Gefühle nicht aussuchen. Man kann nicht wählen, wen man liebt. Er kann es nicht.
Er liebt sie beide. Jede auf ihre eigene Art. Nur davon wird die ganze Sache nicht richtiger – dass er bei einer anderen ist, während seine Frau allein zu Hause sitzt. Es wird auch nicht besser, wenn Bine den Finger in die Wunde legt.
»Ja, ja, schon klar«, sagt Bine und holt Luft.
»Sag es nicht«, meint Demski. Er beugt sich vor, stützt die Ellbogen auf die Knie, legt die Handflächen aneinander. »Red nicht schlecht über sie.«
»Ich rede doch gar nicht schlecht über deine Frau«, sagt Bine.
»Red einfach gar nicht über sie, okay?«
Sie lacht, aber es klingt schnippisch.
»Was?« Demski dreht sich um, sieht sie an.
»Entschuldige«, sagt sie. »Aber ich verstehe dich manchmal einfach nicht.«
»Tja«, sagt Demski. »Ich liebe sie nun mal.«
»Und trotzdem bist du hier. Bei mir im Bett.«
»Das hat doch damit nichts zu tun.« Soweit es ihn angeht, ist das die Wahrheit. Er ist nicht bei Bine, weil er seine Frau nicht liebt oder Bine mehr liebt als Kathrin. Er ist bei Bine, weil er etwas an ihr findet, was Kathrin verloren zu haben scheint. Unbefangenheit. Außerdem fürchtet Bine nichts. Sie hat einfach keine Angst.
»Ach, nee?«
»Nee.« Demski schüttelt den Kopf, fährt sich mit den Fingern grob durchs Haar. »Können wir das Thema wechseln, bitte?«
Demski hat den Satz kaum ausgesprochen, als sein Handy sich meldet und dessen leises Vibrieren die entstandene Stille durchdringt.
»Mhm«, sagt Bine. »Wie praktisch.«
Demski steht auf, seine Wirbelsäule knackt hörbar. Er verzieht das Gesicht.
»Tja.« Bine zupft an der Decke herum. »Du solltest es dir noch mal überlegen.«
»Was?«, fragt Demski.
»Das Rauchen«, sagt Bine. Ein Grinsen huscht um ihre Mundwinkel. »Könnte deinem Rücken ganz guttun.«
»Ich komme schon klar.«
»Das sehe ich«, sagt sie und lässt die Mundwinkel hängen. »Ernsthaft, du solltest was machen. Dauernd Pillen zu schlucken ist doch keine Lösung. Schmerz macht empfindlich.«
»Ich weiß«, sagt Demski.
Er geht zum Fenster, fragt sich, wie das funktioniert. Wie schafft es das verdammte Vibrieren des Telefons stets, mit jeder Sekunde dringender zu wirken.
»Klar«, sagt Bine.
Demski hebt die rechte Hand, streckt ihr den Zeigefinger entgegen. Mit der Linken greift er nach dem Handy.
Doch das Gerät hat bereits aufgehört zu klingeln.
Ein Anruf in Abwesenheit. Frank Theißen.
Das Telefon piepst einmal. Demski kratzt sich flüchtig die Nase und öffnet die SMS, die er gerade erhalten hat.
Seine Augen überfliegen die Nachricht.
»Scheint, dass ich mir den Kaffee unterwegs besorgen muss«, sagt Demski und steckt das Handy ein.
»Arbeit?«, fragt Bine.
»Kann man so sagen«, sagt Demski.
Kapitel 4
Die enge Straße ist ein besserer Feldweg – und eine Zumutung. Zu allem Überfluss hat scheinbar jedes Polizeiauto der Umgebung, ob als solches erkennbar oder zivil, hier geparkt.
Demski steuert seinen Mondeo in die Lücke zwischen einem Streifenwagen und dem rubinroten Audi von Frank Theißen. Demskis Kollege und Partner ist schon vor Ort. Natürlich. Und vermutlich hat er furchtbar gute Laune.
Theißen war nicht immer so. Das fing erst vor zwei Jahren an, als er seine zweite Frau kennenlernte. Seither versucht er stets, allem etwas Positives abzugewinnen, was mit der Zeit anstrengend ist.
Demski schaltet den Motor aus, zieht den Zündschlüssel ab. Einen Atemzug lang hält er inne. Demski schaut in den Rückspiegel und fährt sich hastig mit den Fingern durch das Haar.
Es ist dieser eine letzte Moment, der ihm bleibt, bevor er sich in dieses kontrollierte Chaos draußen stürzt. Ein neuer Fall. Spuren, Indizien und vor allem eine Leiche.
Ein Mensch, der nicht mehr lebt, weil es ein anderer so entschieden hat und niemand zur Stelle war, der ihn aufhalten konnte.
Schließlich stößt Demski die Tür auf und steigt aus seinem Auto.
Es ist inzwischen fast hell, aber das Tageslicht versteckt sich zwischen bleigrauen Wolken, die eine dichte Decke bilden. Fast scheint es, als wollten sie herabfallen und alles unter sich erdrücken. Das Gras ist feucht und noch welk vom Winter. Die Wiese neben der Straße sieht aus wie ein gelblich grüner Flickenteppich. Hier und da sprießen ein paar zähe Schneeglöckchen hervor.
Kalter Nieselregen hinterlässt feine Tropfen auf dem dunkelblauen Lack des Fords und findet einen Weg in Demskis Kragen.
Wenigstens passt das Wetter zum Anlass.
»Guten Morgen, Toto«, hört Demski eine bekannte Stimme hinter sich.
Langsam dreht er sich herum. »Morgen, Frank.«
Frank Theißen lächelt ihn breit an. Da ist sie, die erdrückend gute Laune, die Demski erwartet hat.
Der Kollege ist hochgewachsen, schlaksig. Das fortwährend spärlicher werdende braune Haar auf seinem Kopf ist kurz geschoren. Er trägt einen graublauen Anzug von der Stange, und das blaue Regencape, das Theißen übergezogen hat, passt nicht dazu.
Dennoch und obwohl der Tag grau und trostlos wirkt, lächelt Theißen, verzieht das Gesicht schließlich aber zu einer Grimasse.
»Mann, Demski, so schnell, wie du am Tatort bist, das ist schon nicht schlecht«, sagt Theißen, »aber du siehst aus wie ein ungemachtes Bett.«
Demskis Mundwinkel zucken. »Und du wie ein Gebrauchtwagenhändler.«
»Haha«, sagt Theißen. »Aber ernsthaft, Toto. Du hättest dir ruhig noch die Zeit nehmen können, dich zu rasieren. Der Chef kommt auch gleich.«
»Es ging nicht«, entgegnet Demski.
»Habt ihr keinen Strom zu Hause? Wasser abgestellt oder so?«
Demski schüttelt den Kopf und schiebt die Hände tief in die Hosentaschen. »Ich war nicht zu Hause.«
»Aha«, sagt Theißen, und für einen Moment passt seine Miene zum Regenwetter. »Ich hatte gedacht …«
»Was?«, fragt Demski. Er ahnt, was Theißen meint, und so sehr Demski ihn auch als Freund und Partner schätzt, ist Theißen doch der Letzte, den er in Beziehungsfragen konsultieren würde. Ein Umstand, den Theißen jedoch herzlich ignoriert.
Theißen neigt den Kopf etwas, kratzt sich mit einem Zeigefinger am Auge. »Es ist ja nicht meine Sache. Geht mich nichts an.«
Und da hat er recht.
Demski nickt. »Aber?«
»Kathrin und du … ihr seid schon ewig zusammen. Verständlich, dass …«
Es ist das immer gleiche Thema zwischen ihnen, seit Theißen etwas von der Sache zwischen Demski und Bine weiß. Er schließt von sich auf seinen Kollegen. Menschlich, verständlich, aber falsch. Sicher, Theißen meint es gut. Aber das allein macht es nicht besser.
»Dass was?«, fragt Demski erregt. Sein Herz schlägt ein wenig schneller. Wärme steigt in seine Ohren. Er spricht schneller, als er denkt. »Machst du jetzt den Moralapostel?«
»Ich verstehe dich echt gut, Toto. Die Situation und alles«, sagt Theißen. »Ich meine, als ich und …«
»Du hast dich scheiden lassen, Frank. Nicht ich. Und ich habe das auch nicht vor. Du hast eine Entscheidung getroffen, und das ist okay. Ich, also Kathrin und ich, wir treffen eine andere.«
Daran erinnert sich Demski noch viel zu gut. Als Theißen vor fünf, sechs Jahren erst im Trennungsjahr, dann in der Scheidungsphase so aussah, als könne er es nicht erwarten, sich am nächstbesten Baum aufzuhängen.
Ausgemergelt und blass. Es war herzzerreißend, den Freund so zu sehen. Außerdem ein Mahnmal. Dort will Demski nicht enden. Kathrin und er werden nicht so enden.
Theißen seufzt. »Mann, Demski, ich hoffe, du weißt, was du tust.«
Demski fährt sich mit dem Daumen über die Nase, wendet den Blick ab. Das ist wirklich kein Gespräch, das er führen will. Nicht jetzt, nicht hier. Nicht mit Theißen. »Das hoffe ich auch. Aber dafür sind wir nicht hier.«
»Richtig«, sagt Theißen. »Komm, sie ist da hinten.« Theißen geht voraus, stakst, einem Storch nicht unähnlich, durch das Gras. Wenn der Anlass weniger mies wäre, könnte man über den Anblick lachen.
Aber Demski ist nicht zum Lachen zumute.
Er folgt Theißen über die Wiese. Sie steuern auf eine Baumgruppe zu. Demski hört das Rauschen und Plätschern des Baches. In einiger Entfernung stehen vereinzelte Häuser. Eine kleine Siedlung am Rand der Stadt.
Ein nettes Viertel, denkt Demski. Aber als er über die Schulter schaut, entdeckt er bereits das nächste Industriegebiet und dahinter aufragende Wohnsilos. Man darf sich halt nur nicht umdrehen.
»Es ist kein schöner Anblick«, sagt Theißen. »Fast glaubt man, ihren Schmerz noch fühlen zu können.«
Demski zieht den rechten Mundwinkel nach unten. »Du meinst, du kannst ihn fühlen, oder wie? Hör auf mit diesem Mist, Frank. Ich bin echt nicht in der Stimmung. Niemand außer dieser Frau hat ihren Schmerz gefühlt. Und, hey, ich habe keinen Bock, hier und jetzt über deine seltsamen Ansichten zu diskutieren.«
Demski weiß, dass er zu schroff reagiert, und im nächsten Augenblick tut es ihm leid. Aber was gesagt ist, ist gesagt. Theißen bleibt mitten auf der Wiese stehen.
»Sei nicht so ätzend, Toto«, sagt er. »Du bist ein verdammter Zyniker.«
Das Gras ist feucht. Nässe dringt durch die Nähte in Demskis Schuhe. Langsam werden seine Socken unangenehm nass.
»Hey, es tut mir leid, in Ordnung? Ich will deine Gefühle nicht verletzen«, sagt Demski. »Ich wäre dir nur dankbar, wenn du dich hier auf die Fakten konzentrierst und deinen Fimmel zu Hause auslebst.«
Theißen seufzt. »Es ist kein Fimmel. Aber …«
»Es ist ein Fimmel, und den hat Yoko mitgebracht«, sagt Demski – und es stimmt. Theißens zweite Frau, die sich eigentlich Melissa nennt, ist ein Fall von Birkenstock und Aluhut der härtesten Kategorie. Sie hat diesen Kram eingeschleppt. Zen und Energiebalance und hinter jedem Ereignis eine Verschwörungstheorie. Am Anfang haben Demski und Kathrin versucht, mit der Frau zurechtzukommen. Sie haben versucht, weiterzumachen, als wäre nichts geschehen. Theißen zuliebe. Vor der Scheidung waren beide Paare oft zusammen unterwegs gewesen. Aber mit Yoko geht das einfach nicht. Mit ihren Ansichten könnte Demski sich vielleicht noch arrangieren, aber ihre militante Art, andere zu bekehren, ist einfach zu viel.
Es ist Theißen gegenüber nicht fair, aber ist es Demskis Schuld, dass sein Partner auf dem einen Auge blind erscheint?
Theißen verlagert sein Gewicht von einem Bein auf das andere und zerrt am Kragen seiner Jacke. »Nenn sie nicht Yoko, sie …« Er hält inne, sein Blick schweift über Demskis Schulter hinweg. »Wie auch immer. Der Chef ist da.«
Gabriel Ruggiero joggt ihnen über die Wiese entgegen. Sein blauer Trainingsanzug und das leuchtende Gelb seiner Sportschuhe sind kaum zu übersehen. Ruggiero ist nicht außer Atem. Er schnauft nicht einmal, als er Demski und Theißen erreicht.
»Morgen, Chef«, sagt Theißen.
Demski nickt seinem Vorgesetzten zu.
Ruggiero reicht erst ihm, dann Theißen die Hand. Sein Händedruck ist trocken und fest.
»Gut, dass ich Sie noch erwische, meine Herren«, sagt Ruggiero. Er ist Leiter des Mordkommissariats, so alt wie Theißen und damit nur zwei Jahre älter als Demski. Er stammt aus München und ist unmittelbar nach seinem Schulabschluss und Studium Kriminalpolizist geworden. Das und die Mitarbeit an einigen aufsehenerregenden Fällen dort haben seiner Karriere einen ordentlichen Schub verpasst, sodass seine Versetzung hierher einer Beförderung gleichkam.
Der Mann ist ohne Frage fähig, versprüht aber auch Energie und unbedingten Ehrgeiz, und es fällt nicht leicht, sich dem zu entziehen. »Ich war gerade auf meiner Laufrunde«, sagt er, und das sieht man ihm wirklich nicht an, wenn man von seiner Aufmachung absieht.
Er ist schlank und groß. Breite Schultern füllen die Trainingsjacke aus. Seine Haut hat nicht die Winterbleiche wie Theißens oder Demskis. Vielleicht sind es die guten Gene seines italienischen Vaters. Vielleicht hilft er nach.
»Entschuldigen Sie also bitte meinen Aufzug«, sagt Ruggiero, und gefühlt sieht er Demski ein wenig länger als unbedingt nötig an. »Mir scheint, der Anruf kam für alle überraschend. Waren Sie schon bei der Leiche?«
Demski schüttelt den Kopf.
»Ja, kurz«, sagt Theißen. »Aber dann kam schon Toto an, und wir wollten gerade hingehen.«
Ruggiero nickt. »Gut, in Ordnung. Ich begleite Sie, kann aber nicht lang bleiben. Ich wollte mir nur rasch ein Bild machen, ehe ich mit der Staatsanwältin spreche und Sie beide Ihre Arbeit machen lasse. Die Frau ist gut, aber gerade erst im Amt. Sie wissen ja, wie das mit neuen Besen ist, nicht wahr? Eigentlich wundert es mich ein wenig, dass sie nicht selbst am Tatort ist, aber na ja, wer weiß.«
»Fundort«, sagt Demski.
»Bitte?«, fragt Ruggiero.
»Fundort«, wiederholt Demski. »Bis jetzt ist es nur ein Fundort. Wir wissen nicht, ob es auch der Tatort war.«
»Sie haben recht, absolut«, sagt Ruggiero und nickt eifrig.
»Kein Problem«, meint Demski, und er fragt sich, wieso er das sagt.
»Gut«, sagt Ruggiero. Er schnipst mit den Fingern. »Ach, Herr Demski, ehe ich es vergesse, ich möchte Sie nachher im Büro noch kurz allein sprechen.«
Demski nickt. »Geht klar.«
»Sehr gut«, sagt Ruggiero, klatscht leise in die Hände und lächelt. Doch dieses Lächeln schwindet so rasch, wie es gekommen ist. »Dann sehen wir uns mal den Tatort an.«
Kapitel 5
Wer hat die Leiche gefunden?«, fragt Demski, während er sich unter dem Flatterband, das den Bereich des Fundorts großzügig absperrt, hindurchduckt.
Ruggiero scheint bereits in seinem Element. Mehr Vermittler als Ermittler, spricht er mit allen und jedem, der am Tatort irgendetwas verloren hat.
Ein Umstand, der Demski nicht schmeckt. Er fühlt sich unbehaglich, wenn der Chef in der Nähe umherschwirrt. Dabei ist Ruggiero kein übler Kerl. Das sicher nicht. Aber am Ende des Tages ist er der Chef.
»Ein Mann, der mit seinem Hund spazieren gegangen ist«, sagt Theißen. »Er ist noch da. Du kannst mit ihm reden, wenn du willst.«
Demski nickt. »Es sind immer die Hundehalter, oder?«
Theißen lacht leise. »Oder die Jogger, ja.«
»Der dort«, sagt Theißen. Er zeigt auf einen Mann, der etwas abseits steht und eher wie ein kleiner Junge wirkt, der im Supermarkt verloren gegangen ist, als der erwachsene Mann mittleren Alters, der er ist. »Er ist gleich da vorn.«
Der Mann sieht aus wie Hundehalter, die frühmorgens über Felder und Wiese stiefeln. Er trägt eine gelb-schwarze Weste über einem grauen Kapuzenpullover, eine Outdoorhose, die eher in die Alpen passt, und die unvermeidlichen passenden Schuhe mit der gelben Wolfstatze. Demski ertappt sich unwillkürlich bei der Frage, was der Kerl dann mitten im Winter trägt. Der Mann hat eines dieser Gesichter, das man ansieht und gleich wieder vergisst. Bis auf die unnatürliche Blässe seiner Haut, die seinen Bartschatten dunkler erscheinen lässt.
Demski streckt die Hand aus, streift mit einem Seitenblick den Hund, der neben dem linken Bein des Mannes sitzt. Ein schwarzer Labrador, der nicht den Anschein erweckt, in einem Anflug von Beschützerinstinkt Demskis Hand packen zu wollen.
»Braver Hund«, murmelt Demski leise. Er mag Hunde, hat mit Kathrin sogar mal überlegt, einen ins Haus zu holen. Aber letztlich haben sie es immer aufgeschoben, weil sie warten wollten, bis sie Kinder haben würden und die groß genug wären. Nur dass es dazu nicht gekommen ist.
Der Mann greift nach Demskis angebotener Hand, drückt sie kurz, feucht und schlaff. Er lächelt, aber das wirkt eher gezwungen – wie die ganze Anwesenheit des Mannes. Seine Bewegungen sind fahrig und nervös. Aber er erscheint nicht so wie jemand, der gerade getötet hat. Nur wie der arme Trottel, der die Leiche finden musste.
Die Erkenntnis hat nicht viel mit kriminalistischer Detektivarbeit zu tun. Es ist nur ein Bauchgefühl. Instinkt. Menschenverstand. Manchmal ist das wichtiger.
Aber man muss alles bedenken. Darf nichts ausschließen. Keiner ist unschuldig. Jeder ist verdächtig, und bis zu einem bestimmten Grad lügt jeder die Polizei an.
Demski stellt sich vor und zeigt dem Mann flüchtig seinen Dienstausweis, den der aber kaum zur Kenntnis nimmt. Dafür scheint ihm das verdammte Lächeln wie ins Gesicht gemeißelt. Der Mann schiebt die Hände in die Taschen und holt tief Luft.
Gleich wird er Demski die ganze verfluchte Geschichte, die er den Kollegen bereits aufgetischt hat, noch einmal erzählen. Wieso er ausgerechnet morgens, ausgerechnet hier unterwegs war und wieso ausgerechnet er die Leiche finden musste. Es ist nur menschlich. Die Belastung ist für jemanden wie Demski, der den Anblick und die Grausamkeit gewohnt ist, schon hoch. Für jeden anderen muss sie immens sein. Man will es loswerden, muss es erzählen. Und das tut er dann auch.
»Der Hund stand auf einmal stocksteif da vorn«, sagt der Mann und wedelt mit der Hand herum. »Ich wusste gleich, dass was nicht stimmt.«
»Hmm«, sagt Demski. »Hat der Hund etwas angerührt?«
»Nein.« Der Mann verzieht das Gesicht. »Nein, das tut Rocky nicht.«
Demski nickt. »Haben Sie etwas angefasst?«
Jetzt entgleisen dem Mann die Gesichtszüge völlig.
Er sieht aus, als müsste er sich jeden Moment in den nächsten Busch übergeben. Sein Gesicht verliert den letzten Rest an Farbe. Er wird bleich, so weiß wie die Schneeglöckchen, die überall aus der Wiese sprießen.
»Nein. Oh, Gott. Nein«, sagt er.
»Danke«, sagt Demski. Er greift in seine Jackentasche, nimmt eine Visitenkarte heraus und reicht sie dem Mann. »Die Kollegen haben Ihre Daten aufgenommen?«
Der Mann nickt. »Mein Gott, es ist so eine Schande. Das war eine so nette Frau.«
»Sie kennen sie?«, fragt Demski und blinzelt hastig.
»Nein, nicht so richtig. Kennen wäre zu viel gesagt«, meint der Mann. »Wir sind uns ab und an begegnet. Mit den Hunden, wissen Sie? Haben uns zugenickt. Mehr nicht. Sie wohnt irgendwo da vorn.« Er zeigt in Richtung der Siedlung. »In einem dieser Häuser da. Ihr Mann scheint recht erfolgreich. Hat eine Firma. Stappert oder so.«
»Gut, halten Sie sich bitte bereit, falls noch Fragen auftauchen. Und falls Ihnen noch etwas einfällt …« Demski weist vage auf die Karte, die der Mann in den Fingern dreht und betrachtet.
»Demski …«, sagt er, runzelt die Stirn und wirkt abwesend.
»Ja?«
»Der Name kommt mir bekannt vor. Kenne ich Sie irgendwoher?«
Demski unterdrückt den Zwang, die Augen zu verdrehen.
Normalerweise vergessen die Leute schnell. Aber einen Serienmörder vergessen sie in einer Stadt wie dieser nicht so rasch. Und auch nicht den Polizisten, der den Killer geschnappt hat. Auch wenn diese Sache fast zehn Jahre her ist. An die wirklich schlimmen Geschichten erinnern sich die Menschen immer. Manson, Bundy, Horror-Martina. Und so ist es auch hier. An Bachmann erinnert man sich ebenfalls. Denn das war eine dieser hässlichen Geschichten.
»Ja«, sagt Demski und fährt sich mit den Fingern durch das Haar. »Wenn Sie schon länger als zehn Jahre hier in der Gegend wohnen, dann ist das gut möglich. Halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung.«
Der Mann nickt wortlos. Ein Kollege in Uniform tritt an seine Seite, fasst ihn beim Arm. Demski nickt dem Beamten zu, und der erwidert das Nicken.
Demski sieht dem Mann hinterher, betrachtet abwesend die Wiese, die Schneeglöckchen. Er hört das leise Plätschern des Wassers. Der Bach ist ganz in der Nähe.
Eigentlich ein schöner Ort. Ruhig. Besonders früh am Morgen, wenn man mit dem Hund eine Runde drehen will. Oder zum Joggen. Still.
Wenn da nur diese Leiche nicht wäre.
»Irgendwelche Erkenntnisse?«, fragt Theißen, der unbemerkt an Demski herangetreten ist.
Demski massiert mit dem Zeigefinger seine Nasenwurzel. »Nein, nicht wirklich. Nur der Typ, der über die Leiche stolpern musste.«
Theißen nickt, presst die Lippen aufeinander. »Einen erwischt es immer.«
»Ja«, sagt Demski, und er weiß nicht genau, wen Theißen meint. »Tatorte erzählen immer eine Geschichte. Sehen wir uns doch an, was dieser zu erzählen hat.«
Um den Fundort der Leiche herum tummeln sich die Kollegen, die in weißen Papieranzügen, mit Handschuhen und Mundschutz bewaffnet, ihren Teil des Jobs erledigen.
»Hey«, sagt Demski, »das vorhin wegen deiner Frau … das tut mir leid. Du weißt schon.«
Theißen zieht eine Augenbraue hoch. »Weil du sie Yoko genannt hast?«
Demski nickt, lächelt ein wenig.
Theißen seufzt, dann lächelt auch er. »Schon in Ordnung. Ich weiß, du meinst es nicht böse. Wir haben alle Stress.«
»Danke«, antwortet Demski. »Wir stehen hier doch alle auf derselben Seite, oder?«
»Klar. Die Spurensicherung ist übrigens auch gleich abgeschlossen«, sagt Theißen. »Die Gerichtsmedizin ist schon da.«
»Hmm«, sagt Demski. »Sind ja schon alle sehr fleißig bei der Sache. Irgendwie bin ich wohl der Letzte, der hier irgendetwas erfährt«
»Fleißig und motiviert«, entgegnet Theißen. »Kein Wunder. Alle wollen diesen Typen erwischen.« Sein Blick verfinstert sich. Für einen flüchtigen Moment ist es, als trieben schwarze Wolken darin. »Du verstehst es, wenn du sie siehst.«
Kapitel 6
Irgendwer hat sich die Mühe gemacht, einen weißen Gartenpavillon über dem Fundort aufzubauen, sodass der Regen nicht noch mehr Schaden anrichten kann, als er das ohnehin schon getan hat. Wertvolle Spuren, einfach fortgespült, unwiederbringlich verloren. Der Gedanke ist gut. Der Anblick hingegen irgendwie zynisch. Wahrscheinlich verbinden die meisten Menschen mit solch einem Pavillon eher positive Erinnerungen an Sonne, Grillfeste und Sommer. Für Demski hingegen bedeutet es nur Tatort, Leiche und Regen.
Die Gerichtsmedizinerin kniet in ihrem weißen Overall zwischen der Leiche und einem aufgeklappten Aluminiumkoffer. Routiniert und geschickt bewegen sich ihre Hände.
Der Papieranzug und die Haltung machen es Demski schwer zu erkennen, wer aus der Rechtsmedizin Bereitschaftsdienst hat und dort seine Arbeit tut. In den Schutzanzügen sehen sie alle irgendwie gleich aus.
Demski zieht zwei Paar Plastik-Einweghandschuhe aus einer Tasche seiner Jacke und über seine Hände. Der Geruch von Talkumpuder und Gummi steigt ihm in die Nase.
»Kann ich mich hier frei bewegen?«, fragt er.
Theißen öffnet den Mund, aber noch ehe er antworten kann, kommt ihm eine raue, unverwechselbare Stimme zuvor.
»Sie können tun, was Sie wollen, Schätzchen. Nur stören Sie nicht meine Kreise.« Die Gerichtsmedizinerin streckt ihren Rücken, steht langsam aus der Hocke auf, legt eine chirurgische Schere in ihren Koffer zurück und bedeckt den Körper der Toten mit einer Plane aus Plastik. »Herr Jesus«, sagt sie und seufzt. »Dieses nasskalte Wetter ist Gift für meine Knochen.«
Demski lächelt. »Doktor Adriano.«
»Torsten Demski.« Sie grinst. »Wie geht es Ihrem Rücken?«
Demski wedelt mit der Hand in der Luft. »Sie kennen das, Doktor. Was haben wir hier?«
»Die Spurensicherung ist soweit fertig«, sagt Nicola Adriano. Sie ist Mitte vierzig, trägt ihr braunes Haar kurz und reicht Demski etwa bis zur Schulter.
Nicola Adriano stammt eigentlich aus dem Osten Deutschlands, was man angesichts ihrer dunklen Hautfarbe kaum vermuten würde. Sie hat lange in Berlin gearbeitet, bevor sie hierhergezogen ist. Adriano lässt Demski an diese kleine, resolute Ärztin aus einer amerikanischen TV-Serie denken, an deren Namen er sich aber nicht erinnert. Nur mit dem Unterschied, dass Adriano schlimmer ist. Und besser.
»Danke«, sagt Demski und nickt ihr zu. »Wie läuft es in der Gerichtsmedizin? Was wissen wir schon?«
»Rechtsmedizin, bitte schön. Wir sagen heute Rechtsmedizin. Daran könnte man sich mal gewöhnen, oder?«, sagt Nicola Adriano und seufzt leise. »Ich weiß nicht, was Sie wissen, aber ich weiß, dass ich noch nicht genug weiß.«
Sie kniet sich wieder neben die Leiche und zieht die weiße undurchsichtige Plastikplane, die den Körper der Toten bedeckt, weg.
Die Wiese verwandelt sich augenblicklich in einen Ort, an dem ein perverses Schlachtfest stattgefunden hat.
Demski betrachtet die tote Frau, die mit dem Gesicht nach unten auf der Erde liegt. Ihr Oberkörper ist nackt, die Haut ist bleich, wirkt fast bläulich. Ihre Jeans hat man ihr bis zu den Knöcheln heruntergezerrt. Getrocknetes Blut klebt am Stoff.
Er sieht hin, aber er sieht nicht sie. Er sieht nicht den Menschen. Nicht die Frau, die Freundin, vielleicht eine Mutter. Er betrachtet nur den toten Körper, eine Hülle – und die Aufgabe, die sich ihm stellt. Es ist einfacher, wenn er zu diesem Zeitpunkt ihren Namen nicht kennt. Nicht weiß, wer sie ist – oder war.
»Wurde sie vergewaltigt?«, fragt Demski.
»Verletzungen und Prellungen im Genitalbereich legen das nahe«, sagt die Rechtsmedizinerin. »Aber genauer kann ich es erst sagen, wenn sie auf meinem Tisch lag.«
»Klar«, sagt Demski.
Nicola Adriano deutet mit ihren behandschuhten Händen auf den Hals der Toten. Ihre Stimme schaltet in den kühlen, emotionslosen Klang, mit dem sie bei der Obduktion auch die mitlaufende Aufzeichnung besprechen wird.
»An Nacken und Rücken finden wir achtundzwanzig tiefe Stichwunden, die aus unterschiedlichen Richtungen ausgeführt wurden«, sagt sie. »Ihre Kehle wurde mit vier langen, parallelen Schnitten durchtrennt. Außerdem weisen Hände und Unterarme mehrere Verletzungen auf, die ebenfalls wie Schnittwunden aussehen.«
»Sie hat sich gewehrt«, stellt Theißen fest.
Adriano hebt den Kopf, sieht Theißen an und nickt. »Es hat ihr nichts genützt.«
»Wann wurde sie getötet?«, fragt Demski.
Die Rechtsmedizinerin wiegt den Kopf hin und her. »Lässt sich jetzt noch relativ schlecht sagen«, sagt sie. »Zwischen zweiundzwanzig und zwei Uhr, würde ich schätzen. Plus minus ein oder zwei Stunden. Genaueres erst …«
»… nach der Obduktion«, sagt Demski und nickt.
»Ja«, bestätigt sie. »Wenn Sie so gut Bescheid wissen, können Sie meinen Job ja selbst übernehmen. Aber vermutlich sehen Sie ohnehin mehr Tote als ich. Zumindest sehe ich nicht so tot aus, wenn ich in den Spiegel sehe.«
Theißen lacht leise.
»Schönen Dank«, sagt Demski, fährt sich flüchtig mit den Fingerspitzen durch das Haar.
Dann aber fällt ihm das schelmische Blitzen in den dunklen Augen der Rechtsmedizinerin auf, und er lächelt unwillkürlich.
»Na gut«, sagt Adriano schließlich. »Dann will ich Ihnen beiden mal zeigen, was der Frau angetan wurde. Gehen wir die Verletzungen durch, die mir bislang sonst noch aufgefallen sind.«
Demski folgt den Ausführungen der Gerichtsmedizinerin und seine Blicke ihren Händen und Fingern, die auf die jeweiligen Wunden zeigen.
»Sie erhalten meinen Bericht, sowie die Untersuchung abgeschlossen ist«, sagt die Gerichtsmedizinerin und deckt die Leiche erneut ab.
Demski atmet in einem langen Zug ein und wieder aus. Solange dort nur ein toter Körper liegt und es nur um die technischen Feinheiten der Tötung, des Vorgangs, geht, kann er verdrängen, was er wahrnimmt. Aber jedes Mal kommt auch der Moment, in dem er den Menschen sieht. Sehen muss.
»Er hat sie abgeschlachtet«, sagt Demski.
Die Gerichtsmedizinerin legt den Kopf ein wenig schief und die Stirn in Falten. »Umgangssprachlich könnte man es so ausdrücken, Sherlock. Er hat an ihr herumgewütet. Sich abreagiert wie ein Wahnsinniger, wenn Sie so wollen.«
Demski nickt ihr zu. »Danke.«
»Ach, ehe ich es vergesse«, meint Adriano. »Gleich hier vorn ist ein recht auffälliger Schuhabdruck. Vielleicht will Ihre Spurensicherung sich den ja noch ansehen.«
»Okay«, sagt Demski. »Noch etwas?«
Adriano nickt. »Ich weiß nicht, ob die Spurensicherung etwas gefunden hat, aber soweit es mich betrifft, fehlt ihre Unterwäsche.«
»Ihre Unterwäsche?«, fragt Theißen.
»Ihre Unterwäsche. Ihr Slip, um es genau zu sagen. Er fehlt. Entweder hat sie keinen getragen, oder der Täter hat ihn mitgenommen.«
»Hmm«, sagt Demski. »Danke, Doktor Adriano.«
Sie nickt. »Ach, es ist mir wie immer ein Vergnügen.«
»Ruggiero hat offenbar die ganze Kavallerie zusammengetrommelt«, sagt Demski und grüßt im Vorbeigehen Lena Kessler, die mit einem der Kollegen vom Erkennungsdienst spricht. Ihr kurzes braunes Haar pappt nass an ihrem Kopf. Aber Demski ist sich sicher, dass Kessler das herzlich wenig stört. Auch dass ihr Kapuzenpulli, ihre Jeans und Turnschuhe bereits ebenso durchnässt sind, macht ihr nichts. Wahrscheinlich hat auch ihr Diensthandy in einer völlig unpassenden Situation geklingelt. So ist das. Man lebt damit oder kündigt.
Dem Mann im Schutzanzug reicht Kessler gerade bis zur Schulter. Manche Kollegen nennen sie respektvoll Napoleon, aber das wird ihr nicht gerecht. Sie ist ein Vollblutbulle, drahtig und mit einer Muskulatur gesegnet, die manchen Boxer neidvoll erblassen lassen würde – und in den Hintern treten würde sie ihn wohl auch.
Kessler erwidert das Nicken, widmet sich dann wieder dem Mann von der Spurensicherung.
»Lass uns einen Blick auf diesen Fußabdruck werfen«, sagt Demski.
Theißen nickt.
Es ist kein ganzer Abdruck, der sich in der dunklen Erde unter platt getretenem Gras abzeichnet. Wer immer diese Spur hinterlassen hat, ist nicht richtig aufgetreten. Es ist vor allem die äußere Kante des linken Schuhs. Viele kleine Löcher finden sich in dem Abdruck. So, als hätte jemand kleine Noppen unter den Sohlen.
»Große Füße«, sagt Theißen.
»Ja«, bestätigt Demski und zieht sein Handy aus der Tasche. Mit der Kamera macht er ein, zwei Fotos. »Was denkst du? Vierundvierzig, fünfundvierzig?«
Theißen nickt. »So um den Dreh. Ein Kerl?«
»Ein Kerl«, sagt Demski. »Ein großer, kräftiger Kerl.«
Theißen neigt den Kopf, presst kurz die Lippen aufeinander. »Erinnert dich das irgendwie an Noppen? Fußballschuhe?«
»Nein, das sind keine Fußballschuhe. Eher so Geländesportschuhe. Wie heißen die?«
»Crosstrainer, glaube ich«, sagt Theißen.





























