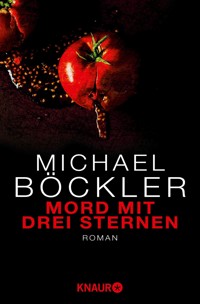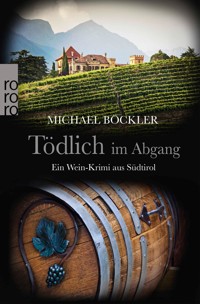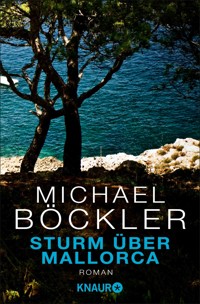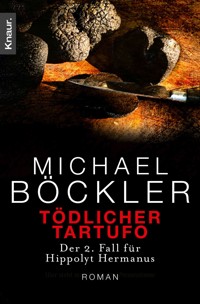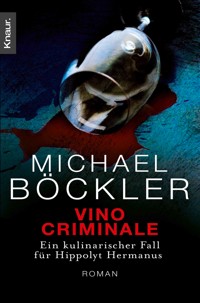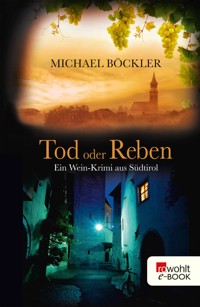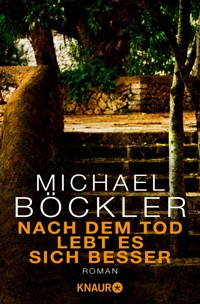
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Tod löst alle Probleme! Das denkt sich zumindest der flüchtige Börsenspekulant Kay, als er auf Mallorca seinen Tod vortäuscht und so einer Verbrecherorganisation entkommt. Nur leider sind die Spanier nicht überzeugt von seinem Ableben. Und entführen daher seine Freundin Dana …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Michael Böckler
Nach dem Tod lebt es sich besser
Ein Mallorca-Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kay, Millionenbetrüger und smarter Devisenspekulant, ist vor Mallorca angeblich mit seiner Jacht verunglückt und ertrunken. Er wurde sogar schon für tot erklärt. In Wahrheit aber ist er auf Menorca untergetaucht, wo er schon bald von Sam, einem raubeinigen Privatdetektiv, aufgespürt wird. Leider glaubt auch ein spanisches Verbrechersyndikat nicht an seinen Tod und entführt prompt Dana, Kays Freundin, die als Einzige von seinem Überleben weiß. Sam und Kay machen sich gemeinsam daran, sie zu retten.
Inhaltsübersicht
Motto
Landkarte
Prefacio
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
Epílogo
REGISTRO TURISTICO
GRACIAS!
Anmerkung
»Unter den heutigen Umständen kann ich diese Reise guten Gewissens nur körperlich robusten und geistig beschwingten Künstlern empfehlen. Aber die Zeit wird bestimmt kommen, wo ein zarter Schöngeist und sogar elegante Damen mühelos und bequem nach Palma fahren können …«
George Sand, Paris 1842, Ein Winter auf Mallorca (Un Hiver à Majorque)
Prefacio
Da gibt es eine junge Frau, die verbindet schöne Erinnerungen mit Mallorca. Leider aber auch weniger schöne! Da gibt es einen Mann, der hat beschlossen, nie mehr einen Fuß auf die Insel zu setzen. Einen Vorsatz, den er wegen unerwarteter Ereignisse brechen wird. Es gibt einige andere Akteure, die mehr oder weniger unlautere Ziele verfolgen. Mord und Totschlag nicht ausgeschlossen. Vor allem aber gibt es eine Vorgeschichte. Und dem Ganzen liegt ein besonderes Konzept zu Grunde.
Um beim letzten Punkt anzufangen: Der Roman spielt zu großen Teilen auf Mallorca. Natürlich in Palma, der altehrwürdigen und doch so jungen »Ciutat«, in Porto Portals, in Port d’Andratx, in Santa Ponça, in Portocolom, in Sóller … Einige Kapitel werden Sie außerdem auf die kleinere Nachbarinsel Menorca entführen – nach Maó, der britisch geprägten Inselhauptstadt mit dem zweitgrößten Naturhafen der Welt; nach Fornells, um dort eine Caldereta de Llagosta zu essen; und nach Ciutadella, der alten Bischofsstadt, die Mallorca geographisch am nächsten liegt.
Was das alles mit dem Konzept zu tun hat? Nun, die Einbeziehung all dieser Orte in die Handlung ist kein Zufall. Das Buch will nämlich nicht nur eine hoffentlich spannende Geschichte erzählen, sondern soll gleichzeitig ein touristischer Begleiter sein, eine andere, besondere Art von Reiseführer. Denn in den Roman sind systematisch Informationen über Mallorca (und Menorca) integriert, von der wechselvollen Geschichte über die Künstler und Gelehrten bis hin zu den Sehenswürdigkeiten. Und damit das Ganze nicht zu trocken gerät oder gar auf den Magen schlägt, wird in diesem Buch mit großer Hingabe gegessen und getrunken. Mit dem Ergebnis, dass wohl fast alle bekannten Restaurants der Insel vorkommen. Mehr noch – einige der Spitzenköche Mallorcas mischen sich für kurze Episoden höchstpersönlich unter die handelnden Personen. Außerdem verraten sie im Registro turistico einige ihrer feinsten Rezepte. Das Buch ist also ein ausgesprochen kulinarischer Roman, bei dem die Wahl schwer fallen soll zwischen einem Kaninchensalat mit Serranoschinken und einem Cap-Roig auf Kartoffelscheiben, zwischen einem tiefroten Manto Negro aus Binissalem und einem leichten Chardonnay aus Porreres.
Damit das Buch tatsächlich auch als Rezeptsammlung, als Reise-, Restaurant- und Hotelführer genutzt werden kann, gibt es ein umfassendes Registro turistico. Dieses liefert kompakte Informationen – bis hin zu Adressen und Telefonnummern. Auf diese Weise wäre es übrigens ein Leichtes, auf den Spuren der Handlung zu wandeln und (schlemmend) die Originalschauplätze aufzusuchen.
So viel zum Konzept des Buchs, das den eigentlichen Roman nicht in den Hintergrund drängen soll. In erster Linie wird eine abenteuerliche Geschichte erzählt, die an Ereignisse anknüpft, welche vor knapp einem Jahr auf Mallorca geschehen sind. Wer das Buch Sturm über Mallorca gelesen hat, der wird wissen, von wem eingangs die Rede war. Wer die junge Frau ist, die nicht nur gute Erinnerungen an Mallorca hat. Und wer der Mann ist, der – obwohl er die Insel liebt – nie mehr einen Fuß auf ihren Boden setzen möchte. Und für alle, die die Vorgeschichte nicht kennen – man muss nur die richtigen Zeitungen und Magazine lesen!
Que gaudiu amb la lectura del llibre i bon profit!
Süddeutsche Zeitung,
Seite 12, Panorama
Todeserklärung in Vorbereitung
Zeugenaussagen vor dem Amtsgericht abgeschlossen –
Dr. Felix Reiter stirbt nun auch de jure
Frankfurt – Fast auf den Tag genau vor neun Monaten ist der Devisenspekulant und mutmaßliche Millionenbetrüger Dr. Felix Reiter vor der Küste Mallorcas mit seiner Yacht in einen schweren Sturm geraten. Alle Indizien sprechen dafür, dass er dabei von Bord gespült wurde und ertrunken ist. Da aber seine Leiche nie gefunden wurde, soll sein Tod nun im Rahmen eines Verschollenheitsverfahrens auch juristisch besiegelt werden. Gestern wurde vor dem Amtsgericht Frankfurt die Einvernahme der Zeugen abgeschlossen. Unter ihnen befand sich die Münchner Studentin Dana Mohnert, die sich an jenem schicksalhaften Tag bei Dr. Felix Reiter auf seiner Yacht befunden hatte. Ihre Aussage haben Journalisten bestätigt, die Dr. Felix Reiter, nach dem international gefahndet wurde, auf Mallorca kurz vor dem verhängnisvollen Sturm observiert hatten. Nähere Einzelheiten erfuhr das Amtsgericht vom privaten Ermittler S. Späth, der den flüchtigen Fondsmanager auf der Baleareninsel aufgespürt und bereits die deutschen Strafverfolgungsbehörden benachrichtigt hatte. Auf Grund der übereinstimmenden Zeugenaussagen und der Protokolle der spanischen Behörden ist die Todeserklärung gemäß § 39 VerschG nur noch reine Formsache. Sie kann allerdings frühestens nach Ablauf eines Jahres erfolgen. Dann wird Dr. Felix Reiter auch de jure nicht mehr am Leben sein. Für das Bundeskriminalamt ist er dies ohnehin nicht mehr: Die Fahndung nach ihm ist zwar formal nicht eingestellt, die Sonderkommission aber längst aufgelöst. Was bleibt, ist die Suche nach den geschätzten 150 bis 200 Millionen Euro Anlagegelder, die seit dem spektakulären Zusammenbruch seines Investmentfonds verschwunden sind.
Bunte, Seite 16,
Leute von Gestern
DR. FELIX REITER
Nasses Grab vor Mallorca
Manche hatten immer noch die Vision, dass der smarte Dr. Felix Reiter, 46, unter einer Palme liegt und im lauen Südwind seine ergaunerten Millionen zählt. Doch so paradiesisch ist es um den Devisenspekulanten aus Frankfurt nicht bestellt. Zeugenaussagen, Protokolle der spanischen Guardia Civil und schwer wiegende Indizien haben zweifelsfrei bestätigt, dass Reiter im Spätsommer letzten Jahres buchstäblich untergetaucht ist – für immer. Er ist wenige Meilen vor der Küste Mallorcas ertrunken. Bis zu einer amtlichen Todeserklärung wird es noch einige Monate dauern – endgültiger Schlusspunkt eines der aufregendsten Kriminalfälle aus der Welt der Finanzen. Zurück bleibt (neben Pleite gegangenen Investoren und frustrierten Staatsanwälten) ein gebrochenes Herz – das von Reiters letzter Liebe, der Münchner Studentin Dana Mohnert, 29.
Der Spiegel,
Seite 115, Wirtschaft
FELIX REITER
À fonds perdu!
Auf Nimmerwiedersehen dürfte das Geld der institutionellen Anleger verschwunden sein, die vor nunmehr drei Jahren mit der Futures Management Inc. des Finanzjongleurs Dr. Felix Reiter in die Pleite gerauscht waren. Zur Erinnerung: Als er Anlagegelder in Milliardenhöhe in einer wahnwitzigen Devisenspekulation gegen den Yen verheizt hatte, war es dem dazumal hoch geachteten Reiter gelungen, seinen Kunden einige weitere hundert Millionen abzuluchsen und mit dieser prall gefüllten Urlaubskasse in den unverdienten Vorruhestand zu flüchten. Eine Verhaftung nach gut zweieinhalbjähriger Fahndung scheiterte am plötzlichen Tod des Zielobjektes durch Ertrinken. Wie es nunmehr scheint, sind auch alle Versuche misslungen, die von Reiter unterschlagenen Millionen wieder aufzuspüren. Sie haben sich wohl endgültig im Bermudadreieck anonymer Konten zwischen der Schweiz, den Bahamas und den Cayman-Inseln verflüchtigt. Was bei den betroffenen Anlegern – allesamt Vorstandsmitglieder großer Unternehmen, die sich freilich nur mit Firmengeldern ins Unglück gestürzt haben – zu tiefen Depressionen und unfreiwilligen Rücktrittsgedanken führen dürfte.
1
Der Länge nach hingestürzt, schlitterte sie, mit den nackten Füßen voran, über den stark geneigten Boden aus Mahagoniholz. Durch eine geöffnete Luke ergoss sich eine Sturzflut von Meerwasser in die Kajüte. Dumpf schlug ihr Kopf gegen eine Kante. Von irgendwo kam eine Flasche geflogen, verfehlte nur knapp ihre Schläfe und zersplitterte am Kartentisch. Wie von Geisterhand hob sich die führerlose Yacht plötzlich in die entgegengesetzte Richtung. Sie bekam eine Stange aus poliertem Aluminium zu fassen. Für einen kurzen Augenblick sah sie den schwarzen Himmel, dann die weiße Gischt eines heranrollenden Brechers. Am gestreckten Arm rotierte ihr Körper unaufhaltsam nach links. Ein stechender Schmerz durchzuckte ihr verdrehtes Schultergelenk. Zum Pfeifen und Heulen des orkanartigen Sturms kam das nervtötende, fetzige Schlagen des zerrissenen Sonnensegels. Aus dem tiefen Schiffsrumpf drang das gleichmäßige Wummern der schweren Dieselmotoren durch den überfluteten Kajütboden. Jetzt hatte ihr linker Fuß an einer Stufe Halt gefunden. Gerade noch hing ihr Gewicht am rechten Arm, nun stiegen die Beine immer höher. Kopfüber sah sie durch ein gesprungenes Kajütfenster, wie ein gleißender Blitz ins schäumende Meer fuhr. Sekundengleich traf die Druckwelle eines gewaltigen Donnerschlags auf ihre Trommelfelle …
Mit aufgerissenen Augen und schweißnasser Stirn fand sich Dana auf dem Bett sitzend wieder. Die Morgensonne fiel durch die hellen Gardinen. Aus dem Garten vor ihrem Schlafzimmer war das Zwitschern eines Vogels zu hören. Dana schlug die Bettdecke zurück. Jetzt hatte sie schon wieder diesen schrecklichen Traum gehabt. Das durfte doch wohl nicht wahr sein, dass sie dieser Sturm immer wieder aufs Neue heimsuchte! Ein drei viertel Jahr nun lag er bereits zurück. Und sie war kein altes verschrecktes Weib, schalt sie sich selbst, sondern eine junge selbstbewusste Frau, die keine Lust hatte, sich von einem lächerlichen Sturm terrorisieren zu lassen. Das war das letzte Mal, nahm sie sich fest vor, dass sie von diesem Erlebnis geträumt hatte. Dana ballte ihre rechte Hand zur Faust. Sie hatte überlebt. Punkt. Sie war weder über Bord gegangen, noch war die Yacht gesunken. Ausrufezeichen. Sie war nicht mehr auf Mallorca, sondern in ihrem Apartment in München. Es gab verdammt noch mal keinen Grund, sich immer wieder diesem Stress auszusetzen. Nicht einmal im Traum!
2
Das Messer hatte einen Griff aus schwarz poliertem Holz. Es war nicht mehr neu, wies deutliche Gebrauchsspuren auf, aber die spitz zulaufende Klinge aus rostfreiem Stahl war von makelloser Güte. Mit dem Daumen fuhr Kay prüfend über die scharfe Schneide. Er hätte für diesen Zweck ein Messer mit feinen Zacken bevorzugt, aber es würde auch so gehen.
Aus dem Wohnzimmer nebenan war Frédéric Chopins Ballade Nr. 4 in f-Moll zu hören. Er liebte an der letzten und größten Ballade Chopins ganz besonders diese ruhigen, ja, traurigen Auftaktklänge. Erst langsam würde sich die Leidenschaft steigern, um dann immer furioser dem Höhepunkt entgegenzustreben.
Kay blickte sein Ziel fest an, kniff die Augen zusammen und fuhr sich mit dem linken Handrücken über die Lippen. Dann setzte er entschlossen das Messer an. Mit dem Aufplatzen der Haut spritzte es rot über die Seiten einer nahe liegenden Zeitung. Geschmeidig glitt die Klinge durchs Fleisch. In wenigen Sekundenbruchteilen war der Akt vollzogen.
Bei der Ballade Nr. 4 von Chopin drängte sich nun ein zweites Thema in B-Dur in die schmerzlich getragene Einleitung. Woran es wohl lag, dass ihm Chopins Musik so ans Herz ging? Es hatte wohl kaum etwas mit Chopins Winter im Kartäuserkloster von Valldemossa zu tun. Auch nicht damit, dass seine Liebe zu George Sand ebenso groß wie tragisch war.
Kay hob das Messer und setzte zu einem neuen Schnitt an. Er würde die reifen Tomaten in kleine Stücke schneiden. In der Kasserolle brieten bereits gehackte Knoblauchzehen in Olivenöl. Die Tomaten würde er in Kürze hinzufügen und gemeinsam mit dem Knoblauch köcheln lassen. Es fehlten noch Zucchini, Auberginen und Paprikaschoten. Schließlich würde er das Ganze mit frittierten, fest kochenden Kartoffeln in einen Tontopf schichten, mit Tomatensoße übergießen und im vorgeheizten Ofen knapp eine halbe Stunde garen lassen. Dann war der Tumbet fertig, jene herzhafte Spezialität, die er auf Mallorca kennen und lieben gelernt hatte.
Kay zog das Geschirrtuch aus seinem Gürtel und versuchte, die Zeitung von den Tomatenspritzern zu reinigen. Quer über den Artikel zur gerichtlichen Verhandlung des Todes von Dr. Felix Reiter hatten die Paradiesäpfel, die einst Kolumbus aus Amerika nach Spanien gebracht hatte, ihre Spur gezogen. Kay musste schmunzeln. Ob das eine tiefere Bedeutung hatte? Aber ihm war es fast egal, zu welchem Schluss die Justiz kommen würde. Felix Reiter war tot. Und er hatte wahrlich nichts dagegen einzuwenden. Kay hielt das Messer unter das fließende Wasser. Gewiss, Felix Reiter hatte dieses Schicksal nicht verdient, auch wenn man ihm einiges vorwerfen konnte. Aber es war besser so. Entschieden besser!
Einige Minuten später stand er auf der Terrasse des kleinen Bauernhauses und sah über knorrige Olivenbäume hinaus aufs Meer. Die CD mit Chopins Meisterwerken war mittlerweile bei der g-Moll-Sonate für Cello und Klavier angelangt. Kay drehte nachdenklich das Weinglas, hielt es gegen die untergehende Sonne. Granatrot schimmerte der Manto Negro aus Binissalem, ein schwieriger Wein, aber vielleicht gerade deshalb so typisch für Mallorca. Mallorca? Nun, wenn man den kräftigen Rotwein trank, Chopin hörte, einem aus der Küche der Duft von Auberginen, Knoblauch und Zucchini in die Nase stieg, man aufs glitzernde Meer blickte, dann war Mallorca ganz nah.
Er atmete tief durch. Es war an der Zeit, einige Erinnerungen aufzufrischen. Kay nahm einen Schluck vom Rotwein. Nein, natürlich nicht alle Erinnerungen. Darauf konnte er getrost verzichten. Aber zumindest jene an eine junge, verdammt gut aussehende, begehrenswerte Frau. Kay schloss für einige Sekunden die Augen, dann drehte er sich um und ging zurück ins Haus. Vorerst verlangte der Tumbet noch seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ob er etwas Rotwein in die Soße gießen sollte?
3
Der Passeig des Born ist die historische Fußgängerpromenade Palmas. Er wird von Schatten spendenden Platanen gesäumt; es gibt viele Steinbänke. An beiden Enden des Passeig des Born stehen rätselhafte Sphinx-Figuren. Sam lief auf den Obelisken zu, der an der Plaça del Rei Joan Carles I. inmitten eines ringförmigen Brunnens mit wasserspeienden Löwen auf vier viel zu kleinen steinernen Schildkröten thront. Auf seiner Spitze ist seltsamerweise eine Fledermaus zu sehen.
Am Zeitungskiosk kaufte er eine deutsche Tageszeitung. Kurz entschlossen überquerte er die Straße trotz roter Fußgängerampel und intensivem Verkehr, was zu wilden Bremsmanövern und einem aufgeregten Hupkonzert führte. Als er in aller Ruhe und ohne Blessuren den gegenüberliegenden Bürgersteig erreicht hatte, fühlte er sich schon besser. Ab und zu brauchte es eben einen kleinen Adrenalinschub, um am späten Vormittag in die Gänge zu kommen. Auf das penetrante Hupen freilich hätte er verzichten können. Sam langte sich an die Schläfen. Er war heute etwas geräuschempfindlich. Nicht auszuschließen, dass er gestern Abend einen Brandy zu viel getrunken hatte.
Er setzte die Sonnenbrille auf und ließ sich in der Bar Bosch an einem der runden Tischchen unter einem weißen Schirm nieder. Die Zeitung legte er auf einen freien Stuhl. Ein Fingerzeig genügte, kurz darauf wurden ihm der obligatorische Café con leche und eine Ensaïmada serviert. Es hatte zweifellos seine Vorzüge, wenn man zu den Stammgästen zählte. Fast jeden Tag pflegte er hier sein Frühstück einzunehmen. Der Straßenverkehr und die Autoabgase störten ihn nicht. Hier pulste wenigstens das Leben.
Sam sah auf die Uhr. Jeden Augenblick musste dieser Typ aus Düsseldorf auftauchen, der ihn gestern angerufen hatte. Er hatte keine Ahnung, was der von ihm wollte. Hoffentlich nichts, was ein intensives Nachdenken verlangte. Dazu sah er sich zu so früher Stunde noch nicht in der Lage.
»Entschuldigen Sie, sind Sie Herr Späth? Der Ober sagte mir …«
»Späth? Ich bin mir da heute nicht so sicher, aber wenn’s der Ramón sagt, wird’s wohl stimmen. Bitte nehmen Sie Platz!«
Sam deutete auf einen freien Stuhl und warf einen kurzen, prüfenden Blick auf seinen Besucher. Heller Anzug, feinstes Leinen, Seidenhemd, Uhr von Bulgari, gepflegte Hände, Ehering, rötliches Gesicht, fortschreitender Haarausfall, vermutlich Ende fünfzig. Sam war mit der Examinierung zufrieden. Sah nach einem einigermaßen liquiden neuen Klienten aus. »Mein Name ist Hasfurth, Hans-Peter Hasfurth, wir haben gestern telefoniert.«
Auch Hasfurth versuchte sich einen ersten Eindruck von seinem Gesprächspartner zu machen. Dieser Sam Späth war ihm von einem Bekannten empfohlen worden. Sollte ein fähiger Privatdetektiv sein. Etwas raubeinig und unbeherrscht, aber absolut professionell. Nun, er hatte ja auch kein besonders schwieriges Anliegen. Für einen Schnüffler wahrscheinlich tägliche Routine. Dieser Späth hatte alte Cowboystiefel, verwaschene Blue Jeans, ein verknautschtes und nicht ganz sauberes Polohemd offen über der Hose an und eine dunkle Sonnenbrille auf. Eine Rasur hätte ihm nicht geschadet. Er machte auf Hasfurth einen ziemlich kräftigen Eindruck. Wäre bestimmt ein guter Leibwächter, dachte er. Aber körperliche Fitness war für den anstehenden Job unerheblich. Hauptsache, er konnte fotografieren. Jedenfalls sah Sam Späth genauso aus, wie man sich klischeehaft einen Privatschnüffler vorstellte. Und dann noch dieser Name!
»Sagen Sie, Ihr Name, Sam Späth, der ist doch für einen Mann mit Ihrem Beruf …?«
Sam winkte gelangweilt ab. »Für meinen Nachnamen kann ich nichts, okay? Und den Vornamen habe ich schon als sabbernder Säugling abbekommen. Mein Vater hat leidenschaftlich Dashiell Hammett gelesen und für Sam Spade geschwärmt. War sozusagen eine frühkindliche Prägung oder wie das heißt. Aber Sie sind ja wohl nicht hierher gekommen, um über meinen Namen zu philosophieren. Dazu hätte ich nämlich wenig Lust.«
Hasfurth räusperte sich. »Nein, natürlich nicht. Ich würde Ihnen gerne einen Auftrag erteilen.«
»Nur zu, tun Sie sich keinen Zwang an!«
»Also, ich habe eine Finca in der Nähe von Portocolom.«
»Schön für Sie.«
»Ja, und eine bezaubernde Frau.«
»Noch schöner, Sie sind ja ein Glückskind.«
»Dachte ich auch, aber momentan kommen mir Zweifel. Sie müssen wissen, ich habe viel zu arbeiten. Ich besitze eine Firma in Düsseldorf, um die ich mich kümmern muss. Meine Frau verbringt die meiste Zeit in unserer Finca auf Mallorca, und ich pendle zwischen Düsseldorf und Mallorca hin und her. Auch jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Flughafen. Mein Flieger geht in knapp zwei Stunden. Am übernächsten Wochenende erst komme ich zurück.«
»Alles klar, wo ist das Problem?«
»Nun, meine Frau ist auf Mallorca viel alleine. Und wie ich schon andeutete, sieht sie sehr gut aus. Sie ist auch etwas jünger als ich.«
Sam grinste. »Und nun wollen Sie wissen, ob Ihnen Ihre hübsche Frau während Ihrer Abwesenheit Hörner aufsetzt, oder?«
Hasfurth atmete erleichtert auf. »Ja, genau. Es fällt mir irgendwie schwer, diesen Verdacht auszusprechen. Eine Ehe basiert ja auf gegenseitigem Vertrauen. Aber meine Gabriele kommt mir in letzter Zeit so verändert vor …«
Sam nahm langsam die Sonnenbrille ab und sah Hasfurth in die Augen. »Wollen Sie meine ehrliche Meinung hören?«
Hasfurth schaute irritiert. »Ich bitte darum.«
»Sie brauchen meine Hilfe nicht, und das Geld können Sie sich sparen. Natürlich betrügt Sie Ihre Gabriele, das machen alle Frauen, die von Ihren Männern, die daheim dem schnöden Mammon nachjagen, auf der Insel geparkt werden. Das ist völlig normal. Eine Frage der Hormone.«
»Das können Sie doch nicht so pauschal sagen«, entrüstete sich Hasfurth.
»Okay, Ausnahmen bestätigen die Regel. Mag in Einzelfällen vorkommen, ist aber wider die Natur. Und woher wollen Sie wissen, dass gerade Ihre Gabriele ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat?«
»Genau das sollen Sie ja für mich herausbekommen!«
»In Ordnung, überredet. Aber machen Sie mir hinterher keine Vorwürfe. Die Wahrheit ist oft schwer zu ertragen.«
»Haben Sie einen Fotoapparat?«
»Na klar, dachten Sie, ich arbeite mit Leinwand und Pinsel?«
Hasfurth zog einen Umschlag aus dem Jackett. »Hier habe ich für Sie ein Foto von Gabriele, hier noch eines mit ihrem schwarzen Cabriolet im Hintergrund, außerdem ein Bild meiner Finca und die genaue Adresse mit Anfahrtsskizze. Und hier ist meine Visitenkarte. Rufen Sie mich an, sobald Sie was wissen?«
Sam nahm den Umschlag entgegen. »Okay, mach ich, kann aber etwas dauern, vor allem, wenn ich Ihre Holde nicht gleich auf frischer Tat ertappe, was ja offensichtlich auch Ihre Hoffnung ist. Aber ich gebe Ihnen auf jeden Fall bereits vor dem nächsten Wochenende einen Zwischenbescheid.«
»Wie hoch ist Ihr Honorar?«
»Sage ich Ihnen hinterher. Sie werden es sich leisten können. Als Vorschuss dürfen Sie mir einen Tausender überweisen. Spesen gehen extra. Hier haben Sie meine Karte, mit meiner Bankverbindung.«
»Tausend Euro? So viel? In Ordnung, ich werde das gleich veranlassen.«
Hasfurth stand abrupt auf, gab Sam die Hand, sprach einige Abschiedsworte und eilte davon.
Sam Späth schüttelte den Kopf. »Rausgeschmissenes Geld«, murmelte er und zog das Foto der Ehefrau aus dem Umschlag. »Uuups, sieht ja wirklich gut aus, die Kleine. Und die soll treu sein? Da lachen ja die Hühner.« Sam grinste. Ihm kam der Gedanke, dass er die Sittsamkeit dieser Señora einem persönlichen Praxistest unterziehen sollte, sozusagen Ermittlungen im freiwilligen Selbstversuch, hatte er dazu doch in gewisser Weise den offiziellen Auftrag des Ehemanns. Sam kicherte. Der Tag fing an Spaß zu machen. Er lehnte sich zufrieden zurück, gab dem Ober ein Zeichen und bestellte einen Carajillo, einen Espresso mit Brandy. Es war langsam an der Zeit, die Lebensgeister zu wecken.
Sam nahm die Zeitung, um unkonzentriert in ihr zu blättern. Plötzlich war er hellwach. »Todeserklärung in Vorbereitung«, las er. »Zeugenaussagen vor dem Amtsgericht abgeschlossen – Dr. Felix Reiter stirbt nun auch de jure. Fast auf den Tag genau vor neun Monaten ist der Devisenspekulant und mutmaßliche Millionenbetrüger Dr. Felix Reiter vor der Küste Mallorcas mit seiner Yacht in einen schweren Sturm geraten. Alle Indizien sprechen dafür, dass er dabei von Bord gespült wurde und ertrunken ist …«
Sam las rasch weiter. Einige Zeilen später stieß er auf seinen eigenen Namen. Tatsächlich war er vor zwei Wochen in Frankfurt vorgeladen gewesen, und man hatte ihn zu den Vorfällen im letzten Jahr befragt. Allerdings hatte er der Rechtspflegerin auch nichts anderes erzählen können, als dass der Flüchtige vor dem Sturm noch auf der Yacht gewesen war und hinterher nicht mehr. Und da Reiter nicht die Kunst des Wandelns auf dem Wasser beherrschte, war er wohl ersoffen. Leider und zu seiner großen Enttäuschung. Jetzt war also auch das Gericht zu dem Schluss gekommen, dass dieser Felix Reiter sein hoffnungsvolles Leben als Fischfutter abgeschlossen hatte? Und in einigen Monaten würde er dann für tot erklärt werden. Davon hatte der Sportsfreund auch nichts mehr. Und er selbst am allerwenigsten.
Sam trank den Carajillo in einem Zug leer. Das war wirklich dumm gelaufen, absolut saudumm. Da hatte er sich als Mitarbeiter einer Frankfurter Detektei die Hacken abgelaufen und schließlich eine heiße Spur entdeckt, die nach Mallorca führte. Und was die Kollegen vom BKA nicht geschafft hatten, das war ihm gelungen. Er hatte Felix Reiter auf seiner Yacht gefunden. Und dann, unmittelbar vor dem Zugriff, war dieser idiotische Sturm übers Meer gezogen und hatte Felix Reiter über Bord gespült. Einzig eine rote Schwimmweste hatte die Seenotrettung im aufgewühlten Meer gefunden und das kieloben treibende Dingi der Aurore – so hieß die Yacht. Diese Freundin von ihm, Dana, die wohl wirklich nichts von seiner Vergangenheit geahnt hatte, musste von der Küstenwache geborgen werden. Für Felix Reiter war’s eine unfreiwillige Seebestattung. Und für ihn eine entgangene satte Provision.
Sam bestellte einen weiteren Carajillo. Den Job bei der Detektei Lummer hatte er trotzdem hingeschmissen. Dafür musste er dem Felix Reiter eigentlich dankbar sein. Er wäre sonst nie nach Mallorca gekommen. Und er hätte nie rausgefunden, dass die Insel für ihn wie maßgeschneidert war. Erstens gefiel es ihm hier total gut. Und zweitens konnte er auf Mallorca muy fácil sein Geld verdienen. Der äußere Schein trog. Erfreulicherweise gab es in diesem Paradies herrlich viel Hader und Zwist. Da wurden Einbrüche verübt, Menschen erpresst, ungedeckte Schecks ausgestellt … Ein schier unbegrenztes Betätigungsfeld für einen Mann mit seinen Fähigkeiten.
»Hola, mein Lieber! Hab ich doch gedacht, Sammy, dass ich dich hier finde. Ich darf mich setzen? Bussi.«
Sam wurde aus seinen Gedanken gerissen. Die Bar Bosch war wirklich das ultimative Kommunikationszentrum von Palma. Lange konnte man hier nicht sitzen, bis jemand vorbeikam, den man kannte. Raymond war einer seiner besten Kunden. Ein etwa dreißigjähriger Industrieerbe aus dem Rheinland, der in einer großzügigen Villa bei Port d’Andratx lebte und sich dort als Maler selbst verwirklichte.
Erstaunlicherweise waren Raymonds Bilder sehr begehrt. Ihm persönlich gefielen sie überhaupt nicht, viel zu bunt. Aber er war ja auch kein Kunstkritiker. Dass Raymond stockschwul war, hatte ihn nur am Anfang gestört. Mittlerweile amüsierte ihn das tuntenhafte Auftreten seines Freundes, der einen herzensguten Kern hatte, aber leider ständig in irgendwelchen Schwierigkeiten steckte. Was hieß leider? Von solchen Schwierigkeiten lebte er schließlich. Und Raymond konnte seine Hilfe wirklich gebrauchen. Nur aus seinen wirren Beziehungskisten sollte er ihn raushalten, darauf hatten sie sich geeinigt.
Raymond zog die getuschten Augenbrauen nach oben. »Geht’s dir gut, Sammy, du siehst so blass aus?«
»Mach dir keine Sorgen, Raymond, mir geht’s immer gut! Ganz im Unterschied zu dir.«
Raymond fuhr sich beleidigt durch die Haare. »Es kann ja nicht jeder so stark sein wie du.« Und nach einer kurzen Pause: »Als ob du es geahnt hättest, dass ich ein klitzekleines Problem habe, bei dem du mir helfen könntest.«
»Heute sprudeln die Aufträge ja nur so rein. Lass hören.«
»Kennst du diesen Hubertus Reinersburg?«
»Den Immobilienhändler, der immer mit dem weißen Bentley rumfährt?«
»Ja, genau. Der hat drei Bilder von mir gekauft und schon vor Wochen abgeholt. Und jetzt zahlt er nicht. Ich finde das völlig unakzeptabel. Dabei war er früher mal so nett.«
»Raymond, du darfst bei den Menschen nie nach dem Äußeren gehen, das musst du dir abgewöhnen. Mache ich doch bei dir auch nicht.«
»Sammy, du bist so direkt! Aber jetzt ist er auch nicht mehr nett. Schon lange nicht mehr. Er hat gesagt, ich sei eine dumme Schwuchtel und solle ihn gefälligst in Ruhe lassen. Und er hat mich bei meinem letzten Besuch in einen Rosenbusch geschubst. Er zahle, sobald er wieder flüssig sei. Aber die Bilder gibt er mir auch nicht zurück. Ich glaube fast, er ist ein Hochstapler. Außerdem ist er aggressiv, und das mag ich nicht!«
Sam schlug mit der Hand nach einer Fliege. »Mach dir keine Sorgen, Raymond. Ich werde ihm einen Besuch abstatten.«
»Aber tu ihm nicht weh!«
4
Dana stand an Deck der Fähre, der Wind fuhr ihr durch die Haare, die Luft schmeckte nach Salz. Die alberne Perücke hatte sie abgenommen und in ihrem Rucksack verstaut. Auch das abscheuliche geblümte Kleid war ausgemustert. Jetzt hatte sie kurze Hosen, Turnschuhe und ein Jeanshemd an. Dana schloss die Augen, atmete tief ein und hielt einen Moment lang die Luft an. Vor einigen Tagen war sie noch schweißgebadet aufgewacht, weil sie von diesem Sturm geträumt hatte. Fest hatte sie sich vorgenommen, nicht mehr daran zu denken. Und dann war dieser Telefonanruf gekommen. Sofort hatte sie die Stimme wiedererkannt. Ob sie ihn nicht mal besuchen wolle, hatte er gefragt. Ohne seinen Namen zu nennen und so selbstverständlich, als würde er in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnen. Sie hatte nicht lange überlegt und spontan die Einladung angenommen. Hinterher war ihr bewusst geworden, dass sie insgeheim wohl schon seit längerem darauf gewartet hatte.
Dana machte die Augen wieder auf und sah über die Reling hinaus aufs Meer. Glatt und friedlich lag es da. Vielleicht half diese Reise, den Albtraum endgültig zu vergessen. Jedenfalls kam sie dem Ziel ihrer Reise immer näher, einem Ziel, von dem sie noch vor kurzem nicht gewusst hatte, wo es lag. Aber jetzt war es nicht mehr fern. Sie musste zugeben, dass sie der Ankunftshafen der Fähre mehr als überrascht hatte.
Losgegangen war die Odyssee am gestrigen Tag in München. Auf ihrem Handy war am Morgen eine kurze Nachricht eingetroffen. Der Aufforderung folgend, hatte sie in ihrem Briefkasten einen Umschlag mit einem Flugticket gefunden. Es war auf ihren Namen ausgestellt und führte über Frankfurt nach St. Petersburg in Russland. Der Abflug mit der LH 199 war bereits um fünf nach zehn gewesen. Sie hatte sich beeilen müssen, um den Flieger noch zu erreichen. In Frankfurt angekommen, hatte sie erneut ihr Handy eingeschaltet. Seine SMS war ebenso kurz wie eindeutig gewesen. Den gebuchten Weiterflug nach St. Petersburg solle sie sausen lassen und stattdessen mit dem Schlüssel, der sich mit dem Ticket im Umschlag befunden hatte, ein bestimmtes Schließfach öffnen. Dort hatte sie dann eine Tasche mit der schwarzen Perücke und dem spießigen Kleid gefunden, außerdem weitere Reiseanweisungen, Flugtickets und Bahnfahrkarten, ausgestellt auf die unterschiedlichsten Namen. Mit dem Bus war sie von Frankfurt nach Düsseldorf gefahren, von dort mit der Lufthansa nach Paris geflogen, dann vom Flughafen Charles de Gaulle zum Bahnhof und per Schlafwagen nach Barcelona. Bei allen Zwischenstationen hatte sie auf ihrem Handy kurze Nachrichten vorgefunden, die sie sozusagen fernsteuerten. Und es hatte alles perfekt geklappt, fast unheimlich perfekt. Sogar von der Verspätung ihres Flugs nach Paris hatte er gewusst. Und auch, dass sie sich am Flughafen verlaufen hatte. Da hatte sie einen leichten Schauder verspürt und sich fortan ständig umgesehen.
Aber jetzt, auf dem Deck der Fähre, unter dem tiefblauen Himmel und mit dem Wind in ihren Haaren, da waren die Strapazen der Anreise vergessen. Eine Stunde noch, dann würde die Fähre in Maó, dem großen Hafen im Südosten Menorcas, ankommen. Auf ihrem Handy hatte sie bereits kurz nach dem Ablegen in Barcelona eine SMS erreicht: »Letzte Etappe. Erwarte dich auf Menorca. Hasta luego.«
Dana beugte sich über die Reling und sah den steilen Schiffsrumpf hinunter auf die weiße Gischt des Kielwassers. Wieder fiel ihr der fürchterliche Sturm ein. Um einen Temporal huracanado hatte es sich gehandelt, wie später in den Zeitungen stand, die das Meteorologische Institut in Porto Pí zitierten, um einen ausgewachsenen Orkan! Heftiges Schaukeln, dumpfe Schläge und ein unheimliches Pfeifen hatten sie in der Gästekajüte geweckt. Als sie sich schließlich an Deck hochgekämpft hatte, musste sie feststellen, dass sie alleine auf dem Schiff war. Mächtige Wellen waren herangerollt und hatten die schwere Yacht wie ein Spielzeugschiff hin und her geworfen. Dann war sie gestürzt und über den Kajütboden geschlittert …
Dana gab sich einen Ruck, wendete sich von der Reling ab und sah hinauf zum blauen Himmel. Nein, heute schien definitiv die Sonne. Weit und breit kein Sturm. Und sie wollte wirklich nicht mehr über die traumatischen Erlebnisse des letzten Jahres nachdenken. Vielmehr sollte sie sich auf das bevorstehende Wiedersehen freuen. Was freilich auch nicht ganz ohne war. Sie musste sich eingestehen, dass sie dem Treffen durchaus zwiespältige Gefühle entgegenbrachte. Einerseits war sie immer noch sauer auf ihn. Was heißt sauer? Wütend! Er hätte sie nie so ihrem Schicksal ausliefern und mit seinem Tod konfrontieren dürfen. Trauer hatte sie empfunden, echte Verzweiflung. Um dann herauszubekommen, dass er noch lebte. Andererseits hatte sie ihm längst vergeben, was wohl daran lag, dass sie sich immer noch zu ihm hingezogen fühlte. Wie sehr, das allerdings vermochte sie nicht so recht einzuschätzen. Die räumliche und zeitliche Distanz waren da wenig hilfreich. Aber um das herauszufinden, hatte sie sich ja auf diese Reise begeben. Dass die Anfahrt so beschwerlich werden würde, hatte sie nicht ahnen können. Die Vorsichtsmaßnahmen deuteten auf einen massiven Verfolgungswahn hin. Dana fuhr sich lächelnd durch die Haare. Aber irgendwie war das ja zu verstehen. Und eines musste sie auch zugeben: Seine ungewöhnlichen Lebensumstände verliehen ihrer seltsamen Beziehung einen besonderen Charme.
Seine ungewöhnlichen Lebensumstände? Nun, das war gewiss eine allzu euphemistische Umschreibung. Dana hatte sich vorgenommen, der Realität ins Auge zu sehen. Fakt war, dass sie sich vor langen Monaten in jemanden verliebt hatte, der offenbar eines Verbrechens schuldig war. Nur hatte sie das damals nicht gewusst! Und es fiel ihr immer noch schwer, es wirklich zu glauben. Sie dachte daran, wie sie sich in Porto Portals kennen gelernt hatten. Auf der Terrasse des Wellies war das gewesen. Eine Zufallsbekanntschaft, wie das eben so im Urlaub passieren konnte, auch wenn sie darauf alles andere als erpicht gewesen war. Aber der Mann hatte ihr sofort gefallen – sein lässiges, selbstsicheres Auftreten, seine Gleichgültigkeit gegenüber Statussymbolen, sein leicht spöttischer Gesichtsausdruck, der sie an Steve McQueen im Film Thomas Crown ist nicht zu fassen erinnert hatte. Im Nachhinein musste sie über diese Assoziation schmunzeln – sie war in vielerlei Hinsicht fast prophetisch gewesen. Etwas mysteriös war er ihr vorgekommen, das musste Dana zugeben. Fast nichts hatte sie von ihm in Erfahrung bringen können. Aber so etwas steigert ja durchaus den Reiz einer Beziehung. Dass er kein armer Schlucker war, darauf hatte erst das Abendessen im Sternerestaurant Tristan hingedeutet. Seine Yacht, die in der Marina von Porto Portals vertäut war, hatte er zunächst mit keinem Wort erwähnt. Ja, und schließlich war sie auf der Yacht mitgefahren. Nicht sofort, sondern erst nach einigen Tagen. Rund um Mallorca hatte sie ihr Törn geführt, eine gemächliche Schiffsreise voller Lebensfreude und Leidenschaft. Eine gute Woche waren sie unterwegs gewesen, ein abschließendes Bad im »karibischen« Wasser vor dem Strand von Es Trenc, am Cabo Salinas vorbei, steuerbords die Insel Cabrera. Sie war unter Deck gegangen, um etwas zu schlafen. Und dann war er gekommen, aus heiterem Himmel, der Sturm, der ihrer Beziehung ein so plötzliches Ende bereitet hatte. Aber genau an diesen Sturm wollte sie nicht mehr denken …
Einige Stunden später saß Dana in Maó am Moll de Ponent auf einer steinernen Bank und wartete. Die große Mole, an der die Fähre von Trasmediterrànea angelegt hatte und auf der noch vor einer halben Stunde hektische Betriebsamkeit herrschte, war mittlerweile nahezu verwaist. Eine breite Treppe führte hinter ihr vom Hafen hinauf in die höher gelegene, malerisch wirkende Altstadt. Am Fuße der Treppe gab es einen Kiosco d’es Port, daneben mobile Verkaufsstände, die T-Shirts, Taschen und die üblichen Souvenirs feilboten. Links befand sich das alte Zollgebäude, in dem heute, wie sie einem Schild entnommen hatte, das Comisaria d’es Port untergebracht war, dahinter eine Reihe von Cafés und Restaurants. Dana warf einen kurzen Blick auf das Display ihres Handys. Keine Nachricht. Langsam wurde es ihr zu blöd. Sie hatte sich nicht den Strapazen dieser kuriosen Reise unterzogen, um hier einsam in der Sonne zu brüten. Zur Ablenkung las sie in einer Informationsbroschüre, die sie auf dem Schiff eingesteckt hatte.
Menorca sei in vielerlei Hinsicht die kleine Schwester Mallorcas, stand da geschrieben. Schon der Name gehe auf den Größenunterschied zurück. Die alten Römer hätten die größere Insel Balearis Mayorica genannt und die kleinere Balearis Menorica – Menorca. Auch habe Menorca nicht nur weniger Einwohner, sondern sehr viel weniger Touristen als Mallorca, was zum ursprünglicheren Charme der Insel beitrage. Menorca, das sei gleichzusetzen mit einem sanften Tourismus, mit nur wenigen Auswüchsen, die sich zudem auf bestimmte Regionen begrenzten. Menorca habe eine eher karge Landschaft, mit kahlen Hügeln, im Frühjahr grünen Wiesen, grasenden Kühen, weiß gestrichenen Häusern, steinernen Zeugnissen der vorchristlichen Talayot-Kultur, schönen und selten überfüllten Stränden, dem saubersten Wasser Spaniens, wenig Deutschen und viel Engländern. Im Winter, da blase vom Norden aus dem Golf von Lion der Wind über die Insel, der eine schützende Bergbarriere fehle, wie sie Mallorca mit der Serra de Tramuntana habe. Und es gebe nur zwei größere Städte. Ganz im Westen, Mallorca zugewandt, das romantische Ciutadella, eine alte Bischofsstadt mit einer tief ins Land einschneidenden, fjordähnlichen Bucht und einem bezaubernden Hafen. Und im Osten Mahón beziehungsweise auf Menorquin Maó, die Hauptstadt Menorcas, benannt womöglich nach dem Karthager Magon, dem Bruder Hannibals, der hier einst mit seinen Truppen Zuflucht suchte. Maó habe nach Pearl Harbor auf Hawaii den zweitgrößten Naturhafen der Welt. Man spüre die fast hundertjährige englische Herrschaft auf Menorca …
Dana hörte ein Motorengeräusch. Wie zur Bestätigung des gerade gelesenen britischen Einflusses auf Menorca sah sie einen alten Mini näher kommen. Der etwas ramponiert wirkende Wagen blieb direkt vor ihr stehen. Dana steckte die Broschüre in den Rucksack und stand auf. Die Beifahrertür wurde von innen geöffnet. Dana bückte sich und schaute ins Auto. Am Steuer saß leise lächelnd ein Mann, ziemlich schlecht rasiert, mit einer runden Nickelbrille und einer schwarzen Wollmütze. Er sah aus wie ein einheimischer Fischer – mit einem englischen Offizier zum Vater und einer Literaturprofessorin als Mutter. Aber er war es, da gab es keinen Zweifel.
»Was ist? Willst du nicht einsteigen?«, fragte er.
»Irgendwie habe ich mir deine Begrüßung herzlicher vorgestellt.«
»Das kommt schon noch, keine Sorge!«
5
Sam hatte seine Harley-Davidson bei einem Freund abgestellt und sich einen kleinen Lieferwagen ausgeliehen. Schließlich musste er Raymonds Bilder irgendwie transportieren. Denn dass der Immobilienhändler einfach bezahlen würde, daran glaubte er nicht. Sam parkte den Lieferwagen in Santa Ponça direkt auf dem Kiesweg vor dem Eingang der Villa. Den hübschen Rosenbusch hatte er mit Absicht unter die Räder genommen. Hatte Raymond nicht erzählt, dass er bei seinem letzten Besuch in einen Rosenbusch gestoßen wurde? Dass Sam beim Zurücksetzen auch noch eine junge Palme entwurzelte, war zwar ein Versehen, fand aber in keinster Weise sein Bedauern. Ein niedliches Anwesen hatte dieser Hubertus Reinersburg, man hätte es mit seinen Säulen und dem tempelähnlichen Giebel auch für ein mittelprächtiges Rathaus halten können. Sam war gerade dabei, einen Klingelknopf zu suchen, da öffnete sich die Eingangstür, zwei nichts sagende weibliche Geschöpfe traten heraus und verabschiedeten sich mit Wangenküsschen von Reinersburg. Sam machte ein paar Schritte zur Seite, um die Gespielinnen des Hausherrn vorbeizulassen – nach seinem Küchenpersonal sahen sie jedenfalls nicht aus.
Reinersburg warf einen entsetzten Blick auf den Lieferwagen, der auf dem Rosenbusch stand und hinter dem eine flachgelegte Palme hervorlugte.
»Sind Sie der Wahnsinnige, dem dieser Wagen gehört?«, fuhr er Sam an.
»In gewisser Weise ja, genau genommen ist es ein Leihwagen.«
Sam sah Reinersburg treuherzig an. Er liebte es, wenn andere Leute die Selbstbeherrschung verloren. Und sein dämlicher Blick verstärkte normalerweise diesen Effekt. Reinersburg enttäuschte ihn nicht.
»Sie werden mir den Schaden ersetzen! Ich werde Sie verklagen!«, schrie er.
Sam sah den beiden Damen nach, die in einem Cabriolet davonfuhren.
»Was für einen Schaden?«
Reinersburg schnappte nach Luft. »Der Rosenbusch, meine Palme, der Kiesweg.«
Sam wiegte zweifelnd den Kopf. »Da kommt bestimmt noch einiges dazu, wenn ich den Wagen wegfahre. Diese bemooste Steinfigur steht im Weg, und ich fürchte auch um die rosafarbenen Hochstämme.«
Reinersburg fasste sich an den Kopf. »Sie sind wirklich ein Wahnsinniger. Aus welcher Heilanstalt sind Sie denn ausgebrochen? Geben Sie mir sofort den Autoschlüssel, das Fahrzeug ist konfisziert!«
»Kon … was? Ich hab’s nicht mit den Fremdwörtern. Aber den Schlüssel geb ich nicht her. Darf ich nicht, ist nicht mein Auto. Wir können ja reingehen und die Polizei anrufen.«
Ehe Reinersburg zu reagieren vermochte, war Sam schon an ihm vorbei ins Haus geschlüpft.
»Halt, stehen bleiben! Verlassen Sie sofort mein Haus!« Reinersburg eilte hinter Sam her und versuchte ihn festzuhalten.
Sam blieb abrupt stehen, drehte sich um und hob die Arme. »Vorsicht. Langen Sie mich nicht an. Ich neige zu Gewalttätigkeiten.«
Tatsächlich blieb Reinersburg verunsichert stehen. Nur wenige Zentimeter trennten ihn von Sam. Vorsichtig wich er zurück.
Sam lächelte zufrieden. »Sehr vernünftig. Wir sollten uns nämlich kurz unterhalten. Und zwar nicht über ihren kümmerlichen Rosenbusch, sondern über die Bilder von Raymond. Entweder Sie bezahlen die Bilder jetzt sofort und direkt an mich, oder Sie zeigen mir, wo sie sind, und ich nehme sie mit. In beiden Fällen verspreche ich Ihnen, dass ich beim Rangieren Ihre Steinfigur und die Hochstämme verschone. Haben Sie das verstanden?«
Reinersburg sah Sam fragend an. »Was haben Sie mit Raymond zu tun?«
»Ich bin Raymonds Freund!«
»Sie? Der Freund dieser Schwuchtel? Das hätte ich nicht gedacht.«
»Ach so, ja, und das mit der Schwuchtel will ich von Ihnen nie mehr hören. Raymond ist ein sensibler Künstler.«
Offenbar hatte Sams missverstandene Aussage, dass er Raymonds Freund sei, ihn in Reinersburgs Augen zur gefahrlosen Memme mutieren lassen. Jedenfalls hatte sich der Hausherr wieder im Griff und wähnte sich in jeglicher Hinsicht überlegen.
»Junger Mann, Sie verlassen jetzt mein Haus, entfernen behutsam Ihr Vehikel und bestellen Raymond, dass ich die Bilder behalten und ihm irgendwann, und zwar zu einem Zeitpunkt, der mir passt, das Geld geben werde. Abzüglich des von Ihnen verursachten Schadens.« Reinersburg grinste hämisch. »Und dass er mich am Arsch lecken könne. Vielleicht bereitet ihm der Gedanke Vergnügen.«
Das scheppernde Lachen blieb Reinersburg im wahrsten Sinne des Wortes im Hals stecken. Er hörte noch Sams Stimme: »Falsche Antwort, Amigo!« Dann raubte ihm ein Magenschwinger fast das Bewusstsein. Er realisierte dumpf, wie er durch sein Haus in den Garten getragen wurde. Und just als er wieder Luft kriegte, sah er eine ihm wohl bekannte Wasseroberfläche näher kommen.
Sam stand am Pool und rieb sich zufrieden die Hände. Reinersburg tauchte prustend auf und schwamm hektisch an den gegenüberliegenden Rand des Pools. Sam bereitete es keine Mühe, ihm um das Becken zu folgen und rechtzeitig zur Stelle zu sein. Dabei hatte er noch ausreichend Zeit, eine angebrochene Flasche Cava aus einem Sektkühler zu nehmen. Reinersburg hielt sich am Rand des Pools fest und sah hinauf zu Sam, der gerade einen kräftigen Schluck trank. Sam wischte sich über die Lippen und rülpste. »Lo siento! Eigentlich trinke ich lieber Bier. Also, wo sind die Bilder?«
»Such Sie doch selbst, du Idiot.«
Sam schüttelte über so viel Starrsinn in gespielter Verzweiflung den Kopf, stieg Reinersburg mit seinen Cowboystiefeln auf die Hände und schubste ihn zurück ins Becken. Reinersburg schwamm auf die andere Seite, kam aber erneut zu spät an. Zunehmend geriet er in Panik. Sein Pool war so angelegt, dass er nirgends stehen konnte. Sam umkreiste Cava trinkend und in aller Ruhe den Pool. Immer wenn Reinersburg irgendwo ankam, war er schon da. Langsam verließen ihn die Kräfte. Und außerdem hatte er den Magenschwinger noch nicht verdaut.
Sam warf die geleerte Flasche hinter sich in die Wiese. »Ich hab nichts mehr zu trinken. Was ist? Willst du mir nicht langsam sagen, wo Raymonds Bilder sind?«
Reinersburg war kurz vor dem Untergehen. »Im ersten Stock«, stieß er hervor. »Im Schlafzimmer ist eine Kammer hinter dem Bett. Der Schlüssel liegt unter dem Kopfkissen.«
»Okay, Amigo, warum nicht gleich so?« Sam drohte mit dem Finger. »Und dass du mir keinesfalls auf die Idee kommst, Raymond zu behelligen. Es wird auch nicht mehr geschubst. In diesem Fall müssten wir nämlich die Schwimmprüfung im Meer wiederholen!«
Einige Minuten später saß er im Lieferwagen. Die Gemälde hatten sich tatsächlich in der besagten Kammer befunden. Aus dem Schlafzimmerfenster hatte er Reinersburg aus dem Pool klettern und erschöpft in die Wiese fallen sehen. Beim Zurücksetzen des Wagens zögerte Sam kurz, dann entschied er sich, die Figur stehen zu lassen. Auch die Hochstämme würde er verschonen. Er war ja kein Unmensch.
Von Santa Ponça fuhr er auf direktem Weg zu Raymond nach Port d’Andratx. Er fühlte sich prächtig. Solche Ausflüge bereiteten ihm großes Vergnügen. Und auch das Programm der nächsten Tage versprach kurzweilig zu werden. Er würde nach Portocolom fahren und sich nach der Frau von diesem Hasfurth umsehen. Wie war doch gleich ihr Name? Gabriele, richtig. Also, wenn sie nur annähernd so attraktiv wie auf dem Foto war und einem Seitensprung nicht abgeneigt …
Sam bog auf die Schnellstraße und gab Gas. Ihm fiel wieder der Artikel in der Zeitung ein. Der Beitrag ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. »Todeserklärung in Vorbereitung« hatte es in der Überschrift geheißen. Es bestand also überhaupt kein Zweifel mehr an seinem Ableben. Zugegeben, auch er hatte nicht den geringsten Anlass, den Tod Reiters in Frage zu stellen, und entsprechend war ja auch seine Aussage vor dem Amtsgericht ausgefallen. Und dennoch – er konnte es nicht erklären, aber so richtig wollte er an den Tod nicht glauben. Ein irrationales Gefühl, das in den letzten Wochen immer stärker geworden war. Entweder wurde dieser Fall bei ihm zur fixen Idee, oder seine Spürnase hatte Witterung aufgenommen.
Nur mal angenommen: Was wäre, wenn dieser Reiter überlebt hätte. Vielleicht hatte er sich schwimmend ans Ufer gerettet? Gut, die Küstenwache hat das hundertprozentig ausgeschlossen, der Sturm hatte die Yacht auf dem offenen Meer überrascht. Oder er war mit Taucherflaschen über Bord gegangen und hatte sich später von einem Komplizen auffischen lassen. Haarsträubend, das funktionierte wohl auch nicht. Oder er hatte sich doch auf dem Schiff versteckt? Aber die Yacht war mehrfach bis in den letzten Winkel durchsucht worden. Egal, nur mal angenommen, er würde noch leben, dann hätte er möglicherweise wie schon vor dem Schiffsunglück Kontakt zu seinem Anwalt, mit dem er eng befreundet war. Sam erinnerte sich noch gut an den Namen. Dr. Peter Mannschuh hieß der Mann, seine Rechtsanwaltskanzlei war in Frankfurt. Frankfurt? Da hatte er doch aus der Zeit, in der er für die Detektei Lummer tätig gewesen war, die besten Kontakte! Sam trommelte mit den Fingern aufs Lenkrad. Das wäre doch gelacht, wenn man die Telefonate dieses Mannschuh nicht irgendwie abhören oder registrieren könnte. Und an seine E-Mails müsste man auch rankommen. Sam rülpste. Zweifellos vertrug er Bier wesentlich besser als Sekt.
Als er links nach Port d’Andratx abbog, fiel ihm eine Lösung ein. Es gab da jemanden, der ihm einen großen Gefallen schuldete. Immerhin hatte er Frank einmal den Hintern gerettet. Und diesen Frank würde er bitten, Dr. Mannschuh anzuzapfen. Das sollte klappen, technisch war das ohnehin kein Problem. Im ungünstigsten Fall kam dabei nichts heraus. Und im günstigsten Fall? Sam wagte gar nicht, an diese Möglichkeit zu denken.
6
Über Son Cardona und an Santa María del Pilar vorbei waren sie Richtung Arenal d’en Castell, Na Macaret und Addaia gefahren. Die Straße führte durch Pinienwälder, an macchiaüberwucherten Steinmauern, den Parets seques, entlang. Dahinter waren Kühe zu sehen, ab und zu auch mal Pferde und Esel.
Nach einer Brücke bog Kay bei einem Schild »Coto privado de caza« rechts ab und holperte mit dem alten Mini über einen Feldweg. Die ganze Fahrt über hatte Dana versucht, ihn auszufragen. Kay aber hatte sich lächelnd darauf beschränkt, sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen, sich für die komplizierte Anreise zu entschuldigen – und ihr einiges über Menorca zu erzählen. Zum Beispiel, dass über vierzig Prozent der Insel unter Naturschutz stünden und Menorca von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt worden sei. Oder dass sich in der Golden Farm oberhalb von Maó der berühmte englische Admiral Lord Nelson heimlich mit Lady Hamilton getroffen habe. Aber diesen Informationen konnte sie heute kein besonderes Interesse abgewinnen. Schließlich fuhren sie durch ein offen stehendes Gattertor aus Olivenholz und hielten vor einem typisch menorquinischen Lloc, einem weiß getünchten Bauernhaus, das zwischen Feigen- und Olivenbäumen in einer Senke lag. Kay half ihr, den Rucksack ins Haus zu tragen. Mit der Fernsteuerung startete er die vorbereitete CD mit Präludien von Frédéric Chopin, die zum Teil im Kartäuserkloster von Valldemossa entstanden waren. Im Kamin brannte Feuer. Die Champagnergläser standen bereit. Und aus der Küche zog feiner Essensgeruch durchs Haus.
»Perlhuhn in Kokosschaum«, erklärte er. »Ich nehme an, du wirst Hunger haben.«
Dana zog eine Augenbraue hoch, stemmte die Arme in die Hüften und räusperte sich. »So, mein Lieber, du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder, du nimmst mich sofort in den Arm und begrüßt mich nach allen Regeln der Kunst – oder du kannst dich um dein Perlhuhn kümmern. Deine Entscheidung wird in jedem Fall weitreichende Folgen haben.«
Kay schmunzelte. »Nach allen Regeln der Kunst? Das kann ja heiter werden. Also, komm schon her!«
Er breitete die Arme aus. Dana zögerte kurz, dann folgte sie der Aufforderung.
Einige Minuten später hätte ein zufälliger Besucher auf dem Boden im Wohnzimmer ein Jeanshemd finden können. Eine Khakihose lag vor der Treppe, die in den ersten Stock führte, einige Stufen weiter eine schwarze Wollmütze, weiße Shorts …
»Ich fürchte, das Perlhuhn ist verbrannt«, stellte Kay fest. Er lag im Bett, einen Arm hinter dem Kopf. Mit der freien Hand streichelte er Danas Brüste. Genau so hatte er ihren Körper in Erinnerung gehabt. Sportlich durchtrainiert und doch gleichzeitig ausgesprochen feminin. Ein seltener Glücksfall der Evolution.
»Und die CD mit den Präludien ist zu Ende.« Dana stützte sich auf und sah Kay in die Augen. »So hatte ich das übrigens mit den Regeln der Kunst nicht gemeint.«
Kay zuckte mit den Schultern. »Dann habe ich dich eben missverstanden. Ich bitte um Vergebung.«
Dana lächelte. »Nicht nötig. Übrigens, für eine Wasserleiche war das gerade nicht schlecht.«
»Und ich bin froh, dass ich mich gegen das Perlhuhn entschieden habe.«
Es war schon dunkel, als Kay und Dana am Tisch saßen. Sie hatten ein paar Kerzen brennen. Es gab zunächst Pa amb oli, geröstete Bauernbrotscheiben, die Kay mit Olivenöl beträufelt, mit Knoblauch abgerieben, mit Salz bestreut und mit zerdrückten Tomaten belegt hatte. Und weil das Perlhuhn tatsächlich nicht mehr genießbar war, hatte Kay auf die Schnelle einige Lammlendchen in der Pfanne kurz beidseitig angebraten, danach in eine Terrine gelegt, eine Hand voll gehobelte Mandeln mit geschlagenem Eiweiß vermischt, über die Lammlendchen verteilt und im Rohr kurz überbacken. Dazu gab es Reis und Zucchini. Mit einem Glas Cabernet Sauvignon von Maciá-Batle aus Santa María stießen sie an. Nach den ersten Bissen der Lammlende war Dana völlig hingerissen.
»Ich wusste gar nicht, dass du so gut kochst.«
»Für eine Wasserleiche?«
Dana ließ ein Stück auf der Zunge zergehen.
»Nein, im Ernst.«
»Auf Mallorca hatte ich ja keine Gelegenheit dazu«, antwortete er. »Aber ich habe immer schon gerne gekocht. Für mich ist das ein meditativer Akt der Selbstfindung …«
»Egal, was es für dich ist, Kay, es schmeckt.« Dana legte die Stirn in Falten. »Sag mal, darf ich dich überhaupt noch Kay nennen? Oder soll ich Felix zu dir sagen? Klingt aber, finde ich, völlig bescheuert.«
»Du hast mich als Kay kennen gelernt, und an den Namen habe ich mich gewöhnt. Das können wir gerne beibehalten. Den Namen Felix finde ich zwar nicht ganz so schlimm wie du, aber ich denke, den Felix Reiter von früher, den gibt’s wirklich nicht mehr.«
Dana sah Kay über die Gabel an. »Du weißt schon, dass du einige Erklärungen schuldig bist?«
Kay nippte am Wein. »Schmeckt fast so gut wie ein Bordeaux, hat vielleicht etwas zu viel Tannine, aber eine elegante Nase …«
Die Gabel, die Dana aus dem Handgelenk nach ihm schleuderte, traf ihn an der Brust.
»Sag mal, spinnst du. Willst du mich umbringen?«
Dana lachte. »Du bist ja schon tot, da kann doch gar nichts passieren. Aber wenn du glaubst, du kannst mir jetzt einen Vortrag über Weine halten, dann hast du dich getäuscht.«
Kay zupfte verlegen an seinem Ohrläppchen. »Überredet. Also, was willst du wissen?«
»O Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Warum hast du mir nicht gesagt, wer du bist? Okay, blöde Frage. So gut kannten wir uns wirklich nicht. Wo hast du dich auf dieser verdammten Yacht versteckt? Was hättest du getan, wenn ich im Sturm über Bord gegangen oder mit dem Schiff gesunken wäre? Du wirst steckbrieflich gesucht, na ja, jetzt vielleicht nicht mehr. Was hast du wirklich getan? Habe ich vorhin mit einem Kriminellen geschlafen? Wo hast du die letzten Monate gesteckt? Was hat dich auf die irrwitzige Idee gebracht, gerade auf Menorca Unterschlupf zu suchen, also fast in Sichtweite von Mallorca? Was für einen Namen hast du jetzt? Und welche Nationalität? Wie stellst du dir dein weiteres Leben vor? Welche Empfindungen hast du für mich?« Dana holte Luft, um dann fortzufahren: »Was ist mit den Menschen, denen du finanziell geschadet hast? Glaubst du, dass das Syndikat noch hinter dir her ist? Waren die Vorsichtsmaßnahmen meiner Anreise nicht etwas übertrieben? Bist du jetzt Brillenträger? Hast du noch ein bisschen Lamm?«
Das Lachen von Kay klang ein wenig gequält. »Etwas viel Fragen auf einmal. Fangen wir mit dem Ende an. Ich hole die Terrine aus dem Rohr, dann reden wir weiter.«
Kay verteilte die gratinierten Lammlendchen auf ihre Teller. Dazu gab es noch etwas Zucchini.
Sie drohte ihm mit dem Finger. »Und fang jetzt nicht an, mir einen Vortrag über die Inhaltsstoffe der Zucchini zu halten.«
»Viel Wasser, Eiweiß, Kohlenhydrate, Vitamin A und C …« Kay lächelte. »Nein, ich will mich nicht drücken. Es ist nur so, dass das auch für mich nicht ganz einfach ist. Wenn man so etwas im Film sieht, dass jemand untertaucht, vielleicht noch mit viel Geld, dann glaubt man, das wäre ganz toll. Mag ja sein, dass das bei manchen auch so ist, die werden dann aber bald geschnappt. Und dazu habe ich keine Lust. Also wird man zwangsweise zum Eigenbrötler, meidet soziale Kontakte, wird dadurch ein klein wenig autistisch, man spricht nicht viel, ist misstrauisch. Tatsächlich habe ich seit den Vorfällen, die mich zur Flucht gezwungen haben, noch mit niemandem darüber geredet, geschweige denn, dass ich mich jemandem anvertraut hätte. Das geht ja auch nicht. Alle denken, ich bin tot. Das ist ein Zustand, der mir gefällt. Aber als Toter kann ich mit keinem über mein voriges Leben sprechen. Wenn du verstehst, was ich meine?«
»Mit mir kannst du das«, sagte Dana leise.
Kay fuhr sich über die Stirn. »Das ist ja das Verrückte. Nur mit dir. Für alle anderen, mit denen ich reden könnte, bin ich nicht mehr am Leben. Ich hab da noch einen Freund in Frankfurt, der weiß Bescheid.«
»Dr. Mannschuh?«
»Ja, aber ich treffe mich nie mit ihm. Das wäre zu riskant. Um auf deine Fragen zurückzukommen. Ich bin kein Brillenträger, hab ja auch jetzt keine auf. Aber ich habe keine Lust, mich wieder operieren zu lassen. Ich bleib jetzt so, wie ich bin. Halt mit Brille, ab und zu mit dieser Wollmütze, schlecht rasiert, mit einem angedeuteten Schnurrbart. Nicht gerade mein Schönheitsideal, doch praktikabel. Waren die Vorsichtsmaßnahmen bei deiner Anreise übertrieben? Keine Ahnung, aber das bringt mich zu deiner anderen Frage. Ja, ich glaube, dass das Syndikat an mir immer noch interessiert ist. Immerhin wissen die als Einzige, dass ich noch lebe. Die müssen mich beobachtet haben, als ich mich nachts von der Yacht gestohlen habe.«
»Ich hab dich auch gesehen!«
»Wirklich? Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Ach so, du wolltest wissen, wo ich mich versteckt hatte? Im Ankerkasten! Ich habe kurz vor dem Sturm erfahren – und zwar von Dr. Mannschuh –, dass ich von einem Privatdetektiv entdeckt worden bin und meine Verhaftung unmittelbar bevorstand.«
»Sam Späth«, sagte Dana.
»Wie bitte? Ach so, richtig, so ist sein Name, ich hab’s irgendwann in der Zeitung gelesen. Übrigens war der entscheidende Hinweis von einem Dr. Schulze gekommen, einem Vorständler, der offiziell nach mir suchen ließ, in Wahrheit aber meine Entdeckung fürchtete. Doch das ist eine andere, eine ganz andere Geschichte. Also, als der Sturm plötzlich und im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel losbrach, habe ich mich erinnert, dass diese Stürme im Spätsommer für die Balearen typisch sind und nie lange dauern. Caps de fibló werden sie von den Einheimischen genannt. Und da habe ich mich kurz entschlossen in den Ankerkasten verzogen. Der ist bei diesen Trawleryachten riesig. Und ich wusste, dass sich bei meiner ganz unten im Schiffsrumpf ein Hohlraum befindet. In dem habe ich mich verkeilt. War allerdings reichlich ungemütlich. So, und jetzt muss ich eine Pause machen. So viel habe ich seit Monaten nicht mehr geredet. Du kannst mich in die Küche begleiten. Zum Dessert gibt’s Crema catalàn. Und nimm die Weinflasche mit den Gläsern mit.«
Kay holte aus dem Kühlschrank die Schalen mit der vorbereiteten Crema catalàn, bestreute sie mit Zucker, drohte Dana mit dem heißen Brüliereisen, um es dann doch der wahren Bestimmung zuzuführen und den Zucker zu karamellisieren.
»Um nochmals auf deine komplizierte Anreise zurückzukommen. Es könnte sein, dass du vom Syndikat überwacht wirst, in der Annahme, dass wir miteinander Kontakt aufnehmen. Theoretisch könnte auch das Bundeskriminalamt auf diese Idee kommen, falls sie doch glauben, dass ich nicht tot bin. Deshalb hielt ich die Vorsichtsmaßnahmen für angemessen. Übrigens war ich in Paris am Flughafen und habe dich beobachtet. Und so wusste ich auch von deiner Verspätung und dass du dich verlaufen hast. Vor allem aber hatte ich den Eindruck gewonnen, dass du nicht verfolgt wirst.«
»Dann hättest du mich ja gleich am Flughafen in Empfang nehmen können.«
Kay lachte. »So wie heute Nachmittag wohl kaum. Da wären wir aufgefallen.«
»Stimmt. Wasserleiche als Sittenstrolch. Das hätte eine schöne Headline abgegeben.«
»Jedenfalls bin ich von Paris mit einem Charterflieger direkt nach Menorca geflogen. Dir wollte ich den Genuss einer kleinen Schiffsreise nicht nehmen.«
»Zu gütig.«
»Was hattest du noch für Fragen? Ich hab den Faden verloren.«
»Ich will wissen, was du gemacht hättest, wenn ich im Sturm über Bord gegangen oder das Schiff gesunken wäre?«
Kay schüttelte den Kopf. »Nun, im letzteren Fall wäre vor allem ich jetzt bei den Fischen. Mein Ankerkasten war wie ein Gefängnis. Aber diese Gefahr hat nicht bestanden, ich kenne diese Trawleryachten, die gehen nicht so leicht unter, schon gleich gar nicht bei einem so kurzen Sturm. Die sind für die Grand Banks vor Massachusetts gebaut, für den Atlantik, die halten was aus. Und dass du nicht über Bord gehst, das habe ich gehofft, das kannst du mir glauben. Aber du bist ja kein schwaches, furchtsames Frauenzimmer, sondern allzeit sportlich und gut drauf. Ich habe dir gute Chancen eingeräumt.«
»Nur gute Chancen?«
»Ziemlich gute Chancen. Nein, im Ernst, da war ich mir sicher.«
»Ich nicht. Nächste Frage: Bist du ein Krimineller?«
»O Gott, jetzt wird’s schwierig. Ob ich ein Krimineller bin und was mit den Menschen ist, denen ich finanziell geschadet habe? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Dieses Thema würde ich gerne auf morgen vertagen. Einverstanden? Aber ich versprech dir, ich werde mich nicht drücken.«