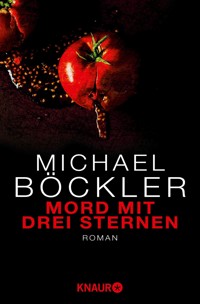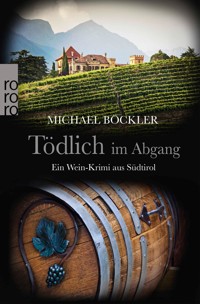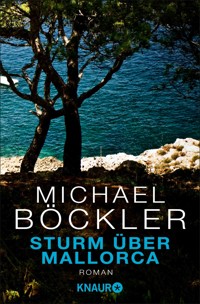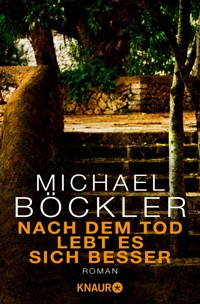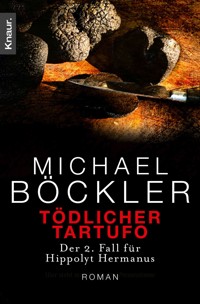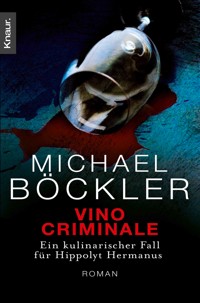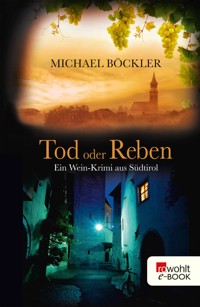
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein
- Sprache: Deutsch
Der Baron liebt Wein und hasst Morde Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein versteht etwas vom Rebensaft, schließlich wuchs er auf einem Weingut auf. Doch seit dem Bankrott des Vaters ist Emilio chronisch pleite – was er nicht zuletzt seiner Vorliebe für die schönen Dinge des Lebens verdankt: guter Wein und gutes Essen! Zum Glück hat Emilio nicht nur einen feinen Gaumen, sondern auch eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe: Sein Geld verdient er als Privatdetektiv. Als ihn eine alte Dame bittet, den vermeintlichen Unfalltod ihres Sohnes aufzuklären, überlegt Emilio nicht lange. Lässt sich der Fall doch mit einem Ausflug in eine der schönsten Weinregionen verbinden: Südtirol!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Michael Böckler
Tod oder Reben
Ein Wein-Krimi aus Südtirol
Über dieses Buch
Der Baron liebt Wein und hasst Morde.
Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein versteht etwas vom Rebensaft, schließlich wuchs er auf einem Weingut auf. Doch seit dem Bankrott des Vaters ist Emilio chronisch pleite – was er nicht zuletzt seiner Vorliebe für die schönen Dinge des Lebens verdankt: guter Wein und gutes Essen! Zum Glück hat Emilio nicht nur einen feinen Gaumen, sondern auch eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe: Sein Geld verdient er als Privatdetektiv. Als ihn eine alte Dame bittet, den vermeintlichen Unfalltod ihres Sohnes aufzuklären, überlegt Emilio nicht lange. Lässt sich der Fall doch mit einem Ausflug in eine der schönsten Weinregionen verbinden: Südtirol!
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Umschlaggestaltung yellowfarm gmbh, Stefanie Freischem
(Umschlagabbildungen: Thomas Schmitt/buchcover.com; Siffert, Hans-Peter/the food passionates/Corbis; Mist/Fotolia.com)
ISBN 978-3-644-47471-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
Finale
Epilog
Anhang
Weine
Essen und Trinken
Danksagung
Prolog
Der Auerhahn hatte falsche Erwartungen. Noch dachte er, es würde ein schöner Tag werden. In den frühen Morgenstunden flog er frohen Mutes durch sein Tal. Er war kein guter Flieger, vor allem tat er sich mit dem Starten schwer, aber er hatte Freude daran. Einige Bergziegen beobachteten ihn, sie wunderten sich über das merkwürdige Pfeifen in der Luft, nahmen ihn aber ansonsten nicht weiter zur Kenntnis. Der scheue Auerhahn war hier zu Hause. Nur selten verirrten sich Menschen in dieses abgelegene Tal der Ötztaler Alpen in Südtirol, irgendwo zwischen der Etsch, dem Passeier- und dem Schnalstal. Der Auerhahn, der auf Italienisch den schönen Namen «Urogallo» trägt, nahm seine übliche Flugroute. Diese führte ihn über ein rotes Bündel am Boden, das er vor einigen Tagen entdeckt hatte. Er war dort auch schon mal gelandet und hatte es genauer inspiziert. Der Geruch hatte ihm nicht gefallen.
Jetzt saß der Auerhahn im Geäst eines Baumes. Der Vogel war noch jung, aber schon ziemlich groß, und er sah ausgesprochen schön aus. Mit schiefergrauem Gefieder, einer Brust, die metallisch grün schimmerte, und mit roten Blättchen über den Augen. Er übte sich gerade im Fächern seines Schwanzes und im Balzgesang, den Kopf stolz in die Höhe reckend. Da hörte er ein merkwürdiges Klappern im Tal, das rasch näher kam. Der Auerhahn hasste es, gestört zu werden, da konnte er aggressiv werden. Aber das stakkatoartige Geräusch war so fremdartig und bedrohlich, dass er beschloss, die Flucht anzutreten. Er verließ seinen Baum und verschwand im Unterholz.
Das unangenehme Geräusch kam von Trekkingstöcken aus Aluminium. Sie wurden von einer Gruppe von Bergwanderern zum Einsatz gebracht, die durch das Tal zogen. Die Stöcke sollten die Trittsicherheit verbessern und die Gelenke entlasten. Vor allem waren sie laut und störten die Bergidylle. Aber da es sich bei den Touristen um Senioren handelte, sie waren aus Westfalen angereist, schienen die Trekkingstöcke unverzichtbar. Ihr Südtiroler Bergführer, hinter dem sie hermarschierten, hatte keine. Steff, so hieß er, war froh, dass die Gruppe in seinem Rücken keine Gedanken lesen konnte. Hatte er doch gerade grinsend überlegt, ob das Klappern ausschließlich von den Stöcken kam – oder ob auch ausgeschlagene Gelenke und künstliche Hüftpfannen ihren Beitrag zur Geräuschkulisse leisteten. Ab und zu musste er stehen bleiben, um seinen kurzatmigen Gästen eine Ruhepause zu gönnen. Geduldig beantwortete er dann ihre Fragen. Warum sie noch keinen Enzian gesehen hätten? Welcher Berg höher sei, der Ortler oder der Langkofel? Ob es hier früher einen Schmugglerpfad gegeben habe?
«Ihr kennt’s net so miad sein, weiter geht’s!», gab Steff das Kommando zum erneuten Aufbruch. Die Gruppe setzte sich in Bewegung, das Klappern begann von neuem. Nach einigen Minuten kniff Steff die Augen zusammen. Er hatte links am Hang, etwas abseits von ihrem Pfad, etwas Rotes erspäht. «Bleibt’s a mal stehn», sagte er, «i geh do kurz aui.»
«Er geht da hinauf», übersetzte ein sprachgewandter Westfale ins Hochdeutsche und deutete zu dem roten Etwas. Entgegen Steffs Anweisung folgten ihm einige neugierige Senioren auf dem Fuße. Und so kam es, dass sie hinter ihm standen, als Steff die Leiche eines Mannes entdeckte, der merkwürdig verrenkt war, eine rote Windjacke trug, eine ebenfalls rote Hose und solide Wanderstiefel. Er schien schon länger hier zu liegen – was sich nicht nur geruchsmäßig bemerkbar machte, sondern auch an der arg ramponierten Bekleidung erkenntlich war. Nicht zu reden von seinem Gesicht … Ein Wandersmann gab würgende Geräusche von sich, drehte sich weg und übergab sich. Steff entdeckte einige Tierspuren in unmittelbarer Nähe des Leichnams.
Die am Pfad Zurückgebliebenen wurden unruhig. Was sie denn gefunden hätten, riefen sie fragend den Hang hinauf.
«Eine Leiche», kam es von oben zurück.
«Eine Leiche?»
«So was wie der Ötzi, die Mumie vom Similaungletscher?», fragte einer.
«Kommen wir jetzt in die Zeitung?», freute sich ein anderer.
«So ein Blödsinn, die Leiche trägt eine synthetische Jacke mit Kapuze und moderne Stiefel, das ist keine Gletschermumie.»
«Schade …»
Steff kniete vor der Leiche, öffnete den Reißverschluss an der Gesäßtasche, zog eine Geldbörse heraus, entnahm ihr eine Scheckkarte und las den Namen. Dann stand er auf und richtete den Blick nach oben. Eine steile Felswand ragte viele Hundert Meter nach oben. «Do hat’sn oi ghaut», murmelte er.
«Beim Bergsteigen?», fragte einer aus der Gruppe.
Steff deutete auf die Stiefel und sagte, dass man damit nicht kraxeln könne, und eine Windjacke sei auch nichts für Bergsteiger. Nein, auf der anderen Seite sei der Berg überhaupt nicht steil und gut zum Wandern geeignet. Das Gipfelkreuz könne man von hier nicht sehen, aber es sei nur wenige Meter vom Abgrund entfernt.
Steff nahm sein Funkgerät aus dem Rucksack und verständigte die Bergrettung in Meran. Er gab den Standort durch und den Namen, den er auf der Scheckkarte gelesen hatte: «Nikolaus Steirowitz». Und obwohl er sagte, dass es keinen Grund zur Eile gebe, der Bergwanderer sei definitiv tot, und zwar schon länger, bekam er zur Antwort, dass der Heli in wenigen Minuten starten würde. Er solle noch so lange warten und schon mal nach einem geeigneten Landeplatz Ausschau halten.
Stunden später, erst am frühen Abend, traute sich der Auerhahn aus seinem Versteck. Er sah erschöpft aus. Die Balzgefühle waren ihm gehörig vergangen. Der Lärm des Helikopters hatte ihm den Rest gegeben. Dazu die vielen Menschen. Aber jetzt war der Trubel vorbei. Das Tal lag ruhig und still im Schatten der Berge. Der Auerhahn erhob sich schwerfällig in die Lüfte und flog sein Tal entlang. Das rote Bündel war verschwunden.
1
Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein war unrasiert, er hatte Kopfschmerzen und eine ausgesprochen schlechte Laune, als er den Weinladen in der Münchner Altstadt betrat. Das mit der schlechten Laune war nichts Ungewöhnliches, die hatte er am späten Vormittag chronisch. Ein Gruß erübrigte sich. Der Besitzer der Weinhandlung war in ein Gespräch mit einer Kundin vertieft, die sich nach Emilios flüchtiger Einschätzung wohl besser mit den Duftnoten eines Parfums von Chanel auskannte als mit den subtilen Aromen eines Spätburgunders. Emilio, der leicht hinkte, stieß mit seinem Gehstock die Tür zu einem Hinterzimmer auf. Dort unterließ er es, die Vorhänge aufzuziehen. Er warf einen Blick auf seinen Anrufbeantworter, stellte fest, dass es keine Nachrichten gab – und legte sich ermattet auf ein antikes Sofa aus der Biedermeierzeit. Das Möbel hatte schon bessere Zeiten gesehen und hätte dringend restauriert werden müssen. Aber Emilio liebte das Sofa so ramponiert, wie es war. Es passte zu ihm: exquisite Herkunft, mit deutlichen Gebrauchsspuren und etwas wacklig auf den Beinen, trotzdem nur schwer umzuhauen.
Emilio schloss die Augen und versuchte, sich an den Wein zu erinnern, den er gestern Abend getrunken hatte. Nein, an der Qualität des Rebensaftes konnte es nicht gelegen haben. Die Kopfschmerzen hatten ihre Gründe zweifellos in der konsumierten Quantität. Er hasste sich dafür. Er konnte Menschen nicht leiden, die zu viel tranken. Aber was sollte es? Oft konnte er sich selbst nicht leiden. Heute war wieder so ein Tag.
Die nächste halbe Stunde verbrachte Emilio gewissermaßen im Stand-by-Modus. Er war zwar körperlich präsent, hatte aber alle Systeme heruntergefahren. Er hätte in dieser Phase über seine aktuelle Situation nachdenken können, aber erstens war diese nicht anders wie so oft, zweitens hätte er nichts daran ändern können, und drittens war ihm das schon längst egal. Abgesehen davon hätte ein allzu intensives Nachdenken seinen Halbschlaf gestört. Er hatte sich daran gewöhnt, dass es ihm mal besser ging und mal weniger. In diesem Punkt war er ein Fatalist, dem die Fügungen des Schicksals unausweichlich erschienen, ergo machte es wenig Sinn, dagegen anzukämpfen. Allerdings gehörte er nicht zu den Menschen, die sich ohnmächtig ihrem Schicksal auslieferten und grundsätzlich mit einem schlechten Ausgang rechneten. Emilio betrachtete sich als Fatalisten, der durchaus die optimistische Annahme hegte, dass es das Schicksal auch gut mit einem meinen konnte. Daran änderte nichts, dass sein Leben auf den ersten Blick nicht danach aussah.
Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein war in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen, geboren auf einem Schloss im Rheingau, das seit sieben Generationen seiner Familie gehörte, umgeben von Rebstöcken, erzogen auf einem englischen Internat. Er war mit den Weinen des elterlichen Gutes groß geworden, verstand entsprechend viel davon, galt schon in jungen Jahren als exquisiter Weinexperte, der bestimmt war, die Familientradition fortzusetzen. Aber dann war alles anders gekommen: Sein Vater hatte sich mit der Aufrechterhaltung des Schlosses und Modernisierung des Weingutes hoch verschuldet, hatte schließlich keinen anderen Ausweg gesehen, als sich im Weinkeller zu erhängen. Wenige Jahre später war Emilios Mutter gestorben – wäre es kein Klischee, würde man sagen: an gebrochenem Herzen! Seine Mutter stammte aus Italien, deshalb hatte er den Vornamen Emilio erhalten. Jedenfalls war es nach dem Tod seines Vaters vorbei mit dem schönen Leben. Die Familie war bankrott, Schloss und Weingut hatten den Besitzer gewechselt. Damit war auch Emilio geld- und mittellos geworden. Ein unerfreulicher Zustand, an den er sich erst gewöhnen musste.
Fortan hatte sich Emilio in vielen Jobs versucht, er hatte als Repräsentant für eine Weinhandelsfirma gearbeitet, sich als Anlageberater betätigt und als Leiter des Weinkellers eines Luxushotels. Schließlich hatte er alles hingeschmissen und für ein Jahr in einer Strandhütte auf Bali gehaust, um auf der Insel der Götter über den Sinn des Lebens nachzudenken – ohne durchschlagenden Erfolg.
Nach Deutschland zurückgekehrt, war er von einem alten Freund gebeten worden, ihm bei einem Problem zu helfen, das sich rasch zu einem veritablen Kriminalfall entwickelt hatte. Wie es der Zufall wollte, war es Emilio gelungen, selbigen aufzuklären, einen Mord zu verhindern, gestohlenes Geld wiederzubeschaffen und seinem alten Kumpel damit einen großen Dienst zu erweisen. Emilio wusste auch nicht, wie er das zustande gebracht hatte, aber offenbar hatte er Talent dafür, Zusammenhänge zu erkennen, die anderen verborgen blieben, er war ein exzellenter Beobachter und verfügte über ein großes, gelegentlich chaotisches Wissen. Wahrscheinlich half es, dass er grundsätzlich an das Schlechte im Menschen glaubte und manche Abgründe aus persönlicher Erfahrung kannte. Jedenfalls hatte sich sein Erfolg als «privater Ermittler» rasch herumgesprochen, und er hatte weitere Aufträge bekommen. Erbschaftsangelegenheiten, Betrügereien, Seitensprünge, Vermisstenfälle … Die Aufträge ergaben sich anfangs wie von selbst, sein großer Bekanntenkreis erwies sich als unerschöpfliches Reservoir. Also hatte Emilio den Wink des Schicksals angenommen und arbeitete seitdem als freischaffender Privatdetektiv. Wohl nicht gerade das, was sich sein Vater für seinen Sprössling vorgestellt hatte, aber der Papa hätte sich ja auch nicht im Weinkeller erhängen müssen!
Und heute? Emilio war an Jahren älter, hatte die fünfzig überschritten, er hatte sich den Leichtsinn eines Zwanzigjährigen bewahrt, kombiniert mit der Lebenserfahrung eines Hundertjährigen. Er arbeitete weiter als Privatdetektiv, wobei die Aufträge mittlerweile nur noch unregelmäßig eintrudelten. Außerdem nahm er sich die Freiheit, nicht alle anzunehmen. Am liebsten waren ihm Projekte, die etwas mit Wein zu tun hatten, wo ihn die Recherchen vielleicht sogar in Weinbaugebiete im In- und Ausland führten. Aber diese Aufträge waren leider selten. Die schöpferischen Pausen zwischen den Ermittlungstätigkeiten entsprachen seinem Lebensgefühl, konfrontierten ihn aber regelmäßig mit finanziellen Problemen. Auch diese wusste er mit fatalistischem Gleichmut hinzunehmen. Dass ihn vor einigen Jahren seine Frau verlassen hatte, störte ihn nur selten, außerdem konnte er sie verstehen. Er hätte es an seiner Seite auch nicht ausgehalten.
Der Gehstock und sein leichtes Hinken? Je nach Laune erklärte er seine Behinderung mit einem Jagdunfall, einem Flugzeugabsturz – oder er machte einen betrogenen Ehemann dafür verantwortlich. Tatsächlich hatte er sich betrunken beim Reinigen einer Waffe selbst ins Bein geschossen. Aber das musste keiner wissen.
Sein Büro hatte Emilio im Hinterzimmer besagter Weinhandlung. Wie und warum es ihn nach München verschlagen hatte, konnte er auch nicht erklären, da hatte wieder mal der Zufall Regie geführt. Egal, er fühlte sich in der Stadt an der Isar sehr wohl. Bei schönem Wetter verbreitete sie italienisches Flair. Mit Frank, dem Besitzer der Weinhandlung, war er befreundet, er musste für seinen Büroraum nur wenig Miete bezahlen, dafür half er bei Bedarf im Verkauf. Er tat das eher widerwillig. Und Frank warf ihm vor, dass seine Beratungsgespräche gelegentlich geschäftsschädigend waren. Konnte er was dafür, dass manche Kunden einfach keine Ahnung hatten und mit Mühe einen Rotwein von einem Weißwein unterscheiden konnten? Und das nur mit geöffneten Augen!
Emilio räusperte sich. Nun hatte er im Halbschlaf doch über sein Schicksal nachgedacht. Das wäre nicht nötig gewesen, die Kopfschmerzen waren unangenehm genug. Die Tür ging auf, und Frank betrat den Raum, leider nicht mit der gebotenen Zurückhaltung. Emilio langte sich an die Schläfen.
Warum er nicht am Computer säße und arbeitete, wollte Frank mit einem Grinsen wissen. Emilio sah ihn verständnislos an. Er halte es mit den alten Griechen, antwortete er, dort galt der Müßiggang als größte Tugend, Arbeit sei etwas für Frauen und Sklaven.
Falsche Antwort, konterte Frank, jedenfalls für einen, der mit der Miete drei Monate im Verzug sei.
Emilio richtete sich stöhnend auf und hob vier Finger. Leider könne er den nächsten Monat auch nicht bezahlen, das wäre schon jetzt abzusehen.
Frank schüttelte den Kopf. Als arbeitender Sklave könne er diese Form des Müßiggangs nur schwer akzeptieren. Ob Emilio denn keine neuen Aufträge habe?
Emilio verneinte. Wenn man von der alten Tante absehe, aber auf die könne er verzichten.
Welche alte Tante, fragte Frank.
Nun, das sei keine richtige Tante, relativierte Emilio, vielmehr eine Freundin seiner verstorbenen Mutter, als Kind habe er «Tante» zu ihr gesagt. Die alte Dame lebte in Südtirol, sie habe vor einigen Tagen angerufen, sie wolle ihn heute Nachmittag im Hotel Bayerischer Hof treffen, sie habe ein Problem und brauche Hilfe.
Frank nickte auffordernd. Das höre sich doch gut an. Vielleicht sei das ein neuer Auftrag, und mit dem Vorschuss könne er die Miete bezahlen.
Emilio winkte ab. Was könne die alte Dame schon für ein Problem haben? Er habe keine Lust, einen verschwundenen Königspudel zu suchen. Oder sich mit einem Friseur anzulegen, der ihr die Haare falsch gefärbt habe. Nein, er würde dankend auf dieses Gespräch verzichten, ihr eine Visitenkarte mit seiner freundlichen Absage übermitteln und stattdessen im Englischen Garten spazieren gehen.
Genau das würde Emilio nicht tun, protestierte Frank entschieden. Als Freund und Gläubiger ausstehender Zahlungen bestehe er darauf, dass Emilio den Termin wahrnehme. Außerdem sei er das seiner guten Kinderstube schuldig, das mache man nicht, einer alten Nenntante einen Korb geben. Eine Visitenkarte mit einer freundlichen Absage, ob er denn spinne.
Emilio sah seinen Freund zweifelnd an. Dann gab er sich einen Ruck. Nun gut, erklärte er widerstrebend sein Einverständnis, er könne ja mal hingehen und mit der alten Dame einen Orangenlikör trinken. Vielleicht helfe der gegen Kopfschmerzen.
2
Man sollte meinen, es wäre schön, viel Zeit in einer «Opera» in Mailand verbringen zu dürfen. Man denkt an die ehrwürdige Scala, assoziiert Opern von Verdi, träumt von Rigoletto oder Aida. Aber weit gefehlt. Allenfalls hätte Nabucco noch einen gewissen Bezug, dies aber allein aufgrund des Gefangenenchors. Denn in der «Opera» im Süden der lombardischen Metropole hat es keinen Mangel an Gefangenen. «Va, pensiero, sull’ali dorate … Flieg, Gedanke, getragen von Sehnsucht …» Hinter den hohen grauen Mauern der Justizvollzugsanstalt, die ironischerweise «Opera» genannt wird, verbüßen die Häftlinge meist längere Haftstrafen – und es sind nur die Gedanken, denen es gestattet ist, davonzufliegen.
Die Casa di Reclusione, die zudem im Ruf stand, der größte Mafia-Knast der Welt zu sein, war ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem Marco Giardino die letzten zehn Jahre verbracht hatte. Aber heute war es so weit, er machte seine ersten Schritte zurück in die Freiheit.
Hinter ihm schlossen sich die schweren Eisentore der Justizanstalt. Er blieb stehen, stellte seinen Koffer ab und atmete tief durch. So also roch die Luft außerhalb der Gefängnismauern – er hatte es fast vergessen. Marco war sportlich angezogen, mit einer beigen Leinenhose, weißem Poloshirt und einem Pulli locker über die Schultern gehängt. Es war ein strahlend schöner Tag in Mailand. Er setzte sich eine Sonnenbrille auf. Wäre nicht seine blasse Gesichtsfarbe gewesen, hätte man ihn für einen Urlauber halten können, der gerade vom Comer See kam oder von Capri.
Marco sah sich um. Es war niemand da, ihn abzuholen. Er durfte sich nicht beklagen, er hatte es so gewollt. Niemand seiner Bekannten oder von der Familie wusste, dass er heute entlassen wurde, vorzeitig, wegen guter Führung. Außerdem war es weit von Bozen hierher. Er nahm seinen Koffer, der nicht schwer war, und machte sich auf den Weg. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fuhr er in die Innenstadt. Marco saß am Fenster und genoss den Blick auf die vorbeiziehenden Häuser, auf die Autos, Vespas und Passanten. Das Schönste an der Fahrt war die schlichte Tatsache, dass er sich fortbewegte, und zwar im ursprünglichen Wortsinn, er bewegte sich fort – nicht im engen Kreis wie im Gefängnishof.
Eine knappe Stunde später hatte er seinen Koffer bei einer Gepäckaufbewahrung deponiert. Er schlenderte über die Via Spadari, ergötzte sich an den Delikatessen in den Auslagen, die ihm wie von einer anderen Welt erschienen, er genoss die unendliche Freiheit auf der weiten Piazza del Duomo, verzichtete aber auf einen Besuch des Domes, schließlich wusste er nicht, wofür er dem himmlischen Herrn danken sollte. Er dachte an das letzte Gespräch mit der Gefängnispsychologin, erst gestern war das gewesen. Sie hatte seine Fortschritte in den letzten Jahren gelobt, er sei viel ausgeglichener geworden, habe seine Aggressionen offenbar unter Kontrolle. Sie sei stolz auf ihn. «Porca puttana», murmelte Marco – was sich wohlwollend mit «Schweineschlampe» übersetzen ließ.
Er betrat die Galleria Vittorio Emanuele II., setzte sich vor das legendäre Jugendstilrestaurant Zucca und bestellte ein Glas vino bianco. Gott sei Dank war die Psychologin hässlich wie die Nacht, sonst hätte er ihr schon vor Jahren gezeigt, dass seine Aggressionen alles andere als unter Kontrolle waren. Aber dann wäre er jetzt nicht hier. So war es besser, entschieden besser.
Marco stammte aus einer armen Familie, er war in einem Milieu aufgewachsen, wo Aggressionen fürs Überleben notwendig waren. Wenn ihn ein cretino blöd anmachte, bekam der Volltrottel eine verpasst, ohne Vorwarnung, so einfach war das. Wenn einer im Weg stand, wurde er weggestoßen. Und wenn einer seine Freundin anbaggerte, dann konnte er für nichts garantieren. Wie in jener Nacht vor der Disco in Bozen. So ein stronzo mit geföhnten Haaren hatte versucht, ihm seine Gina auszuspannen. Er hatte dem Hurensohn einen kräftigen Stoß versetzt und ihm den Rat gegeben, sich zu verpissen: «Vaffanculo!» Aber das Stück Scheiße war betrunken gewesen und hatte ihn nicht verstanden. «Pezzo di merda!» Der Idiot hatte sich aufgerappelt und war auf Marco losgegangen …
Die folgende Verurteilung wegen Totschlags hatte ein höheres Strafmaß zur Folge, weil Marco wegen schwerer Körperverletzung vorbestraft war. Und nach all diesen Jahren meinte die Gefängnispsychologin, er habe eine «gute soziale Prognose» und seine Aggressionen unter Kontrolle. Marco musste lachen, fast verschluckte er sich am Wein. Er bestellte noch ein bicchiere. Ja, er hoffte schon, dass er sich in Zukunft besser beherrschen konnte, aber wenn die flachbrüstige puttana meinte, er würde jetzt ein angepasstes Leben führen, dann hatte sie sich gehörig getäuscht. Welche Ziele er für die Zukunft habe, hatte sie von ihm wissen wollen. Er wolle wieder in seinem alten Beruf arbeiten, hatte er geantwortet, Konflikten aus dem Weg gehen, eine gute Frau finden, vielleicht eine Familie gründen. Dabei hatte er sie treuherzig angeschaut. Marco kicherte. Die dumme Nuss hatte ihm geglaubt!
3
Phina Pernhofer stand in ihrem Südtiroler Weinberg, inmitten von Rebzeilen, die mit Sauvignon bestockt waren. Natürlich war sie auch dem Vernatsch verbunden, auch hatte sie Lagen, die sich für Lagrein eigneten, für Cabernet, Blauburgunder und für Merlot. Aber von diesen Rotweinen gab es auf dem Markt viel zu viele, vom Vernatsch sowieso, auch wenn sich die in Südtirol allgegenwärtige Traube ein wenig auf dem Rückzug befand. Eigentlich schade, denn Phina fand, dass der Vernatsch in guten Lagen immer noch großes Potenzial hatte. Sie war der festen Überzeugung, dass ein leidenschaftlicher Vernatsch, nicht zu dunkel, im Ertrag reduziert, in der Pergelerziehung vor zu viel Sonneneinstrahlung geschützt und bei verkürzter Maischestandzeit, ausgesprochen lustvoll sein konnte – leicht, geschmeidig, dezente Mandelaromen, wenig Säure und Tannine, dennoch strukturiert und ein idealer Begleiter bei einer mittäglichen Marende mit Speck und Schüttelbrot. Der leichte Wein passte auch hervorragend zu Pastagerichten und sogar zu Sushi und Sashimi.
Während der Vernatsch mittlere Höhenlagen bevorzugte, kam der Sauvignon auch weiter oben zurecht, zudem hatte er keine Probleme mit einer intensiveren Sonneneinstrahlung. Phina pflückte eine unreife Traube vom Weinstock, schob sie in den Mund und schloss die Augen. Noch war nichts von den sortentypischen Aromen zu erkennen, die an Stachelbeeren oder Brennnesseln erinnerten. Aber sie war sich sicher, dass daraus ein großartiger Weißwein werden würde.
Angesichts einer globalen Schwemme von guten Rotweinen, nicht nur aus den traditionellen Anbaugebieten in Europa, sondern zu konkurrenzlos niedrigen Preisen auch aus Übersee, vertrat sie die Auffassung, dass Südtirols Zukunft bei den Weißweinen lag. Beim Sauvignon sowieso, aber auch beim heimischen Gewürztraminer und beim Weißburgunder. Die Voraussetzungen waren ideal. Und es gab keine negativen Vorurteile zu überwinden, die dem Vernatsch immer noch wie Pech anhafteten – aus längst vergangenen Zeiten, als vom Kalterersee und Sankt Magdalener mehr Wein verkauft wurde, als in den Anbaugebieten überhaupt produziert wurde.
Phina, die ausgesprochen attraktiv war, aber die kräftigen Hände eines Weinbauern hatte und eine sonnengegerbte Haut, musste an ihren Vater denken. Der hatte von Weißweinen nichts wissen wollen, auch nichts von internationalen Sorten wie Cabernet und Merlot. Für ihn hatte es nichts anderes gegeben als den Vernatsch, der in Südtirol schon im Mittelalter angebaut wurde. Phina riss einige Blätter von einem Rebstock. Ihr Vater war auch gegen die biodynamische Bewirtschaftung gewesen, die sie mittlerweile mit großem Erfolg praktizierte. Er hatte nur mitleidig gelächelt, wenn sie von der natürlichen Balance zwischen Natur und Wein gesprochen hatte, von organischem Kompost, der Vermeidung von Chemikalien und von den kosmischen Kräften von Sonne und Mond. Stattdessen hatte er vorgehabt, das Weingut zu verkaufen, das seit Generationen im Familienbesitz war. Auf Phinas Stirn bildeten sich steile Falten, ihre Hände verkrampften sich. Das alles nur deshalb, weil er keinen Sohn hatte, der die Tradition fortsetzen konnte – nur eine Tochter, die er zwar liebte, aber sich nicht als Nachfolgerin vorstellen konnte.
Sie verknotete fest ihre Hände, bis das Weiße an ihren Knöcheln hervortrat. Phinas Atem ging kurz, ein Zittern durchlief ihren Körper. Nun, ihr Vater war nicht mehr am Leben. Seine antiquierten Vorstellungen waren mit seinem Leichnam auf dem Friedhof von St. Pauls beigesetzt worden. Gott sei seiner Seele gnädig! Sie entfaltete ihre Hände und hob sie vor ihr Gesicht. Dass an ihnen Blut klebte, war nicht zu erkennen. Aber sie konnte es nicht vergessen. Jeder neue Jahrgang war ein «Blutwein». Und da gab es keinen Unterschied zwischen Vernatsch, Lagrein, Gewürztraminer, Weißburgunder oder Sauvignon.
4
Emilios Laune hatte sich nicht wesentlich gebessert, als er am Nachmittag zum Hotel Bayerischer Hof schlenderte. Immerhin waren die Kopfschmerzen verflogen, das war ein unerwartetes Erfolgserlebnis an diesem trüben Tag. Frank hatte ihm das Versprechen abgenommen, sich nicht auf dem Alten Südfriedhof auf eine Parkbank zu setzen, was er oft tat, um dem hektischen und fröhlich-nervigen Treiben zu entfliehen. Er hatte ihm sein Wort gegeben, den Termin mit der alten Dame wirklich wahrzunehmen. Der Baron wählte den Weg über den Viktualienmarkt. Seinen schwarzen Gehstock, der auf Hochglanz poliert war und einen silbernen Knauf hatte, brachte er nur bei jedem dritten Schritt zum Einsatz. Er hätte auch ohne Stock gehen können, sehr gut sogar und erstaunlich ausdauernd, aber er hatte sich an das Requisit gewöhnt, und trotz seines leichten Hinkens fand er auf diese Weise einen ihm angenehmen Laufrhythmus. Obwohl es leicht nieselte, trug er eine dunkle Sonnenbrille, mit einem dicken Hornrahmen, der so altmodisch war, dass er schon wieder avantgardistisch wirkte. Die Sonnenbrille hatte bereits seinem verstorbenen Vater gehört. Ebenso die rahmengenähten Budapester, die mindestens dreißig Jahre alt waren. Er hielt die maßgefertigten Schuhe seines Vaters in Ehren. Emilio hatte sich vorgenommen, in diesem Leben keine Schuhe mehr zu kaufen – die Dutzend Klassiker seines Vaters mussten bis zu seinem letzten Gang halten.
Im Vorbeigehen ignorierte er an einem Obststand das Schild, dass man die feilgebotene Ware nicht anlangen dürfe, er nahm geistesabwesend eine Handvoll Bio-Erdbeeren aus einem Korb, schob die erste in den Mund und ging weiter. Einige Kunden sahen ihm ob dieser Dreistigkeit entgeistert hinterher. Die Marktfrau lächelte, sie kannte den «Wein-Baron» schon seit langem, sie mochte seine kauzige Art und verzieh ihm so einiges.
Emilio genoss die ungewaschenen Erdbeeren, das Grünzeug aß er mit, schließlich taten das auch die Ziegen. Er überquerte den Marienplatz, schob mit dem Gehstock einige Touristen zur Seite, die hinauf zum Glockenspiel am Rathaus starrten. Währenddessen versuchte er, sich an «Tante Theresa» zu erinnern. Sie entstammte einer alten Industriellenfamilie aus Wien, so viel wusste er noch. Ihre Freundschaft zu Emilios verstorbener Mutter ging wohl auf gemeinsame Jungmädchenzeiten in einem Schweizer Internat zurück. Theresa war bei Emilios Eltern ein- und ausgegangen, war bei allen Familienfeiern zugegen gewesen, hatte einfach zum Leben dazugehört. Auch hatten sie Theresa gelegentlich in ihrer Villa im Südtiroler Meran besucht. Daran konnte er sich noch gut erinnern – auch an den Vorhang, den er zu Weihnachten versehentlich angezündet hatte.
Emilio ging am Dom vorbei, durch eine Passage, schließlich erreichte er den Bayerischen Hof. Davor parkten Luxuslimousinen, einige Wichtigmenschen in Anzügen telefonierten mit ihren Handys. Emilio stöhnte. Aber er konnte nicht umdrehen, denn Versprechen pflegte er zu halten, auch wenn er sie leichtfertig gegeben hatte. Und vielleicht, so hoffte er, war es amüsant, die alte Freundin seiner Mutter wiederzusehen. Er hatte ein Faible für Realsatire.
Emilio betrat das Hotel, erinnerte sich, wo Theresa auf ihn warten wollte, ging aber erst auf die Toilette, um sich die Hände zu waschen und den Mund zu säubern. Er wollte ihr beim Handkuss Reste von Erdbeeren ersparen. Er entdeckte die alte Dame sofort, trotz ihres gewaltigen Strohhutes, sogar hinter dem roten Fächer, mit dem sie sich Luft zufächelte. Oder vielleicht gerade deshalb, sie war kaum zu übersehen. Auch Theresa hatte ihn entdeckt, sie klappte den Fächer zusammen und zeigte ein strahlendes Lächeln. Sie schien sich wirklich zu freuen, ihn wiederzusehen. Nun, dann war sein Kommen schon mal nicht gänzlich vergebens gewesen. Es war ihm bislang nur selten beschieden gewesen, alte Damen glücklich zu machen.
Die folgende Stunde unterhielten sie sich zunächst über Belanglosigkeiten, dann über vergangene Zeiten. Das Gespräch verlief relativ einseitig, denn Theresa erzählte ausführlich und mit Liebe zum Detail, wie sie Emilios Mutter kennengelernt hatte, von ihren gemeinsamen Jahren in der Schweiz, über Jungmädchenstreiche und erste, schüchterne Männerbekanntschaften. Emilio beschränkte sich weitgehend aufs Zuhören, die Geschichten gefielen ihm, sie brachten ihn dazu, an seine verstorbene Mutter zu denken. Warum tat er dies sonst so wenig?
Auf seine Frage und um das Thema zu wechseln, schilderte Theresa ihren Jahresablauf, der an feste Rituale geknüpft schien. Wie er wisse, habe sie ihren Hauptwohnsitz in Meran, dort verbringe sie die meisten Monate, aber sie liebe es, zu reisen. Allerdings versuche sie, sich nur innerhalb der Grenzen der alten Donaumonarchie zu bewegen. Südtirol sei ohnehin nur aufgrund höchst dubioser Ereignisse abhandengekommen. Schließlich habe das wunderschöne Land an Etsch, Passer und Eisack seit dem 14. Jahrhundert zum Habsburger Reich gehört. Dass es 1918 an Italien gefallen war, wurde von ihr konsequent ignoriert. An den Vertrag von Saint Germain dürfe sie gar nicht denken, davon bekäme sie Migräne.
Emilio zog es vor, ihr nicht zu widersprechen. Sein Einwand, dass sie mit München die historischen Grenzen der Donaumonarchie überschritten hätte, konterte sie mit dem Hinweis, dass sich König Ludwig II. gut mit der Sissi verstanden habe – außerdem sei sie hier, um sich mit Emilio zu treffen und mit ihm etwas zu besprechen.
Emilio musste grinsen. Die alte Dame hatte ziemlich abgefahrene Ansichten, aber im Kopf war sie hellwach, das musste man ihr lassen. Und sie schien endlich zum Grund ihres Treffens zu kommen. Aber auch das machte sie auf Umwegen. Theresa orderte einen Sekt. «Nein, keinen Champagner», rüffelte sie den Ober. Sie bevorzuge Riesling-Sekt. Von dem «französischen Sprudel», so ihre Erklärung, bekäme sie Sodbrennen. Und Prosecco sei vulgär.
Die Flasche wurde entkorkt. Gab es was zu feiern? Die alte Dame hob ihr Glas. «Ich möchte mit dir auf meinen Niki anstoßen», sagte sie feierlich, «er hätte heute Geburtstag, einen runden, seinen Fünfzigsten!» Nun war Emilio doch überrascht. Deshalb war er hier? Während er mit Theresa anstieß, rief er sich besagten Niki in Erinnerung. Richtig, das war Theresas Sohn gewesen, Nikolaus Steirowitz, ihr einziges Kind, er hatte ihn kaum gekannt. Niki war irgendwann ums Leben gekommen, daran erinnerte er sich. Sie stießen also gerade auf den Geburtstag ihres toten Sohnes an. Warum nicht?
Theresa sah Emilio an. «Niki, du weißt …»
«Natürlich, Niki, dein verstorbener Sohn», bestätigte er. «Ich habe ihn noch als jungen Mann in Erinnerung. Er wäre heute fünfzig geworden? Unvorstellbar, wie schnell die Zeit vergeht.» Fast genierte er sich für den blöden Satz, aber etwas anderes als diese Platitude war ihm spontan nicht eingefallen.
«Deshalb habe ich dich hergebeten», fuhr Theresa fort. «Ich danke dir, dass du gekommen bist.»
«Das ist doch selbstverständlich …»
«Nein, ist es nicht. Wäre ich nicht so penetrant gewesen», sie drohte ihm lächelnd mit dem Zeigefinger, «hättest du mir einen Korb gegeben, ich kenne dich.»
Er hob entschuldigend die Hände. «Vielleicht, aber jetzt bin ich hier.» Dabei dachte er, dass nicht Theresas Überzeugungskraft den Ausschlag gegeben hatte, sondern Frank und die normative Kraft des Faktischen – in Form ausstehender Mietzahlungen.
Theresa machte eine lange Pause, sie leerte das Glas, sah ihn forschend an, gab dem Ober ein Zeichen, nachzuschenken. Dann fuhr sie fort: «Nikis Tod ist genau zehn Jahre her», sie seufzte, «zehn Jahre, zwei Monate und vielleicht zwei Wochen, oder eine Woche, oder drei Wochen, plus minus einige Tage.» Theresa langte sich an den Kopf. «Das ist nicht zu fassen. Ich habe ihn geboren, aber ich weiß nicht, wann Niki gestorben ist, an welchem Tag ich auf den Friedhof gehen soll, um an seinem Grab eine Kerze zu entzünden.»
Emilio sah sie fragend an. Diesen Gesichtsausdruck beherrschte er, selbst wenn ihn eine Antwort nur wenig bis gar nicht interessierte.
«Du willst wissen, wie das sein kann?», fuhr sie fort.
«Ja, natürlich», bestätigte er, «leider weiß ich nicht, wie Niki ums Leben gekommen ist, tut mir leid.» Er ließ sich dazu hinreißen, ihre Hand zu nehmen und zu streicheln. Manchmal war er sich selbst ein Rätsel.
«Niki hat in Bozen gelebt», erklärte Theresa, «er war unverheiratet, hatte keine Kinder. Er hatte eine Vinothek, die lief sehr gut. Bei einer Bergtour ist er über eine hohe Felswand gestürzt. Wanderer haben seinen Leichnam erst einige Zeit später entdeckt. Der genaue Todeszeitpunkt ließ sich nicht mehr feststellen.»
Emilio hatte noch nie verstanden, warum Menschen freiwillig auf Berge stiegen, dabei ins Schwitzen gerieten und sich unkalkulierbaren Gefahren aussetzten. Mit diesem Unsinn hatten im 19. Jahrhundert die Engländer angefangen. Wäre Niki im Tal geblieben, wie jedes vernunftbegabte Wesen, wäre er noch am Leben. Nun ja, oder auch nicht, wer wusste das schon?
Emilio räusperte sich. «Ein Unfall?», hakte er nach. «War er bei der Bergtour alleine?»
«Du stellst die richtigen Fragen, deshalb wollte ich mit dir sprechen. Ein Unfall? So steht es im Bericht der Polizei. Dort steht auch, dass Niki die Wanderung alleine unternommen hat. Das hätten die Nachforschungen ergeben.»
«Macht man das? Geht man alleine auf den Berg?»
«Doch, warum nicht. Die Tour war nicht weiter gefährlich. Außerdem war Niki ziemlich leichtsinnig. Er hat schon als Kind die verrücktesten Sachen gemacht.»
«Dann war das ein Fehler. Aber es hätte wohl nichts geändert, oder? Nach einem Sturz über eine hohe Felswand kommt wahrscheinlich jede Hilfe zu spät.»
Theresa sah ihn ob dieser pietätlosen Bemerkung vorwurfsvoll an, nahm dann einen Schluck vom Riesling-Sekt. «Der hätte auch dem Niki geschmeckt», murmelte sie. «Du hast recht», fuhr sie fort, «nach dem Sturz war alles vorbei. Wenigstens hat er nicht leiden müssen. Aber ich darf mir gar nicht vorstellen, wie lange er am Fuße der Felswand gelegen hat, was mit ihm in dieser Zeit …» Sie schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte.
«So darfst du nicht denken, behalte deinen Niki lebend im Gedächtnis, erinnere dich an schöne Zeiten.» Noch so eine Platitude.
Theresa tupfte sich mit der Serviette die Tränen von den Wangen. «Doch, das tue ich, keine Sorge. Aber sein Tod lässt mir keine Ruhe, auch nicht nach zehn Jahren. Ich habe das Gefühl, dass ich ihm etwas schuldig bin.»
«Schuldig?»
«Ab und zu träume ich, dass er zu mir spricht. Er macht mir Vorwürfe. Warum, so fragt er, will ich als seine Mutter nicht wissen, was da oben am Berg wirklich passiert ist. Womöglich war alles ganz anders.»
«Hatte er Probleme?», fragte Emilio. «Vielleicht war es Selbstmord?»
«Selbstmord? Ich will es nicht hoffen, dann nämlich wäre ich nicht frei von Schuld. Ich hätte seine Verzweiflung spüren und ihm helfen müssen, dafür sind Mütter da. Aber ich habe nichts gespürt. Nein, ich glaube nicht an Selbstmord. Niki ging es gut, er war beliebt, von Problemen weiß ich nichts.»
Emilio sah sie skeptisch an. «Du hältst es also für möglich …»
«… dass Niki umgebracht wurde. Ja, genau das halte ich für möglich. Das würde erklären, warum mich Niki in den Träumen immer so vorwurfsvoll anschaut. Er erwartet von mir, dass ich die Umstände seines Todes aufkläre. Und wenn es Mord war, dann muss der Schuldige gefunden und bestraft werden.»
«Niki ist seit zehn Jahren tot. Der Fall ist damals sicher untersucht worden. Hätte es Anhaltspunkte für einen Mord gegeben, wäre man diesen gewiss nachgegangen, und man hätte mit dir darüber gesprochen. Aber offenbar gab es keine. Liebe Theresa, es ist nicht ungewöhnlich, dass dich dein verstorbener Sohn in den Träumen verfolgt.»
Theresa schüttelte energisch den Kopf. «Nein, so ist es nicht. Ich bin nicht hysterisch, ich habe auch keine Halluzinationen. Aber ich bin alt, vielleicht habe ich nicht mehr lange zu leben, und wenn ich dann tot bin, treffe ich Niki auf einer Wolke, und er fragt mich, warum ich nichts unternommen habe. Und was antworte ich ihm dann?» Nach einer Pause fuhr sie fort: «Außerdem habe ich vor einigen Wochen etwas gefunden, seitdem erscheint Nikis Tod in einem anderen Licht.»
«Etwas gefunden?»
Sie nickte. «Eine Freundin hat mich gefragt, ob ich für einen Basar in Naturns, dessen Erlös wohltätigen Zwecken dient, einige alte Sakkos von Niki zur Verfügung stellen könnte. Ich hielt das für eine gute Idee und bat Greta, das ist meine gute Seele, du kennst sie noch von früher, ein paar Jacken rauszusuchen. Und ich habe ihr gesagt, sie solle zur Sicherheit schauen, ob alle Taschen leer sind. Da hat sie das gefunden …» Theresa zog aus ihrer Handtasche eine Plastikhülle, entnahm ihr ein zusammengefaltetes, verknittertes Blatt Papier und reichte es Emilio.
Er nahm das Blatt entgegen, faltete es behutsam auseinander. Der Text war offensichtlich mit dem Computer geschrieben und mit einem alten Nadeldrucker ausgedruckt. Jedenfalls keine Schreibmaschine und leider auch nicht handschriftlich. Denn die wenigen Zeilen hatten es in sich. Schon die Überschrift in Großbuchstaben: «WARNUNG!» Darunter: «Lieber Nikolaus. Man trachtet dir nach dem Leben. Pass gut auf dich auf!» Und als Absender: «Jemand, der es gut mit dir meint.»
Emilio dachte nach. Zunächst über den Zettel mit der Botschaft, aber nicht lange, dann kam ihm ein Chardonnay Löwengang von Lageder in den Sinn, er dachte an den Sauvignon Quarz der Kellerei Terlan, er glaubte, die feinen Duftaromen eines Cabernet von Sankt Michael in Eppan zu riechen. Südtirol war ein beneidenswertes Land. Theresas fragender Blick brachte ihn zurück zum Thema. Er sortierte seine Gedanken. «Zugegeben», sagte er, «diese Nachricht lässt Nikis Tod in einem anderen Licht erscheinen. Aber das hat nichts zu besagen, es kann trotzdem ein Unfall gewesen sein.»
«Natürlich, das ist mir schon klar. Aber diese Warnung geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist doch unheimlich, findest du nicht?»
«Ja, schon», bestätigte er, «trotzdem …»
«Emilio», unterbrach sie, «ich möchte, dass du mir hilfst, deshalb habe ich dich hergebeten.»
«Wie könnte ich dir helfen? Zehn Jahre sind eine kleine Ewigkeit. Wenn man damals nichts herausfinden konnte, dann heute ganz bestimmt nicht mehr.»
«Hör auf, sprich nicht weiter», fiel ihm Theresa ins Wort. «Ich kenne dich, wenn es überhaupt jemanden gibt, der mir helfen kann, dann bist du es. Zehn Jahre sind eine lange Zeit, das weiß ich selber. Ich will ehrlich sein, ich verspreche mir auch nicht viel davon. Aber ich möchte dich bitten, nach Südtirol zu fahren und einige Nachforschungen anzustellen.»
Emilio zögerte. «Ich weiß nicht …» Plötzlich glaubte er, einen St. Magdalener aus Bozen zu schmecken, vom Ansitz Waldgries, dann erahnte er eine feine Rotweincuvée von Elena Walch.
Theresa schaffte es zu lächeln: «Sieh es doch mal so: Eine alte Freundin deiner Mutter lädt dich zu einem kleinen Erholungsurlaub nach Südtirol ein. Als Gegenleistung könntest du dich ein bisserl umhören und versuchen herauszufinden, was vor zehn Jahren wirklich passiert ist.»
«Meine liebe Theresa, ich wüsste nicht, wovon ich mich erholen müsste. Ich tue seit Monaten nichts, was in irgendeiner Weise anstrengend wäre. Vielen Dank für deine Einladung, aber es würde nichts dabei herauskommen.»
«Komm, gib dir einen Stoß!» Theresa sah ihn hoffnungsvoll an. «Nur ein bis zwei Wochen, ich komme für alle Kosten auf. Du kannst mir auch eine Honorarrechnung stellen, kein Problem.»
Er schüttelte den Kopf. «Ein Honorar? Von dir? Nein, wirklich nicht, kommt nicht in Frage.» Dann fielen ihm wieder Frank ein und seine misslichen Außenstände. «Nun ja, einen kleinen Vorschuss würde ich schon akzeptieren.» Er hüstelte. «Aus rein formalen Gründen, um die Sache sozusagen offiziell zu machen.»
Theresa griff zu ihrer riesigen Handtasche, die neben dem Tisch auf dem Boden stand, entnahm ihr einen Umschlag. «Hier, ist bereits alles vorbereitet. Ich hoffe, die Summe ist adäquat.»
Emilio nahm den Umschlag entgegen und steckte ihn unbesehen ein. «Davon bin ich überzeugt.» Nach einer kurzen Pause, die in seiner Phantasie von den kräftigen Duftaromen eines Gewürztraminers überlagert wurde, fuhr er fort: «Aber wie stellst du dir das vor? Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte?»
Wieder griff sie in ihre Handtasche und entnahm ihr eine schwarze Ledermappe. «Hier! Du kannst sofort anfangen. Ich habe alles Wesentliche zusammengestellt: das Untersuchungsprotokoll der Polizei und ein Bericht der Bergrettung. Eine Liste mit den Namen, Adressen und Telefonnummern seines damaligen Bekanntenkreises, jedenfalls so weit ich seine Freunde in Erfahrung bringen konnte. Ansprechpartner vor Ort, die dir vielleicht weiterhelfen können. Außerdem habe ich in einem Heft alles aufgeschrieben, was ich von Nikis Leben weiß, was er beruflich so gemacht hat, seine Hobbys und so weiter. Ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen. Dazu die Kopien einiger Dokumente. Zeitungsartikel, die nach seinem Tod erschienen sind. Außerdem ein Reiseführer Südtirols und ein Wanderführer. Eine Bestätigung, dass du in meinem Auftrag Erkundigungen zum Tode meines Sohnes anstellst. Und die Adresse einer alten Freundin, bei der ich für dich ein Zimmer reserviert habe.»
Er sah sie erstaunt an. «Du hast dir viel Arbeit gemacht», stellte er fest.
«Ich sagte ja, es ist mir wichtig.»
«Und ein Zimmer hast du auch schon reserviert? Du traust dich was. Darf ich fragen, ab wann?»
Theresa lächelte. «Ab morgen. Ich dachte, wir sollten keine Zeit verlieren.»
Emilio zuckte zusammen. «Wie bitte? Ab morgen?»
Sie nickte. «Wir könnten heute Abend zusammen essen, dabei erzähle ich dir, was mir sonst noch alles zu Niki einfällt. Du kannst Fragen stellen. Und dann könntest du gleich morgen losfahren.»
«Du bist verrückt.»
«Bitte etwas Respekt. So spricht man nicht zu einer alten Dame, die dir mal die Windeln gewechselt hat.»
«Du hast mir die Windeln gewechselt? Das wird ja immer toller.»
«Na, siehst du, ich hab was gut bei dir.»
Emilio konnte nicht anders, er musste lachen. Dann erbat er sich Bedenkzeit bis zum Abend. Was natürlich Unsinn war, den Vorschuss hatte er bereits eingesteckt. Sie tranken noch ein Glas Riesling-Sekt und verabschiedeten sich. Die Mappe mit den Unterlagen nahm er mit. Dabei fiel ihm ein, dass es auch in Südtirol sehr guten Riesling gab.
5
Meran hat eine glanzvolle Geschichte als Kurstadt – was angesichts von unzähligen Reisebussen und Pauschalurlaubern gelegentlich in Vergessenheit gerät. Im 19. Jahrhundert war die Stadt am Zusammenfluss von Etsch und Passer eine noble Destination für die erschöpfte Oberschicht aus ganz Europa, für den Adel und für gekrönte Häupter. Luxuriöse Residenzen legen von dieser Epoche Zeugnis ab, zum Beispiel im Stadtteil Obermais mit seinen Villen und Ansitzen. Marco war die Geschichte von Meran scheißegal. Das nahegelegene Schloss Trauttmansdorff? Ein hässlicher Kasten! Kaiserin Elisabeth, die hier zweimal überwintert hatte? Die magersüchtige Sissi konnte ihm gestohlen bleiben! Der berühmte Botanische Garten? Etwas für verblödete Touristen, die nichts Besseres mit ihrer Zeit anzufangen wussten!
In Obermais gab es viele Gärten. Marco lehnte an einem Zaun und wartete. Er tat so, als ob er in einer Zeitung las, tatsächlich beobachtete er eine Villa auf der anderen Seite der Straße. Dabei hing er seinen Gedanken nach. Er dachte an seine Jugendjahre in Bozen. Marco Giardino war mit dem Herzen ebenso Italiener wie Südtiroler. Mussolinis Umsiedlungsprogramm hatte seine Vorfahren von Kalabrien nach Bozen verschlagen, genauer gesagt in den «neuen» Stadtteil westlich des Flusses Talfer, wo bis heute vorwiegend Italienisch gesprochen wurde. Aber Marco beherrschte fast genauso gut den Südtiroler Dialekt. Und er hatte Freunde und gute Verbindungen in allen Bevölkerungsgruppen.
Aus der Jugendstilvilla trat eine dicke, an Jahren schon ältere, aber überaus agile Frau, sie sperrte die Haustür ab und kam über einen gepflasterten Weg zur Pforte am Gartenzaun. Marco versteckte sich hinter der Zeitung. Er kannte die Person von früher, sie war die Haushaltshilfe in der Villa – und es war besser, wenn sie ihn nicht entdeckte.
Er dachte an seinen alten Job in einem genossenschaftlichen Weinkeller. Dort war er bis zu seiner Verhaftung angestellt gewesen. Marco beherrschte sein Handwerk, das Trennen der Trauben von den Stielen, das sanfte Abpressen, die Steuerung des Pumpkreislaufs und der Temperatur in den Edelstahltanks, das Abziehen des Weins von der Maische, den Ausbau in Barriquefässern … Allerdings hatte er in seinem Beruf nie besonderen Ehrgeiz entwickelt und keine Sekunde daran gedacht, eine Ausbildung zum Kellermeister zu absolvieren. Denn natürlich konnte das alles nicht wirklich befriedigen, vor allem nicht finanziell. Deshalb hatte Marco parallel immer ein zweites Leben geführt, eines, in dem er seine alten Kontakte im Milieu nutzte. Er handelte mit zollfreien Zigaretten, brachte nachgemachte Uhren und Handtaschen unters Volk, auch gefälschtes Viagra. Und er vermittelte gelegentlich Nutten aus Süditalien oder aus Nordafrika. Marco hielt sich auf dem Gebiet der kleinen, schnellen Geschäfte für außerordentlich talentiert. Vor dem tödlichen Zwischenfall, der ihm den langjährigen Gefängnisaufenthalt eingebrockt hatte, war es besonders gut gelaufen, da hatte er an einem wirklich vielversprechenden Projekt mitgewirkt. Danach war alles in die Hose gegangen. In der Opera war er zur Untätigkeit verdammt gewesen. Aber jetzt war er hier!
Marco wartete noch einige Minuten, dann machte er sich auf den Weg. Er überquerte die Straße, ging am Zaun der Villa entlang, sah sich noch einmal um. Schwungvoll nahm er Anlauf, sprang auf einen Mauervorsprung, von dort über die schmiedeeiserne Pforte, er landete auf beiden Beinen, rollte sich ab – und lief geduckt zum Haus. Wie oft hatte er das schon gemacht? Wie lange war das her? Er rüttelte am Gitter zum Kellerfenster, hinter dem der Heizraum lag. Es war als einziges am Haus nicht verschraubt, das war schon immer so gewesen. Auch ließ sich das Kellerfenster, das wegen der Frischluftzufuhr das ganze Jahr gekippt war, mit einem einfachen Trick von außen öffnen. Marco zog das Gitter zurück an seinen Platz und verschwand im Haus. Ohne Licht zu machen, eilte er durch den Keller und über die Treppe hinauf ins Erdgeschoss. Im Foyer blieb er kurz stehen, aber außer seinem eigenen Atem war nichts zu hören. Wie erwartet, war er allein im Haus.
Im zweiten Stock fand er ohne zu suchen den Weg zu einem großen Zimmer unter der Dachgaube. Es war abgeschlossen, aber der Schlüssel lag oben auf dem Türsims. Marco öffnete, ging hinein und blieb stehen. Für einige Sekunden lief der Film rückwärts, Bilder blitzten auf. Marco gab sich einen Ruck, er hatte keine Zeit für Sentimentalitäten. Mitten im Raum waren etwa zwanzig große Umzugskartons gelagert, die Wände war holzvertäfelt, über dem Sofa lag zum Schutz eine große Decke, die Vorhänge waren zugezogen, das Licht war schummrig, und es roch muffig. Er zog einen Schraubenzieher aus dem Gürtel, ging zu einer Ecke und kniete sich hin. Es dauerte nicht lange, dann hatte er eine Platte von der Holzvertäfelung gelöst. Dahinter befand sich ein Hohlraum. Mit einer kleinen Taschenlampe leuchtete er hinein. Er fand ein Bündel Geld, das in einer Plastikfolie eingewickelt war, eine Kassette mit einer Rolex-Uhr, eine Schachtel mit Briefen und eine kleine Holzkiste mit Computerdisketten, mit Fotos, Tonbändern, Speicherkarten für Digitalkameras und einigen Aufzeichnungen sowie Fotokopien von Dokumenten. Außerdem ein rotes Modellauto – ein Ferrari 246 GT aus den siebziger Jahren. Obwohl Marco maßlos enttäuscht war, was die Dicke des Geldbündels betraf, musste er beim Anblick des Ferraris lächeln. Er drehte an den Rädern, rollte ihn kurz über das Parkett, um ihn schließlich wieder zurückzustellen. Dann setzte er sich auf den Boden und zählte das Geld. Nur einige Tausend Euro. Das hatte er sich anders vorgestellt. Wo, verdammt noch mal, war das viele Geld? Er leuchtete erneut in das Versteck, tastete in die Ecken. Nichts, gar nichts. Scheiße! Marco steckte die Rolex-Uhr ein, packte das Geld und die Briefe in eine mitgebrachte Plastiktüte. Die Holzkiste würde er mitnehmen, ihr Inhalt war vielversprechend. Schließlich rückte er die Platte der Vertäfelung wieder an ihren Platz. Alles sah aus wie zuvor.
Marco umkreiste die Umzugskartons. Ob es Sinn machte, sie zu öffnen und durchzustöbern? Abgesehen davon, dass das ewig dauern würde, war kaum damit zu rechnen, dass er etwas finden würde. Er entschied sich dagegen. Er flüsterte ein «Ciao, amico mio», verließ den Raum, zog die Tür hinter sich ins Schloss, sperrte ab und legte den Schlüssel zurück auf den Sims. Im Umdrehen stieß er im Flur gegen eine Stehlampe. Sie fiel mit einem lauten Scheppern um. Marco hielt für einen Moment den Atem an. Als im Haus nichts zu hören war, richtete er die Lampe wieder auf. Zu seiner Erleichterung stellte er fest, dass sie keinen Schaden genommen hatte. Dann verließ er das Haus durch den Heizkeller – mit der Rolex-Uhr, der kleinen Holzkiste und der Plastiktüte mit dem Geld und den Briefen.
6
Emilio beobachtete die Gewitterwolken, die sich über den Bergen zusammenbrauten. Er hatte keine Lust, durch Pfützen zu pflügen. Obwohl sein alter, verbeulter Land Rover dafür bestens geeignet war. Mit ihm konnte man auch durch Bachläufe fahren. Die Pfützen waren nicht das Problem, schon eher die Scheibenwischer, die bei allzu heftigem Regen gelegentlich den Dienst quittierten. Was natürlich widersinnig war, geradezu grotesk, denn der Regen war ja die einzige Daseinsberechtigung für Scheibenwischer! Aber sein geliebter, rechtsgesteuerter Landy war sowieso nicht mit den Maßstäben modernen Automobilbaus zu messen. Die Frontscheibe war zweigeteilt. Polternde Starrachsen sorgten dafür, dass man bei der Fahrt nicht einschlief. Der Schalthebel verdiente seinen Namen nicht, mit ihm konnte man im Getriebe allenfalls rühren. Das flachstehende Lenkrad erforderte permanentes Steuern – weshalb er schon im nüchternen Zustand Schlangenlinien fuhr.
Er war auf der Landstraße unterwegs, er hasste Autobahnen – vor allem gebührenpflichtige! Den Brenner hatte er längst hinter sich gebracht, auch Sterzing, wo er eine Pause eingelegt hatte. Frank hatte ihm den Pretzhof empfohlen, der würde ihm gefallen. Er hatte recht gehabt, die kulinarische Einstimmung auf Südtirol hätte nicht besser sein können, auch nicht der Spanferkelbraten. Nur fühlte er sich jetzt etwas schläfrig.
Nach Bozen waren es nur noch wenige Kilometer. Emilio war sauer – und zwar auf sich selbst. Warum hatte er sich von Theresa breitschlagen lassen? Das musste was mit seinem limbischen System zu tun haben, mit jenen Hirnarealen, die für Emotionen zuständig waren. Sein limbisches System hatte dem Teil seines Gehirns, das für Vernunft und Logik verantwortlich zeichnete, einen Streich gespielt. Emilio schlug mit der Faust gegen das Armaturenbrett. War er jetzt total verblödet? Limbisches System? Bullshit! Natürlich gab es handfeste Gründe, warum er Theresas Einladung gefolgt war. Diese passten als kleines Bündel in einen Briefumschlag und halfen bei seinem aktuellen Liquiditätsengpass. So einfach war das. Es lag an ihm, das Beste daraus zu machen. Immerhin war er nicht gleich am nächsten Tag losgefahren, so viel Stolz musste sein. Die alte Dame konnte doch nicht über seinen Terminkalender verfügen – auch wenn er keine anderen Verpflichtungen hatte.
Wie auch immer, die Nachforschungen im Fall des Niki Steirowitz würde er auf ein Minimum beschränken, das hatte er sich fest vorgenommen. Stattdessen würde er sich mit der gebotenen Ernsthaftigkeit der systematischen Verkostung Südtiroler Weine widmen, außerdem freute er sich auf Speckknödel, Schlutzkrapfen und Kaminwurzen. Er entschuldigte sich schon mal bei Theresa für diese Berufsauffassung. Aber hatte sie nicht leichtfertigerweise selbst von einem «Erholungsurlaub» gesprochen? Außerdem, was sollte schon dabei herauskommen? Zwar konnte er nachvollziehen, dass Theresa Zweifel an der Unfallversion hegte. Aber der Fund der anonymen Warnung hätte etwas eher erfolgen müssen, nicht erst nach zehn Jahren.
Welche Szenarien waren außer einem einsamen Bergunfall vorstellbar? Nun dachte er doch über den Fall nach! Gut, er hatte ja gerade nichts Besseres zu tun. Natürlich könnte es sein, dass Niki damals nicht alleine auf dem Gipfel gewesen war und ein Kamerad den Absturz miterlebt hatte. Aus Angst vor Ermittlungen und möglichen Schuldzuweisungen hatte er sich feige davongemacht. Aber was änderte das?
Nächste Möglichkeit: Niki hatte Selbstmord verübt. Aber in den Unterlagen, die ihm Theresa gegeben hatte, fand sich kein Motiv. Dennoch, die statistische Häufigkeit von Selbsttötungen wurde meist unterschätzt. Er hatte mal gelesen, dass sich in Südtirol deutlich mehr Menschen das Leben nahmen als irgendwo sonst in Italien. Außerdem brachten sich Männer ganz generell sehr viel häufiger um als Frauen. Suizid? Gut möglich!
Das letzte Szenario, dass nämlich Niki Opfer einer Gewalttat geworden war, schien ihm am unwahrscheinlichsten – trotz dieser ominösen Warnung. Nun gut, ausschließen konnte man es nicht. Wer hatte keine Feinde? Aber diese Variante wollte er schon deshalb nicht glauben, weil er sich dann auf die Suche nach einem Täter begeben müsste. Dazu hatte er nun wirklich keine Lust. Lieber saß er auf einer Holzveranda, mit Blick auf Weinlauben, und trank einen Vernatsch, Lagrein, Gewürztraminer, egal.
Mittlerweile kurvte Emilio durch ein ausgesprochen hässliches Industriegebiet am Stadtrand von Bozen – wo waren die verdammten Weinberge? Er hatte kein Navi, aus Prinzip. Emilio war davon überzeugt, dass die Menschen durch Navigationsgeräte jeglichen Orientierungssinn verloren. Die nächste Generation würde ohne Navi nicht mehr auf die Toilette finden. Trotzdem hatte er irgendeine Abzweigung verpasst …