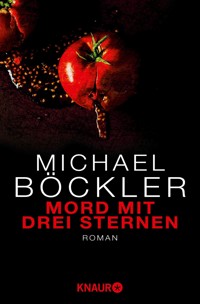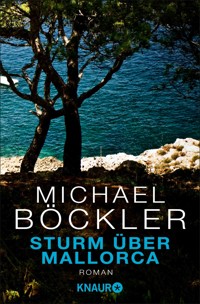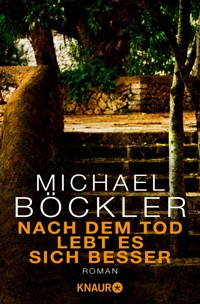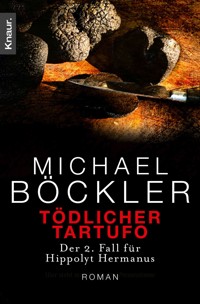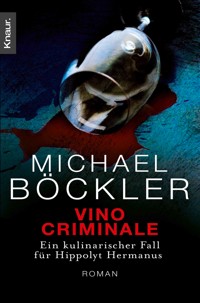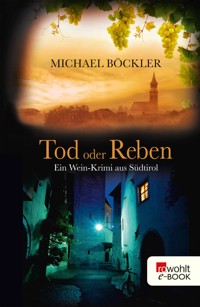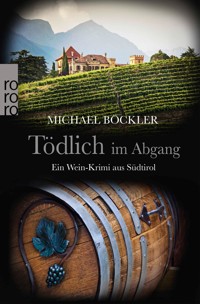
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein
- Sprache: Deutsch
Baron Emilio auf der Suche nach neuen Gaumenfreuden - doch diese Entdeckung ist nicht nach seinem Geschmack. Der neue Weinkrimi von Michael Böckler um Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein. Was soll man mit Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg anfangen, die nie genutzt wurden? Wein darin einlagern! Baron Emilio hält das für eine gute Idee. Er ist nur allzu gern bereit, die attraktive Fotokünstlerin Tilda Kneissl auf ihren Ausflügen für ein Fotobuch über die Südtiroler Bunkeranlagen zu begleiten – erst recht, wenn ein guter Tropfen dabei herausspringt. Doch dann finden sie in einem Vinschgauer Bunker etwas deutlich weniger Erfreuliches: die mumifizierte Leiche einer jungen Frau. Wer ist die Tote? Und wer hatte Grund, sie aus dem Weg zu schaffen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michael Böckler
Tödlich im Abgang
Ein Wein-Krimi aus Südtirol
Über dieses Buch
Emilio sucht neue Gaumenfreuden – doch diese Entdeckung ist nicht nach seinem Geschmack.
Was soll man mit Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg anfangen, die nie genutzt wurden? Wein darin einlagern! Baron Emilio hält das für eine hervorragende Idee. Er ist nur allzu gern bereit, die attraktive Künstlerin Tilda Kneissl auf ihren Ausflügen für ein Fotobuch über die Südtiroler Bunkeranlagen zu begleiten – erst recht, wenn dabei ein guter Tropfen herausspringt. Doch in einem Vinschgauer Bunker findet sich etwas deutlich weniger Erfreuliches: die mumifizierte Leiche einer jungen Frau. Wer ist die Tote? Und wer hatte Grund, sie aus dem Weg zu schaffen?
Vita
Michael Böckler hat sich als Krimiautor einen Namen gemacht. In seinen Romanen verknüpft er spannende Fälle mit touristischen und kulinarischen Informationen. Sein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Wein. Er hat Kommunikationswissenschaft studiert und lebt in München. Südtirol kennt er seit seiner Kindheit, bereist die Region auch heute noch regelmäßig – und natürlich liebt er die Südtiroler Weine.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung yellowfarm gmbh, Stefanie Freischem
Coverabbildung Arun Dangwal/Getty; senorcampesino/iStock
ISBN 978-3-644-40254-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Das Gotteshaus war der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht. Der spitz zulaufende Kirchturm ragte hoch über dem Vinschgauer Talgrund. Im Inneren gab es mittelalterliche Fresken, eine barocke Holzdecke und eine Empore aus dem siebzehnten Jahrhundert. Eine Grabplatte erinnerte an ein längst ausgestorbenes Grafengeschlecht. In manchen Reiseführern wurde der Sakralbau kulturgeschichtlich interessierten Feriengästen zur Besichtigung empfohlen. Am heutigen Tag aber und zu dieser Stunde war die Kirche menschenleer – und totenstill.
Menschenleer? In der dritten Reihe der Holzbänke kniete ein einsamer Mann, vornübergebeugt und mit gefalteten Händen. Es machte den Anschein, als ob er betete. Aber der Eindruck täuschte.
Dem Mann ging in diesem Moment vieles durch den Kopf, aber gewiss kein Gebet. Dabei wäre es so leicht: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden …
Stattdessen hämmerten qualvolle Erinnerungen gegen seine Schädeldecke, als ob sie sich hinauszwängen und seine Schuld in das leere Kirchenschiff hineinschreien wollten. Kurz darauf verwandelten sich die peinigenden Gedanken in einen dunklen Strudel, der ihn unaufhaltsam in die Tiefe zog. In die Hölle, wo der Teufel und das Fegefeuer auf ihn warteten. Wie sollte man bei diesem Martyrium beten?
Immer wieder hatte er es versucht – geschafft hatte er es nie. Auch hatte er nie den Weg zum Beichtstuhl gefunden. Schon deshalb, weil er nicht daran glaubte, dass ein Pfarrer in der Lage war, ihm seine Schuld zu vergeben. So spreche ich dich los von deinen Sünden … Wenn es nur so einfach wäre.
Außerdem bekam er Herzrasen bei der Vorstellung, dass jemand Kenntnis von seiner Tat haben könnte. Beichtgeheimnis hin oder her. Den Glauben an die Kirche hatte er längst verloren, auch jenen an die Unverletzlichkeit des Bußsakraments.
Irrationalerweise suchte er dennoch immer wieder Zuflucht in einer Kirche. Vielleicht hoffte er, dass sich etwas von der heiligen Ruhe auf sein Inneres übertragen und die Wogen seiner Seelenqual glätten könnte? Doch wusste er, dass das Gegenteil der Fall war. Es wurde alles wieder aufgewühlt. Und er wollte es so. Zu groß war die Schuld, die er auf sich geladen hatte. Also tat er Buße – indem er sich bei seinen Kirchenbesuchen quälte und sich seinem inneren Dämon stellte.
Auf ihm lastete die schlimmste aller Sünden. Er hatte gegen das fünfte Gebot verstoßen. Du sollst nicht töten! Bis zu seinem Lebensabend würde ihn verfolgen, dass er einen Mord begangen hatte. Einen Mord zudem aus kühler Berechnung. Wäre es nach seinem Herzen gegangen, hätte er anders entschieden. Minderte das seine Schuld? Nein, es steigerte sie sogar ins Unermessliche.
Dass darüber hinaus noch eine weitere Person zu Tode gekommen war, versuchte er zu verdrängen. Weil die emotionale Nähe zu diesem Opfer fehlte, gelang ihm das ganz gut. Er wollte sich mit dieser Tragödie nicht auch noch belasten.
Wie lange lag dieser finsterste Moment in seinem Leben zurück? Mal kam es ihm vor wie eine Ewigkeit. Dann wieder schien es ihm wie gestern.
Aber er machte Fortschritte. Die Abstände zwischen seinen Kirchenbesuchen wurden größer. Auch quälten ihn immer seltener Albträume, die ihn mitten in der Nacht schweißnass und zitternd aufschrecken ließen.
Vor allem schaffte er es zunehmend gut, die Angstattacken auf das Kircheninnere zu beschränken, vor dem Heiligen Kreuz und im Angesicht der Mutter Maria. Er konzentrierte alle quälenden Gedanken auf diese Phasen der inneren Einkehr. Um danach wieder frei zu sein. Bis zum nächsten Mal.
Wie immer dauerte es seine Zeit, bis er spürte, dass sich sein Atem langsam beruhigte. Dass sich die Verkrampfung um sein Herz löste, auch jene der gefalteten Hände. Und dass der Geist wieder frei wurde.
Als er sich schließlich in der Lage fühlte, ins Leben zurückzukehren, stand er auf. Er bekreuzigte sich, was nicht mehr war als ein Ritual, und nahm von seinen Erinnerungen Abschied. Nicht nur von seinen Erinnerungen, sondern auch von dem Menschen, den er mal begehrt hatte – um ihn dann umzubringen.
Schweren Schrittes verließ er die Kirche. Mit hängenden Schultern. Es war keiner da, der ihn beobachtete. Nicht einmal der Pfarrer. Vielleicht der liebe Gott? Doch fehlte ihm der Glaube. Seine Schritte wurden leichter. Der gebückte Gang aufrechter.
Er setzte eine dunkle Sonnenbrille auf und trat hinaus in das klare Licht des Vinschgau, wo der Ortler nicht fern war und die Etsch, vom Reschen kommend, nach Meran strömte. Es hieß, dass der Gebirgsfluss in der Lage sei, alle peinigenden Gedanken hinwegzuspülen. Doch das war eine Mär.
1
Emilio Baron von Ritzfeld-Hechenstein war kein Freund von Feierlichkeiten und Empfängen. Genau genommen scheute er sie wie der Teufel das Weihwasser. Ihm widerstrebte es, wildfremden Menschen die Hand zu schütteln und dabei ein freundliches Gesicht aufzusetzen. Er hasste es, dumm herumzustehen und inhaltsleere Gespräche zu führen. Er verabscheute lauwarmen Prosecco. Das herumgereichte Fingerfood löste bei ihm nur verständnisloses Kopfschütteln aus. Warum sollte er wie in der Steinzeit mit den Fingern essen? Wenn dann noch Reden gehalten wurden, denen man mit geheucheltem Interesse folgen sollte – spätestens in solchen Momenten setzte sein Fluchtreflex ein.
Dass Emilio trotz dieser ausgeprägten Abneigung am heutigen Tag genau einer solchen Veranstaltung in Meran beiwohnte, war einzig auf die Überzeugungskraft von Phina Perchtinger zurückzuführen. Und darauf, dass er seiner Freundin nur schwer etwas abschlagen konnte. Im Ortsteil Obermais wurde ein Waisenhaus eingeweiht, in dem vor allem Flüchtlingskinder untergebracht waren. Ihre alte Unterkunft war abgebrannt, doch jetzt hatten sie ein neues Zuhause bekommen. Dank eines anonymen Spenders. Wie schön – aber musste man sich deshalb ein schlecht gespieltes Adagio von Händel anhören? Auf der Blockflöte? Emilio langweilte sich zu Tode, aber noch hielt er den Fluchtreflex unter Kontrolle. Ob Phina seine Selbstdisziplin zu schätzen wusste?
Er sah sie von der Seite an und stellte fest, dass sie glücklich lächelte. Wenigstens etwas. Für Phina, die im Überetsch zwischen Bozen und Kaltern ein Weingut besaß, auf dem er mit ihr wohnte, war das Waisenhaus eine Herzensangelegenheit. Er konnte sich noch gut an die Panik in ihren Augen erinnern, als sie von dem schlimmen Brand gehört hatte. Und an ihre Erleichterung, als sich herausstellte, dass von den Kindern keines ernsthaft verletzt worden war.
Nun hielt sich Emilio nicht gerade für einen Kinderfreund. Aber natürlich hatte auch er sich gefreut, dass den Kindern kein Leid geschehen war. Sie konnten ja nichts dafür, dass sie auf der Welt waren. Grundsätzlich konnte er den Fortpflanzungstrieb der Menschen nicht verstehen. Abgesehen von dem Akt als solchem … Aber musste man dafür gleich Kinder in die Welt setzen? Emilio hielt es für einen Segen, dass mit ihm der uralte Adel derer von Ritzfeld-Hechenstein ausstarb. So ersparte er einem Kind, mit seinen degenerierten Genen leben zu müssen.
Während Emilio noch darüber nachdachte, was für eine Zukunft eine Welt haben würde, auf der es keine Kinder gab – was vielleicht doch keine so schöne Perspektive war, jedenfalls für die Menschheit –, hörte die Musik plötzlich auf. Vorne stand ein Rednerpult. Der Bürgermeister von Meran machte sich auf den Weg dorthin. Ganz zweifellos mit der Absicht, eine Rede zu halten. Emilio spürte, wie sich sein Atem beschleunigte. Der Fluchtreflex ließ sich nicht länger unterdrücken.
«Phina, bitte entschuldige, ich muss mal kurz raus.»
Sie sah ihn fassungslos an. «Du kannst doch nicht einfach gehen, ausgerechnet jetzt …»
«Tut mir leid, mir geht’s gerade nicht so gut.»
Er hauchte Phina einen Kuss auf die Wange und trat die Flucht an. Sie versuchte noch, ihn festzuhalten. Vergeblich. Wenn Emilio einen Entschluss gefasst hatte, war er nur schwer zu stoppen.
Draußen angekommen, holte er einige Male tief Luft. Schon ging es ihm besser. Tatsächlich hatte er sich ja nicht wirklich schlecht gefühlt. Er hatte es einfach nicht länger ausgehalten. Emilio lief zu seinem Landrover. Weil er es eilig hatte, klemmte er sich seinen antiken Gehstock, den er immer bei sich führte, unter den Arm. Er kam gut auch ohne ihn zurecht. Genau genommen brauchte er ihn nicht. Aber er hatte sich nach einer schon lang zurückliegenden Schussverletzung am Bein an den Stock gewöhnt. So wie andere Leute an ihr Handy, das sie sich fortwährend ans Ohr oder vors Gesicht hielten. Das war eine schreckliche Zivilisationskrankheit. Sein Gehstock dagegen war ein Familienerbstück, und zwar ein ganz besonderes. Er war innen hohl, und wenn Emilio ihn entriegelte, dann konnte er den darin verborgenen Degen herausziehen. Sein Großvater hatte mit ihm mal die Unschuld einer feinen Dame verteidigt. Wie ritterlich. Aber nicht ganz selbstlos. Schließlich hatte er sie später geehelicht und mit ihr fünf Kinder gezeugt.
Minuten später parkte Emilio vor einer nahe gelegenen Weinschenke. Der Einfachheit halber auf dem Bürgersteig. Emilio liebte kleine Gesetzesübertretungen. Er neigte zum zivilen Ungehorsam. Anders verhielt es sich bei gröberen Verstößen gegen Recht und Ordnung. Wenn sie von kriminell veranlagten Menschen begangen wurden, ließ er sich sogar dazu hinreißen, sie unnachsichtig zu verfolgen – vorausgesetzt, es gab einen Auftraggeber, der ihn dafür bezahlte. Das war eine Frage des Prinzips. Und der Ehre. Das Geld brauchte er nicht. Nicht mehr. Seiner Tante Theresa sei Dank. Er sollte ihr mal wieder Blumen ans Grab stellen.
Er bestellte einen Grappa. Die Wirtin sah ihn verwundert an. Er bestellte sonst nie Tresterschnaps. Aber sie konnte ja nicht wissen, was er gerade durchgemacht hatte. Als er gleich im Anschluss einen seiner Lieblingsweine aus der hervorragenden Lage Mazzon orderte, schien sie beruhigt. Das war der Emilio, den sie kannte – und liebte. Behauptete sie wenigstens. Gott sei Dank platonisch, denn sie hatte die Figur einer trächtigen Haflinger-Stute.
Emilio ließ den Blauburgunder im Glas kreisen. Er erfreute sich an der kirschroten Farbe, er inhalierte den Duft und goutierte zarte Himbeeraromen, er ließ den ersten Schluck eine Weile auf der Zunge und am Gaumen verweilen … und zu guter Letzt durch die Kehle rinnen. Emilio verstand es, aus einem Glas Wein den maximalen Genuss herauszuholen. Das war eine Kunst, die er beherrschte wie kaum ein anderer. Sie war ihm quasi in die Wiege gelegt worden. Er war auf dem väterlichen Weingut im Rheingau aufgewachsen. In zwölfter Generation. Dann hatte sich sein Vater erhängt – und das renommierte Weingut gehörte mittlerweile einer Bank. Doch das war eine andere Geschichte. Kein Mensch interessierte sich mehr dafür, nicht einmal er selbst. Tempi passati …
Die Wirtin servierte ihm unaufgefordert ein Gericht von der Mittagskarte. Ein Risotto mit Radicchio. Sie wusste, was ihm guttat.
Als er mit dem Teller fertig war, bekam er unerwarteten Damenbesuch. Phina! War denn der Empfang schon vorbei? Oder hatte auch sie das Weite gesucht?
«Habe ich mir doch gedacht, dass du hier bist», begrüßte sie ihn. «Hättest wenigstens noch die Rede des Bürgermeisters abwarten können.»
«Eben nicht», grummelte er.
«Er hat sich bei allen bedankt …»
«Ich hab’s befürchtet.»
«Ganz besonders bei dem Finanzier des Waisenhauses, der anonym bleiben möchte.»
Emilio verdrehte die Augen. «Anonym? Ein anonymer Idiot. Wie kann man so sentimental sein und sein Geld für diese unerzogenen Kinder zum Fenster hinauswerfen?»
Er bemerkte, dass Phina ihn seltsam ansah. Weil er sich über den Spender lustig machte? Das Recht nahm er für sich in Anspruch.
«Stimmt, du bist ein Idiot», stellte sie fest. «Ein anonymer, ein sentimentaler Idiot, um genau zu sein. Außerdem schizophren, sonst könntest du nicht so einen Unsinn daherreden.»
Schizophren? Jetzt schoss sie aber deutlich über das Ziel hinaus. Nur weil er gelegentlich Dinge tat, die im Widerspruch zu seinen Äußerungen standen, war er doch nicht psychisch krank. Höchstens ein wenig sonderbar; das mochte sein.
Phina beugte sich zu ihm. «Kimm, loss dr a Bussl gebn», sagte sie auf gut Südtirolerisch.
«Wer von uns beiden ist jetzt sentimental?»
«Ich bin es ganz sicher», antwortete sie. «Außerdem muss dir ja jemand im Namen der Kinder für alles danken.»
«Besser du als der Bürgermeister. Er riecht nach Knoblauch, ist dir das aufgefallen?»
«Gibst du mir nur deshalb den Vorzug?»
Emilio runzelte die Stirn. «Muss ich noch darüber nachdenken. Wo bleibt das Bussl?»
2
Bastian Steingruber war ein leidenschaftlicher Winzer, der vor keinem Experiment zurückscheute. Vor kurzem hatte er in einer Fachgazette gelesen, dass er ein «Weinverrückter» sei. Ein größeres Kompliment hätte man ihm kaum machen können. Denn nach seiner Überzeugung brauchte es im Leben viel Verrücktheit, wollte man wirklich Großes erreichen. Ganz sicher war ein Kolumbus verrückt gewesen. Auch ein Reinhold Messner, als er ohne Sauerstoff auf den Everest wollte. Natürlich war Bastian nicht so größenwahnsinnig, seine Visionen auf eine ähnliche Stufe zu stellen. Mit Kolumbus schon gleich gar nicht. Na ja, ein bisschen vom Geist eines Messner hatte er vielleicht schon. Schließlich strebte auch er zu den höchsten Gipfeln. Sein Ziel war es, die besten Weine zu kreieren, die vorstellbar waren. Mit oder ohne Sauerstoff.
Natürlich fing auch bei ihm die Arbeit ganz normal im Weinberg an. Das war nun mal die Basis für jeden guten Wein. Aber schon da folgte Bastian kompromisslos seinen Vorstellungen vom biodynamischen Anbau. Er verzichtete auf Pestizide und Kunstdünger. Stattdessen füllte er schon mal Hörner mit Kuhmist und vergrub sie über den Winter zwischen den Rebstöcken. Beim Rebschnitt oder der Weinernte achtete er auf die Mondphasen. Er lehnte Reinzuchthefen ab und überließ die Gärung den kosmischen Kräften. Mit dieser Philosophie war er in Südtirol nicht alleine. Immer mehr Winzer erzeugten ihren Wein auf biodynamische Weise. Viele waren wie er Anhänger des Anthroposophen Rudolf Steiner. Aber nur wenige so fanatisch.
Bastian Steingrubers größte Leidenschaft galt dem Ausbau des Weines. Hier gab es nach seiner Überzeugung noch viel unerforschtes Land. Terra incognita! Klassischerweise erfolgte die Reifung in Edelstahltanks. Oder in Holzfässern. Dabei spielte die Größe ebenso eine Rolle wie etwa bei den kleineren Barrique-Fässern das Toasting. Das Holz musste zum Wein passen und die richtigen Noten hervorheben. Aber das wusste jeder Anfänger. Bastian dagegen experimentierte mit anderen Behältnissen. So hatte er ein Faible für große Betoneier. In ihnen könne der Wein langsam um sich selbst kreisen, argumentierte er, und auf diese Weise zu seiner spirituellen Mitte finden. Außerdem sei das Ei der Ursprung des Lebens – mithin die ideale Form, um in ihm etwas reifen zu lassen. Das sei leicht zu begreifen. Doch nicht allen Weinen, so hatte er herausgefunden, tat das Betonei gut, manche kreiselten sich darin offenbar zu Tode. Oder sie kamen entgegen der Theorie gar nicht erst in Bewegung. Er hatte es auch schon mit Granitfässern versucht, um die Mineralität der Weine hervorzuheben. Überzeugt hatte ihn das Ergebnis nicht. Ohne zu wissen, woran es lag.
Seine neueste Leidenschaft galt Amphoren. In diesen Tongefäßen hatten schon die alten Babylonier ihren Wein gelagert. Das konnte so falsch also nicht sein. Vor zwei Jahren hatte Bastian Steingruber erstmals große Amphoren mit Gewürztraminer gefüllt, oben mit Wachs abgedichtet und bis zur Oberkante in der Erde vergraben.
Das Ergebnis war, nun ja, gewöhnungsbedürftig. Und das war geschmeichelt. Irgendwas hatte er falsch gemacht.
Dennoch hatte er den Wein in Flaschen gefüllt – und diese in einem Metallkäfig in einem Bergsee versenkt. Dort bekam der Gewürztraminer eine zweite Chance. Der Sage nach lebte im See eine verwunschene Jungfrau. Vielleicht hauchte sie seinem Wein neues Leben ein …
Den Floh, Weinflaschen unter Wasser zu deponieren, hatte ihm ein Freund ins Ohr gesetzt, der mindestens so verrückt war wie er selbst. Baron Emilio war ein notorischer Querdenker – diesen Wesenszug schätzte er an ihm. Man musste ja nicht alles in die Tat umsetzen, was seinem Freund nach dem dritten Glas Wein so einfiel. In diesem Fall konnte Emilio allerdings ganz nüchterne Argumente vorbringen. Er hatte von Weinen berichtet, die nach Schiffsuntergängen Jahrzehnte später geborgen wurden. Bei ihrer Verkostung habe sich herausgestellt, dass sie sich unter Wasser prächtig entwickelt hatten. Beim verunglückten Gewürztraminer würde er sich allerdings keine Wunder erwarten, hatte er gesagt. Offenbar glaubte Emilio nicht an die Magie verwunschener Jungfrauen.
Weil Bastian die Flinte nicht so schnell ins Korn warf und weiterhin an die Kraft der Amphoren glaubte, hatte er vor kurzem einen zweiten Versuch gestartet. Diesmal mit Lagrein. Und mit dickwandigeren Amphoren, die man nicht eingraben musste.
Zudem hatte er einen weiteren Geistesblitz. Er wusste schon länger, dass die Whisky-Destillerie Puni aus Glurns im Obervinschgau ihre Single Malts in Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg lagerte. Keine schlechte Idee, wenn man die wesentlichen Parameter wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Dunkelheit in Betracht zog. Die Kellerei St. Pauls ließ in einem ähnlichen Bunker einen besonderen Sekt gären. Auch kannte er einen Affineur, der seinen Käse in einem Bunker reifen ließ. Natürlich kam es für Bastian nicht in Frage, seine Amphoren neben Käselaiben zu lagern. Wer mochte schon einen Wein mit den Aromen eines würzigen Graukäse oder eines süßen Kloaznkas?
Da erschien es ihm als Wink des Schicksals, als er von einem Apfelbauern in Mals hörte, der einen Weltkriegsbunker sein eigen nannte, nichts mit ihm anzufangen wusste und ihn deshalb gerne verpachten würde. Schnell wurde Bastian mit ihm handelseinig. Späterer Kauf nicht ausgeschlossen.
Eine kurze Bedenkzeit hatte er zuvor aber doch benötigt. Denn nach seiner Überzeugung übertrugen sich positive wie negative Schwingungen auf den Wein. Weshalb in seinem Barrique-Keller in Girlan immer Musik von Vivaldi lief. Es verbot sich also, die Amphoren mit dem Lagrein einem blutrünstigen Ambiente auszusetzen. Aber die Bunker des Südtiroler Alpenwalls waren nie zum Einsatz gekommen. Mit etwas Phantasie konnte man sie sogar als Fanale des Friedens interpretieren. Jedenfalls wollte Bastian sie so sehen – und diese Botschaft seinem Wein mitgeben.
Jetzt lagerten im Vinschgauer Bunker zwölf Amphoren mit Lagrein. Das Eisentor am Eingang war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ein Dreivierteljahr würde er dem Wein Zeit geben, zu reifen und zu sich selbst zu finden. Hoffentlich mit einem besseren Ergebnis als bei seinem ersten Versuch mit dem Gewürztraminer.
3
Emilio ging seiner Lieblingsbeschäftigung nach – nämlich dem süßen Nichtstun. Er lag im Liegestuhl und döste vor sich hin. Phina war mit dem Traktor in ihren Weinbergen unterwegs. Die Vinothek des Weinguts Perchtinger hatte zwar geöffnet, aber gerade war wenig los, weshalb der alte Oskar ohne seine Hilfe auskam. Folglich konnte er sich mit reinem Gewissen im Schatten der Pergola von den Strapazen des Alltags erholen. Strapazen? Emilio gestand sich ein, dass er momentan keinen Belastungen ausgesetzt war. Weder körperlichen noch seelischen.
Er dachte an die viel zitierte Work-Life-Balance. Die hatte er aktuell außer Kraft gesetzt, weil er sich bei seiner Arbeit als Privatdetektiv eine Auszeit gönnte. Man konnte keine Waage ins Gleichgewicht bringen, wenn eine Schale leer war. Wie er ohnehin die Auffassung vertrat, dass es den Widerspruch zwischen Arbeit und Leben eigentlich nicht geben sollte. Wenn die Arbeit Spaß machte, war sie Bestandteil des Lebens. So wie für Phina der Weinbau. Wenn die Arbeit keinen Spaß machte, sollte man sich eine andere suchen. Punktum!
So weit die Theorie. Dass das in der Praxis nicht für jeden eine Option darstellte, war ihm klar. Insofern betrachtete er es als Privileg, die Wahl zu haben, entweder nichts zu tun – oder Kriminalfälle aufzuklären. Bis vor kurzem war Letzteres für ihn eine ökonomische Notwendigkeit gewesen. Dank Theresas großzügigem Testament war er vom Zwang des Gelderwerbs befreit. Aber er hielt sich für zu jung, um nur noch dem Müßiggang zu frönen. Es grauste ihn bei der Vorstellung … etwa hinter einem Golfball herzulaufen. Da verfolgte er lieber Mörder, Diebe, Vergewaltiger, Erpresser … Das war in jedem Fall kurzweiliger. Und diente überdies einem höheren Zweck.
Emilio tat sich schwer, sich mit seinem Alter zu identifizieren. Mal fühlte er sich wie ein kopfloser Jüngling, dann wieder kam er sich vor wie ein altersweiser Greis. Die Wahrheit lag dazwischen: Emilio war Mitte vierzig. Er konnte also beides sein. Jung und alt – abwechselnd oder gleichzeitig.
Oft wurde er von sich selber überrascht. Entweder weil er sich mit jugendlichem Übermut in ein Abenteuer stürzte. Oder weil plötzlich sein Verstand einsetzte und aus den Tiefen seiner Lebenserfahrung kluge Entscheidungen herbeiführte. So gesehen war er sich selber ein fortwährendes Rätsel.
Ähnlich verhielt es sich mit seinem Phlegma. Emilio konnte tagelang antriebslos herumhängen. So wie gerade eben, wo er wie ein toter Frosch im Liegestuhl lag. Toter Frosch? Lieber verglich er sich mit einem Krokodil. Diese Reptilien konnten aus ihrer Starre urplötzlich zum Leben erwachen – um ihr ahnungsloses Opfer blitzschnell anzugreifen und zu verschlingen.
Allerdings war gerade kein Opfer verfügbar. Nur eine angebrochene Weinflasche und sein Glas neben dem Liegestuhl. Er tastete danach und nahm einen Schluck. Die Augen musste er dafür nicht öffnen. Dass es ein Vernatsch war, merkte er auch so.
Ihm fiel wieder das Bild vom Frosch ein. Dabei kam ihm das Museum für moderne Kunst in Bozen in den Sinn. Denn zur Eröffnung des Museion, das war schon einige Jahre her, hatte der Künstler Martin Kippenberger einen Frosch ans Kreuz genagelt. Die Gotteslästerung hatte für große Empörung gesorgt. Emilio hatte der Frosch gefallen, auch wenn er sein Schicksal nicht teilen wollte. Dann lieber doch ein schlafendes Krokodil …
Emilio döste vor sich hin. Seine schlaftrunkenen Gedanken wurden dabei nicht gescheiter. Was ihn nicht störte. Das war er von sich gewohnt.
Erst eine Fehlzündung von Phinas Traktor holte ihn in die Realität zurück. Dabei gab es bei einem Diesel keine Fehlzündungen. Wie auch immer, jetzt war er wach. Phina winkte ihm lachend zu und fuhr weiter. Emilio sah ihr gedankenverloren hinterher. Dabei schoss ihm durch den Kopf, dass er ein Idiot war. Denn obwohl er mit ihr eine großartige Frau an seiner Seite hatte, konnte er den Lockungen des Weibes nicht immer widerstehen. Aktuell hatte ihn eine gewisse Tilda Kneissl am Haken. Oder umgekehrt? Er sie? Egal. Sie war Fotokünstlerin, trank gerne Champagner, stammte aus dem Grödnertal, hatte eine aufregende Figur und eine geheimnisvolle Aura. Sie war ihm zum ersten Mal bei einer Trauerfeier im Kloster Neustift begegnet. Und danach …
Emilio hüstelte. Dabei gab es keinen Grund, verlegen zu sein. Sah man mal davon ab, dass er mit ihr eine Affäre hatte.
Um sich abzulenken, setzte er sich auf und blätterte in der Südtiroler Tageszeitung Dolomiten. Dabei stieß er auf einen Artikel über die Bunker und Panzersperren des faschistischen Alpenwalls im oberen Vinschgau. Das Thema interessierte ihn aus zwei Gründen. Erstens wusste er, dass sein Freund Bastian Steingruber auf die Idee gekommen war, in einem dieser Bunker Amphoren mit Lagrein zu lagern. Zweitens hatte er am morgigen Tag einen Ausflug auf dem Programm, der ihn dorthin führen würde. Nicht alleine, sondern – wieder musste er hüsteln – mit besagter Tilda, an die er gerade nicht denken wollte. Sie bereitete aktuell eine Fotoausstellung mit Motiven des Alpenwalls vor, von denen manche wie Kunstinstallationen in der Landschaft stünden. Behauptete sie jedenfalls. Man müsse sie nur entsprechend in Szene setzen. Dann wirkten sie wie ein Projekt von Christo und Jeanne-Claude. Nun ja, das war sicher ein allzu kühner Vergleich. Aber neugierig war er dennoch.
Für morgen hatte ihn Tilda eingeladen, sie auf eine ihrer Fotoexkursionen zu begleiten. Er hatte zugesagt. Natürlich aus rein künstlerischem Interesse.
Von Bastian Steingruber hatte er sich den Schlüssel für seinen Bunker mit den Amphoren geben lassen. War sicher spannend, sich das mal anzuschauen. Und ein gutes Fotomotiv für Tilda war es vermutlich obendrein.
Den Artikel in der Zeitung las er recht schnell. Die wesentlichen Fakten hatte er zuvor schon gekannt: Die Befestigungen waren mit gigantischem Aufwand von 1938 bis 1942 entlang der Grenze zum Deutschen Reich errichtet worden. Auf Befehl Mussolinis, der Adolf Hitler offenbar nicht traute und eine Invasion fürchtete. Zum Alpenwall Vallo Alpino del Littorio gehörten bizarre Panzersperren wie jene auf der Hochebene Plamort am Reschenpass. Die «Drachenzähne» waren aus Holzpfählen errichtet, mit Beton ummantelt und mit Eisenspitzen versehen. Hinzu kam eine Vielzahl von Bunkern, ordentlich durchnummeriert, genau sechsundsechzig allein im Vinschgau. Zum Beispiel die unterirdische Anlage Nummer zwanzig. Während dieser «Etschquellbunker» leicht zu finden war und besichtigt werden konnte, lagen andere Bunker bis heute versteckt und waren nur Einheimischen bekannt. Als potenzielle Fotomotive eigneten sich jene Bunker besser, die oberirdisch angelegt waren und eine abgerundete Form hatten. Einige befanden sich in unmittelbarer Nähe der Ortschaft Mals. So auch der berühmt gewordene Bunker Nummer dreiundzwanzig des Benny von Spinn. Aus der Wand ragte ein Wohnwagen. Auf dem Dach hatte er eine sogenannte «Friedensterrasse» eingerichtet. Die Bretter des Geländers symbolisierten die Tonfolge von John Lennons Give Peace a Chance. Der kreative Geist, der dieses Wunderwerk geschaffen hatte, war allerdings 2019 aus dem Leben geschieden.
Emilio hätte ihn gerne kennengelernt. Er mochte Menschen mit Visionen. Auch wenn sie etwas «verrückt» wirken mochten. So wie Bastian Steingruber mit seinen Weinen.
4
Während Emilio mit Tilda ins Vinschgau fuhr, gab es in unmittelbarer Nähe von Bozen einen Mann, der wie er bester Dinge war und den schönen Tag genoss. Ohne zu ahnen, dass genau heute etwas Entscheidendes passieren würde. Etwas, das für ihn den Anfang vom Ende bedeuten konnte. Nicht sofort, vielleicht kam er auch davon, aber es würde ihn ganz sicher in große Gefahr bringen. Da konnte er sich noch so oft in eine Kirche zurückziehen, um Buße zu tun und um Vergebung zu bitten. Das Schicksal würde unbarmherzig seinen Lauf nehmen – und die Vergangenheit ihn einholen.
Ähnlich wie diesem Mann – der nicht vorhersehen konnte, was in den nächsten Stunden geschehen würde – sollte es auch Emilio ergehen. Für ihn hatte der Tag ebenfalls ein unvorhersehbares Ereignis in petto. Ein höchst dramatisches zudem.
Noch war er ahnungslos. Er saß am Steuer seines Landrovers und fühlte sich ausgesprochen wohl, was nicht zuletzt an Tildas Gesellschaft lag, die wie immer unverschämt gut aussah. Emilio verdrängte alle Gedanken an Phina, die nichts von seinem Ausflug wusste. Die aber auch nicht danach gefragt hatte. Sie war es gewohnt, dass Emilio nach dem Frühstück verschwand, ohne ihr zu sagen, was er vorhatte. Steckte er in Ermittlungen, schwieg er sowieso. Auch sonst legte er Wert auf seine Unabhängigkeit.
Tilda legte wie unbeabsichtigt eine Hand auf seinen Oberschenkel. Er warf ihr einen Blick zu. Ein vieldeutiges Lächeln umspielte ihre Lippen. Eigentlich hatten sie mit ihrem Cabrio fahren wollen. Aber weil sie auf der Suche nach den Bunkern womöglich durch unwegsames Gelände fahren mussten, hatten sie sich für seinen Landy entschieden. Mit dem blöden Nebeneffekt, dass er selbst gerade keine Hand frei hatte. Denn die Lenkung war so ausgeschlagen, dass er fortwährend gegensteuern musste. Auch in nüchternem Zustand fuhr er gelegentlich Schlangenlinien.
Naturns lag bereits hinter ihnen. Auch die Burg Juval, wo Reinhold Messner in den Sommermonaten lebte. Und wo das dazugehörige Weingut Unterortl exquisite Rieslinge und Weißburgunder zustande brachte. Wie das Vinschgau überhaupt einen bemerkenswerten Aufschwung als Weindestination erlebte. Emilio mochte viele der Weine, die auf den kargen Böden entstanden. Vorbei war die Zeit, als in dem regenarmen Tal so große Armut herrschte, dass die Kinder im Sommer als «Schwabenkinder» zu Fuß über die Pässe geschickt wurden, um sich in Süddeutschland als billige Arbeitskräfte zu verdingen.
Sie kamen an Kastelbell vorbei, wohin es Emilio sonst nur verschlug, um in einem seiner Lieblingslokale zu speisen. Bei Jörg Trafoier im Kuppelrain.
Es folgten die Orte Schlanders, Laas …
«Warst du mal dort?», fragte Tilda.
«Wo soll ich gewesen sein?», erwiderte er geistesabwesend. In Gedanken war er gerade bei Hirschmedaillons in Portweinsauce.
«In den Steinbrüchen von Laas», antwortete sie. «Der Laaser Marmor ist doch weltberühmt.»
«Weltberühmt? Vielleicht in Südtirol», relativierte er ihre Behauptung, skeptisch wie immer.
«Nein, wirklich. Sogar in New York haben sie für die neue U-Bahn-Station am Ground Zero Laaser Marmor verwendet.»
Er sah sie ungläubig an. «Wirklich?»
«Ich erzähl keinen Quatsch. Der Laaser Marmor ist nicht nur extrem widerstandsfähig, sondern auch besonders schön.»
«Kein Grund, ihn von hier über den Atlantik zu schaffen», meinte Emilio.
«Ich mache im Steinbruch immer wieder mal Modeaufnahmen», überging sie seine kritische Bemerkung. «Der weiße Marmor eignet sich hervorragend als Hintergrund für bunte Fashion … einfach irre. Toll ist auch die schräge Materialbahn aus den dreißiger Jahren, mit der die schweren Marmorblöcke ins Tal transportiert werden …»
Emilio musste schmunzeln. Tilda hatte Temperament und konnte sich leicht für etwas begeistern. Sogar für ihn.
«Zeige ich dir das nächste Mal», fuhr sie fort. «Heute sind die Bunker dran. Viele habe ich schon fotografiert. Doch einige Motive fehlen mir noch.»
Es folgte die Abzweigung zum Stilfser Joch. Es war nicht mehr weit nach Glurns und Mals.
Wenige Zeit später erreichten sie auf Umwegen den Bunker, für den Emilio den Schlüssel besaß. Tatsächlich fehlte er noch in Tildas Sammlung. Wobei es ihr ja nicht darum ging, alle Bunker und Unterstände des Alpenwalls zu fotografieren. Was eine Mammutaufgabe wäre, denn alleine um Mals sollten es vierundzwanzig sein. Dreihundertfünfzig in ganz Südtirol. Vielmehr suchte Tilda nach ausgefallenen Formen und Perspektiven – im Wechselspiel mit der Natur, wie sie sagte. In ihrem Studio würde sie die Bilder bearbeiten und zu großformatigen Kunstwerken umgestalten. Verbunden mit politischen Botschaften. Das konnte sie, darin war sie gut. Oft griff sie dabei zum Pinsel und übermalte die Fotos. Am Schluss tat sich der Betrachter schwer, zu entscheiden, ob es sich um ein Foto oder ein Gemälde handelte.
Sie parkten wenige Meter entfernt auf einer Wiese. Tilda fand, dass Emilios ramponierter Landrover durchaus als Vordergrund taugte. Er sähe kaum jünger aus als der Bunker, stellte sie fest. Emilios Hinweis, dass selbst der älteste Landrover erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut und außerdem das Vinschgau seines Wissens nicht von den Engländern befreit worden war, tat sie mit einem Lachen ab. Ob er noch nie etwas von künstlerischer Freiheit gehört habe?
Während sie mit der Kamera umherschweifte, sich mal auf den Boden legte, um kurz darauf auf das Dach des Landrovers zu klettern und von dort zu fotografieren, öffnete Emilio das Schloss am Eisentor. Er tat dies bedächtig und mit gemischten Gefühlen. Sicher, er wusste, dass all die Bunker des Alpenwalls nie zum Einsatz gekommen waren. Kein Schuss war jemals von hier abgefeuert worden. Blut war nicht geflossen – jedenfalls nicht im Kampf. Bedrohlich wirkten sie trotzdem auf ihn. Aber von außen auch schön. Eine seltsame Melange.
Emilio hatte eine große Taschenlampe dabei. Von Bastian wusste er, dass es drinnen keinen Strom und deshalb auch kein Licht gab. Zögernd betrat er den Bunker. Der Aufbau sei bei allen gleich, hatte ihm Tilda zuvor erklärt. Eine Etage sei unterirdisch, eine oberirdisch angelegt, mit bis zu sechs Meter dicken Mauern aus Beton. Mit Schießscharten für Kanonen. Sogar eine nach oben für die Flugabwehr. Mit Mannschaftsräumen, Sanitäreinrichtungen, Küche … und einem ausgeklügelten System zur Belüftung.
Nach wenigen Schritten blieb er überrascht stehen. Er hatte verrottete Mauern wie in alten Burgen erwartet. Aber im Inneren wirkte alles so gut erhalten wie gerade eben gebaut. Dabei sei der Bunker im Originalzustand, hatte Bastian gesagt. Nur wenige Wände seien herausgebrochen, um mehr Platz zu haben. Das habe der Apfelbauer Mayr gemacht, von dem er den Bunker gepachtet hatte. Ursprünglich sollte auch der Eingang vergrößert werden, um landwirtschaftliche Fahrzeuge unterstellen zu können. Aber das Projekt habe er nicht umgesetzt. Was nichts machte, denn für Bastians Amphoren war der Eingang groß genug.
Emilio entdeckte einige Fledermäuse, die an der Decke hingen. Der Strahl seiner Taschenlampe schien sie nicht zu irritieren.
Er betrat den großen Raum, von dem ihm Bastian Fotos gezeigt hatte. Vor ihm standen die Amphoren aus Ton. Emilio fühlte sich an die Terrakotta-Armee des chinesischen Kaisers Qin Shi Huang Di erinnert. Nur roch es hier nach Wein. Hatte er gerade noch das Bunkerinnere als beklemmend empfunden, verspürte er plötzlich eine völlig andere, mystische und positive Ausstrahlung.
«Nicht erschrecken, du bekommst Besuch», hörte er von hinten Tildas Stimme.
Er sah den Kegel ihrer Taschenlampe näher kommen.
«Wow, sieht das schön aus», raunte sie. «Das hätten sich die armen Schweine, die diesen Bunker gebaut haben, nicht träumen lassen, dass er mal dazu dient, zerbrechlichen Amphoren Schutz zu bieten.»
Emilio klopfte gegen eine. «Und zwar Amphoren randvoll mit Wein», ergänzte er.
«Das muss ich fotografieren. Fragt sich nur, wie ich das mit dem Licht hinbekomme …»
«Im Auto habe ich Streichhölzer.»
«Witzbold.»
Emilio deutete auf einen Gang, der weiter nach hinten führte.
«Zuerst will ich mich noch ein bisschen umsehen. Kommst du mit?»
«Na klar, glaubst du, ich bleib hier alleine mit deinen Amphoren und den Fledermäusen?»
«Sind nicht meine Amphoren.»
Er ging voraus, Tilda folgte dicht hinter ihm.
Mit ihren Taschenlampen leuchteten sie in die kleinen Räume, die am Gang lagen. Sie hatten keine Türen und waren völlig kahl. Als ob sie darauf warteten, dass jemand den Innenausbau endlich zu Ende brachte. Tilda, die den Aufbau der Bunker kannte, wusste, dass eine Kammer für die Offiziere bestimmt gewesen war, eine andere als Munitionsdepot gedient hatte.
Einige Schritte später führte eine Treppe in die untere Ebene. Aber sie ignorierten sie und gingen geradeaus weiter.
«Bleib mal stehen!», sagte Tilda.
Sie leuchtete auf einen Mauerabschnitt, der sich in der Struktur vom Rest des Bunkers unterschied.
«Sieht komisch aus, findest du nicht?»
Emilio runzelte die Stirn. «Nein, nur anders. Da hat wohl jemand versucht, den Beton zu verputzen.»
Tilda strich mit den Fingern über den Putz. Sie trat zurück und machte ein Foto.
«Warum sollte jemand ein Stück der Mauer verputzen?», entgegnete sie. «Graffiti haben wir ja schon einige gesehen …»
Nachdenklich schauten beide auf den seltsamen Mauerabschnitt.
«Früher haben hier junge Leute Partys gefeiert», wusste Tilda zu erzählen. «Wie in den meisten Bunkern, bevor sie mit Stahltüren verschlossen wurden.» Sie lachte. «Aber bestimmt hatten sie Besseres zu tun, als eine Wand zu verputzen.»
«Stimmt, da fällt mir einiges ein.»
Emilio leuchtete in die Kammern, die vom Gang abgingen. An den grauen Wänden gab es Rußspuren. Oben waren erstarrte Tropfsteine zu erkennen.
Er betrachtete den verputzten Mauerabschnitt. Dann drehte er die Taschenlampe um und klopfte an verschiedenen Stellen dagegen.
«Hört sich hohl an», flüsterte Tilda. «Meinst du, dahinter verbirgt sich ein Raum?»
«Hat jedenfalls dieselbe Breite wie die Eingänge zu den anderen Kammern.»
«Könnte also sein. Ich liebe Geheimnisse. Vielleicht gibt es dort einen verborgenen Schatz? So ähnlich wie die verschwundenen Goldbarren in der Franzensfeste …»
«Oder Weinflaschen», hatte Emilio spontan einen anderen Gedanken. «Die Franzosen haben während der deutschen Besatzung ihre wertvollsten Weine eingemauert …»
«So alt ist der Putz nicht. Den Wein kannst du dir also abschminken.»
Emilio sah auf sein Handy. Natürlich hatte er keinen Empfang.
«Komm, lass uns rausgehen. Ich ruf meinen Freund an, der den Bunker gepachtet hat. Vielleicht weiß er, was es mit der verputzten Mauer auf sich hat.»
Während Emilio draußen telefonierte, geisterte Tilda fotografierenderweise um den Bunker, immer auf der Suche nach noch ausgefalleneren Perspektiven. Stirnrunzelnd beobachtete er, wie sie mit umgehängter Kamera auf einen Baum kletterte. Irgendwann würde sie sich bei ihrer Arbeit das Genick brechen …
Bastian Steingruber sagte, dass ihm von einer verputzten Mauer im Bunker nichts bekannt sei. So genau habe er sich nicht umgesehen. Auf Emilios Bitte erkundigte er sich beim Apfelbauern, von dem er den Bunker gepachtet hatte. Aber auch dem Mayr Gustl war die Mauer nie aufgefallen. Außerdem sei sie ihm egal. Es gäbe wirklich Wichtigeres, zum Beispiel eine aus Asien nach Südtirol eingeschleppte Wanze, die einige seiner Apfelbäume befallen habe.
Emilio konnte ihn verstehen. Bei Bastian wunderte er sich aber doch über das Desinteresse. Schließlich war sein Freund ansonsten ein ausgesprochen neugieriger Mensch.
«Hast was dagegen, wenn ich die Mauer einschlage?», fragte Emilio.
«Solange meinen Amphoren nichts geschieht, kannst du im Bunker tun und lassen, was du willst. Vergiss nur nicht, hinterher wieder abzusperren.»
«Okay, dann mache ich mich mal an die Arbeit …»
«Jetzt gleich?»
«Natürlich. Indiana Jones würde auch nicht warten.»
«Indiana Jones? Bist jetzt verrückt, oder glaubst du wirklich, dass sich hinter der Mauer ein Schatz verbirgt?»
«Nein, natürlich nicht. Obwohl … kann man’s wissen? Also dann, servus …»
«Stopp, stopp. Emilio, eine Sache müssen wir noch klä ren.»
«Die wäre?»
«Falls du wirklich was findest, gehört die Hälfte mir. Schließlich ist das mein Bunker.»
Emilio lächelte. Jetzt hatte er doch Bastians Neugier geweckt.
«Streng genommen gehört er deinem Apfelbauern …»
«Aber ich bin der Pächter.»
«Okay, halbe-halbe.»
«Ausgemacht. Und ruf mich an, sobald …»
«Natürlich, mein lieber Bastian.»
Bei der Arbeit im Weinberg brauchte man viele Werkzeuge. Auch solche für grobe Tätigkeiten. Letzte Woche hatte ihn Phina gebeten, im Baumarkt eine schwere Hacke mit zwei stabilen Zinken zu kaufen. Ihr Zweck war es, den Boden zwischen den Rebzeilen zu lockern. Emilio hatte ihren Auftrag pflichtschuldigst ausgeführt – doch prompt vergessen, ihr die Hacke zu übergeben. Sie lag noch hinten in seinem Landrover. Wie so vieles andere. Was sich jetzt als Glücksfall erwies.
Emilio winkte Tilda herbei und machte sich mit der Hacke auf den Weg zurück in den Bunker.
Sie klatschte in die Hände. «Emilio, das wird ein Spaß.»
«Das wissen wir erst hinterher. Vielleicht stoßen wir hinter dem Putz auf eine dicke Betonwand, und das war’s dann.»
«Nein, nein, ich spüre, dass wir was entdecken werden.»
Tilda hatte eine esoterische Ader. Die war ihm fremd. Aber gespannt war er auch.
Vor der Mauer angekommen, gab Emilio Tilda seine Taschenlampe und bat sie, ihm zu leuchten.
«Wie soll ich gleichzeitig fotografieren?»
«Kannst du hinterher immer noch. Bitte geh einen Schritt zur Seite, ich will dich nicht versehentlich erschlagen.»
Sie lachte. «Versehentlich oder mit Absicht? Vielleicht hast du mich in eine Falle gelockt?»
Interessanter Gedanke. Einen besseren Platz konnte man sich kaum aussuchen …
Emilio holte aus und ließ die Hacke mit voller Wucht gegen die Mauer krachen. Der Schlag hallte im Bunker wider. Putz splitterte. Emilio wiederholte die Aktion – schon lockerten sich die ersten Ziegelsteine. Diese sahen völlig anders aus als die übrigen im Bunker. Nicht nur die Form unterschied sich, auch die Farbe: Rotorange statt Grau.
«Die Mauer wurde nachträglich eingezogen», stellte Tilda fest.
Emilio sah, wie es blitzte. Irgendwie schaffte sie es, trotz der beiden Taschenlampen in den Händen auch noch ihre Kamera zu betätigen.
Die ersten Steine brachen heraus und fielen splitternd zu Boden. Hinter den Ziegelsteinen war keine Betonwand, sondern ganz offenbar ein Hohlraum. Emilio fand Spaß daran, auf die Ziegel einzuschlagen. Etwas zu zerstören konnte sehr befriedigend sein. Vor allem, wenn es dabei was zu entdecken gab.
Er machte eine kurze Pause, stützte sich auf die Hacke und schnaufte durch. Um seine Fitness hatte es schon mal besser gestanden.
«Machst du schlapp?»
Bei diesen Worten fühlte er sich in seiner Ehre gekränkt. «Wie kommst du bloß darauf?», erwiderte er.
Tilda hielt die Kamera durchs entstandene Loch und machte eine Blitzlichtaufnahme. Dann schaute sie aufs Display.
«Ist was zu erkennen?»
«Nein, nur dass es sich um eine Kammer handelt. Scheint leer zu sein.»
«Wäre aber schade.»
«Auf geht’s, mach weiter! Oder soll ich dich ablösen?»
«Kommt nicht in Frage.»
Emilio holte aus und begann, weiter auf die Ziegel einzuschlagen. Mit den Zinken der Hacke ließen sich gelockerte Steine gut rausbrechen. Entsprechend wurde das Loch rasch größer. Noch immer konnten sie nicht erkennen, ob in der Kammer etwas gelagert war. Weder Goldbarren noch Weinflaschen. Sollte die Arbeit umsonst sein? Aber warum sollte jemand einen Raum zumauern, der leer war? Eine Erklärung fiel ihm nicht ein, aber möglich war alles.
Bald war das herausgeschlagene Loch groß genug, um hindurchzusteigen.
Emilio machte eine einladende Handbewegung. «Ladies first.»
«Ein Kavalier der alten Schule. Oder hast du Schiss?»
«Schiss vor was? Vor der gähnenden Leere des Nichts?»
Tilda reichte ihm seine Taschenlampe und kletterte durch die Öffnung.
Er erwartete, dass sie gleich was sagte. Auch wenn die Kammer tatsächlich leer war.
Doch von Tilda war nichts zu hören. Er konnte nur den Widerschein ihrer Lampe sehen.
«Was ist?», fragte Emilio, während auch er durch die Maueröffnung stieg.
«O mein Gott …»
Das war nicht die erwartete Antwort. Vor allem klang Tildas Stimme gepresst und seltsam heiser.
Zunächst sah er nur ihren Rücken. Offenbar starrte sie nach unten in eine Ecke. Er schob sie sanft zur Seite. Dann stockte auch ihm der Atem …
5
Phina saß auf ihrer Lieblingsbank, die vor einem Steinblock inmitten ihrer Weinberge stand. Hierher zog sie sich gerne zurück, wenn sie meditieren oder ungestört nachdenken wollte. Schon als Kind hatte sie sehr oft hier gesessen. Die alte Bank, die noch ihr verstorbener Vater gebaut hatte, gab es freilich nicht mehr; sie war verfallen. Aber sie hatte an diesem für sie wichtigen Ort die Überreste der alten weggeräumt und eine neue errichtet. In den alten Südtiroler Geschichten wurde von magischen Plätzen erzählt. Wenn es diese wirklich gab, dann war das hier einer. Davon war sie überzeugt. Sie glaubte, die besondere Energie zu spüren, die von diesem Fleck Erde ausging. Phina liebte es, mit geschlossenen Augen hier zu sitzen und der Natur zu lauschen. Die nächste Straße war weit genug entfernt, um nur die Stille hören zu können. Ihr Vater hatte von einem mythischen «Kraftort» gesprochen, von denen es in Südtirol viele gab. Oft fanden sich dort Spuren heidnischer Kultstätten. Auf dem Felsen in ihrem Rücken waren eingeritzte Zeichen. Ihr Vater hatte erzählt, dass sie seit grauer Vorzeit existierten. Einst hätten sich hier Schamanen getroffen. Aber das sei in Vergessenheit geraten. Heute wüsste nur noch ihre Familie von der Magie und dem Kraftfeld dieses Ortes.
Ihre Familie? Phina atmete tief durch. Von ihrer Familie lebte niemand mehr – nur noch sie selbst.
Was war mit Emilio? War er ihre Familie? Verheiratet war sie mit ihm nicht. Emilio war … Sie suchte nach dem richtigen Wort … Er war ihr Lebenspartner. Soviel war klar. Auch «Lebensgefährte» würde es treffen. Beide Begriffe waren ziemlich unromantisch. Als ob sie eine Geschäftsbeziehung unterhielten. Noch desillusionierender wäre «Lebensabschnittspartner». Sie hoffte, dass Emilio für sie mehr war. Und umgekehrt auch sie für ihn. Sicher war sie sich aber nicht.
Phina hörte ein Rascheln und sah in die Richtung des Geräuschs. Zwischen den Weinstöcken entdeckte sie umherstreifende Hühner. Sie freute sich darüber. Genauso wie über den Marienkäfer auf ihrem Handrücken. Nicht nur, weil er schön aussah. Zudem war er ein Nützling. Und sprach wie die Hühner dafür, dass in ihrem Weingarten die Natur mit sich im Einklang war.
Wo war sie gerade mit ihren Gedanken stehengeblieben? Ach ja, dass sie zwar Emilio hatte, dass ihr aber eine wirkliche Familie fehlte, weil alle nahen Verwandten gestorben waren. Kinder hatte sie keine. Und wie sie seit wenigen Tagen wusste, würde sie auch nie welche bekommen. Ihr Frauenarzt hatte sie mit der Diagnose konfrontiert, dass sie aufgrund einer nicht behandelbaren hormonellen Störung unfruchtbar war. Sie hatte es schon länger geahnt, jetzt hatte sie Gewissheit. Ein schönes Gefühl war das nicht, denn sie liebte Kinder.
Phina wischte sich eine Träne von der Wange – und ärgerte sich über sich selbst. Denn sie hasste es, Gefühle zu zeigen. Aber erstens war sie alleine, und zweitens mussten die Gefühle mal raus. Die Bank vor dem mythischen Felsen war der richtige Ort dafür.
Ihr fiel das Waisenhaus in Meran ein. Die Kinder dort hatte sie in ihr Herz geschlossen. Sie war Emilio unendlich dankbar dafür, dass er die von Theresa geerbte Villa für das Waisenhaus zur Verfügung gestellt hatte und das Projekt mit einer großzügigen Spende unterstützte. Ausgerechnet Emilio, der nach außen immer so tat, als ob er keine Kinder mochte. Aber ohne ihn würde es das Waisenhaus nicht geben. Harte Schale, weiches Herz. Sie kannte niemanden, auf den das mehr zutraf als auf Emilio.
Zu den Kindern zählte die fünfjährige Zola. Phina liebte die Kleine. Sie stammte aus dem westafrikanischen Mali und hatte keine Eltern. Nicht zum ersten Mal ging ihr durch den Kopf, dass sie Zola adoptieren könnte. Jetzt erst recht, wo sie wusste, dass sie selber keine Kinder bekommen würde.
Was Emilio wohl dazu sagen würde? Mit Zola spielte er gerne Memory – um sich zu ärgern, dass die Kleine ihn ständig schlug. Mittlerweile versuchte er, ihr Schach beizubringen.
Emilio, Emilio … Wenn nur sein Freiheitsdrang nicht wäre. Sie wollte gar nicht wissen, was er den ganzen Tag so trieb. Und doch erfuhr sie es regelmäßig. Von Freundinnen, die nichts Besseres zu tun hatten, als ihr zu berichten, dass sie Emilio in weiblicher Begleitung gesehen hätten. So wie vor einer Stunde. Eine blonde Frau sei zu ihm in seinen Landrover gestiegen. Sie sei flippig angezogen gewesen und habe mehrere Kameras dabeigehabt. Ihr Cabrio der Marke Alfa Romeo habe sie zuvor auf einem Parkplatz abgestellt.
Na, vielen Dank auch. Genau diese Information hatte ihr heute noch gefehlt. Es ging ihr schon so nicht gut. Immerhin wusste sie aufgrund der Beschreibung, wer die Frau war. Sie hieß Tilda Kneissl. Emilio war ihr erstmals auf einer Beerdigung im Kloster Neustift begegnet. Er bewunderte ihre künstlerischen Arbeiten. Was ihm sonst noch an ihr gefiel, konnte sie sich denken. Bei nächster Gelegenheit würde sie ihn zur Rede stellen. Er sollte sich darüber im Klaren sein, dass ihre Toleranz Grenzen kannte.
6
Emilio stand neben Tilda, die regungslos am Boden kniete. «O mein Gott», hatte sie gesagt. Jetzt verstand er, warum. In der Ecke der Kammer lag … eine zusammengekrümmte … mumifizierte … Frauenleiche …
Der Anblick war so grauenvoll, dass Tilda für den Moment sogar das Fotografieren vergaß. Die Haut der Leiche war lederartig verschrumpelt, die Wangen bis auf die Knochen eingefallen … lange verfilzte Haare … ein knielanges, rotes Kleid … nackte, verkrampfte Füße …
«Nicht gerade das, was wir erwartet hatten», flüsterte Emilio.
«Eine Mumie …» Ihre Stimme war kaum zu verstehen. «Eingemauert – wie kann das sein?»
«Einen Suizid schließe ich aus», sagte Emilio, der sich seinen schwarzen Humor selbst in dieser Situation bewahrte.
Tilda richtete sich langsam auf. Sie hatte sich so weit gefangen, dass sie sich wieder in der Lage sah, zu fotografieren.
«Wie lange, glaubst du, liegt die Leiche hier schon?», fragte sie.
«Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass menschliche Körper bei geeigneten Bedingungen relativ schnell mumifizieren können. Ganz von selbst. Da reichen wenige Jahre.»
«Dafür spricht auch ihr Kleid; es ist gut erhalten.»
«Trotzdem kommt jede Hilfe zu spät.»
«Das ist nicht witzig.»
Er ging auf ihre Bemerkung nicht ein. Außerdem hatte sie recht.
«Kannst du bitte außer der Leiche auch die Wände der Kammer fotografieren», bat er. «Und die Decke und den Boden.»
Ohne den mumifizierten Leichnam zu berühren, inspizierte er ihn im Schein seiner Taschenlampe. Dabei stellte er sich die Frage, ob die Frau noch gelebt hatte, als sie eingemauert wurde. Ihre zusammengekrümmte Haltung sprach dafür. Eine grauenvolle Vorstellung.
«Schwer abzuschätzen, wie alt die Frau war», murmelte er.
«Nicht so alt. Das Kleid und der Gürtel deuten auf eine junge Frau hin. Auch trägt sie am Fußgelenk ein Kettchen …»
Er beugte sich vor. «Richtig, habe ich gar nicht gesehen. Machst du bitte von der Kette eine Nahaufnahme.»
«Arbeite ich jetzt bei der Spurensicherung?»
«Das überlassen wir den Profis. Aber deine Fotos sind sicher besser.»
«Davon kannst du ausgehen.»
«Sobald du fertig bist, verlassen wir den Tatort und verständigen die Polizei.»
«Tatort?»
«Das hier war ganz sicher kein christliches Begräbnis.»
Draußen angekommen, rief Emilio in der Bozner Quästur bei Commissario Sandrini an. Mit ihm arbeitete er häufiger zusammen. Nicht immer reibungslos. Genau genommen hielt Emilio nicht viel von ihm. Aber sie kannten sich, und Sandrini hatte gelernt, dass es nicht zu seinem Nachteil war, mit dem Privatdetektiv zu kooperieren. Denn Emilio überließ ihm gerne den Ruhm, sobald er einen Fall aufgeklärt hatte.
Als er ihm nun vom Fund der mumifizierten Leiche erzählte, reagierte der Commissario ungläubig.
«Baron Emilio, Sie nehmen mich auf den Arm. Die letzte Mumie, die bei uns gefunden wurde, war der Ötzi. Außerdem, wie sollte eine Mumie ins Vinschgau gelangen? Ein Weltkriegsbunker ist doch keine altägyptische Pyramide.»
Sandrinis Begriffsstutzigkeit konnte ganz schön nerven.
«Wir haben auch keinen Pharao gefunden, sondern eine weibliche Leiche, die mumifiziert ist», stellte Emilio klar. «Alle Anzeichen deuten auf ein Gewaltverbrechen hin», fügte er hinzu, falls Sandrini auch das nicht kapiert haben sollte. «Also schicken Sie umgehend ein Team. Wir brauchen einen Forensiker, die Spurensicherung, also das volle Programm.»
Emilio hörte den Commissario stöhnen. «Können Sie sich das nicht endlich mal abgewöhnen?»
«Was soll ich mir abgewöhnen?»
«Immer wieder über Leichen zu stolpern. Wenn Sie wüssten, wie viel Arbeit Sie mir damit machen. Jetzt graben Sie schon jahrhundertealte Leichen aus. Nur, um mich in den Wahnsinn zu treiben.»
Eine interessante Sichtweise, die aber an der Realität vorbeiging.
«Die Frau ist erst wenige Jahre tot», korrigierte Emilio ihn. Auch wenn er sich, was die genaue Zeitspanne betraf, natürlich nicht sicher sein konnte.
«Wie kann sie dann mumifiziert sein?»
«Das wird uns der Gerichtsmediziner erklären.»
«Baron Emilio, wir sind gerade mit einem wirklich schlimmen Fall beschäftigt, der alle unsere Kapazitäten bindet. Ihre Mumie kann doch sicher noch etwas warten.»
«Ist nicht Ihr Ernst? Ich melde Ihnen den Fund einer Leiche, und Sie wollen sich erst um andere Dinge kümmern.» Emilio machte eine kurze Pause. «Aber einverstanden, dann informiere ich die Presse, dass wir eine mumifizierte Leiche gefunden haben.»
«Die Presse informieren?» Sandrinis Stimme überschlug sich. «Um Gottes willen, nur das nicht. Dann habe ich auch noch die Pressefuzzis im Nacken. Baron Emilio, ich flehe Sie an, bitte behandeln Sie den Leichenfund mit äußerster Diskretion. Ich verspreche Ihnen auch, dass ich meine Leute sofort losschicke.»
Na bitte, warum nicht gleich?
«Sehr schön, ich warte.»
Emilio nannte ihm die Koordinaten des Bunkers. Und er gab ihm die Empfehlung, ohne Blaulicht und Sirene zu kommen. Denn in zwei Punkten hatte der Commissario recht: Übertriebene Eile war bei einer mumifizierten Leiche nicht geboten. Und auf übertriebenes Aufsehen konnten sie auch verzichten.
7
In der Kammer mit der mumifizierten Leiche waren Scheinwerfer aufgestellt. Spurensicherer nahmen mit Spezialgeräten jeden Quadratzentimeter in Augenschein. Zum Beispiel suchten sie nach eingetrockneten Blutspuren und genetischem Material. Dabei standen sie sich wechselseitig im Weg, denn viel Platz gab es nicht – obwohl die Frauenleiche bereits rausgeschafft war und auf einer Spezialfolie im Gang lag. Die erste Untersuchung hatte der Rechtsmediziner Professor Dr. Turmstaller noch am Fundort durchgeführt. Jetzt examinierte er den mumifizierten Körper genauer. Emilio stand neben ihm und beobachtete ihn bei seiner Arbeit. Tilda hielt sich im Freien auf, um sich von den schockierenden Eindrücken zu erholen.
Turmstaller hatte einen ausgezeichneten Ruf. Emilio und er kannten sich von einem früheren Fall und von gemeinsamen Weinverkostungen, weshalb der Rechtsmediziner seine Anwesenheit akzeptierte.