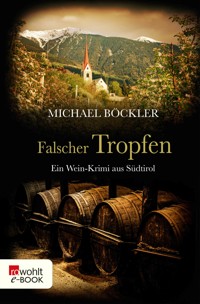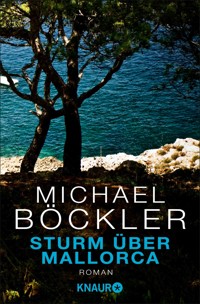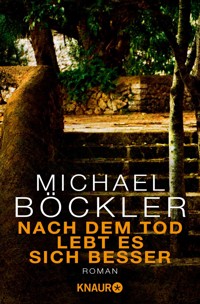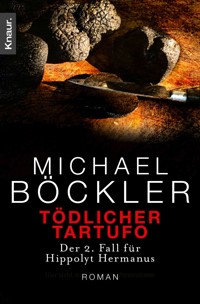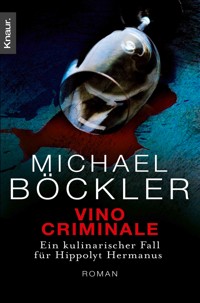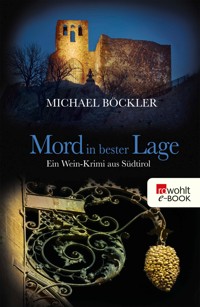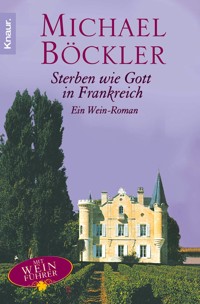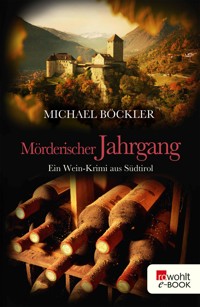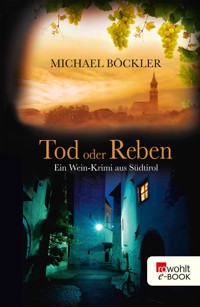6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein letzter Takt Verdi, ein Taumeln, ein Stürzen. Sekunden später liegt die alte Dame einige Meter tiefer und sehr viel lebloser zwischen ihren Rosen. Ihrem Enkel, dem Modefotografen Mark, hinterlässt sie ein stattliches Vermögen inklusive Villa am Gardasee. Doch das Dolce Vita will sich für Mark nicht einstellen. Dafür gibt es zu viele Anhaltspunkte, dass seine Großmutter keines natürlichen Todes starb. Und dass man auch ihm nach dem Leben trachtet. Michael Böckler schickt seinen Helden vom Gardasee bis Venedig auf eine fesselnde Krimihatz.Und hat damit auch noch einen ungewöhnlich unterhaltsamen Reiseführer geschrieben: Mit vielen touristischen Tipps unf Rezepten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Michael Böckler
Verdi hören und sterben
Ein Roman aus Venedig und dem Veneto
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
»Mir wurde klar, dass ich mich an einem Ort befand, wo, wenn das Falsche wahr schien, das Wirkliche Traum sein musste. An einem Ort, wo der Verstand nur noch halben Wert hatte. An einem Ort, wo die Vernunft von der überhitzten Phantasie zum Opfer trügerischer Hoffnung gemacht wurde.«
Giacomo Casanova in den Bleikammern von Venedig
Prefazione
Der Roman beginnt am Gardasee mit einer alten Dame, die auf der Terrasse ihrer Villa mit einem Glas Rotwein den Sternen zuprostet. Und die Handlung endet – so viel sei hier bereits verraten – in Venedig, der Serenissima, der unvergleichlichen Stadt in der Lagune, mit ihren glanzvollen Palazzi, verwunschenen Kanälen und schwarzen Gondeln. Jenem Venedig, das historisch sein Glück zunächst nur auf den Meeren gesucht hat, seinen Herrschaftsbereich im 15. Jahrhundert aber auf das Festland auszudehnen wusste. Der geflügelte Löwe von San Marco machte sich die Terraferma und damit stolze Städte wie Verona, Vicenza, Padua und Treviso untertan.
Das heutige Veneto reicht vom Ostufer des Gardasees bis hinauf nach Cortina d’Ampezzo in den Dolomiten und im Süden hinunter zum breiten Flusslauf des Po. Und natürlich bis nach Venedig, dem Stein gewordenen Traum am Adriatischen Meer. Die Landschaft Venetiens könnte abwechslungsreicher kaum sein. Mit gewaltigen Berggipfeln, mit sanften Hügeln und weiten Ebenen, mit Weinbergen und Olivenhainen, mit Lärchen, Palmen und Pinien, mit langen Sandstränden und Lagunen. Diese Vielfalt ist es wohl auch, die dazu führt, dass sich kein einheitliches Bild des Veneto ergeben will. Anders als beispielsweise die Toskana weckt das Veneto keine spontanen Assoziationen. Und auch die geografische Abgrenzung ist trotz fast vierhundertjähriger gemeinsamer Geschichte nicht allgemein gewärtig, was wohl am alles überstrahlenden Glanz der Lagunenstadt liegen dürfte. Aber gerade dieses unendlich breite Spektrum an Eindrücken macht den besonderen, einmaligen Reiz Venetiens aus. Einer Faszination, der auch die handelnden Personen des Romans erliegen. Allerdings, wie sich zeigen wird, auf individuell sehr unterschiedliche Weise – und mit entsprechend gegensätzlichem Ausgang.
Die folgenden Abenteuer, die mit der alten Dame am Gardasee ihren Anfang nehmen, führen durch die wichtigsten Städte und Regionen des Veneto. Was kein schicksalhafter Zufall ist, sondern erklärte Absicht, denn das Buch verfolgt neben der (hoffentlich spannenden) Unterhaltung noch ein weiteres Ziel: Es soll gleichzeitig ein touristischer Begleiter sein, eine andere, besondere Art von Reiseführer. Denn in den Roman ist systematisch eine Fülle von Informationen über das Veneto integriert. Die Erzählung wirft ein Licht auf die wechselvolle Geschichte Venetiens – von den Skaligern Veronas über die Dogen von Venedig bis zu Napoleon. Auch die großen Maler finden sich darin – von Veronese über Tizian bis Canaletto. Geniale Baumeister wie Andrea Palladio werden vorgestellt. Und weil die Protagonisten des Romans ganz generell den schönen Dingen des Lebens zugetan sind, kommen auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz. Der Roman führt durch die wichtigsten Weine des Veneto (vom Valpolicella über den Soave bis zum Prosecco), präsentiert die Delikatessen des Landes (vom Radicchio über Fegato alla veneziana bis zur Polenta) und gibt eine Vielzahl von Restaurant- und Hotelempfehlungen, wobei einige ausgesuchte Lokale sogar ihre beliebtesten Rezepte verraten und zum Nachkochen animieren.
Damit das Ganze nicht zu unübersichtlich wird, gibt es – wie schon in den vorangegangenen Büchern über Mallorca und die Toskana – einen umfangreichen touristischen Anhang. Der Anhang liefert kompakte Informationen – inklusive Telefonnummern und Adressen. Es wäre also ein Leichtes, die Fährte der Handlung aufzunehmen und die Originalschauplätze des Romans aufzusuchen. Ein Unterfangen, bei dem der Leser automatisch auch auf den Spuren des Autors wandeln würde.
Zum Abschluss dieses Vorworts noch ein kurzer Exkurs zu Giuseppe Verdi. Der große Komponist so herrlicher Opern wie Nabucco, Rigoletto, La Traviata und Aida wurde 1813 in Le Roncole bei Busseto und damit in der Emilia-Romagna geboren, hat aber dennoch im Titel eines Veneto-Romans seinen legitimen Platz. Und zwar aus zwei Gründen: Erstens steht die Arena von Verona fast schon synonym für die großen Aufführungen seiner Opern, die darüber hinaus immer wieder von Venedig inspiriert waren und zum Teil auch an Venedigs Teatro La Fenice ihre Uraufführung hatten. Und zweitens hat die alte Dame am Gardasee nun mal eine Vorliebe für Verdis große Arien, die so phantastisch mit der Landschaft und dem Lebensgefühl des Veneto korrespondieren. Aber nun genug der Vorrede. Die alte Dame am Gardasee wartet schon!
Lo scrittore chiede perdono per il destino della Signora. Tuttavia, buon divertimento!
PROLOGO
Die alte Dame setzte den Tonarm auf die Schallplatte. In Erwartung der Streicher, die gleich beginnen würden, umspielte ein freudiges Lächeln ihre Lippen. Ein vertrautes Knistern kam aus den Lautsprechern. Wie oft wohl hatte sie diese Platte mit Giuseppe Verdis großen Arien schon gehört? Gut dreißig Jahre mochte es her sein, da hatte sie mit ihrem Mann in der Arena di Verona Verdis Oper Aida besucht. Und am nächsten Tag hatte er ihr diese Platte geschenkt. Mit der linken Hand gab sie dem Orchester ein Zeichen. Auf den Takt genau setzte es ein. Zunächst die Geigen, sanft und schmeichelnd. Dann die Celli, tief und melodisch. Und schließlich der Tenor: »Quando le sere al placido chiaror d’un ciel stellato …« Wenn abends im friedlichen Licht des Sternenhimmels …
Ottilia Balkow nahm das Rotweinglas, das sie neben dem Grammofon abgestellt hatte, und ging die wenigen Schritte durch die weit offen stehende Terrassentür hinaus ins Freie. Für die alte Dame, sie war fast neunzig, gehörte dies zum allabendlichen Ritual. Sie würde noch dieses eine Glas mit dem schweren, süßlichen Wein trinken, einen Blick hinaus auf den See werfen, die warme Luft einatmen, den Klängen Verdis lauschen und dann zu Bett gehen.
Seit vielen Jahren schon lebte sie in dieser Villa an den Hängen unterhalb von Albisano am Gardasee, an jenem östlichen Ufer, das die Riviera degli Olivi genannt wird und zum Veneto gehört. Bei Tag reichte der Blick über die Dächer des mittelalterlichen Orts Torri del Benaco, über das Kastell und die Kirche weit hinaus auf den See, der sich im Norden fjordähnlich verengt und nach Süden zur Ebene hin öffnet. Links die märchenhafte Isola del Garda, am anderen Ufer die sanften Hügel von Gardone, dahinter die felsigen Gipfel des Monte Spino und des Monte Pizzòcolo.
Jetzt, spät am Abend, es ging bereits auf Mitternacht zu, da ahnte man nur die Silhouetten der hohen Pinien, die rechts und links der Terrasse standen. Die alte Dame richtete den Blick hinauf zu den Sternen, die der Tenor in Verdis Oper Luisa Miller gerade gepriesen hatte. Sie sang leise mit: »Che sembrò l’empireo aprirsi all’alma mia.« Dass sich der Himmel meiner Seele zu öffnen schien.
Ottilia Balkow liebte das begleitende Zirpen der Zikaden, das den Arien von Verdi ein ganz besonderes, mediterranes Flair verlieh. Nach einem Schluck aus dem Glas ging sie vor zum Geländer. Die Schatten vor ihr, das waren knorrige Olivenbäume, viel älter noch, als sie es war. Bestimmt einige hundert Jahre alt. Die Olivenbäume hatten schon Generationen überlebt. Und sie würden auch sie überleben. Für Ottilia Balkow waren die Olivenbäume weniger wegen ihres zarten und nussigen Öls von Bedeutung, das sie gleichwohl sehr zu schätzen wusste. Sie waren in ihren Augen in erster Linie Symbole, Mahnmale der Ewigkeit.
Sie dachte an ihren Mann, der schon lange tot war, und an ihre Tochter Patrizia, die Selbstmord begangen hatte. Wie lange war das jetzt her? Zehn Jahre, ja, genau vor zehn Jahren hatte sich Patrizia umgebracht. In England, dort, wo sie mit einem Maler verheiratet gewesen war. Ottilia Balkow seufzte. Das war wohl der Tribut, den man dafür zahlen musste, wenn man ein solches Greisenalter erreichte. Man musste den Verlust von Menschen hinnehmen, die einem nahe standen und eigentlich noch gar nicht an der Reihe waren. Manchmal plagten sie Schuldgefühle, dass sie noch lebte und sich bester Gesundheit erfreute. Aber nur selten, denn im Grunde war sie mit sich und ihrem Schicksal zufrieden. Ottilia Balkow lächelte. Ja, und in Augenblicken wie diesem, da war sie glücklich, ausgesprochen glücklich.
Ein ereignisreiches Leben lag hinter ihr. Die Ehe mit einem Diplomaten hatte sie in ferne Länder geführt. Die fremden Kulturen hatten sie fasziniert, der Kontakt zu den Menschen war ihr immer wichtig gewesen. Aber nirgends hatte es ihr so gut gefallen wie hier am Ufer des Gardasees. Vor allem im Frühling, wenn auf dem Monte Baldo noch Schnee lag und gleichzeitig die Pfirsichblüten ihren Garten mit einem rosa Schleier überzogen. Und im Herbst, wenn die Heerscharen der Touristen wieder entschwunden waren, die Luft noch warm war und das Licht auf dem See von schimmerndem Glanz. In den Wintermonaten, die sich oft von ihrer kalten und unwirtlichen Seite zeigten, in denen Nebel aus der Poebene heraufkroch, da fuhr sie immer noch gelegentlich nach Verona, Vicenza, Padua und Treviso. Und natürlich nach Venedig, diesem unvergleichlichen Juwel in der Lagune.
Ottilia Balkow kannte fast alle Antiquitätengeschäfte zwischen dem Lago di Garda und dem Lido von Venedig. Schließlich war das Sammeln von alten Möbeln, Bildern, Kerzenleuchtern, Spiegeln und Gläsern zu einer späten Leidenschaft geworden. Und da sie durch die Ehe mit ihrem Mann, der einer wohlhabenden Familie entstammte, über ein ansehnliches Vermögen verfügte, konnte sie dieser Passion ohne allzu große Zwänge frönen. Nun, da ihr diese Ausflüge immer schwerer fielen, erfreute sie sich an all den Dingen, die sie im Laufe der Jahre in ihrer Villa angesammelt hatte.
»Dio! Mi potevi scagliar tutti i mali della miseria …« Der Tenor auf der abgenutzten Schallplatte war mittlerweile bei Otello angelangt. Gott, hättest Du auf mich alle Qualen des Unglücks gehäuft …
Ottilia Balkow strich gedankenverloren über ihr fast bodenlanges Seidenkleid, prostete ins Dunkel der Nacht, leerte mit einem letzten Schluck ihr Glas und machte kehrt, um zurück ins Haus zu gehen. Sie war nicht mehr ganz nüchtern, aber an diesen Zustand war sie gewohnt. Nach ihrer festen Überzeugung war der Rotwein so etwas wie ein Lebenselixier. Sie wählte den Weg am niedrigen Mäuerchen entlang, hinter dem sich einige Meter tiefer das Rosenbeet befand, das noch ihr Mann angelegt hatte. Plötzlich, sie wusste nicht warum, stockten ihre Beine. Sie geriet ins Straucheln, fühlte sich unversehens nach rechts gezogen. Während sie noch über ihre Ungeschicklichkeit nachdachte und darüber, dass ihr das noch nie passiert war, versuchte sie mit rudernden Armen das Gleichgewicht wieder zu finden. Dann fiel ihr noch ein, dass einer ihrer Enkel sie vor nicht so langer Zeit besorgt vor dieser nur wenige Handbreit hohen Mauer gewarnt hatte. Immerhin gehe es unmittelbar dahinter steil nach unten. Sie wusste auch noch ihre Antwort, nämlich, dass dies nun schon seit Jahrzehnten so sei und allenfalls für Besucher eine Gefahr sein könne. Ottilia Balkow ärgerte sich, dass sie nun genau an dieser Stelle aus der Balance geraten war. Sie hatte doch keinen Tropfen mehr getrunken als sonst auch. Und jetzt zog sie der Abgrund hinter dem lächerlich niedrigen Mäuerchen richtiggehend an. Sie hörte noch die Stimme Otellos: »Desdemona, Desdemona. Ah! morta! morta …«
Sekunden später lag die alte Dame einige Meter tiefer zwischen den Rosen – unnatürlich verrenkt und regungslos.
»Or morendo, nell’ombra in cui mi giacio …« Nun, im Sterben, da Schatten mich umfangen …
Aber Ottilia Balkow konnte ihre Lieblingsplatte nicht mehr hören.
PRIMA PARTE
La sfida alla fortunaSpiel mit dem Glück
1
Mark Hamilton stand am Strand des Lido mit dem Rücken zum Meer bis zum Bauchnabel im Wasser. Hinter ihm, weit draußen am Horizont, zogen lautlos einige Frachter vorbei auf ihrem Weg nach Triest. Vor ihm die malerische Kulisse der Capanne, jener Badehäuschen, die schon in den zwanziger Jahren das Bild am Lido bestimmt hatten. Wie kleine weiße Beduinenzelte sahen sie an diesem Abschnitt des Strandes aus, auf der Spitze jeweils eine Glaskugel, in denen sich die noch tief stehende Morgensonne spiegelte. Und dahinter die unvergleichliche Fassade des Hotels Excelsior mit einem kühnen Stilmix aus maurischen und byzantinischen Elementen.
1907 war der Stein gewordene Traum aus Tausendundeiner Nacht mit einem legendären Fest eröffnet worden. Zwei Stunden hatte allein das imposante Feuerwerk gedauert. Dreitausend geladene Gäste feierten bis zum frühen Morgen. Von Anbeginn an haben sich in diesem Palast alle eingefunden, die zum »grande mondo« zählten. Barbara Hutton, Elsa Maxwell und Erroll Flynn gehörten zu den Stammgästen. Winston Churchill liebte es, vor dem Excelsior am Strand spazieren zu gehen. Um sich vor der Sonne zu schützen, zog er dabei den Bademantel über den Kopf. Wie ein Tuareg habe er dann ausgesehen, berichteten Chronisten. Und zum Bad im Meer habe er seine Sandalen ausgezogen. Aber nur die Sandalen, nicht den Bademantel.
Mark kniff prüfend ein Auge zu. Die große Kuppel des Excelsior schimmerte grün. Die Fassade mit ihren orientalischen Zinnen gab den roten Glanz des Morgens wieder. Die Fluten der Adria liefen sanft auf dem Sand aus. Die Luft war klar und das Licht zu dieser frühen Stunde geradezu perfekt.
»I’m ready, avanti, let’s go!«, rief Mark und brachte seine Kamera in Position. »It’s showtime!«
Vor ihm am Strand bewegten sich die Models in lang geübter Routine. Die weißen Chiffonkleider der neuen Kollektion waren so fein, dass sie fast durchsichtig wirkten. Von rechts sorgte eine Windmaschine für eine leichte Brise. Gerade stark genug, dass die zarten Stoffe wie schwerelos zu schweben schienen. Links befand sich die Crew: die Stylistin, die Maskenbildnerin. Der Werbeleiter der Modefirma, die die Produktion in Auftrag gegeben hatte, saß auf einem Klappstuhl und gefiel sich in seiner bedeutenden Rolle. Mit seiner Zigarre und der dunklen Sonnenbrille sah er aus wie die schlechte Kopie eines Hollywood-Regisseurs.
Mark schoss die Aufnahmen im Sekundentakt. Schon war der erste Film durch. Sein Assistent, der neben ihm im Wasser stand, nahm die Kamera entgegen und reichte ihm die nächste. Die Stylistin eilte zu den Models und setzte ihnen schwarze Strohhüte auf. Eine Assistentin zupfte aufgeregt an den Kleidern herum.
Mark beugte sich über das Wasser und peilte durch den Sucher. Die Reflexe auf den sanften Wellen faszinierten ihn. Sie tanzten auf und ab, drehten sich im Kreise. Ein Ballett irisierender Kristalle. Immer in Bewegung, voller Überraschungen und Geheimnisse.
Mark richtete sich wieder auf und beobachtete die Szene am Strand. Die Kollektion war nicht übel, immerhin. Und in spätestens einer Stunde würden sie fertig sein. Vier Tage hatte das Shooting gedauert. Das Honorar, das seine Agentin in London ausgehandelt hatte, war in Ordnung. Da konnte er ohne finanzielle Probleme wieder eine schöpferische Pause einlegen. Diese Auszeiten trieben Norma regelmäßig zum Wahnsinn. Gerade dann hätte er immer die tollsten Aufträge haben können – behauptete sie jedenfalls. Ihm war das allerdings ziemlich egal. Er hatte keine Lust, sich vollends vermarkten zu lassen. Nun ja, auf diese Weise würde er den ganz großen internationalen Durchbruch als Modefotograf wohl nicht schaffen. Und reich wurde er so auch nicht. Aber was machte das schon! Außerdem war er auch so ganz gut im Geschäft. Mark Hamilton bewohnte einen Loft in London, der nicht viel kostete. Er hatte bereits seinem Vater, der Maler gewesen war, als Atelier gedient. Und außerdem war er sowieso meistens unterwegs. Besondere Ansprüche hatte er keine. Bei den Fotoproduktionen war ohnehin immer alles vom Feinsten. Und in der Zeit dazwischen ließ er es locker angehen. Ihm war ein Schlafsack am Strand von Biarritz genauso recht wie eine Suite im Ritz-Carlton. Als geborener Engländer, mit einem schottischen Vater und einer deutschen Mutter, zur Schule gegangen in London, in den Ferien viel in Deutschland und bei seiner Großmutter in Italien, später auf der Fotoakademie in Paris und bei Fotoshootings schon fast überall auf der Welt, fühlte sich Mark als ausgesprochener Kosmopolit. Er reiste viel herum. Fotografierte dabei einfach zum Spaß. Ging gern zum Essen. Hielt nach Mädchen Ausschau, die ihm gefielen. Und wenn das Geld knapp wurde, erklärte er die schöpferische Pause einfach für beendet, rief seine Agentin Norma an und zog wieder einige Produktionen durch. Das kam seiner Vorstellung vom idealen Leben ziemlich nahe.
Mark kontrollierte das Objektiv. Keine Wasserspritzer. Alles klar.
»Okay, Girls, es geht weiter. Und schaut nicht so ernst. Das ist hier keine Beerdigung. Girls wanna have fun!«
Die Stylistin rückte noch einen Hut zurecht und lief dann mit bloßen Füßen über den Sand aus dem Bild. Unwillkürlich folgte Mark ihr mit der Kamera. Miranda, so hieß die Stylistin, mit der er bei dieser Produktion zum ersten Mal zusammenarbeitete, gefiel ihm ungleich besser als die Models, denen es nach seinem Geschmack am wünschenswerten Sex-Appeal mangelte – wofür sie gewiss nichts konnten. Sie entsprachen nun mal perfekt dem Schönheitsideal der Modeindustrie, hoch aufgeschossen und ziemlich mager. Er persönlich hatte es gerne etwas femininer. Mark drückte einige Male auf den Auslöser. Miranda blieb stehen, sah ihn an, lachte und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Wieder drückte Mark auf den Auslöser.
»Gleich gibt’s Ärger«, zischte ihm sein Assistent von der Seite zu. Mark warf einen Blick zu den Models, die sich ganz offensichtlich missachtet fühlten. Er sah, dass der Werbeleiter bereits seine Zigarre zur Seite gelegt hatte und im Begriff war aufzustehen.
»Okay, Girls, ich bin ja schon bei euch!«, rief Mark und konzentrierte sich wieder auf seine Arbeit. »Carla-Darling, dreh dich doch bitte etwas mehr zur Seite. Und Lisa, steh nicht so steif. Ja, so ist’s besser.«
2
Im Palazzo Vendramin-Calergi war Hochbetrieb. Aber wohl keiner seiner Besucher würdigte in angemessener Form die Pracht dieses Palastes am Canal Grande. Kein Auge hatten sie für die seidenbespannten Wände, die schweren Lüster aus Muranoglas, die kunstvollen Fresken und Stuckaturen. 1883, ein Jahr nach der Premiere von Parsifal, war Richard Wagner in diesem Palast der Frührenaissance verstorben, an seinem Bett Cosima, die Tochter von Franz Liszt. Aber auch das interessierte an diesem Abend niemanden. Stattdessen fieberten sie ihrem Glück entgegen. In den Wintermonaten bis in den späten Frühling rollt im Palazzo Vendramin-Calergi die Kugel, werden Karten gemischt und Spielautomaten malträtiert. Erst im Juni verlegt das Casinò Municipale di Venezia seinen Sitz auf den Lido in den Palazzo del Casinò.
Er stellte sein leeres Cocktailglas auf den Tresen und atmete ruhig durch. Der nackten Schönheit auf dem Ölgemälde über der Bar schenkte er zum Abschied ein vertrautes Lächeln. Dann ging er hinüber zu dem separaten Raum, in dem die Einsätze am Roulettetisch etwas höher waren. Mit einem raschen Blick erfasste er die zuletzt gefallenen Zahlen auf dem Display. Schwarz lag leicht vorne, und die kleine Serie dominierte. Fast achtlos warf er einige Jetons auf den grünen Samt. »Huit, plein!«, gab er seine Anweisung. Er beobachtete den Croupier, wie er die Drehscheibe in Rotation versetzte und mit routiniertem Schwung die Elfenbeinkugel in den Kessel warf. Eine verlebt wirkende Dame setzte noch schnell einen Jeton auf Pair. Dafür hatte er nur ein verächtliches Grinsen übrig. Er wusste, dass er der Einzige am Tisch war, der das Herz und die Erfahrung eines echten Spielers hatte. Noch sauste die Kugel am oberen Rand der Scheibe entlang.
»Terminato! Rien ne va plus!«
Jetzt begann die spannendste Phase des Spiels. Er liebte diese kurze Zeit des Hoffens und Bangens. Eigentlich war bereits alles entschieden. Und doch kannte keiner den Ausgang. Allein die kleine weiße Kugel mochte wissen, für welche Zahl sie sich letztlich entscheiden würde. Würde sie die Acht noch ein- oder zweimal passieren?
Die Kugel verlor an Geschwindigkeit, kollidierte mit einer der metallenen Rauten, sprang wie von Sinnen hin und her, prallte gegen die Stege zwischen den Nummerfächern. Obwohl sich jetzt alles in Sekundenbruchteilen abspielte, nahm er das Ende, das unaufhaltsam näher rückte, wie in Zeitlupe wahr. Bald würde die Kugel ihr kurzes, temperamentvolles Leben aushauchen und sich in einem Fach zur Ruhe begeben. Aber noch bewahrte sie ihr Geheimnis.
Egal, er hatte beschlossen, sich heute Abend nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Eigentlich spielte er gar nicht richtig, er setzte nur einige Jetons zum Zeitvertreib. Fingerübungen sozusagen, um sich das Gefühl für das Zusammenspiel von Kessel und Kugel zu erhalten. Er hatte sich für diesen Abend eine Verlustgrenze gesetzt. Kam er nicht in die Gewinnzone, dann machte das überhaupt nichts. Bei Erreichen der Verlustgrenze würde er das Spiel einfach abbrechen, zurück an die Bar gehen und völlig entspannt einen Wodka Martini trinken. Und so viel er wusste, gab es dort nicht nur anzügliche Frauen auf alten Ölgemälden kennen zu lernen.
Sechsunddreißig, elf, dreißig … Er hielt den Atem an. Die Kugel verharrte bei der Acht. Plötzlich aber kam noch einmal für einen Wimpernschlag Leben in die Kugel. Sie hatte ihn nur verspottet. Hatte ihn gelockt und dann abgewiesen. Wenn es etwas gab, das er überhaupt nicht leiden konnte, dann war es genau diese hinterlistige Art. Erst so tun, als ob, und dann doch nicht. Warum dann überhaupt diese arglistige Täuschung?
»Dieci, nero, pair et manque.«
Was sollte dieses Kauderwelsch, konnte sich der Croupier nicht endlich für eine Sprache entscheiden? Mit seinem Rechen schob er die platzierten Jetons über das Tableau. Die Dame, die den schönsten Teil ihres Lebens schon hinter sich hatte, bekam einen kleinen Stapel hingeschoben – sie zählte zu den Gewinnern. Er konnte ein Lächeln kaum unterdrücken. Was waren das für Kleingeister an diesem Tisch? Die beiden jungen Männer links von ihm hatten zwar schöne Krawatten, aber ganz offensichtlich keine Ahnung von diesem königlichen Spiel. Hauptsache, ihre blonden, nichts sagenden Begleiterinnen waren von ihrem weltmännischen Gehabe ausreichend beeindruckt. Und der hagere Herr rechts neben dem Croupier, den hatte er schon oft gesehen, der spielte wie ein Buchhalter sein System herunter. Er hätte jedes Mal schon vorher sagen können, worauf dieser einfältige Mensch setzen würde. Das System war ebenso alt wie untauglich.
Nein, das war kein Tisch, der ihn inspirierte. Ob er besser herumlaufen und an mehreren gleichzeitig spielen sollte? Das war amüsant und hielt einen wenigstens in Bewegung. Keine großen Einsätze, nein! Er war wirklich stolz auf sich. Er kam sich vor wie ein Alkoholiker, der am Glas nur nippte und dann die Selbstbeherrschung hatte, es zur Seite zu stellen. Keine Frage, er hatte sich unter Kontrolle.
»Faîtes vos jeux!«
Ob er noch einmal einen dieser hübschen eckigen Jetons plein auf die Acht setzen sollte? Oder eine Transversale pleine mit der Sieben, Acht und Neun? Er kniff kurz die Augen zusammen.
»Zehn Jetons auf die Acht, zehn auf noir, jeweils zehn auf Pair und Manque!«
Die Scheibe rotierte bereits wieder, die Elfenbeinkugel machte sich auf die Reise.
Im letzten Augenblick setzte er weitere vierzig Jetons auf die Acht.
»Rien ne va plus!«
Wie viel hatte er jetzt im Spiel? Umgerechnet zehntausend Mark. Nun, da war er einer spontanen Eingebung gefolgt. Aber in solchen Augenblicken durfte man nicht zögern. Da musste man den Mut zur Offensive haben. Alles andere war Kinderkram. Ob die Kugel ihn diesmal erneut verspotten würde?
»Ventitré, rosso, impair et passe!«
Er zeigte keine Gefühlsregung. Wie hoch war eigentlich die Verlustgrenze, die er sich am heutigen Abend gesetzt hatte? Er konnte sich nicht mehr erinnern.
Dreiundzwanzig! Das durfte doch nicht wahr sein. Zweimal hintereinander in direkter Nachbarschaft seiner Acht. Schon das vierte Mal en suite im Sektor der kleinen Serie. Was sollte das? Diese Kugel hätte seine Geliebte werden können, stattdessen hatte sie ihm den Krieg erklärt. Was heißt die Kugel? Alle hatten sich wieder einmal gegen ihn verschworen. Die Kugel, der Kessel, der Croupier, das Kasino.
Ihr wollt die kleine Serie? Nun, das könnt ihr haben. Glaubt ja nicht, dass ich euch so einfach davonkommen lasse. Ihr hättet euch euren Gegner vorher genauer anschauen sollen. Die kleine Serie? Nein! Ich durchschaue euer mieses Spiel. Ihr stellt mir eine Falle. Aber nicht mit mir. Genau gegenüber ist der Ort der Verheißung. Die Drei? Oder vielleicht die Sechsundzwanzig? Das Leben ist ein Spiel. Und dieses Spiel ist das Leben.
Der Croupier versetzte die Drehscheibe in Rotation und warf die Kugel in den Kessel. Er musste sich entscheiden! Jetzt! Ihr wollt mich reinlegen? Eure stärkste Waffe trägt die Farbe Grün und heißt Zero! Entschlossen setzte er einen Stapel Jetons.
»Alles auf Zero!«
Er spürte, wie ihn die anderen Spieler am Tisch erschrocken ansahen. Was verstanden sie von dem Duell, dem er sich gerade stellte? Und wenn die Zero jetzt nicht kommen sollte, würde er diese Niederlage elegant wegstecken und zum nächsten Angriff übergehen. Der Zufall war sein Verbündeter. Das war schon immer so gewesen. Bereits als kleines Kind hatte er wichtige Entscheidungen von einem Würfel treffen lassen. Und er war stets gut damit gefahren. Zugegeben, es hatte hin und wieder Krisen gegeben, sogar ernste, aber sie hatten ihm nicht wirklich etwas anhaben können. Er konnte sich auf sein Glück verlassen. Aber er musste dazu etwas beitragen, sich engagieren, sich voll einbringen, dem Glück eine Chance geben. Es galt, das Terrain so vorzubereiten, dass der Zufall seine große, himmlische Macht ausspielen konnte.
»Trentadue, rosso, impair et passe.«
Jetzt glaubten sicher alle, er habe eine Niederlage erlitten. Er konnte nur mit Mühe ein schallendes Lachen unterdrücken. Das Gegenteil war richtig. Die Zweiunddreißig! Unmittelbar neben der Zero! Fast genau gegenüber der Acht. Er hatte es einfach geahnt. Schon wieder direkt und nur haarscharf daneben. Er war voll dabei und der Kugel dicht und unbarmherzig auf den Fersen. Quer über den Kessel war er ihr gefolgt. Er hatte die Sache im Griff. Er würde weiter dranbleiben. Der Zufall musste nur noch ein kleines bisschen mithelfen, sozusagen die Feinjustierung vornehmen. Das war ja nun wirklich nicht zu viel verlangt.
3
Die Arena von Verona stammt aus römischer Zeit. Sie wurde im Jahre 30 nach Christus fertig gestellt. Mit einer Länge von hundertachtunddreißig Metern und einer Breite von hundertzehn Metern ist die Arena das drittgrößte Amphitheater der Welt. Nur das Kolosseum in Rom und das Amphitheater in Capua sind größer. Im Inneren haben zweiundzwanzigtausend Zuschauer Platz.«
Laura Zanetti machte eine kurze Pause und holte Luft. Sie stand auf der weitläufigen Piazza Brà in Verona mit dem Rücken zum monumentalen Bau der Arena, vor sich eine Gruppe mit Touristen aus Amerika, allesamt in Shorts, mit Turnschuhen und unglaublich bunten Hemden.
Laura Zanetti, die gut Englisch sprach, mit einem sympathischen italienischen Akzent, deutete hinter sich: »Bitte beachten Sie die klassisch gegliederte Fassade mit den Arkaden. Ursprünglich wurde die Arena von einer äußeren Prunkmauer umschlossen, von der allerdings nur noch vier Bogen erhalten sind.«
Laura Zanetti – sie war Ende zwanzig, hatte Kunstgeschichte studiert und verdiente sich übergangsweise ihr Geld als Fremdenführerin – warf einen prüfenden Blick auf ihre Reisegruppe. Eine besondere Faszination schien von ihrem Vortrag nicht auszugehen. Der dicke Mann ganz links konzentrierte sich mit seiner Videokamera auf eine Taube, die gerade vor ihm gelandet war, als ob es sich hierbei um das letzte Exemplar einer aussterbenden Vogelart handeln würde. Eine junge Frau feilte mit Hingabe an ihren Fingernägeln. Laura musste lächeln, als ihr Blick auf ein älteres Ehepaar mit Tirolerhüten fiel. Offenbar war die Reisegruppe vorher in Bayern oder Österreich gewesen. Wahrscheinlich hatten die Amerikaner, die allesamt aus Wyoming stammten, eine Rundreise nach dem Schema gebucht: »See Europe in seven days!« Ob die Folklorefreunde mit den grünen Hüten wussten, dass sie mittlerweile in Italien waren? Laura Zanetti beschloss, ihre Ausführungen etwas lebendiger zu gestalten. Da sie diesen Job erst seit wenigen Monaten machte und dies auch nur so lange tun wollte, bis sie eine Stelle an einem der Museen in Verona, Padua oder Venedig bekommen hatte, nahm sie solche Herausforderungen gerne an. Einer hauptamtlichen, leidgeprüften Reiseführerin wäre es vielleicht egal gewesen. Wäre doch gelacht, wenn es ihr nicht gelänge, die Gruppe zu fesseln.
»Wissen Sie, wofür die Arena von den Römern gebaut wurde?«, fragte Laura in die Runde. Wie erwartet, gab es zunächst keine Reaktion. Dann meldete sich überraschenderweise der Tirolerhut: »Yeah, young lady, die Römer bauten die Arena, um Aida aufzuführen!«
Seine Frau nickte zustimmend. Da sage noch jemand, Amerikaner hätten keine Ahnung von europäischer Kultur und Geschichte.
Laura lächelte. »Sehr gut. Die Arena ist in der Tat weltberühmt für ihre Opernfestspiele. Aber der Komponist Verdi lebte wesentlich später als die alten Römer.«
Der Mann mit dem Tirolerhut zeigte einen verblüfften Gesichtsausdruck.
Laura fuhr fort: »Verdis Oper Aida wurde hier in dieser Arena erstmals 1913 aus Anlass des hundertsten Geburtstags des Komponisten aufgeführt. Premiere hatte Aida ja schon 1871 in Kairo. Verdi hatte die Oper im Auftrag des Khediven von Ägypten für die Feierlichkeiten zur Eröffnung des Suezkanals geschrieben. Nein, die Arena wurde fast zweitausend Jahre früher gebaut, vor allem, um Gladiatoren gegeneinander und gegen Löwen und Tiger kämpfen zu lassen. Unzählige Gladiatoren, darunter viele verfolgte Christen, haben hinter diesen Mauern zur Unterhaltung der Zuschauer ihr Leben gelassen. Die alten Römer hatten einen feinen Sinn fürs Entertainment.«
Laura hatte das Gefühl, dass die Gruppe aus Wyoming die Arena plötzlich mit größerem Interesse betrachtete.
»Später gab es hier Hinrichtungen, und in der Arena wurden Stierkämpfe abgehalten. Die äußere Mauer, von der ich Ihnen vorhin erzählt habe, ist bei einem Erdbeben 1183 eingestürzt.«
Der Taubenfilmer ließ beim Stichwort »earthquake« von seinem Zielobjekt ab und sah sich erschrocken um. »Wann war das Erdbeben?«, fragte er.
Laura lachte. »1183, da war Amerika noch nicht entdeckt. Hier gab es immer wieder starke Erdbeben, ganz ähnlich wie bei Ihnen in Kalifornien. Übrigens, hier unter den Arkaden, da war im vorigen Jahrhundert ein Bordell mit aufreizenden Nutten.«
Laura verbuchte es als großen Erfolg, dass der dicke Amerikaner nun endgültig das Interesse an der Vogelwelt verloren hatte und die Videokamera auf die Arkaden richtete.
Sie schaute auf die Uhr – elf. In der verbleibenden Stunde des Vormittagsprogramms würde sie mit ihrer Gruppe noch durch die Via Mazzini laufen, die erst am späten Nachmittag und am Abend richtig belebt sein würde. Dann nämlich traf sich halb Verona zum Bummel in dieser beliebten Einkaufsstraße. Ein kurzer Abstecher würde sie in die Via Capello führen, wo es im Hof der gotischen Casa di Giulietta den berühmten Balkon aus Shakespeares Romeo und Julia zu sehen gab.
Die unversöhnliche Fehde zwischen den beiden Adelsfamilien Montague und Capulet hatte es Anfang des 14. Jahrhunderts wohl wirklich gegeben, auch wenn sie historisch nicht belegt ist. Shakespeare kannte die veronesische Legende dieses tragischen Liebespaars, war selbst aber nie an diesem Ort gewesen. Den Balkon, dem er in der Szene »In geheimer Nacht« zu Weltruhm verholfen hat, hätte er sich ohnehin nicht anschauen können. Er wurde nämlich erst 1935 angebaut, um den Erwartungen der Besucher aus aller Welt zu entsprechen. Aber diese desillusionierende Information wollte Laura ihrer Gruppe ersparen.
Den Abschluss ihrer Tour bildete die Piazza delle Erbe. Dort würde sie erzählen, dass dieser malerische Platz der Kräuter der wichtigste Markt Veronas war. Dass die Römer hier einst ihr Forum hatten. Dass das Wahrzeichen der Stadt, die Madonna di Verona, eigentlich eine römische Figur sei, der erst im 14. Jahrhundert ihr heutiger Kopf aufgesetzt wurde. Sie würde auf die Fresken an den Case Mazzanti hinweisen und die Aufmerksamkeit auf den geflügelten Markuslöwen vor dem Palazzo Maffei lenken, der die jahrhundertelange Herrschaft Venedigs über Verona symbolisierte. Ja, und danach würde sie ihre erschöpfte Gruppe zum Bus bringen, der sie zum Mittagessen zurück ins Hotel fuhr. Laura blieben vier Stunden Pause. Um sechzehn Uhr begann die kurze Nachmittagsführung. Und um achtzehn Uhr war sie schließlich fertig. Sie freute sich auf die drei Tage, die sie im Haus am Gardasee verbringen würde, wo sie eine kleine Einliegerwohnung hatte. Abends würde sie mit Ottilia Balkow auf der Terrasse sitzen, Rotwein trinken und über Tizian, Palladio oder Tiepolo diskutieren. Die alte Dame kannte sich glänzend aus in der Kunst- und Kulturgeschichte des Veneto. Beide hatten sie Freude an diesen Gesprächen, zu denen im Hintergrund fast immer eine der alten Platten mit Musik von Verdi oder Vivaldi zu hören war.
Laura konzentrierte sich wieder auf ihre Gruppe. »So, wenn Sie mir nun bitte folgen würden.« Sie hob eine kleine Fahne nach oben, die ihren amerikanischen Gästen als Orientierung diente, und ging nach links, an der Arena vorbei, zur Via Mazzini. Der Videofilmer, der mit seiner Kamera in den Arkaden immer noch nach den angesprochenen Nutten Ausschau hielt, verpasste fast den Anschluss.
4
Alessandro lief der Schweiß über die Stirn, als er die schweren Gewichte erneut nach oben stemmte. Siebenundneunzig, achtundneunzig, neunundneunzig. Er machte eine kurze Pause. Hundert. Geschafft! Alessandro ließ die Gewichte in die Halterung krachen, atmete tief durch und stand auf. Das morgendliche Krafttraining war beendet. Der über zwei Meter große Hüne bewunderte sich im Spiegel, ließ noch einmal kurz den Bizeps anschwellen, grinste zufrieden, löste die zum Zopf gebundenen Haare und ging unter die Dusche. In einer Stunde hatte er sich bei seinem Chef zu melden, den alle nur Principale nannten. Alessandro war der Mann für besondere Aufgaben, worunter der Principale vor allem das Eintreiben von Schulden verstand. Schon allein mit seiner Körpersprache hatte Alessandro eine beachtliche Überzeugungskraft. Und bei extrem hartnäckigen Fällen verfügte er zudem über ein erprobtes Repertoire an wenig feinen Maßnahmen. Da spielte es keine Rolle, dass die geistigen Fähigkeiten nicht ganz mit seinem Muskelumfang Schritt halten konnten. Der Principale war auch so mit ihm hoch zufrieden.
Pünktlich auf den Glockenschlag – der Principale war ein Mann von großer Gewissenhaftigkeit – betrat Alessandro das Kaminzimmer. Der dicke Perserteppich dämpfte seinen schweren Schritt. Der Principale, ein alter Herr mit weißem Haar und einer dunklen Sonnenbrille, saß in einem antiken Lehnstuhl und spielte mit dem Jeton einer Spielbank. Er gab Alessandro ein Zeichen, sich zu setzen. Behutsam nahm dieser in einem Sessel Platz.
»Alessandro, ich bin unglücklich«, begann der Principale, »um ehrlich zu sein, sehr unglücklich.« Dabei legte er die Stirn in Sorgenfalten.
Alessandro wusste nicht, wie er auf dieses Bekenntnis zu reagieren hatte, und nickte deshalb vorsichtshalber zustimmend.
Der Principale ließ den Jeton durch die Handfläche gleiten, streichelte ihn. Plötzlich war der Jeton weg. Alessandro kannte die kleinen Tricks seines Chefs, auch wenn er nie herausbekam, wie sie funktionierten.
Der Principale betrachtete seine leeren Handflächen und machte eine hilflose Geste. »Warum zahlt dieser Stronzo seine Schulden nicht? Wahrscheinlich war ich wieder zu großherzig, zu langmütig. Und jetzt denkt er, er könne sich ewig Zeit lassen. Alessandro, das missfällt mir. Und wenn ich an die Summe denke, dann werde ich unglücklich. Madonna mia, auch meine Nächstenliebe hat ihre Grenzen. Du verstehst mich, Alessandro? Bitte sag, dass du mich verstehst.«
»Natürlich, Principale. Ich verstehe Sie.« Alessandro nickte erneut.
»Sehr schön. Dafür liebe ich dich, Alessandro.«
Der alte Herr machte eine kurze Pause. Plötzlich hatte er wieder den Jeton in der Hand, hielt ihn zwischen Daumen und Zeigefinger, gab ihm einen Stoß und ließ ihn um die Achse kreiseln.
»Ich darf gar nicht daran denken, wie viel mir dieser Stronzo schuldet. Alessandro, du weißt, von wem ich spreche?«
»Natürlich, Principale, ich weiß, wen Sie meinen.«
»Allora, ich glaube, es ist an der Zeit, dass du unserem Freund einen Höflichkeitsbesuch abstattest. Richte ihm einen schönen Gruß von mir aus. Und lass dir zumindest eine angemessene Anzahlung in bar aushändigen. Ich denke da an eine Größenordnung von dreihundert Millionen Lire. Und den Rest, lieber Alessandro, bitte mache ihm diesen Punkt unmissverständlich klar, den Rest erwarte ich in spätestens einem Monat. Zusätzlich zwanzig Prozent Zinsen für die Fristeinräumung. Ich denke, das ist mehr als fair.« Der Principale machte eine schnelle Bewegung, und der Jeton war wieder verschwunden. »Buona fortuna, Alessandro. Enttäusche mich nicht!«
»Nein, Principale, das habe ich doch noch nie.«
»Stimmt, das hast du noch nie.«
Alessandro stand auf, verbeugte sich und zog sich zurück. Er wusste, was er zu tun hatte.
5
Laura Zanetti bog mit ihrem kleinen Fiat in die Einfahrt und blieb vor dem schmiedeeisernen Tor stehen. Sie stieg aus und streckte sich. Der Job als Fremdenführerin war anstrengender als gedacht. Hoffentlich klappte es bald mit einer Tätigkeit bei einem der Museen, wo sie sich beworben hatte. Laura sah nach oben. Kein Wölkchen trübte den Himmel. Es war heiß und windstill. In einer Stunde erst würde es dunkel werden. Laura beschloss, ihre Sachen schnell ins Haus zu bringen, die alte Dame zu begrüßen und dann noch kurz hinunter an den See zu fahren, um ein Bad zu nehmen. Sie öffnete den rechten Flügel des Tors nur gerade so weit, dass sie mit ihrem »Seicento« durchfahren konnte. Vor dem Seiteneingang der efeubewachsenen Villa hielt sie, machte die Tür zu ihrem Apartment auf, stellte ihre beiden Taschen ab und öffnete die Fensterläden. Dann lief sie durch den Garten um das Haus herum nach oben.
»Signora Balkow, ich bin wieder da. Wo sind Sie? Signora?«
Die große Terrassentür der Villa stand offen. Die alte Dame konnte nicht weit sein.
»Signora. Ich bin’s, Laura.«
Heute war Donnerstag, da hatte die Haushälterin frei. Vielleicht machte Signora Balkow gerade ein Nickerchen auf dem Wohnzimmersofa. Laura betrat das Haus.
»Signora?«
Sie sah, dass sich auf dem Grammofon eine Schallplatte drehte. Der Tonarm sprang auf der letzten Rille immer vor und zurück. Laura tat ihn in die Halterung und schaltete das Gerät aus. Was hatte die alte Dame aufgelegt? Sie stoppte die langsamer werdende Platte mit dem Finger und musste schmunzeln. Natürlich, die Arien von Verdi, eine der Lieblingsplatten von Signora Balkow. Wo steckte sie nur? Auf dem Sofa war sie jedenfalls nicht. Laura schaute in der Küche nach, in der Bibliothek, in den Zimmern im ersten Stock, im Schlafzimmer. Sie fing an sich Sorgen zu machen. Wieder draußen auf der Terrasse, lief sie vor zum Geländer, von wo aus man nicht nur weit über den See, sondern auch auf den darunter liegenden Teil des Grundstücks sehen konnte.
Laura hielt die Hände wie einen Trichter vor den Mund. »Signora!«
Sie fühlte es, irgendetwas war passiert.
Sie lief am niedrigen Mäuerchen entlang zurück zum Haus. Eher zufällig warf sie dabei einen Blick hinunter auf das Rosenbeet, das die alte Dame so liebte, weil es noch von ihrem verstorbenen Mann angelegt worden war.
Ruckartig blieb sie stehen. Da unten, zwischen den Rosen, im hellen Kleid, die schlohweißen Haare …
Laura schlug die Hände vors Gesicht.
»Dio mio, Oddio, Santo Cielo!«
Nach einem Schreckensmoment rannte sie nach rechts, sprang über die Mauer und rutschte über die abschüssige Wiese. Sekunden später hielt sie den Kopf der alten Dame in den Händen. Sie brauchte keinen Arzt, um festzustellen, dass Ottilia Balkow tot war. Laura streichelte die kalten Wangen und fuhr ihr zärtlich durch die Haare.
6
Mark Hamilton saß auf der Terrasse vor dem Hotel des Bains in einem Korbstuhl und tunkte das Frühstückshörnchen in den Caffelatte. Rechter Hand lag die hübsche Gartenanlage mit dem Pool. Links konnte er über eine Oleanderhecke und durch die Allee der Uferstraße Lungomare auf den Eingang zum Strand sehen. Die Models und die Crew waren noch am gestrigen Tag abgereist. Sein Assistent hatte das belichtete Filmmaterial mitgenommen, um es in Deutschland zum Entwickeln zu bringen. Eigentlich wurde vom Fotografen erwartet, dass er eine Vorauswahl der Bilder traf, die dann dem Kunden vorgelegt wurde. Aber Mark hatte diese Aufgabe vertrauensvoll an seinen Assistenten delegiert. Man sollte es mit dem beruflichen Engagement seiner Überzeugung nach nicht übertreiben.
Vor wenigen Minuten hatte sich endlich auch der überhebliche Werbeleiter der Modefirma verabschiedet. Gestern Abend hatte er noch versucht, Mark zu einem Besuch des Spielkasinos zu überreden. Das sei ein herrliches Erlebnis, hatte er gesagt. Wie in einem schlechten Film. Diese schräge Kulisse dürfe er sich als Fotograf keinesfalls entgehen lassen. Der herrliche alte Palast am Canal Grande, wunderbar dekadent. Und all die aufgetakelten Weiber, einfach köstlich. Und diese Knallchargen von Spielertypen. Der Kerl hatte ihm feixend in die Rippen geboxt. Bei dieser Gelegenheit könne er ja seine Gage am Roulettetisch aufbessern, hatte er gesagt. Um dann laut zu lachen. »Oder verspielen, das geht in null Komma nix!« Sehr sympathisch. Nun, es war ihm nicht schwer gefallen, dieser Versuchung zu widerstehen. Er hatte wirklich Besseres vorgehabt. Er konnte sich noch an seine Erleichterung erinnern, als er den Mann gestern Abend in einem dieser schönen Mahagoniboote des Hotels hatte abfahren sehen. Mit einer dicken Zigarre und einem selbstgefälligen Grinsen. Als ob er in seinem schlechten Film soeben die Hauptrolle übernommen hätte. Mark gefiel dieser Gedanke.
Jetzt war der Idiot jedenfalls weg. Vorhin hatte er noch lautstark die gesamte Terrasse an seinem weiteren Tagesablauf teilhaben lassen. Dass er nämlich zum Golfclub Venezia fahre und dort eine Zockerrunde mit Freunden aus Beverly Hills spiele. Mark, der den Golfplatz im Süden des Lido von Fotoaufnahmen kannte, fand, dass der traditionsreiche Platz eigentlich viel zu schön für diesen Angeber war. Aber Hauptsache, er hatte sich endlich abgesetzt. Und vielleicht zockten ihn seine Mitspieler richtig ab. Das würde ihm sicher gut tun.
Mark lehnte sich entspannt zurück. Vor ihm saß Miranda und bestrich einen Panino mit Marmelade. Er lächelte. Zweifellos war die Stylistin letzte Nacht wesentlich lustbringender gewesen als ein Spielkasino. Er sah sie noch vor sich, wie er kurz nach Mitternacht aus dem Badezimmer gekommen war. Nackt hatte sie vor dem geöffneten Fenster ihres Zimmers im Hotel des Bains gestanden. Hinter ihrer aufreizenden Silhouette schimmerte die Adria im Glanz der Sterne und des Monds. Das Salz des Meers, man konnte es fast mit den Lippen schmecken. Langsam hatte sie sich umgedreht, aufreizend an ihre Brüste gefasst und sich mit gespreizten Beinen auf die breite Fensterbank gesetzt …
Mark gab sich einen Ruck und fand in die Gegenwart zurück. Er tunkte seine Brioche in den Caffelatte und beobachtete Miranda. Sie musste noch heute nach Mailand zu einer Modenschau. Ihren Vorschlag, sie zu begleiten, hatte er leider ablehnen müssen. Zugegeben, das war ihm nicht ganz leicht gefallen. Und die Erinnerung an die vergangene Nacht ließ auch begründete Zweifel an der Richtigkeit dieser Entscheidung zu. Aber er hatte für die nächsten Tage andere, unumstößliche Pläne.
Mark sah gedankenverloren zum Nebentisch, wo eine junge Frau in einem Buch las.
»Kannst du nicht wenigstens warten, bis ich unterwegs nach Mailand bin?«, fragte Miranda.
»Womit soll ich warten?« Er wirkte leicht irritiert.
»Damit, andere Frauen anzuschauen!«, stellte Miranda lächelnd fest.
»Habe ich gar nicht«, protestierte Mark. »Ich habe mich nur für ihr Buch interessiert.«
»Das ist ja eine besonders faule Ausrede«, entgegnete sie. »Aber so kommst du mir nicht davon. Nicht hingucken! Schau mich an! Und jetzt sag mir, um was für ein Buch es sich handelt.«
»Ein Buch, das außerordentlich gut zu diesem Hotel passt, immerhin wurde es hier geschrieben«, erklärte Mark nach kurzem Zögern mit einem Schmunzeln, ohne Miranda aus den Augen zu lassen.
»Mach’s nicht so spannend!«
»Also, Tod in Venedig von Thomas Mann.«
»Stimmt«, sagte die junge Frau vom Nachbartisch, die die Unterhaltung amüsiert verfolgt hatte.
»Ich danke Ihnen für die Bestätigung«, erwiderte Mark mit festem Blick auf Miranda.
»Du bist rehabilitiert, du alter Gauner.« Miranda schlug lachend ihre Beine übereinander.
»Nicht ganz.« Mark hatte die Augen immer noch nach vorne gerichtet.
»Warum?«
»Weil ich auch weiß, dass die junge Dame blonde Haare hat, blaue Augen, unlackierte Fingernägel, keinen Ehering, eine weiße Bluse …«
»Es reicht!« Mirandas Lachen klang jetzt etwas weniger locker.
Mark drehte sich grinsend zum Nachbartisch. »Übrigens, haben Sie Luchino Viscontis Verfilmung von Tod in Venedig gesehen?«
»Natürlich. Schon deshalb liebe ich dieses Hotel. Eine wunderbare Kulisse für einen alternden Schriftsteller …«
»… für einen alternden Komponisten«, unterbrach Mark. »Ich will damit sagen, Visconti hat aus dem Schriftsteller Gustav von Aschenbach einen Komponisten gemacht.«
»Wirklich? Aber seine erotischen Sehnsüchte waren dieselben, oder?« Die junge Frau sah Mark erwartungsvoll an.
»Erstens waren die erotischen Sehnsüchte homoerotisch, zweitens pädophil, und drittens blieben sie unerfüllt«, warf Miranda ein. »Ich finde, dieser Aschenbach war ein besonders armes Schwein!«
Mark amüsierte die Unterhaltung. »Du bist ganz schön direkt«, erwiderte er, »aber im Ergebnis hast du sicher Recht. Immerhin ist das arme Schwein, um bei diesem Ausdruck zu bleiben, vor diesem Hotel im Liegestuhl gestorben.«
»Zerbrochen am Schmerz einer unerfüllten Liebe«, ergänzte die Blondine mit leichtem Timbre in der Stimme.
»Unsinn, an Cholera!«, stellte Miranda fest.
Mark schüttelte grinsend den Kopf. »Miranda, sei doch nicht so pietätlos. Diese Dame hat eben einen Sinn für große Gefühle.«
»Also, ich steh mehr auf Sex.«
»Dagegen ist natürlich auch nichts einzuwenden«, gab Mark zu und dachte erneut an die vergangene Nacht.
Einige Stunden später lag Mark am Pool des Hotel des Bains. Miranda war bereits abgereist, und er hatte zu seinem Bedauern feststellen müssen, dass die junge Frau mit dem Buch und dem viel versprechenden Hinweis auf erotische Sehnsüchte in fester Begleitung war. Allerdings hätte er heute sowieso keine Zeit mehr gehabt, und vermutlich tat ihm eine kleine Erholungspause auch gut. Aber man hätte ja die Adressen austauschen und das Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen können. War wohl nichts! Mark nahm sein Handy, rief seine Agentin in London an und teilte Norma mit, dass er für zehn Tage eine künstlerische Pause einlege. Norma könne möglichen Kunden auch gerne sagen, dass er eine vorübergehende Schaffenskrise habe. Nein, sie könne ihn nicht erreichen. Sein Handy habe einen technischen Defekt. Aber er wolle mit ihr gerne am übernächsten Wochenende zum Essen gehen. Und ob sie noch die rot gefärbten Haare habe? Die würden ihm wirklich gut gefallen. Das war zwar gelogen, verbesserte aber ganz entschieden Normas Stimmung.
Mark beendete das Gespräch. Er sah hinüber zur Poolbar unter dem weißen Markisendach und ließ den Blick über eine antike Steinfigur hinüber zur kleinen Brücke schweifen, die über das Becken führte. Es duftete nach Lavendel. Aus dem Hotel war leise klassische Musik zu hören. Zufrieden lehnte er sich zurück. Mit halb geschlossenen Augen gab er die Telefonnummer von Roberto ein, einem italienischen Freund, der in Belluno lebte. Roberto war ein in Italien bekannter Journalist, der sich auf Themen rund ums gute Essen und Trinken spezialisiert hatte. Er schrieb Kritiken für Feinschmeckermagazine und verfasste Kochbücher und Restaurantführer.
»Hallo, Roberto, ich bin’s, Mark.«
»Sag bloß, du kannst nicht?«, erwiderte Roberto erschrocken.
»Doch, Roberto, natürlich kann ich. Es bleibt dabei.«
»Bravo. Wann wirst du hier sein?«
»Heute Abend.«
»Benissimo. Ich reserviere einen Tisch im Al Borgo, du kannst dich schon auf einen vorzüglichen Risotto freuen. Die nächsten Tage gibt’s dann nur noch trockenes Brot.«
»Ganz so schlimm wird’s hoffentlich nicht werden.«
Roberto lachte. »Keine Sorge. In meiner Begleitung ist noch niemand verhungert. Ich habe etwas Proviant zusammengestellt, dessen Gewicht in einem umgekehrten Verhältnis zu seiner ausgesuchten Delikatesse steht. Hast du deinen Schlafsack dabei?«
»Natürlich, auch meinen Rucksack und die Bergstiefel.«
»Allora, dann kann ja gar nichts schief gehen. Die Wettervorhersage ist auch gut. Also dann, bis heute Abend. Ciao, Mark.«
»Ciao, Roberto.«
Mark drückte auf die rote Taste. Er hatte das Handy noch in der Hand, als es klingelte. Er zögerte nur kurz, grinste, schaltete das Handy aus und legte es neben sich in die Wiese. Wer auch immer ihn sprechen wollte, er würde sich einige Tage gedulden müssen. Ab jetzt wollte er sich nicht mehr stören lassen. Zu sehr freute er sich auf die Bergwanderung in den Dolomiten, die er mit Roberto schon so lange geplant hatte. Und nach der Tour würde er noch einen kurzen Abstecher an den Gardasee machen. Er hatte seine Großmutter schon einige Monate nicht mehr gesehen. Dabei liebte er die alte Dame von ganzem Herzen. Was, wie er wusste, auf Gegenseitigkeit beruhte. Und außerdem war von seiner Familie bis auf seinen Halbbruder Rudolf, der in München wohnte und den er nur selten sah, nun mal nur noch seine Großmutter am Leben. Seine Eltern waren schon seit Jahren tot. Von seinem Vater gab es nur einige entfernte Verwandte in Schottland, zu denen er keine Beziehung hatte. Er überlegte kurz, ob er am Gardasee anrufen und seinen Besuch ankündigen sollte. Aber dann dachte er, dass es lustiger wäre, seine Großmutter einfach zu überraschen.
Er wachte erschrocken auf und sah auf die Uhr. Da war er doch tatsächlich auf der Liege eingeschlafen. Wenn er sich beeilte, würde er das Ferryboat erreichen, das kurz nach ein Uhr in San Nicoló losfuhr. Wenige Minuten später rollte er in seinem alten Morgan, mit dem er aus England nach Venedig gekommen war, auf die Fähre. Nachdem er den Roadster abgestellt hatte, warf er einen skeptischen Blick auf die auf dem Beifahrersitz liegenden Taschen. Er beschloss, wenigstens den großen Kamerakoffer, den er mit Lederriemen auf den Gepäckständer geschnallt hatte, mit hinauf an Deck zu nehmen. Ansonsten blieb ihm nichts anderes übrig, als auf die Ehrlichkeit der Mitreisenden zu vertrauen. Oben angelangt, setzte er sich direkt an die Reling. Die Fähre hatte bereits abgelegt.
Rechts voraus sah Mark die Grünanlagen des Biennale-Geländes. Von selbst hätten die Venezianer diese Giardini wohl kaum angelegt. Sie sind ein Erbe der für Venedig wenig erfreulichen Herrschaft Napoleons. Der große Korse hatte die Lagunenstadt nach Kräften geplündert. Da war die Anlage dieser Gärten nur eine sehr zweifelhafte Wiedergutmachung.
Mark folgte mit den Augen der Uferpromenade. Kleine weiße Brücken führten über Kanäle, der Glockenturm einer Chiesa war zu sehen. Irgendwo da hinten musste Arsenale sein, wo Venedig einst die größte Schiffswerft der Welt unterhielt und die Galeeren der mächtigen Kriegsflotte auf Kiel legte.
Mark setzte eine Sonnenbrille auf. Wo sonst auf der Welt, dachte er, gibt es eine Autofähre, die vor so eindrucksvoller Kulisse verkehrt? Er sah nach links zur Klosterinsel der Benediktiner mit der grandiosen Kirche San Giorgio Maggiore.
Die Fähre drehte in Richtung Canale della Giudecca. Mark nahm eine Kamera aus seinem Koffer und fotografierte über das Heck die Piazzetta, den Eingang zur Piazza San Marco, mit den beiden Säulen aus dem 12. Jahrhundert, an denen einst die Schiffe festmachten, die aus fernen Ländern ihre Schätze nach Venedig brachten.
Rechts sah er den prachtvollen Palazzo Ducale und links, alles überragend, den fast hundert Meter hohen Campanile von San Marco mit einem goldenen Engel auf der Spitze. An klaren Tagen, hatte Mark gelesen, konnte man von seinem Aussichtsbalkon bis zu den Dolomiten sehen. Der Turm hat eine wechselvolle und dramatische Geschichte hinter sich. Auf das 9. Jahrhundert gehen seine Anfänge zurück. Über lange Zeit diente sein Leuchtfeuer den Seefahrern zur Orientierung. Doch nicht immer war seine Bestimmung so segensreich. Der Turm wurde auch zum Aufhängen von Folterkäfigen zweckentfremdet. Seine heutige Gestalt erhielt er erst im 16. Jahrhundert nach einem Erdbeben. Auf dem Aussichtsbalkon demonstrierte Galileo Galilei dem Dogen sein Teleskop. Jahrhundertelang bestimmten die Glocken des Campanile den Lebensrhythmus der Lagunenstadt. 1902 schließlich stürzte er ohne jegliche Vorwarnung in sich zusammen. Ein Wunder, dass dabei nur die Katze des Turmwächters zu Tode kam. In Windeseile bauten die Venezianer ihr Wahrzeichen wieder auf. Und schon zehn Jahre später war das gewohnte Bild der Piazza San Marco wieder hergestellt.
Der Canal Grande verschwand hinter der Dogana di Mare und der Chiesa della Salute. Rechts zog der Sestiere Dorsoduro, der harte Rücken, vorbei. Links lag die Insel Giudecca, deren Name möglicherweise auf die Juden zurückzuführen ist, die hier im 12. Jahrhundert gewohnt hatten. Gleich bei der Chiesa delle Zitelle lag das Hotel Cipriani & Palazzo Vendramin, eine Gründung des legendären Giuseppe Cipriani von der Harry’s Bar. Heute gehört das Luxushotel zu einer internationalen Hotelgruppe.
In der Verlängerung des Canale della Giudecca schoben sich bereits die Industrieanlagen von Porto Marghera ins Bild. Mark fuhr sich durch die Haare. Ein brutaleres Kontrastprogramm war wirklich kaum vorstellbar. Hier die prächtige Lagunenstadt, die Serenissima mit ihren einmaligen Kunstschätzen und dem Lebensgefühl einer untergegangenen Epoche. Direkt dahinter die hässliche Fratze der Industrialisierung, die ihn an verpestete Luft und vergiftete Abwässer denken ließ. Mark schaute durch den Sucher der Kamera und drückte auf den Auslöser.
Einige Tische, die linker Hand am Canale standen, gaben ein letztes Lebenszeichen des feinen Venedig. Sie gehörten zu Harry’s Dolci, einem Ableger der berühmten Bar von Cipriani. Der Backsteinkomplex von Mulino Stucky leitete über zum gegenüberliegenden Industriehafen von Venedig – verrottete Lagerhallen, vergammelte Krananlagen und verrostete Frachter. Vor ihnen tauchte die Isola del Tronchetto auf, wo die Fähre gleich anlegen würde. Mark verstaute die Kamera, nahm den Alukoffer und machte sich auf den Weg nach unten zu seinem Auto. Seine Habseligkeiten waren alle noch da. Der alte Roadster sprang auf Anhieb an – was bei ihm nicht immer selbstverständlich war. Über eine stählerne Rampe fuhr er an Land.
7
Rudolf Krobat saß in den Vormittagsstunden desselben Tages zu Hause an seinem Schreibtisch und blätterte unkonzentriert in Geschäftspapieren seiner Weinhandelsfirma. Das Unternehmen war schon von seinem Vater gegründet worden und auf den Import und Vertrieb von italienischen Weinen spezialisiert. Er war stolz darauf, dass er zu den größten Anbietern in Deutschland zählte. In seinem Zentrallager im Osten Münchens hatte er ständig Weine im Wert von einigen Millionen Mark in den Regalen. Darunter befanden sich ebenso billige Massenweine wie Spitzenweine aus den besten Lagen Italiens. Entsprechend breit gefächert war sein Kundenkreis. Er reichte von großen Einzelhandelsketten und Kaufhäusern bis hin zur Spitzengastronomie.
Rudolf Krobat führte ein luxuriöses Leben. Er bewohnte eine Villa in Grünwald, hatte immer die neuesten Nobelkarossen in der Garage und war Mitglied in einem renommierten Yachtclub am Starnberger See. An der Wand neben seinem Schreibtisch hing ein gerahmtes Bild, das ihn zusammen mit einigen Würdenträgern aus der bayrischen Politik zeigte. Er war ein gern gesehener Gast bei Premieren, Modeschauen, auf Vernissagen und bei den Partys der Münchner Schickimicki-Gesellschaft. Kurzum, Rudolf Krobat gehörte einfach dazu! Dass ihn manche für einen etwas großspurigen Neureichen hielten, das wusste er, aber es machte ihm nichts aus. Schließlich lebte man nur einmal. Heute Abend hatte er einen Tisch in einem bekannten Sterne-Restaurant bestellt. Es gehörte zu den angenehmen Pflichten seines Berufs, sich dort immer wieder mal sehen zu lassen. Immerhin standen auf der Weinkarte diverse Marken, die von ihm exklusiv vertrieben wurden.
Krobat lehnte sich zurück und zündete sich eine Zigarre an. Er dachte an Ilonka, mit der er letzte Nacht einige Stunden verbracht hatte. Oder war ihr Name Ivanka gewesen? Egal. Jedenfalls hatte sie all seine Wünsche erfüllt. Krobat drehte versonnen die Zigarre zwischen den Fingern und blies leicht in die Glut. Nun, billig war das Mädchen nicht gewesen. Aber das waren sie alle nicht, die wirklich guten Callgirls. Da unterschieden sie sich wenig von seinen Weinen. Qualität hatte eben ihren Preis. Billige Nutten waren wie gepanschter Wein. Sie sind belanglos, haben häufig Kork. Und hinterher plagt einen das schlechte Gewissen, dass man sich auf so ein erbärmliches Niveau herabgelassen hat. Rasseweiber dagegen, die ließen wie ein großer Wein die Sinne explodieren. Rudolf Krobat benetzte mit den Lippen seine Zigarre. Man vergisst Raum und Zeit. Alle Hemmungen werden förmlich hinweggespült. Und danach fühlt man sich großartig. Erschöpft vielleicht, ermattet, aber großartig. Ein Genuss ohne Reue, ohne Kater.
Das Klingeln des Telefons riss ihn aus seinen Gedanken. Er legte die Zigarre behutsam in den Aschenbecher und hob ab.
»Ja, bitte?«
»Sind Sie Herr Krobat?«, wollte die Anruferin mit einem unüberhörbaren italienischen Akzent wissen.
Rudolf Krobat schob den Drehstuhl zurück und stand auf.
»Ja, am Apparat. Und wer sind Sie?«
»Mein Name ist Laura Zanetti. Ich wohne im Haus Ihrer Großmutter am Gardasee.«
»Ja, ich erinnere mich. Meine Großmutter hat uns bei meinem letzten Besuch miteinander bekannt gemacht. Warum rufen Sie an? Kann ich etwas für Sie tun?«
»Ich habe eine traurige Mitteilung.«
»Ist meiner Großmutter etwas passiert?«
»Sie ist tot!«
»Tot? Um Gottes willen. Aber vor drei Wochen, da war …« Rudolf Krobat hielt mitten im Satz inne. Er schluckte. Nach einer kurzen Pause sprach er weiter: »Vor drei Wochen, bei meinem letzten Besuch, da fühlte sie sich doch noch ausgesprochen gut. Warum hat sie mir denn nicht gesagt, dass es ihr schlecht geht?«
»Das konnte sie nicht«, antwortete Laura. »Ihr ging es nicht schlecht. Es war ein Unfall. Ich habe Ihre Großmutter gestern Abend im Garten ihres Hauses gefunden. Offenbar ist sie über die kleine Mauer gestürzt, Sie wissen schon, die Mauer auf der Terrasse links.«
»Links? Wenn man von innen kommt? Dort, wo es zum Rosenbeet hinuntergeht?«
»Genau. Über diese Mauer ist sie hinuntergefallen. Und zwar, wie es scheint, schon vorgestern Abend. Der Arzt, der ihren Tod festgestellt hat, sagt, dass sie nicht habe leiden müssen. Sie sei sofort tot gewesen.«
»Sofort tot«, wiederholte Rudolf Krobat monoton.
»Ich konnte Sie leider erst jetzt anrufen, weil ich Ihre Nummer nicht hatte und auch Ihren Nachnamen nicht wusste. Außerdem war hier so viel los. Der Arzt, die Polizei, der Leichenwagen …«
»Der Leichenwagen …«
»Die Polizei hat bereits die deutsche Botschaft informiert. Ihren Namen haben wir übrigens im Adressverzeichnis von Signora Balkow gefunden.«
»Wir?«
»Ja, ein Commissario aus Verona und ich. Er steht neben mir, und er hat mich gebeten, dieses Telefonat zu führen, ist es wohl möglich, dass Sie sofort hierher kommen? Es ist so viel zu regeln. Irgendjemand muss sich doch um alles kümmern.«
Rudolf Krobat zögerte keinen Augenblick. »Selbstverständlich. Ich fahre sofort los. Ich kann …« – er überlegte kurz – »… ich kann in etwa vier Stunden da sein. Können Sie so lange auf mich warten?«
»Natürlich. Ich bin im Haus. Sie haben doch noch einen Bruder?«
»Ja, einen Halbbruder. Er heißt Mark Hamilton, ich werde ihn gleich anrufen. Allerdings ist er immer etwas schwierig zu erreichen. Aber ich habe die Nummer seines Handys. Die restlichen Telefonate erledige ich aus dem Auto. Vor allem muss ich mich dringend mit Herrn Doktor Leuttner in Verbindung setzen. Er ist der Rechtsberater meiner Großmutter und hat sich immer um alles gekümmert. Auch um die Finanzen und so. Da wird es doch sicherlich viel Papierkram geben, wofür wir seine Hilfe brauchen. Ich bin sicher, dass er auch so schnell wie möglich nach Italien kommen wird.«
»Gut. Und noch einmal, es tut mir wirklich Leid um Ihre Großmutter. Ich habe sie sehr gemocht. Sie war eine großartige Frau.«
»Ich weiß. Ja, das war sie!«
»Mein Beileid!«
»Danke. Und besten Dank für Ihren Anruf. Das alles ist für Sie ja auch nicht einfach. Tausend Dank für alles. Ich bin schon so gut wie unterwegs. Auf Wiederhören.«
»Auf Wiederhören, Herr Krobat.«
Rudolf Krobat legte den Hörer zurück auf den Apparat. Er nahm die Zigarre, drückte sie im Aschenbecher aus, drückte immer fester und zerbröselte sie, bis nur noch kleine braune Fetzen übrig waren. Schließlich nahm er sein in Leder gebundenes Adressbuch und suchte die Nummer von Marks Mobiltelefon. Er hatte schon längere Zeit nicht mehr mit seinem Halbbruder gesprochen und deshalb keine Ahnung, wo er sich derzeit befand. Nachdem er die Nummer mit der englischen Vorwahl eingegeben hatte, hörte er zunächst ein Freizeichen, dann wurde die Verbindung abgebrochen, und es meldete sich eine automatische Ansage, die ihm mitteilte, dass der Teilnehmer derzeit nicht erreichbar sei. Als Nächstes rief Rudolf Krobat bei der Agentin in London an, deren Nummer ihm Mark gegeben hatte. Von ihr erfuhr er, dass Mark gerade eine Produktion in Venedig beendet habe und wieder einmal – Marks Agentin kommentierte dies mit einem verzweifelten Seufzer – in der Versenkung verschwunden sei. Jedenfalls wisse sie auch nicht, wo Mark sich jetzt aufhalte. Das sei typisch für ihn, dass er immer wieder untertauche. Und gerade jetzt hätte sie eine Produktion für die Vogue. Ob er Mark nicht einmal ins Gewissen reden könne. Er nehme das Leben einfach viel zu leicht. Es fehle ihm an jeglicher Disziplin. Irgendwann war es Rudolf Krobat gelungen, die Agentin in ihrem Redefluss zu unterbrechen und ihr mitzuteilen, dass Marks Großmutter gestorben sei und dass sich Mark sofort bei ihm im Büro oder gleich im Haus am Gardasee melden solle. Die Agentin hatte ihm wenig Hoffnung gemacht, dass dies in den nächsten Tagen zu erwarten war.
Eilig packte Rudolf Krobat einige Sachen in eine Reisetasche. Keine Viertelstunde später schloss sich das elektrische Tor der Garage hinter seinem silberfarbenen Mercedes.
8
Während Mark von Tronchetto kommend den Schildern Tutte le direzioni
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: