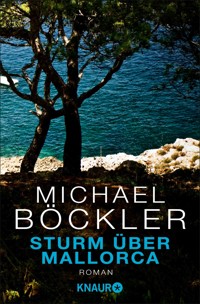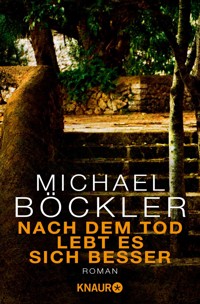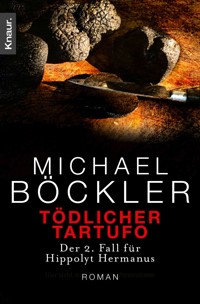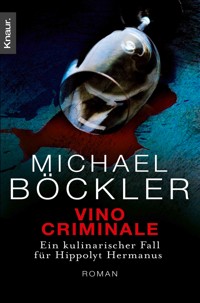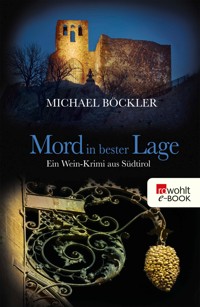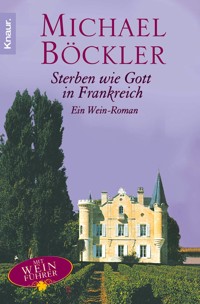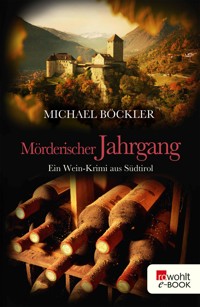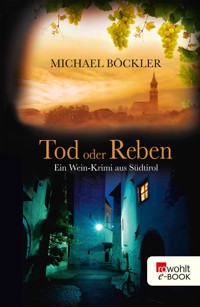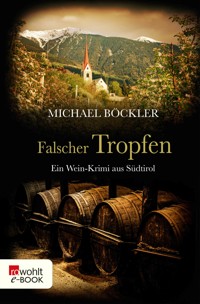
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein
- Sprache: Deutsch
Südtirol bietet viele gute Tropfen – doch dieser bereitet dem Baron Kopfzerbrechen Der Eisack ist ein wildromantischer Gebirgsfluss, der schon mal entwurzelte Bäume mit sich führt. Und eines schönen Sommertages auch die Leiche von Franz Mitterlechner, einem in Südtirol weithin bekannten Weinhändler. Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein, Privatermittler wider Willen, ist das erst einmal herzlich egal. Bis er erfährt, dass der Tote ihn testamentarisch bedacht hat: mit einer Magnumflasche Tignanello, einem besonders edlen Roten. Doch wenn der Baron von etwas Ahnung hat, dann ist es Wein. Und dieser ist gefälscht! Als sich auf der Rückseite des Etiketts auch noch eine posthume Nachricht des Weinhändlers findet, der behauptet, er sei ermordet worden, muss Emilio sich eingestehen, dass er schon wieder mitten in einem neuen Fall steckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Michael Böckler
Falscher Tropfen
Ein Wein-Krimi aus Südtirol
Über dieses Buch
Südtirol bietet viele gute Tropfen – doch dieser bereitet dem Baron Kopfzerbrechen
Der Eisack ist ein wildromantischer Gebirgsfluss, der schon mal entwurzelte Bäume mit sich führt. Und eines schönen Sommertages auch die Leiche von Franz Mitterlechner, einem in Südtirol weithin bekannten Weinhändler. Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein, Privatermittler wider Willen, ist das erst einmal herzlich egal. Bis er erfährt, dass der Tote ihn testamentarisch bedacht hat: mit einer Magnumflasche Tignanello, einem besonders edlen Roten. Doch wenn der Baron von etwas Ahnung hat, dann ist es Wein. Und dieser ist gefälscht! Als sich auf der Rückseite des Etiketts auch noch eine posthume Nachricht des Weinhändlers findet, der behauptet, er sei ermordet worden, muss Emilio sich eingestehen, dass er schon wieder mitten in einem neuen Fall steckt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Arno Hoven
Umschlaggestaltung yellowfarm gmbh, Stefanie Freischem
Umschlagabbildung imageBroker/Dr. Wilfried Bahnmüller/Carlos Sanchez Pereyra/mauritius images
ISBN 978-3-644-40253-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
In Sterzing hatte sich eine Gruppe norddeutscher Urlauber zusammengefunden, um entlang des Eisacks nach Bozen zu radeln. Das war nicht besonders anstrengend, weil Flüsse naturgemäß bergab fließen. Eine Tatsache, die bei der Planung eine wichtige Rolle gespielt hatte, denn die Radfahrer waren schon älteren Semesters. Einige litten unter Arthrose, einer hatte eine künstliche Hüfte und wieder eine andere gelegentliche Durchblutungsstörungen im Gehirn – weshalb sie in der Mitte fuhr, da konnte sie nicht verlorengehen.
Die Eisacktal-Radroute war gut ausgebaut und führte streckenweise über ehemalige Bahntrassen. Nur selten musste man auf die Brennerstaatsstraße oder ruhige Nebenstraßen ausweichen. Wie sich zeigen sollte, ging es nicht immer bergab, es waren auch kleinere Steigungen zu bewältigen. Aber diese hielten sich im Rahmen der konditionellen Möglichkeiten. Vom Brennerpass aus hätte die Gruppe genau sechsundneunzig Kilometer bis Bozen radeln müssen. Von Sterzing waren es nur fünfundsiebzig. Sportlichere Radler schafften das locker an einem einzigen Tag. Die Seniorengruppe dagegen ließ sich Zeit. Gemäß der Maxime, dass der Weg das Ziel sei.
In ihren Fremdenführern hatten sie zuvor von Johann Wolfgang von Goethe gelesen, der auf seiner Italienischen Reise 1786 in einer Postkutsche gen Süden gefahren war: «zwischen hohen Felsen, an dem reißenden Eisack hinunter» – um dorthin zu gelangen, «wo die Zitronen blühn». Sie waren auf Heinrich Heine gestoßen, der gut vierzig Jahre später aus seiner Kutsche «himmelhohe Berge» und «kreischende Waldbäche» erblickt hatte. Und sie wussten von Albrecht Dürer, der in Klausen eine berühmte Skizze des Städtchens angefertigt hatte – während eines Zwangsaufenthalts, weil der Weg nach einem Unwetter unbefahrbar geworden war.
Wie viel Zeit hatten Goethe, Heine oder Dürer in ihren Kutschen für die damals abenteuerliche Strecke von Sterzing nach Bozen benötigt? Die Senioren wussten es nicht, aber keinesfalls wollten sie schneller sein.
Gleich zu Beginn radelten sie an der auf einem Felsen thronenden Burg Reifenstein vorbei und an der spätgotischen Wallfahrtskirche Maria Trens. Sie passierten die Sachsenklemme und machten einen Stopp bei der gewaltigen Franzensfeste. Schließlich gelangten sie zum berühmten Kloster Neustift, wo sie die großartige Stiftskirche besichtigten und anschließend im Stiftskeller vom köstlichen Sylvaner probierten. Manche gönnten sich ein zweites Glas, schließlich war es nicht mehr weit nach Brixen, wo sie nächtigten.
Der folgende Tag war der Erholung vorbehalten – auch jener der geschundenen Gesäßmuskeln. Einige Gelenke wurden mit Schmerzsalbe behandelt. Ansonsten aber ging es allen gut. Die Seniorengruppe besichtigte die Bischofsstadt, die verwinkelten Gassen, die Lauben, den prächtigen Dom Mariä Himmelfahrt, das berühmte «Rüsselpferd» im Kreuzgang – und natürlich die einschlägigen Wirtshäuser, wo sie sich für den morgigen Tag stärkten.
Die nächste Etappe sollte nach Klausen führen. Das war nun wirklich nicht weit, dennoch bat schon nach wenigen Kilometern einer der Radler, der bereits am ersten Tag mit einer schwachen Blase aufgefallen war, um eine kurze Unterbrechung. Er lehnte sein Rad an einen Baum. Während sich die anderen unterhielten oder einen Schokoriegel aßen, stieg er über ein niedriges Geländer und betrat die Uferböschung, um von dort in den Eisack zu pinkeln. Ein Warnschild hatte er geflissentlich übersehen: «Attenzione, pericolo. Achtung, Gefahr. Möglichkeit plötzlicher Flutwellen auch zufolge von Betätigung der Staudammschütze.» Er stand so weit oben, dass von plötzlichen Flutwellen keine Gefahr drohte. Dennoch kam es unversehens zu einem Zwischenfall, der erstens zu einem akuten Harnverhalt führte und ihn zweitens fast in den Fluss stürzen ließ. Panisch hielt er sich an einem Busch fest und starrte nach unten.
Der Eisack, der viel Wasser führte und eigentlich eine reißende Strömung aufwies, nahm hier eine kleine Kurve, weshalb es an dieser Stelle eine beruhigte Zone gab, in der recht gemächlich ein Strudel kreiste. Genau dorthin hatte der Senior zu pinkeln versucht. Eine sehr optimistische Annahme, aber das war nicht das Problem. Denn hätte sein Strahl tatsächlich so weit gereicht, hätte er nicht nur den Strudel, sondern auch das Objekt getroffen, das langsam in ihm kreiste. Objekt? Das war das falsche Wort, denn unverkennbar handelte es sich um einen menschlichen Körper – mit dem Gesicht nach unten und mit abgespreizten Armen und Beinen. Dass kein Leben mehr in ihm war, stand außer Zweifel.
Der Senior schloss zitternd seinen Hosenschlitz und trat vorsichtig den Rückzug an. Er fühlte sich so schwach in den Beinen, dass ihm ein Mitradler über den Zaun helfen musste. Er rang nach Worten, und es dauerte eine Weile, bis alle ihn verstanden hatten.
Einer tat das einzig Richtige und verständigte mit seinem Handy die Polizei. Andere stiegen über den Zaun und beobachteten mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination den sich im Kreise drehenden Leichnam. Sie konnten es sich nicht verkneifen, ihn zu fotografieren. Das Kloster Neustift und die barocke Domkirche in Brixen hatten sie schon abgelichtet, auch verfügten sie über viele Fotos der pittoresken Altstadt. Eine Leiche fehlte noch in ihrer Bildersammlung.
Das war ein Souvenir der besonderen Art.
1
Die Bar am Bozner Obstmarkt zählte zu Emilios Lieblingsplätzen, wenn es darum ging, ein Glas Wein zu trinken. Sollte man ihn fragen, müsste er freilich zugeben, dass er viele bevorzugte Plätze hatte. Aber wer sollte ihn fragen? Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein konnte so misslaunig dreinblicken, dass ihn kein Fremder ansprechen würde. Und wer ihn kannte, würde ihn nicht fragen. Denn jeder wusste von seinen Vorlieben – jedenfalls im Hinblick auf seine weinaffine Lebensführung.
Man traf Emilio ebenso in gehobenen Vinotheken wie in einfachen Buschenschänken oder Almgasthöfen. In Letzteren allerdings nur, wenn er mit seinem alten Landrover dort hingelangen konnte, denn er hielt eisern an seiner Gewohnheit fest, keine größeren Wegstrecken zu Fuß zurückzulegen. Erst recht nicht solche, die im weitesten Sinne an eine Wanderung erinnern könnten. Das Flanieren in Städten zählte er nicht dazu. Der schlendernde Spaziergang war sogar eine Passion von ihm. Dafür brauchte es kein besonderes Schuhwerk. Man benötigte auch sonst keinerlei Verkleidung, wie zum Beispiel schlecht geschnittene Sportjacken, karierte Hemden oder gar kurze Hosen. Wie immer trug er rahmengenähte Budapester Schuhe, die er in großer Zahl von seinem Vater geerbt hatte und die nach seiner Überzeugung auch ihn überleben würden. Dazu ein leicht abgeschabtes Sakko aus englischem Tweed. Darauf verzichtete er nur, wenn es brütend heiß war, was in Bozen während des Sommers freilich häufig vorkam. An solchen Tagen trug er auf dem Kopf einen Borsalino und auf der Nase eine dicke Hornbrille mit dunkelgrünen Gläsern. Des Weiteren hatte Emilio bei jeder Gelegenheit seinen antiken Gehstock dabei, mit einem Knauf aus massivem Silber und dem eingravierten Wappen derer von Ritzfeld-Hechenstein. Dass man den Griff entriegeln konnte, um einen Degen herauszuziehen, war ein extravagantes Detail, von dem keiner wissen musste. Emilio führte den Stock mal auf der rechten Seite, dann auf der linken; mal hinkte er leicht, dann wiederum nicht. Viele hielten seinen Gehstock für eine Marotte. Wahrscheinlich hatten sie recht. Emilio war irgendwo in den Vierzigern. Sein genaues Alter hatte er verdrängt. Gemessen an seiner Lebenserfahrung war er ein Greis. Dabei hatte er sich den Leichtsinn eines Jugendlichen bewahrt. Und wenn es darauf ankam, hatte er den Elan eines Mannes in den besten Jahren – was er schließlich auch war.
Während Emilio auf einem Barhocker saß und genüsslich seinen Wein trank, las er eine englische Tageszeitung. Vor den vorbeiziehenden Touristen schützten ihn große Töpfe mit Grünpflanzen. Kaum hatte er sein Glas geleert, wurde er von der Wirtin gefragt, ob er noch etwas Wein wünsche. Er antwortete nicht sofort, sondern zögerte kurz. Aber nicht deshalb, weil er ernsthaft in Betracht zog, die Frage zu verneinen. Vielmehr musste er die schwierige Entscheidung treffen, ob er beim Weißburgunder bleiben oder zu einem Sauvignon wechseln sollte. Er prüfte seinen Gaumen, zog etwas Luft durch die Nase … und entschied sich für einen Blauburgunder aus der Lage Mazzon – natürlich für einen Riserva aus einem vorzüglichen Jahrgang, der längere Zeit im Holzfass gereift war.
Emilio dachte, dass es ihm schlechter gehen könnte. Aber kaum besser. Seine Tätigkeit als Privatdetektiv ließ er derzeit ruhen. Dank einer unerwarteten Erbschaft gab es keine ökonomische Notwendigkeit für ihn, neue Aufträge anzunehmen. Er hatte noch nie darüber nachgedacht, welche Berufsbezeichnung auf seinem Grabstein stehen könnte. In früheren Zeiten war so etwas üblich gewesen. Er liebte es, über alte Friedhöfe zu spazieren und die Inschriften zu lesen. In seinem Fall sah die Sache jedoch etwas anders aus. Erstens hatten die Ritzfeld-Hechensteins im Rheingau eine Familiengruft. Und zweitens legte er keinen Wert auf irgendein Grab. Sollte man seine Asche doch in alle Winde verstreuen. Gleichwohl hatte es ihm schon immer gefallen, wenn auf einem Grabstein stand, dass der Verblichene den «Beruf» des Privatiers ausgeübt hatte. Was nichts anderes bedeutete, als dass die Person nicht hatte arbeiten müssen. Statt sich dem schnöden Gelderwerb zu widmen, hatte sie die Kunst des Müßiggangs erlernen dürfen. Emilio fand, dass er dafür geradezu prädestiniert war. Wenn also irgendwann einmal sein Name im Zusammenhang mit einer Berufsangabe stehen sollte – nur so als Gedankenspiel –, dann bitte «Privatier». Aber ganz bestimmt nicht «Privatdetektiv». Diese Tätigkeit hatte irgendwie einen Hautgout und war in gewisser Weise ordinär.
Die Wirtin kehrte zurück und brachte Emilio den gewünschten Blauburgunder. Er ließ den Wein im Glas kreisen und nahm einen ersten Schluck. Was hatte er gerade überlegt? Dass die Tätigkeit eines Privatdetektivs einen vulgären Beigeschmack hatte? Der Blauburgunder hatte ihn jedenfalls nicht, er war frei von jedem Makel. Emilio sah einer jungen Frau hinterher, die einen kurzen Rock trug und beim Gehen provozierend mit ihrem Hintern wackelte. War das vulgär? Und wenn ja, was sprach dagegen? Das war die Würze des Lebens. Als er diesen Aspekt in seine Betrachtungen mit einbezog, musste er sich eingestehen, dass ein Dasein als schöngeistiger Privatier auf längere Sicht doch allzu fad war. Der Müßiggang war zwar eine Leidenschaft von ihm, er hatte auch Talent dafür, aber ihm gefiel es ebenfalls, wenn es zur Abwechslung hin und wieder mal richtig krachte. Er liebte es, in die Abgründe des Lebens zu tauchen und Übeltätern hinterherzujagen.
Erneut nahm er einen Schluck vom Blauburgunder. Eine Zeitlang spielte er mit dem Knauf seines Gehstocks. Nur Privatier zu sein war trostlos. Nun gut, er könnte seiner Freundin Phina häufiger beim Weinverkauf auf ihrem Weingut helfen. Sie würde das zu schätzen wissen. Aber in der Vinothek musste man nett zu wildfremden Menschen sein, sie anlächeln und immer höflich bleiben, selbst wenn sie dummes Zeug redeten und von Wein keine Ahnung hatten. Das lag ihm nicht. Davon bekam er Sodbrennen. Wahrscheinlich sogar ein Magengeschwür. Ganz sicher sogar.
Emilio trank den Blauburgunder aus. Ihm fehlte was im Leben. Etwas Abwechslung. Es musste ja nicht gleich Mord und Totschlag sein. Er lächelte versonnen. Warum eigentlich nicht? Wäre auch in Ordnung. Leider war die Kriminalität in seiner Wahlheimat Südtirol recht unterentwickelt. Er hätte sich besser in Chicago niedergelassen. Aber dort wurde kein Wein angebaut, es gab wohl auch keine Spinatknödel und Speckwurzen.
Bevor er in Selbstmitleid versinken konnte, zahlte er die Rechnung und küsste zum Abschied die Wirtin. Dann nahm er seinen Gehstock und machte sich auf den Weg zu seinem geparkten Landrover. Vor ihm ging ein Mensch, der schon von hinten einen unsympathischen Eindruck machte. Der Einfachheit halber könnte er ihn mit dem Degen erstechen – dann hätte er einen Kriminalfall. Nein, das war keine gute Idee. Hatte ihm der Blauburgunder das Hirn vernebelt? Er sollte froh sein, dass um ihn herum alles so friedlich war. Froh schon, aber nicht wirklich glücklich.
2
Das berühmte Augustinerkloster Neustift wurde Mitte des 12. Jahrhunderts vom ehrwürdigen Bischof Hartmann von Brixen gegründet. Es liegt in bevorzugter Lage nur drei Kilometer nördlich der Residenzstadt im Eisacktal, das sich hier, von Norden kommend, nach engen Schluchten zu einem weiten und sonnenverwöhnten Becken öffnet. Kunstsinnige Menschen geraten bei der Betrachtung des Chorherrenstifts ins Schwärmen, weil es als Glanzstück barocker Baukunst gilt. Sie besichtigen die prachtvolle Stiftskirche und bestaunen den Rokokosaal der Bibliothek mit Exponaten Neustifter Buchmalerei. Oder sie stehen in der Pinakothek andächtig vor einem Flügelaltar, der den heiligen Barbara und Katharina gewidmet ist.
Doch nicht wenige Besucher – wie auch die eingangs erwähnte Seniorengruppe – verbinden mit dem Kloster Neustift ganz andere «Kulturschätze». Sie assoziieren fast reflexartig die Weine der Stiftskellerei, sie spüren am Gaumen die Mineralität eines Sylvaner, sie erfreuen sich am pfefferigen Nachhall eines Veltliner oder am feinfruchtigen Apfelaroma eines Kerner.
Rund um das Chorherrenstift liegt das nördlichste Weinbaugebiet südlich der Alpen, mit Höhenlagen bis neunhundert Meter und einem frischen Klima, das charaktervolle Weißweine begünstigt. Die Vorzüge des Terroirs, die schon im 12. Jahrhundert den Augustinermönchen bekannt waren, machen sich heute viele engagierte Weinkellereien zunutze. Gerade unter den jüngeren Winzern der Region gibt es einige, die im positiven Sinne als «weinverrückt» gelten. Manche treffen sich nach getaner Abend regelmäßig in einer Vinothek, die nur wenige Schritte vom Kloster entfernt liegt.
Heute war die Stimmung weniger ausgelassen als sonst. Was nicht daran lag, dass die Weinbauern besonders erschöpft waren, vielmehr hatte ihnen ein Ereignis aufs Gemüt geschlagen.
Einer hob das Glas und forderte die anderen auf, es ihm gleichzutun.
«Jetzt stoßen wir auf unseren alten Spezi Franzl an», sagte er mit belegter Stimme. «Gott hab ihn selig. Er ist von uns gegangen und wird uns fehlen.»
«Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.»
«Prost, Franzl, auf dein Wohl.»
«Schod, dass er iatz nimmer do isch», kommentierte ein anderer auf Südtirolerisch. «Iatz miass mr den gonzn Wein alloan owe schwoab’n.»
Womit er die Notwendigkeit artikulierte, den ganzen Wein jetzt ohne Franzls Hilfe trinken zu müssen. Nichteinheimische hätten ihn wohl kaum verstanden. Aber die Winzer waren unter sich, weshalb sie so sprachen, wie ihnen gerade zumute war – einige heftiger im Dialekt, andere moderater.
«Des schoff mr, obr du fahlst ins trotzdem. Prost, Franzl. Hattesch net gian miassn, mir hattn di no gern be ins gkopt.»
Sie stießen die Gläser so heftig gegeneinander, dass sie fast splitterten.
Alle machten betretene Gesichter. Einer wischte sich sogar eine Träne aus dem Augenwinkel.
Die Winzer beklagten den Tod eines Freundes, dessen Leiche am späten Vormittag im Eisack südlich von Brixen entdeckt worden war. Wenig später hatte man ihn aus den Fluten geborgen. Die Polizei brauchte eine Weile, um seine Identität festzustellen. Dann gab es Gewissheit: Der Tote hieß Franz Mitterlechner und war ein bekannter Südtiroler Weinhändler. Die traurige Nachricht von seinem plötzlichen Ableben hatte sich unter seinen Winzerfreunden schnell herumgesprochen. Fest stand, dass der Franzl in den Eisack gestürzt und dort jämmerlich ersoffen war. Nun gut, er hatte oft einen über den Durst getrunken und war schon mal die Treppe in seinem Weinkeller runtergefallen. Auch hatte er im letzten Jahr mit seinem Auto auf der Landstraße zwischen Bozen und Meran betrunken den Anhänger eines Traktors gerammt. Äpfel der Sorten Braeburn, Gala und Golden Delicious hatten zu einer stundenlangen Vollsperrung des Straßenabschnitts geführt. Seine gelegentliche Trunkenheit war allerdings kein hinreichender Grund, um in den Eisack zu fallen. Aber passieren konnte es. Vor allem wenn man wie der Franz ein passionierter Angler war. Er hatte einen bevorzugten Platz am Ufer, wo er Entspannung beim Fischen von Äschen oder Forellen suchte. Vermutlich hatte er dort den Halt verloren. Da war man sich schnell einig. Die Erklärung lag auf der Hand. Zwar besaß der Franz neben seinem Weinhandel auch einen kleinen Weinberg, der mit grünem Veltliner bestockt war und steil zum Eisack abfiel. Aber von dort wäre er allenfalls auf die Staatsstraße gefallen, nicht direkt ins Wasser.
Man könne nur hoffen, dass er vor dem Unglück genug von seinem Veltliner getrunken hatte, stellte einer der Winzer fest, dann habe er vielleicht nichts von seinem Unfall mitbekommen und sei mit einem glückseligen Lächeln in den Fluten versunken.
«Ja, das wäre ihm zu wünschen», stimmte ein anderer ihm zu. Entschieden leerte er sein Glas – um gleich nachzuschenken.
«Arme Sau, der Franzl.»
«Wir müssen uns um seine Martina kümmern, die ist ja nun Witwe.»
«Die lassen wir jetzt besser in Ruhe. Die Martina hat einen Bruder, der wird ihr helfen.»
«Unser Beileid müssen wir ihr schon aussprechen.»
«Wir sehen sie ja spätestens auf der Beerdigung.»
Ein Weinbauer, der bis jetzt geschwiegen hatte, wechselte unvermittelt das Thema. «Habt’s euch schon die geschäftlichen Folgen überlegt?»
«Na, logisch net.»
«Der Franzl ist ja gerade erst tot.»
«Er hat mit seiner Firma auch unsere Weine vertrieben. Wahrscheinlich stehen noch einige Paletten in seinem Lager.»
«Die holen wir halt wieder ab, aber das hat keine Eile. Los werden wir unsere Flaschen auch ohne ihn. Ich bin eh schon ausverkauft.»
«Ich auch. Als Weinhändler wird uns der Franzl nicht fehlen. Aber beim geselligen Zusammensein …»
«Er hat immer gute Witze gewusst.»
Einer lachte. «Vor allem schweinische. Da war er gut. Könnt ihr euch noch an den erinnern? Eine Nutte …»
«Gea, her auf.»
«Uns ist grad nicht nach Witzen zumute.»
«Eigentlich war der Franzl ein Landesverräter.»
«Spinnsch iatz?»
«Ein Landesverräter? Warum denn das?»
«Weil er nur nebenher Südtiroler Weine vertrieben hat. Sein Hauptgeschäft hat er mit Weinen aus Italien gemacht.»
«Aus Italien? Südtirol gehört zu Italien», stellte einer fest. Dabei grinste er verschmitzt.
«Weißt genau, wie ich das meine. Der Franzl hat mit seiner Mitterlechner Weinvertriebsgesellschaft vor allem überteuerte Weine aus der Toskana und dem Piemont ins Ausland verscherbelt.»
«Aber getrunken hat er sie nicht.»
«Doch, natürlich schon.»
«Deswegen war er aber kein Landesverräter. Außerdem soll man über Tote nicht schlecht reden.»
«Tun wir doch nicht. Fragt sich aber schon, wie das mit seiner Firma weitergeht und was mit all den Flaschen passiert, die er gelagert hat.»
«Aufmachen und in den Eisack schütten», schlug einer vor. «Tignanello, Sassicaia, Ornellaia … Das wär ein Vergnügen.»
«Na, des tat i net übers Herz bringen. Guat sein sie schun, de Tropfn, nur viel zu teuer. Stell dr vor, mir kanntn fir insere Südtiroler Weine soffl verlongen.»
«Dann würde ich meiner Freundin einen Porsche kaufen.»
«Sonst hast keine Probleme?»
«In seiner Firma wird’s Lieferverpflichtungen geben. Hatte der Franzl jemanden, der ihm im Büro hilft?»
«Die kleine Steffi? Die hat doch keine Ahnung.»
«Also müssen wir doch der Martina unter die Arme greifen?»
«Aber nicht gleich.»
«Ich mach nicht mit. Ich helf nicht dabei, italienische Weine zu vertreiben.»
«Der Franzl … jetzt ist er tot. So ein Pech.»
«Er hat gern einen Blatterle getrunken. Weißt schon, den von …»
«Genau. Da bestellen wir jetzt eine Flasche. Und dann stoßen wir erneut auf ihn an.»
«Des moch mr. Dr Franzl wor olm schun a Sauhund.»
«Der hat viel Geld mit seinem Weinhandel verdient.»
«Aber nicht mit dem Blatterle, den kennt kein Mensch, nur wir Südtiroler.»
«Gut so.»
3
Als Emilio am nächsten Morgen gegen zehn Uhr den Weg in die Küche suchte, befand er sich noch im Schlafmodus. Ihn lockte der würzige Geruch von frisch aufgebrühtem Kaffee. Er hatte keinerlei Zweifel daran, dass seine Freundin Phina schon seit Stunden wach war. Wahrscheinlich hatte sie bereits im Weinberg gearbeitet und war gerade erst wieder zurückgekommen. Seit langem wusste er, dass sie eine frühaktive Lerche war. Er dagegen hatte den Schlafrhythmus einer Eule. Weshalb sie in getrennten Zimmern nächtigten – was seine Vorzüge hatte, aber auch zwischenmenschliche Nachteile mit sich brachte. Allerdings ließen sich diese jederzeit mit Kreativität und Eigeninitiative überwinden. Dunkel erinnerte er sich, dass ihm dies auch in der letzten Nacht gelungen war. Oder hatte dieses freudige Intermezzo schon in der Nacht zuvor stattgefunden? Na egal, in der Früh konnte er nicht klar denken. Geschweige denn, sich präzise erinnern. Ihm fiel der französische Philosoph und notorische Langschläfer René Descartes ein, den frühmorgendliche Geistesanstrengungen das Leben gekostet hatten. Die junge Königin Christina von Schweden hatte ihn 1649 an ihren Hof geholt, und nur wenige Monate später war er gestorben, weil sie ihn genötigt hatte, um fünf Uhr in der Früh bei ihr zu erscheinen und sie zu unterrichten. Nun gut, vielleicht hatte man ihn auch mit Arsen vergiftet. So genau wusste man das nicht. Jedenfalls war Emilio fest entschlossen, Descartes’ Schicksal nicht zu teilen. Deshalb schlief er morgens gerne aus. Und bei Phina hatte er obendrein die Gewissheit, dass der Kaffee nicht vergiftet war.
«Guatn Morgn, du Schlofmitz», begrüßte sie ihn mit erschreckend lauter Stimme.
Auf dem großen Bauerntisch stand ein Korb mit Vinschger Paarln, und auf einem Holzbrett lag aufgeschnittene Wurst. Frisch ausgepresster Saft. Selbstgemachte Marmelade. Emilio unterdrückte ein Gähnen. Er konnte sich wahrhaft nicht beklagen. Seine Phina war ein Schatz. Wenigstens heute. Es gab allerdings auch Tage, da überließ sie ihn kaltherzig seinem Schicksal. Und wenn es ganz schlimm kam, legte sie Wert darauf, dass er das Frühstück höchstselbst anrichtete. Aber heute hatte er Glück. Er umarmte sie und gab ihr einen Kuss.
Sie goss Kaffee ein und deutete auf die aufgeschlagene Tageszeitung Dolomiten auf dem Frühstückstisch.
«Hast schon gelesen? Nein, natürlich nicht. Der Franz Mitterlechner ist tot. Seine Leich ham’s gestern aus dem Eisack gefischt.»
Emilio schob sich gleichmütig eine Scheibe Jägersalami in den Mund. Franz Mitterlechner? Ach so, der Weinhändler aus Brixen. Er kannte ihn, ganz gut sogar. Nun denn, dann war er halt tot. So was kam vor.
«Ist er ertrunken?», fragte er mit mäßigem Interesse. «Oder warum lebt er nicht mehr?»
Phina nickte bestätigend. «Ja, ertrunken. Das hat der vorläufige Obduktionsbericht ergeben. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus.»
«Konnte der Franz nicht schwimmen?»
Sie sah ihn kopfschüttelnd an. «Hast du schon mal versucht, im Eisack zu schwimmen? Da würdest du auch ertrinken.»
Er zog eine Grimasse. «Könnt gut sein. Ich halte schon das Baden im Kalterer See für lebensgefährlich.»
«So ein Blödsinn! Im Kalterer See habe ich als Kind das Schwimmen gelernt.»
«Sehr mutig.»
«Im Artikel heißt es, dass der Franz offensichtlich beim Sportfischen ausgerutscht und in den Fluss gestürzt ist. Man hat an seinem bevorzugten Angelplatz seine Sachen gefunden und in der Nähe sein geparktes Auto.»
«Beim Angeln? Vielleicht hatte er ja einen Schwertfisch am Haken, der ihn von den Beinen gerissen hat.»
«Witzbold. Jedenfalls ist er jetzt tot. Wir müssen auf seine Beerdigung.»
«Die wird ja nicht gleich heute sein.»
«Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen hin.»
Emilio dachte, dass er diese Notwendigkeit nicht wirklich nachvollziehen konnte. Er verabscheute Beerdigungen. Sie konfrontierten ihn nicht nur mit der Endlichkeit des Seins, was im schlimmsten Fall zu Depressionen führen konnte, sondern strapazierten auch die Nerven, weil über die Verstorbenen meist viel dummes und verlogenes Zeug geredet wurde. Würde man glauben, was so alles auf Trauerfeiern erzählt wurde, dann gäbe es nur brave und hochintelligente Menschen auf dieser Welt. Leider war eher das Gegenteil der Fall. Schon vor Jahren hatte er sich vorgenommen, an keiner Beerdigung mehr teilzunehmen. Nur noch an seiner eigenen. Aber da hatte er sozusagen Präsenzpflicht – als Leichnam, post mortem.
Dennoch gab es Ausnahmen. Ihm fiel seine Tante Theresa ein, die auf dem Friedhof von Meran ihre ewige Ruhe gefunden hatte. An deren Beerdigung hatte er tatsächlich teilgenommen. Aber sie hatte ihm auch nahegestanden, was man vom Franz Mitterlechner nicht behaupten konnte. Nun gut, sie hatten sich häufig bei Weinverkostungen getroffen. Aber wenn es danach ginge, müsste er bei jedem zweiten verstorbenen Südtiroler zur Trauerfeier erscheinen.
«Ich gehe jedenfalls hin», sagte Phina entschieden, «und ich würde mich freuen, wenn du mich begleitest.»
«Ich überleg’s mir», grummelte Emilio.
Es gefiel ihm nicht, schon wieder mit seinen Prinzipien zu brechen. Wegen eines Weinhändlers, der so töricht gewesen war, im Eisack zu ertrinken. Seine Tante Theresa war wenigstens an Altersschwäche gestorben. Und sie hatte ihn mit einem unerwarteten Erbe bedacht. Aber das war eine andere Geschichte. Ihm fiel ein Zitat von Oscar Wilde ein: «Gute Vorsätze sind nutzlose Versuche, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen.» Eine Beerdigung war kein Naturgesetz. Die Schwerkraft allerdings schon. Dieser war der Weinhändler Franz Mitterlechner offenbar zum Opfer gefallen. Da halfen die besten Vorsätze nichts.
4
Martina Mitterlechner saß am Schreibtisch ihres Mannes und weinte jämmerlich. Sie schluchzte und zitterte. Hinter ihr stand die Büroassistentin Steffi, die vergeblich nach Worten des Trostes suchte. Aber welchen Trost könnte es geben? Martina hatte von einem Tag auf den anderen ihren Mann verloren. Bei einer längeren, schweren Krankheit hätte sie sich auf diese Situation vorbereiten können. Aber so hatte sie das Schicksal wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel getroffen. Ihr Franz war tot. Er war gegangen, ohne dass sie sich hätten voneinander verabschieden können. Das war grausam – und unendlich traurig.
Martina fiel es schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Fortan musste sie irgendwie alleine klarkommen. Nicht nur mit ihrem Leben, sondern auch mit der Firma ihres Mannes. Auf dem Tisch stapelten sich Papiere. Die Regale waren voll mit Aktenordnern. Der Computer enthielt unendlich viele Dateien, deren Sinn sich ihr nicht erschloss. Franz’ privaten Laptop konnte sie nicht öffnen, er war passwortgeschützt. Steffi war bei all den wichtigen Dingen keine große Hilfe. Sie war ein herzensgutes Mädel, aber viel zu jung und unerfahren. Franz hatte seine Weinvertriebsgesellschaft im Alleingang gemanagt. Er hatte dies sehr erfolgreich getan, und sie hatten ein gutes Auskommen damit. Aber was jetzt? Was war zu tun? Wie sollte es weitergehen?
Sie hatte keine Ahnung. Gab es Rechnungen, die zu bezahlen waren? Musste Ware ausgeliefert werden? Und wenn ja, wohin? Hatten sie genug Geld auf dem Konto?
Die Tür ging auf. Martina zuckte zusammen. Ihre Nerven lagen blank. Erleichtert sah sie, dass sie Besuch von ihrem Bruder bekam. Sepp Hofreiter stand ihr unheimlich nah. Er war einige Jahre älter als sie und hatte schon immer auf sie aufgepasst. Er nahm sie liebevoll in die Arme und strich ihr beruhigend über den Kopf.
«Alles wird gut», tröstete er sie mit leiser Stimme. «Du schaffst das. Ganz sicher. Aber das geht nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit.»
«Der Franz, er fehlt mir», schluchzte sie.
«Ich weiß, Martina. Ich weiß.»
«Möchten Sie einen Kaffee?», fragte die Büroassistentin. «Oder ein Wasser?»
«Lieb von dir, Steffi. Nein danke. Kannst du uns bitte ein bissel alleine lassen?»
«Aber natürlich, Herr Hofreiter. Wenn Sie mich brauchen, ich bin im Nebenzimmer.»
«Passt schon.»
Sepp, der groß war und behäbig wie ein Bär, zog einen Stuhl heran und setzte sich zu seiner Schwester an den Schreibtisch.
«Ich hab Nachricht von der Polizei bekommen», berichtete er. «Die Untersuchung ist so gut wie abgeschlossen.»
«Jetzt schon?»
«Warum nicht? Gibt ja nicht viel zu untersuchen. Der Franz ist in den Eisack gefallen; das steht fest. Die Obduktion hat bestätigt, dass er ertrunken ist. Er war also nicht schon vorher tot, verstehst?»
Sie sah ihn mit großen Augen an. «Nein, verstehe ich nicht. Wie könnte er schon vorher tot gewesen sein?»
«Na ja, zum Beispiel könnte er beim Angeln einen Herzinfarkt bekommen haben. Dann wäre er schon vor seinem Sturz in den Fluss tot gewesen.»
«Der Franz hatte nie Probleme mit seinem Herzen.»
«War ja nur ein Beispiel.»
Sie dachte kurz nach und meinte dann: «Wäre aber besser für ihn gewesen …» Erneut begann sie zu schluchzen. «Dann hätte er im Fluss nicht gegen das Ertrinken ankämpfen müssen. Ich darf mir das gar nicht vorstellen, wie der Franz …»
Er nahm ihre Hände. «Martina, du musst dir gar nichts vorstellen», unterbrach er sie. «Keiner weiß, wie es genau passiert ist. Vielleicht ist der Franz beim Sturz mit dem Kopf wo angeschlagen und hat nichts mehr mitbekommen?»
«Ja, das hoffe ich für ihn.»
«Jedenfalls ist sein Leichnam freigegeben. Wir können dem Franz die letzte Ehre erweisen und ihn beisetzen.»
«Die letzte Ehre? Ich werde ihn immer ehren, meinen Franz.»
Er sah ihr in die tränenfeuchten Augen. «Das sollst du auch, liebe Martina. Dafür hast du dein ganzes Leben lang Gelegenheit.»
«Oh mein Gott, die Beerdigung. Die müssen wir organisieren. Der Pfarrer, die Traueranzeige, die Einladungen für all die vielen Leute …»
«Ganz ruhig, Martina, nur kein Stress. Ich kümmere mich um alles.»
«Hast du denn überhaupt Zeit dafür?»
Sepp Hofreiter, der Koch in einem angesehenen Gasthaus der Region war, winkte beruhigend ab. «Die Zeit nehm ich mir. Ich hab schon mit meiner Chefin gesprochen; die gibt mir frei.» Er grinste. «Jetzt kann der Sous-Chef mal zeigen, was er draufhat.»
«Sepp, was tät ich nur ohne dich?»
«Die Frage stellt sich nicht, ich bin ja da.»
Sie deutete auf die vielen Aktenordner. «Du müsstest mir auch in der Firma helfen. Ich hab keine Ahnung, was zu tun ist.»
Er zuckte verlegen mit den Schultern. «Ich leider auch nicht. Ich kann ein perfektes Backhendl zubereiten, aber von Büroarbeit versteh ich nichts.» Er zog eine Grimasse. «Kann aber nicht so schwierig sein. Morgen verschaff ich mir einen Überblick.»
«Du bist ein Schatz.»
Es klopfte an der Tür, und Steffi steckte ihren Kopf herein. «’tschuldigung, dass ich störe, aber draußen ist ein Lieferwagen, der will zwei Paletten Wein abholen.»
«Der Lieferwagen?»
Steffi wurde rot. «Nein, natürlich der Fahrer. Das ist der Hannsjörg aus Sterzing, den kenn ich. Der beliefert einige Gastronomiebetriebe in Innsbruck.»
«Dann soll er die Paletten aufladen und den Empfang quittieren. Gibt’s für so was ein Formular?»
«Ja, und ich weiß sogar, welches», antwortete sie stolz.
Sepp klatschte in die Hände. «Also, auf geht’s! Ich sag’s ja, kann alles nicht so schwierig sein. Eine gute Panade beim Backhendl braucht viel mehr Erfahrung.»
5
Emilio hatte in der alten Villa im Meraner Ortsteil Obermais die Vorhänge aufgezogen und saß nachdenklich am Klavier. An Franz Mitterlechners Ableben lag es nicht, aber irgendwie war er heute schwermütig. Das kam vor. Zum Glück nicht allzu häufig, weshalb es ihn nicht weiter beunruhigte. Was sollte er spielen? Was passte zu seiner depressiven Stimmungslage? Er stand auf und goss sich einen Brandy ein.
Er ging auf und ab und dachte über die Villa nach. War sie der Grund für seine Melancholie? Weil das Haus so überhaupt nicht zu ihm passte – ihm aber gehörte? In ihrem unergründlichen Eigensinn hatte seine Tante Theresa ihm die Villa vererbt. War sie vielleicht der Ansicht gewesen, es hätte ansonsten die Gefahr bestanden, dass er irgendwann ohne Dach über dem Kopf sein würde? Er musste leise lächeln. Nun, das hätte sogar passieren können. Immerhin war er seit dem Tod seines Vaters und dem finanziellen Ruin des jahrhundertealten Imperiums der Familie von Ritzfeld-Hechenstein geld- und mittellos. Gewesen, musste man hinzufügen, denn zu Theresas Erbe gehörte nicht nur diese noble, wenn auch ziemlich betagte Villa, sondern auch ein Aktiendepot bei einer Privatbank in Bozen. Zudem ein Grundstück am Luganersee, das er sich bis heute noch nicht einmal angesehen hatte. Gleiches galt für das Mietshaus in Wien. Er hatte Theresas Anwalt Marthaler damit betraut, sich um alles zu kümmern. Der plötzlich wiedererlangte Wohlstand passte nicht zu seinem Lebensgefühl. Emilio hatte sich an die Verknappung seiner finanziellen Ressourcen gewöhnt. Er schätzte die unbeschwerte Leichtigkeit der Bedürfnislosigkeit. Er wollte an diesem paradiesischen Zustand nichts ändern. Theresa hin oder her. Er empfand die Erbschaft als Ballast. Er hätte sie ausschlagen sollen. Aber dazu war es zu spät. Jetzt hatte er ein Klavier und wusste nicht, was er spielen sollte.
Schließlich entschied er sich für eine langsame Nocturne von Chopin, obgleich er allergrößte Bedenken hatte. An diesem Stück hatte er sich schon mal versucht – und war kläglich gescheitert. Es gab obendrein keinen Grund, warum es diesmal besser klappen sollte. Warum spielte er ein Stück, das er nicht beherrschte? Eigensinn, purer Eigensinn. Aber er hatte keine Zuhörer, da war es egal. Er machte mehrere Anläufe, brach ab, versuchte es erneut. Irgendwann gab er auf. Er wechselte zu Jazz, das konnte er besser. Er improvisierte vor sich hin, wie er das während seiner Studienzeit in England als Barpianist getan hatte. Seine Stimmung besserte sich zusehends.
Ihm wurde bewusst, dass er in seinem Leben was ändern musste. Aber er wusste nicht, was. Er durfte sich glücklich schätzen, mit einer wunderbaren Frau wie Phina zusammen zu sein und auf ihrem Weingut wohnen zu dürfen. Das war großartig. Sozusagen ein Geschenk des Himmels. Das war es also nicht, was er unbedingt ändern sollte. Hatte vielleicht die Villa eine schlechte Aura? War sie es, die ihn herunterzog? Oder lag es einfach daran, dass er nichts zu tun hatte – außer Weine verkosten, Spinatnocken essen, auf dem Klavier spielen und sich ein Nickerchen auf Theresas Chaiselongue gönnen? War dies das Paradies auf Erden? Oder der Vorhof zur Hölle?
Er hörte abrupt auf zu spielen. Er schlug den Tastendeckel zu, trank den Brandy aus und verließ die Villa. Draußen auf der Straße atmete er tief durch. Gleich ging es ihm besser. Wenn jetzt noch sein altersschwacher Landrover ansprang, dann war die Welt wieder in Ordnung. Mehr oder weniger. Aber immerhin.
6
Es war spätabends, und Martina Mitterlechner saß allein im Büro. Ihr Bruder Sepp hatte sie gerade verlassen. Und Steffi war längst daheim. Stundenlang hatten sie sich durch Akten, Lieferscheine und Bestelllisten gewühlt; sie hatten den Lagerbestand überprüft und versucht, sich in den Dateien auf dem Computer zurechtzufinden. Sepp hatte gemeint, dass ihr Mann ein ziemliches Chaos hinterlassen habe. Das mochte stimmen, aber Franz war ein Meister der Improvisation gewesen. Irgendwie hatte er immer alles im Griff gehabt. Er hatte ja nicht ahnen können, dass er plötzlich nicht mehr da sein würde. Mit seinem Tod war alles verlorengegangen, was er in seinem Kopf gespeichert hatte. Kein Wunder, dass sie sich nicht zurechtfanden.
Hinzu kam, dass sie keinen wirklich klaren Gedanken fassen konnte. Sie stand immer noch unter Schock und konnte nicht begreifen, dass ihr Franzl tot war. Am liebsten wäre sie heute gar nicht erst aufgestanden und hätte sich den ganzen Tag unter der Bettdecke verkrochen. Aber Sepp hatte ihr den sprichwörtlichen Tritt in den Hintern gegeben und gesagt, dass sie Ablenkung brauche. Sie müsse tun, was jetzt zu tun sei – das wäre die beste Therapie. Woher wollte er das wissen? Sepp war mit Leib und Seele Koch und verfügte außerhalb seiner Küche über einen begrenzten Erfahrungshorizont. Doch er hatte recht, das spürte sie. Wie er fast immer recht hatte. Sepp hatte das Herz auf dem rechten Fleck und den Blick fürs Wesentliche. Er war geradeheraus – eben ein echter Südtiroler. Darauf legte er großen Wert.
Martina stand auf und streckte sich. Ihr Blick fiel auf ein großes Foto an der Wand, das die im Abendrot glühenden Zinnen des Rosengartens zeigte. Ob Steffi wusste, was sich dahinter verbarg? Ihr Bruder Sepp ganz sicher nicht. Und obwohl sie ihm ansonsten alles anvertraute und ohne Bedenken zuließ, dass er in alles Einblick nahm, hatte sie ihm dieses kleine Geheimnis vorenthalten. Ohne einen wirklichen Grund. Vielleicht, weil sie spürte, dass es Franz so gewollt hätte.
Sie ging zum Bild, das auf einer Holzplatte aufgezogen war, fand den verborgenen Riegel und schwenkte es zur Seite. Der dahinter in der Wand eingelassene Tresor hatte ein Zahlenschloss. Hoffentlich hatte Franz die Nummernkombination nicht geändert. Gleich würde sie es wissen. Sie tippte die Zahlenfolge ein, die sie zuvor sicherheitshalber auf einem kleinen Zettel notiert hatte. Der Code setzte sich aus privaten Daten zusammen, aus ganz persönlichen, die niemand anders kannte, wie zum Beispiel dem Tag ihres Kennenlernens. Sie hörte, wie sich die Bolzen entriegelten. Die Stahltür öffnete sich. Der Deckenstrahler, der sonst auf den Rosengarten gerichtet war, leuchtete in den Tresor.
Martina konnte erst nicht glauben, was sie sah. Verwirrt klemmte sie den Zettel mit dem Nummerncode von hinten in den Rahmen des Bildes. Sie hatte zwar damit gerechnet, dass Franz im Tresor auch Bargeld aufbewahrte – aber nicht bündelweise und in großen Scheinen. Sie vergewisserte sich, dass die Fensterläden geschlossen waren, und sperrte von innen das Zimmer ab. Dann nahm sie das Geld heraus, stapelte es auf dem Tisch und begann zu zählen. Ihr wurde heiß und kalt zugleich. Wo kam dieses viele Geld her? Sie hatte keine Erklärung. Die Weingeschäfte liefen in der Regel im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Nur kleinere Bestellungen wurden schon mal bar bezahlt.
Nachdenklich legte sie das Geld in den Tresor zurück. Dann nahm sie einige Umschläge zur Hand. Auf einem stand: «Mein Testament». Sepp hatte schon danach gefragt. Sie hatte ihm zur Antwort gegeben, dass es keines gab. Martina setzte sich an den Schreibtisch und öffnete den Umschlag mit flatternden Händen. Das Testament bestand aus wenigen Zeilen und war so nüchtern gehalten, wie man es sich nur vorstellen konnte. Weshalb sie auch nicht lange brauchte, um es zu verstehen. Im Endeffekt stand bloß drin, dass sie die alleinige Erbin war. Von allem und ohne Ausnahme. Sie warf einen Blick zum offen stehenden Tresor. Also auch vom Bargeld, von dessen Existenz wohl keiner etwas wusste. Aber das hätte sie sich auch ohne Testament eh einfach nehmen können. Jedenfalls hatte sich ihre kurz aufkeimende Angst nicht bestätigt. Das Testament enthielt keine unangenehmen Überraschungen. Franz hatte nur klargestellt, was in ihren Augen selbstverständlich war. Aber mit dem Testament in den Händen waren die Behördengänge womöglich einfacher. Was enthielten die anderen Umschläge? Sie waren alle ordentlich beschriftet. Von wegen Chaos. Ihr Bruder würde sich wundern. Hauptsächlich waren es Dokumente zum Haus, zum Weinlager, Kfz-Papiere, Geburts- und Hochzeitsurkunden und so weiter. Sie beschloss, sich nichts im Einzelnen anzuschauen. Vielleicht morgen. Heute Nacht jedenfalls war sie dafür zu müde. Sie legte alles wieder zurück in den Tresor. Erst jetzt wurde ihre Aufmerksamkeit auf eine Flasche Wein gelenkt, die seltsamerweise auch darin stand. Eigentlich nicht zu übersehen, denn es handelte sich um eine Magnumflasche. Genauer gesagt um einen Tignanello aus der Toskana. Gewiss ein Kultwein, aber das war noch lange kein Grund, ihn im Tresor aufzubewahren. Dafür hatten sie ihr Weinlager.
Martina nahm den Tignanello zur Hand. Zwischen Etikett und Flaschenhals war ein Zettel mit einer kurzen Anweisung aufgeklebt: «Für Emilio Baron von Ritzfeld-Hechenstein. Im Falle meines vorzeitigen Ablebens umgehend auszuhändigen! Franz Mitterlechner.»
Für Emilio? Jetzt verstand sie gar nichts mehr. Natürlich kannten sie den Baron, auch Phina Perchtinger, seine Lebensgefährtin, die bei Eppan ein Weingut besaß. Aber sie kannten ihn nicht besser als viele andere Menschen. Wie konnte Franz also auf die Idee kommen, ihm nach seinem Tod eine Flasche Wein zu schenken? Einfach so, ohne jegliche Erklärung. Und noch mal: Was hatte Franz dazu veranlasst, diese Flasche im Tresor aufzubewahren? Das war absurd. Oder gab es etwas, was sie nicht wusste? Franz hatte im Tresor eine geradezu akribische Ordnung. Alles war beschriftet und sorgsam gestapelt. Ganz gewiss hatte es einen Grund, warum er ausgerechnet diese Flasche Wein für so wichtig hielt, sie an einem sicheren Platz aufzubewahren. Aber welchen Grund konnte es geben? Ob sich Emilio darauf einen Reim machen konnte? Sie beschloss, ihn gleich morgen früh anzurufen. Erstens war es das, was Franz offenbar gewollt hatte. Und zweitens war sie auf eine Erklärung gespannt.
7
Linus Foidel war stinkesauer – auf sich selbst, auf Franz Mitterlechner, auf den Rest der Welt. Mit einer Flasche Wein, aus der er immer wieder einen kräftigen Schluck nahm, stolperte er durch seinen Weinkeller. Häufig musste er sich abstützen, um nicht zu fallen. Eigentlich sollte er sich freuen. Den Keller hatte er erst im letzten Jahr gebaut, für sündhaft teures Geld. Mit großen Akazienfässern und temperaturgesteuerten Edelstahltanks. Alles vom Feinsten. Der Stolz eines jeden Winzers. Auch hatte er einen Barriquekeller errichtet und sich eine groß dimensionierte Abfüllanlage zugelegt.
Linus rülpste. Er klopfte gegen einen Edelstahltank. Das Geräusch war leer und hohl. So eine Scheiße. Der Hagel hatte ihm die letztjährige Ernte versaut. Sein Weingut hatte es von allen in der Gegend am schlimmsten getroffen. Versichert war er nicht. Und in diesem Jahr sah es nicht viel besser aus. Im Frühjahr war es erst viel zu warm gewesen, dann frostig kalt. Gut die Hälfte seiner Blüten war erfroren. Na servus.
Wieder setzte er die Flasche an den Mund. Er trank den Wein wie ein Penner. Verabscheuungswürdig. Für einen Winzer undenkbar. Aber er wollte sich besaufen, und das ging so am schnellsten. Schwankend blieb er vor dem nächsten Edelstahltank stehen. Auf seinem Gesicht machte sich ein Grinsen breit. Fast schon zärtlich klopfte er dagegen. Der Tank war voll. Linus Foidel lachte. Er war ja kein Idiot. Nein, wirklich nicht. Er ließ sich nicht von Hagel und Frost in die Knie zwingen. Man brauchte für alles einen Plan B. Sein Glück, dass er schon in den vergangenen Jahren zweigleisig gefahren war. Jetzt hatten sich halt die Gewichte verschoben. Er hielt sich für einen begnadeten Kellermeister, der alle Kniffe kannte. In der jetzigen Situation waren seine Talente halt noch mehr gefragt als in der Vergangenheit. Einträglich war es. Nur blieb einem das verdiente Lob versagt. Aber damit konnte er leben.
Linus stellte fest, dass sein Hirn schon ziemlich benebelt war. Wie sonst hätte er sich plötzlich freuen können? Dafür gab es definitiv keinen Anlass. Der Franz Mitterlechner war ein Arsch gewesen, immer schon. Aber deshalb hätte er nicht gleich sterben müssen. Wieder musste er laut lachen, was im Weinkeller gespenstisch widerhallte. Scheiß drauf! Jetzt war der Mistkerl tot. Menschlich kein großer Verlust, aber für sein Geschäft fatal. Schließlich waren sie Partner gewesen, was niemand wusste – was keiner wissen durfte. Zu allem Überfluss schuldete ihm der Franz noch verdammt viel Geld. Das konnte er jetzt vergessen. Die Kohle konnte er sich in die Haare schmieren. Und obendrein brauchte er den Franz für den Vertrieb. Auf dem Gebiet war der Typ richtig gut gewesen. Er selbst hatte davon keine Ahnung, vor allem fehlten ihm die Kontakte.
Linus trank die Flasche aus, viel war nicht mehr drin. Der nächste Rülpser war besonders herzhaft.
Und jetzt? Jetzt steckte er in Schwierigkeiten. Denn diesmal hatte er keinen Plan B.
8
Hinter der Theke in Phinas Vinothek zu stehen empfand Emilio als Martyrium. Was nun wirklich nicht an der Vinothek lag, denn diese war architektonisch gelungen und hatte ein angenehmes Raumklima. Auch konnte sich Emilio Schlimmeres vorstellen, als von Weinflaschen umgeben zu sein. Zum qualvollen Unterfangen wurde diese Aushilfstätigkeit durch die Tatsache, dass er nicht alleine war.
Sinn und Zweck des Verkaufs- und Verkostungsraums auf dem Weingut Perchtinger war ja der Publikumsverkehr. Zu seinem Missfallen fiel dieser ausgesprochen rege aus. Die Besucher gaben sich die Klinke in die Hand. Leider taten sie dies nicht schweigend und mit der gebotenen Demut. Vielmehr wuselten sie planlos hin und her, nahmen Flaschen aus dem Regal, um sie zuverlässig an den falschen Platz zurückzustellen, plapperten untereinander wirres Zeug – und löcherten ihn mit Fragen, deren Sinnhaftigkeit sich ihm häufig nicht erschloss. Aber Emilio hatte gelernt, dies alles mit fast stoischem Gleichmut zu ertragen. Auch schaffte er es, freundlich zu lächeln. Zugegeben, es gelang ihm nicht immer, aber doch erstaunlich oft. Darauf war er stolz. Oder auch nicht. Denn Selbstverleugnung hielt er für keine Tugend. Aber was tat er nicht alles, um Phina zu erfreuen. Genau genommen war er es ihr schuldig, dass er diese Aufgabe ordentlich erledigte. Er war eine glatte Fehlbesetzung, das war auch ihr bewusst, aber ab und zu musste er halt in die Bresche springen – und über seinen Schatten. Was physikalisch unmöglich war, denn der Schatten sprang ja mit. Dennoch war dieses Kunststück heute nötig, weil Oskar einen ziemlich schlimmen Schnupfen hatte. Er war schon älter und sein Immunsystem offenbar geschwächt. Aber er hatte schon für Phinas Vater gearbeitet und machte den Job in der Vinothek gerne. Hoffentlich war er bald wieder genesen.
Verstohlen blickte Emilio auf die Uhr. Irgendwie ging sie heute langsamer als sonst. Die Mittagspause wollte einfach nicht näher rücken.
Ein Karton mit Sauvignon? Bitte, gerne. Außerdem zwei Flaschen Gewürztraminer? Mit dem größten Vergnügen. Bezahlung mit der Kreditkarte? Selbstverständlich. Den PIN-Code vergessen? Ein verständnisvolles Lächeln. Ja, so was kann passieren. Barzahlung? Fehlanzeige, nicht genug Geld im Portemonnaie. Wieder mal typisch, dachte Emilio, eine fette Limousine fahren, aber zahlungsunfähig sein. Und jetzt? Für den Sauvignon würde es reichen? Na also, dann verzichten Sie halt auf den Gewürztraminer. Genialer Einfall des Kunden: Ob er aus dem Karton zwei Flaschen Sauvignon rausnehmen könne und stattdessen den Gewürztraminer …
Emilio dachte, dass man in solchen Fällen eigentlich die Geduld eines Zen-Meisters brauchte. Aber er war kein Zen-Meister. Außerdem gab es einen Kartonpreis, der für sechs Flaschen Sauvignon berechnet war. Der Gewürztraminer war teurer. Die nächsten Kunden warteten. Langsam wurden sie ungeduldig.
Emilio suchte nach einer kreativen Lösung. Er könnte darum bitten, vom Kauf Abstand zu nehmen und das Weite zu suchen. Doch das würde Phina missfallen. Davon würde sie zwar nichts mitbekommen, weil sie in Bozen einen Termin wahrnahm, aber trotzdem kam dieser Rausschmiss nicht in Frage. Er rang sich ein gequältes Lächeln ab – und überreichte die beiden Flaschen Gewürztraminer als Geschenk des Weingutes Perchtinger. Das war charmant und großzügig. Jetzt stimmte zwar die Kasse nicht mehr, aber er hatte aus der Not eine PR-Maßnahme gemacht. Und verhindert, dass er die Selbstbeherrschung verlor. Vielleicht war er in dem Job doch nicht so schlecht? Den Gedanken wollte er allerdings erst gar nicht aufkommen lassen. Die Vorstellung ängstigte ihn.
Dass jetzt schon zum zweiten Mal sein Handy klingelte, trug nicht zu seiner Ausgeglichenheit bei. Multitasking war ihm ein Gräuel. Dennoch beschloss er ranzugehen. Die nächsten Kunden mussten halt einen Moment warten. Er hatte ihnen gerade einen Lagrein zum Verkosten eingeschenkt. Sollten sie sich mal darauf konzentrieren und selber herausfinden, dass der dunkle Rotwein einen würzig-fruchtigen Duft mit Aromen von Veilchen, Vanille und Schokolade verströmte. Und wenn sie was anderes rochen oder gar nichts, war es auch egal. Hauptsache, sie konnten sich später an ihre PIN-Nummer erinnern oder hatten genug Bargeld bei sich.
Zu Emilios großer Überraschung kam der Anruf von Martina Mitterlechner. Er war so geistesgegenwärtig, ihr zu kondolieren. Was sie mit einem tiefen Schluchzer beantwortete. Emilio fragte sich, was zum Teufel sie veranlasst haben könnte, ihn anzurufen. Hatte sie ihn mit der telefonischen Seelsorge verwechselt?
«Martina, wie kann ich helfen?», fragte er hilflos. Irgendwas musste er ja sagen.
«Emilio, du kannst mir gar nicht helfen», stellte sie schniefend fest.
Gott sei Dank! Immerhin litt sie nicht unter Realitätsverlust. Er war definitiv kein Witwentröster. Er räusperte sich verlegen. Nun, er konnte sich durchaus Witwen vorstellen, die zu trösten reizvoll sein könnte. Aber ganz bestimmt nicht Martina.
«Was kann ich dann für dich tun? Oder warum rufst du an?»
«Ich möchte, dass du zu mir kommst und etwas abholst. Etwas ganz Merkwürdiges. Nämlich eine Flasche Wein.»
Emilio fasste sich verdutzt an den Kopf. Eine Flasche Wein? Was war daran merkwürdig? Immerhin war er gerade von unzähligen Flaschen umgeben. Aber wieso sollte er den weiten Weg nach Brixen fahren, um dort eine weitere abzuholen?
«Äh, wie bitte?», stammelte er.
«Mein verstorbener Franzl hat es so gewollt. Ich habe in seinem Safe eine Magnumflasche Tignanello gefunden. Darauf steht: ‹Für Emilio Baron von Ritzfeld-Hechenstein. Im Falle meines vorzeitigen Ablebens umgehend auszuhändigen!›»
Ups, das war tatsächlich merkwürdig. Oder total bescheuert. So gut kannten sie sich nun wirklich nicht, dass es dem Franz Mitterlechner ein Anliegen gewesen sein könnte, ihm nach seinem Tod eine Magnum Tignanello zu schenken. Und zwar «umgehend». Des Weiteren war der Tignanello zwar ein feiner Wein, der sich durchaus seiner Wertschätzung erfreute, aber es gab keinen Grund, die Bouteille im Safe aufzubewahren. Man konnte einen Tignanello in jeder gut sortierten Weinhandlung kaufen.
«Emilio, bist du noch dran?»
«Ja, natürlich. Entschuldige, ich war gerade abgelenkt.»
«Was hat es mit dieser Flasche auf sich? Kannst du mir das bitte erklären?», fragte sie.
«Ich habe keine Ahnung. Ist auch mir ein totales Rätsel. Steht sonst noch was auf der Flasche? Irgendeine Begründung?»
«Eben nicht. Aber der Franzl wird sich schon was dabei gedacht haben. Deshalb habe ich dich gleich angerufen.»
«Und jetzt willst du, dass ich die Flasche abhole?»
«Sagte ich doch.»
Stimmt, das sagte sie bereits. Blieb die Frage, was dieser ganze Zinnober sollte. Den Franz konnte er nicht mehr fragen. Martina hatte keinen blassen Schimmer. Er bezweifelte, dass er eine Eingebung haben würde, wenn er die Flasche in den Händen hielt. Also könnte er sich die Fahrt im Prinzip sparen. Einerseits. Anderseits liebte er Rätsel. Und wenn er nach einem Grund gesucht haben sollte, seinem Aushilfsjob in der Vinothek nach der Mittagspause zu entfliehen – jetzt hatte er einen. Phina sollte bis dahin aus Bozen zurück sein. Er würde ihr von dem merkwürdigen Anruf erzählen und dann das Weite suchen.
«Einverstanden», stimmte er zu. «Ich könnte heute Nachmittag kommen. Wäre das für dich okay?»
«Ja, passt gut. Ich bin im Büro.»
«Sei nicht zu fleißig. Bis später.»
9
Alles war nach Plan verlaufen. Wenigstens bis jetzt. Phina war zeitig aus Bozen zurückgekehrt und würde am Nachmittag die Vinothek zusammen mit einer Freundin betreiben. Von Oskar hatten sie die Nachricht erhalten, dass der Schnupfen schon besser sei; morgen könne er wieder arbeiten. Emilios Landrover war auf Anhieb angesprungen, der Sprit sollte reichen, und der Stau an der Autobahnauffahrt interessierte ihn nicht, weil er sowieso auf der Landstraße fuhr. Wie fast immer. Denn sein alter Geländewagen wurde mit zunehmender Geschwindigkeit immer störrischer. Er musste sich schon bei gemächlichem Tempo fortwährend mit der ausgeschlagenen Lenkung abmühen, um die Spur zu halten. Das strengte gewaltig an. Außerdem polterte die Hinterachse. Das allerdings war reine Nervensache. Wie auch immer, Emilio fühlte sich auf der Landstraße ganz grundsätzlich wohler. Sie entsprach mehr seinem Lebensgefühl. Lange Geraden mochte er nicht, Kurven dagegen schon. Nicht nur auf der Straße, auch im übertragenen Sinne. Auf der Autobahn beengten Leitplanken schon psychologisch seinen Freiheitsdrang. Auf Landstraßen konnte man nach Lust und Laune ausscheren, spontan abbiegen oder sogar umdrehen. Wirtshäuser lockten zur Einkehr, was man vom Schnellimbiss in Autobahntankstellen nicht wirklich behaupten konnte. Wenn er ein Schild entdeckte, das den Weg zu einem Weingut wies oder zu einer Buschenschänke, konnte er frei und spontan entscheiden, sich eine kleine Pause zu gönnen und dort hinzufahren. Auf der Autobahn klemmte er dagegen meist hinter einem Laster fest, den zu überholen es seinem Fahrzeug an Leistung mangelte.
Da er mit Martina keine feste Zeit ausgemacht hatte und ihn plötzliche Hungergefühle peinigten, beschloss er, in Brixen einen Stopp einzulegen. Er parkte kreativ im Halteverbot und fand zielsicher den Weg zur Domgasse und zum berühmten Finsterwirt, der so hieß, weil früher in unmittelbarer Nähe des Domes nach Anbruch der Dunkelheit kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden durfte. Natürlich war dies trotzdem geschehen – im Finstern. Emilio hatte dafür jedes Verständnis. Noch dazu konnte man davon ausgehen, dass sich auch die Geistlichen hinter ihren Mauern mit Messwein über das Verbot hinwegsetzten. Wie auch immer, Emilio wählte zur Labsal die dem Finsterwirt zugehörige Vinothek Vitis. Er hätte unter Weinlaub im luftigen Hofgarten sitzen können, zog aber den modernen Innenraum vor. Das Ambiente gefiel ihm, denn in den Regalen rundherum präsentierten sich viele hundert Flaschen Wein. Nicht nur aus Südtirol, sondern aus ganz Italien und sogar aus Übersee. Prompt entdeckte er eine Flasche Tignanello, was ihm den Zweck seiner Landpartie in Erinnerung rief. Er konnte sich immer noch nicht erklären, warum ihm Franz eine Magnumflasche dieses Weines vermacht hatte. Wenn es eine Botschaft sein sollte, dann verstand er sie nicht. Emilio wählte Risotto Carbonara und als Begleitung einen Eisacktaler Weißwein. Oder hätte er eingedenk des Tignanello einen Sangiovese aus der Toskana bestellen sollen? Sozusagen zur Einstimmung – oder in der Hoffnung, während des Trinkgenusses eine Inspiration zu erhalten? In vino veritas? Wenn was dran war an der These, dass im Wein die Wahrheit läge, dann müsste er schon einen veritablen Tignanello trinken. Aber er hatte allergrößte Zweifel, dass er hinterher auch nur ein kleines bisschen klüger sein würde. Also konnte er es auch sein lassen. Außerdem bekam er in Kürze eine große Flasche ganz umsonst. Dann könnte er immer noch die Probe aufs Exempel machen.
Eine gute Stunde und einen Strafzettel für unerlaubtes Parken später fuhr er auf den Hof der Mitterlechner Weinvertriebsgesellschaft. Sie befand sich am nördlichen Ortsrand von Brixen, fast schon in Neustift, wo Martina und Franz auch ihr Wohnhaus hatten. Emilio stieg aus und streckte sich. Bereits nach wenigen Kilometern Fahrt musste man bei seinem rumpligen Uraltgefährt die Bandscheiben neu sortieren. Er verzichtete auf seinen Gehstock und ging zum Eingang. Dort wurde er bereits von Martina erwartet, die ihn wohl hatte kommen sehen.
Er nahm sie wortlos in die Arme. Das musste als Zeichen seines Mitgefühls reichen.
Sie hätten Glück, sagte Martina, sie seien alleine. So könne sie ihm die Flasche übergeben, ohne dass jemand etwas mitbekomme. Steffi, die Bürohilfe, sei nämlich von Natur aus neugierig. Sie würde wissen wollen, was es mit einer Flasche Wein auf sich habe, die ihrem Chef so wichtig gewesen war, dass er sie im Tresor aufbewahrt hatte.
Emilio dachte, dass genau dies die entscheidende Frage war, die sich auch weniger neugierige Menschen stellten. Zum Beispiel er selbst.
Er folgte Martina ins Büro im ersten Stock, wo sie gleich zur Tat schritt. Sie schwenkte ein großes Wandbild zur Seite, das das Bergmassiv des Rosengartens zeigte, warf ihm einen verunsicherten Blick zu, um ihn dann zu bitten, einige Schritte zur Seite zu treten. Schade, er hatte den eingebauten Tresor nur kurz erspähen können. Jetzt war ihm die Sicht durch den blöden Rosengarten versperrt. Nun, beim Nummerncode hätte er diskret weggeschaut. Er musste grinsen. Oder auch nicht, denn er war mindestens so neugierig wie besagte Steffi. Nur allzu gerne hätte er einen kurzen Blick auf den weiteren Inhalt des Tresors erhascht. Aber Martina hatte dem geschickt vorgebeugt. Erst im letzten Moment war ihr diese Vorsichtsmaßnahme eingefallen. Ganz so, als ob sie plötzlich realisiert hatte, dass nicht alles im Tresor für seine Augen bestimmt war. Eine Mutmaßung, die seine Wissbegier nur steigerte. Die nun aber nicht befriedigt würde. Stattdessen konnte er jetzt aus nächster Nähe die Zinnen des Rosengartens studieren.
Er hörte, wie sich der Tresor öffnete und wenige Sekunden danach wieder schloss. Martina kam zurück in sein Blickfeld und überreichte ihm die angekündigte Großflasche Tignanello. In ihrem Gesicht spiegelte sich Erleichterung wider, wenigstens diesen letzten Willen ihres Mannes hiermit erfüllt zu haben. Emilio hielt den Wein mit großer Ratlosigkeit in den Händen. Die Botschaft auf dem Aufkleber über dem Etikett war eindeutig. Kein Zweifel, Franz Mitterlechner hatte ihn gemeint. Na ja, das war schon vorher klar gewesen, aber jetzt konnte er es schwarz auf weiß nachlesen. Er fragte, ob das wirklich die Handschrift vom Franz sei. Martina nickte. Ja, zweifelsfrei. Nun, dann war auch das geklärt. Und jetzt? Emilio drehte die Flasche und sah sie sich von allen Seiten an. Ein ganz normaler Tignanello. Ein schöner Wein, aber eben nichts Außergewöhnliches. Er stammte nicht aus Südtirol, sondern
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: