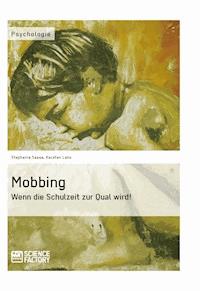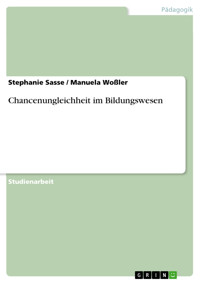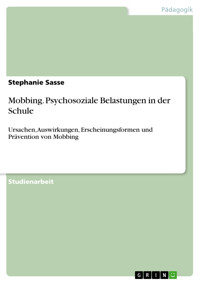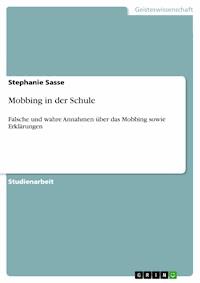Nachhilfeunterricht. Ein kritischer Überblick über den außerschulischen Förderunterricht E-Book
Stephanie Sasse
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Pädagogik - Schulwesen, Bildungs- u. Schulpolitik, Note: 1,0, Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Pädagogische Psychologie), Veranstaltung: Einführung in die quantitativen Forschungsmethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Schon in der Weimarer Republik haben die Bildungsschichten mehr Bildung für sich erschlossen als für andere. Die PISA-Studie, die beispielsweise sagt, dass ein Viertel der deutschen Jugendlichen nicht richtig lesen und rechnen können, zeigt uns, dass uns andere Gesellschaften überlegen sind. Viele Jugendliche haben es schwer eine Arbeit oder eine Ausbildung zu finden (Hendricks, 2004). „Sitzen bleiben – jeder Dritte kennt es aus eigener Erfahrung“ (Kowalczyk & Ottich, 2003, S. 5). Wenn man die Werbeanzeigen von meist privaten Anbietern mit Namen wie „Studienkreis“, „Schülerhilfe“, „Abacus“, u.a. in der Presse betrachtet, scheint es leicht, tatsächliche und vermeintliche Lerndefizite von Schülerinnen und Schülern aller Altersstufen und Schulformen zu beheben: „Durch Motivation und Leistungswillen zum Erfolg“. Dies und mehr versprechen Nachhilfeeinrichtungen (Rudolph, 2002). Zudem ist auffällig, dass Nachhilfe zwar ein großes Thema der Bildungswirklichkeit ist, jedoch kaum darüber gesprochen – eher schamhaft geschwiegen wird - wogegen es endlose Kontroversen und Debatten um Schulformen und Lehrpläne gibt. ... Eine eigenhändige Forschung an einem bekannten Nachhilfeinstitut zu den üblichen Fragen: Welche Fächer werden unterrichtet? Wieviel Erfolg bringt Nachhilfeunterricht? Welche Zukunftsaussichten und gesellschaftliche Aspekte spielen hierbei eine Rolle? Welche Probleme (in) der Schule gibt es, und kann man sie umgehen? Diese und weitere Fragen wurden in der Forschung durch Fragebogenanalysen beantwortet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Stephanie Sasse Manuela Woßler
Page 4
Plötzlich geht’s bergab - ein Teufelskreis
Schon in der Weimarer Republik haben die Bildungsschichten mehr Bildung für sich erschlossen als für andere. Die PISA-Studie, die beispielsweise sagt, dass ein Viertel der deutschen Jugendlichen nicht richtig lesen und rechnen können, zeigt uns, dass uns andere Gesellschaften überlegen sind. Viele Jugendliche haben es schwer eine Arbeit oder eine Ausbildung zu finden (Hendricks, 2004).
Die ehemalige Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, Entertainer Harald Schmidt, Bayerns Ministerpräsident Dr. Stoiber und etliche andere Zeitgenossen wurden diesem Schicksal zuteil. Der Bielefelder Jugendforscher Klaus Hurrelmann schließt aus der Tatsache, dass jeder fünfte Schüler zwischen 12 und 17 Jahren Nachhilfe bekommt, dass die Intensität der pädagogischen Arbeit nicht so ist, wie sie sein müsste. Die durchschnittliche Nachhilfe umfasst einen Zeitraum von neun Monate mit zwei Stunden pro Woche. Da die Schule den einzelnen Schüler nur noch sehr begrenzt individuell fördern kann, ist auch die „Dicke des Portemonnaies“ der Eltern hilfreich beim Schulerfolg. Eine Frage, die man sich dabei stellt ist, ob man Hilfe in Anspruch nehmen sollte (Kowalczyk & Ottich, 1999).
Wolfgang Bergmann schreibt in seinem Buch, dass die Bildungschancen für junge Menschen noch nie so gut waren wie heute. Dies habe mit den Bildungsreformen in den 70er Jahren zu tun. Dennoch hat der „Bildungsboom“ auch negative Seiten. Die Bildungschancen von Migrantenkindern sind erheblich schlechter, als die deutscher Kinder. Die Chancen auf Bildung von Arbeiterkindern sind ebenfalls erheblich schlechter als die von Beamten- bzw. Akademikerkindern. Zudem haben sozialwissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass für viele Familien die Schule und die dazugehörigen Schulnoten zu einem großen Problem geworden sind. Das Ergebnis, dass 80% der Eltern nichts so sehr Angst macht und den Familienfrieden beeinträchtigt wie die Schule, lässt einen nachdenklich stimmen. Trotz aller Reformpädagogik hat sich nichts daran geändert. Schlechte Noten und schlechte Zeugnisse wurden zu einem Dauerstörenfried in den Familie. Die Eltern sind hilflos, reagieren mit Vorwürfen manchmal sogar mit Strafen.
Page 5
Durch den Druck verlieren die Kinder den Spaß am Lernen verlieren, was wiederum zu schlechten Noten führt - ein Teufelskreis (Bergmann, 1995). Wollen die Eltern doch nur deswegen gute Leistungen, da Schulnoten nun mal über die Schullaufbahn und über berufliche Chancen entscheiden. Guter Rat ist dann oft teuer, denn stures „Pauken“ hilft selten und Unterstützungsversuche enden meist mit Streit und Tränen. Ist in solchen Fällen Nachhilfe sinnvoll? (Kowalczyk & Ottich, 2002).
Die Bildungschancen und der Bildungsehrgeiz sind nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Schülern erheblich gewachsen. So besuchten 1950 noch 80% der 14jährigen die Hauptschule. Von den Eltern der Schüler, die 1995 die Hauptschule besuchten, welche 30% ausmachten, geben nur 10% an, dass sie mit einem Hauptschulabschluss zufrieden seien. Dabei muss man sich nicht wundern, dass viele Kinder geistig und seelisch schlichtweg überfordert werden, wenn die Mehrzahl aller Eltern ihr Kind lieber auf der Realschule und am liebsten auf dem Gymnasium sehen wollen. Doch auch viele Jugendliche haben die Werte der Schulleistung verinnerlicht - sie teilen die allgemeine Hochschätzung von Schulbildung durchaus mit den Eltern. Das zeigen Untersuchungen der Bielefelder Universität aus dem Jahr 1990. Für viele Kinder ist der Schulerfolg eine wichtige Vorraussetzung ihres Selbstbewusstseins geworden. Bleibt der Erfolg aus, fühlen sie sich in ihrem Selbstwertgefühl getroffen und seelische Probleme, bis hin zu psychischen Erkrankungen, treten immer häufiger auf (Bergmann, 1995).
Dieses Bündel von Entwicklungen hat dazu geführt, dass Nachhilfe zu einem immer wichtigeren Thema in unserer Bildungslandschaft geworden ist und weiter bleiben wird. In einer Woche erhalten etwa 2 Millionen Schüler Nachhilfeunterricht. Professor Klaus Hurrelmann fand 1995 in einer Untersuchung heraus, dass umgerechnet ca. 15 Millionen Euro pro Woche für Nachhilfeunterricht in Deutschland ausgegeben werden. Neben Nachhilfeinstituten gibt es eine ganze Palette von Nachhilfeangeboten privater Art, Hausaufgabenhilfen, Kurse für die Leistungsförderung in Schulen etc. die in diesen Zahlen nur zum Teil berücksichtigt wurden (Bergmann, 1995). Man könnte jedoch annehmen, dass diese Zahl in den letzten 10 Jahren noch stark gewachsen ist.
Wenn man die Werbeanzeigen von meist privaten Anbietern mit Namen wie „Studienkreis“, „Schülerhilfe“, „Abacus“, u.a. in der Presse betrachtet, scheint es leicht, tatsächliche und vermeintliche Lerndefizite von Schülerinnen und Schülern aller Altersstufen und Schulformen zu beheben: „Durch Motivation und Leistungswillen zum Erfolg“.
Page 6
Dies und mehr versprechen Nachhilfeeinrichtungen (Rudolph, 2002). Zudem ist auffällig, dass Nachhilfe zwar ein großes Thema der Bildungswirklichkeit ist, jedoch kaum darüber gesprochen - eher schamhaft geschwiegen wird - wogegen es endlose Kontroversen und Debatten um Schulformen und Lehrpläne gibt.
Dr. Margitta Rudolph geht in ihrem Buch „Nachhilfe - gekaufte Bildung? Empirische Untersuchung zur Kritik der außerschulischen Lernbegleitung“ unter anderem der Grundüberlegung nach, welche Faktoren und Ursachen dazu geführt haben, warum sich seit 1974 in unserer öffentlichen Schullandschaft außerschulische institutionelle Förderanbieter an dieser Größenordnung etablieren können.
In dieser Untersuchung soll herausgefunden werden, in welchen Jahrgängen und in welchen Fächern Nachhilfe eigentlich aktuell ist - inklusive einer Häufigkeitsverteilung an den unterschiedlichen Schulstufen, wieviel Geld im Schnitt dafür ausgegeben wird, weswegen Eltern ihre Kinder zur Nachhilfe schicken und ob sich bereits Erfolge gezeigt haben. Zudem soll auch auf die Qualifikation der Lehrkräfte eingegangen werden. Weiterhin wird erforscht, ob Eltern finden, dass die Kinder durch den Nachhilfeunterricht belastet werden und mit welchem Grund, in Hinsicht auf die Zukunft des Kindes, Eltern den Nachhilfeunterricht bezahlen, den sich viele eigentlich nicht leisten können. Am Ende der Forschung soll noch genauer auf die Problematik der Schule und die Meinungen der Befragten hierzu eingegangen werden.