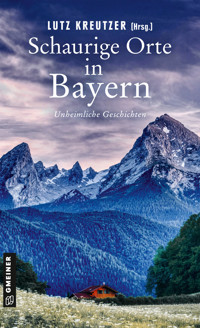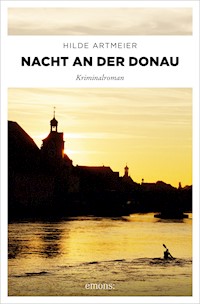
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei Morde geschehen, ein Mädchen verschwindet - treibt in der verträumten Donaumetropole Regensburg ein Serientäter sein Unwesen? Ex-Polizistin und Privatdetektivin Anna di Santosa erhält von einer ebenso schönen wie undurchsichtigen Frau den Auftrag, den Fall zu untersuchen. Doch als sie sich auf Spurensuche begibt, gerät sie in einen Strudel aus verwirrenden Lügen - und ins Visier eines unberechenbaren Killers . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hilde Artmeier wurde 1964 in Oberbayern geboren. Nach einem Studium der Biologie an der Universität Regensburg und einer Ausbildung zur Fremdsprachlichen Wirtschaftskorrespondentin folgten berufliche Stationen in der Pharmaindustrie, im weltweiten Export und als Übersetzerin wissenschaftlicher Fachtexte. Seit dreißig Jahren lebt die Mutter von zwei Kindern in und um Regensburg und arbeitet heute wieder im fremdsprachlich-kaufmännischen Bereich und seit 2000 als freie Schriftstellerin. Hilde Artmeier schuf die erste Regensburger Krimireihe, die in der Presse große Beachtung fand. Nach ihrem Debütroman »Drachenfrau« (Gmeiner, 2004) erschienen mehrere Kurzgeschichten und fünf Kriminalromane, zuletzt »Die Tote im Regen« (Piper, 2010), der erste Band ihrer Reihe um die italienischstämmige Privatermittlerin und Expolizistin Anna di Santosa. Nähere Informationen unter www.hildegunde-artmeier.de.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen, Personen und manche Örtlichkeiten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: © mauritius images/imageBROKER/Bahnmueller Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-580-8 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de Dieser Roman wurde vermittelt durch die Buchplanung Dirk R. Meynecke, Clenze, sowie die Dörnersche Verlagsgesellschaft mbH, Reinbek.
Für Sebastian
PROLOG
Freitag, 5.Juni, 21.34Uhr
Ich will nicht sterben.
Ich habe noch nicht genug gelebt.
Vincenzo. Er braucht doch seine Mutter.
Und Maximilian. Auch er braucht mich …
Dort in der Ecke. Dieser leblose Körper.
Überall das viele Blut.
Wer hilft uns?
Wer nur?
Die scharfe Klinge kommt näher.
Sie zittert kein bisschen.
Nur diese irren Augen über mir flackern.
Aber sie kennen kein Erbarmen.
Sekunden, Minuten, Stunden. Tage und Nächte – alles zuckt durch meinen Kopf.
1
Sonntag, 31.Mai, 21.22Uhr
»Heute wieder mal die Einfahrt fremder Leute zugeparkt?«, fragte ich die junge Frau über die Schulter an jenem ungewöhnlich warmen Sonntagabend Ende Mai und trabte zügig an ihr vorbei.
Mein Ton war angriffslustiger als beabsichtigt. Wenn ich gewusst hätte, dass die flachsblonde, viel zu dünne Frau kaum eine Stunde später tot sein würde und meine Hände rot von ihrem Blut gefärbt sein sollten, wäre ich versöhnlicher gewesen.
Ihren energischen Schritten und dem stur nach vorn gerichteten Blick nach zu urteilen, hatte die Frau, die als Anwältin in der Kanzlei neben meinem Haus arbeitete, achtlos an mir vorbeistöckeln wollen. Jetzt aber konnte sie nicht mehr so tun, als hätte sie mich nicht bemerkt. Abrupt blieb sie stehen und wandte sich um. Auch ich hielt inne.
»Tut mir leid«, sagte sie unerwartet zerknirscht. »Ich hatte es wirklich eilig letzten Freitag. Ein dringender Termin im Amtsgericht. Eigentlich wollte ich den Wagen noch wegfahren, damit er nicht Ihre Einfahrt blockiert. Aber dann war es so hektisch, und ich habe es einfach vergessen.«
Ihr Termin hatte vier Stunden gedauert. Anfangs hatte ich in Einklang mit meinem toskanischen Erbe erst einmal gewartet – was machte eine Viertelstunde hin oder her schließlich aus? Zwanzig Minuten und eine Kanne Tee später war aber auch mir der Geduldsfaden gerissen. Vier große Kartons, randvoll mit neuer Kommissionsware, warteten darauf, in meine Boutique befördert zu werden – und zwar bevor der umsatzstarke Freitag vorbei war. Also hatte ich in der Kanzlei Sturm geläutet. Eine gelangweilte Sekretärin hatte mir die kalte Schulter gezeigt.
»Sie hätten Ihrer unverschämten Kollegin den Schlüssel dalassen können«, entgegnete ich. »Dann hätte ich mir den Anruf beim Abschleppdienst gespart.«
»Und ich mir hundertfünfzig Euro.«
Ich hob die Augenbrauen und musterte die junge Anwältin kühl. Sie wich meinem Blick aus, schien aber immerhin zu begreifen, dass ihre Bemerkung unangebracht war. Schließlich war es nicht das erste Mal gewesen, dass ihr silberfischchenfarbener Golf die Zufahrt zu meiner Einfahrt versperrte.
»Kommt nicht wieder vor«, versprach sie und nickte betreten. Dann sah sie mich mit ihren großen schokoladenfarbenen Augen an, mit einem Mal ohne Scheu und entwaffnend offen.
Wir standen in der Prebrunnallee gegenüber dem Regensburger Herzogspark, unter dicht belaubten Bäumen und nur wenige Meter entfernt von meinem Haus. Seit es so warm geworden war, nutzte ich jeden Abend, um mich sportlich wieder fit zu machen. Die Sonne war schon seit geraumer Zeit untergegangen und der Himmel voller Abendrot. Die Luft roch nach Jasmin, verblühtem Flieder und einer lauen Frühsommernacht.
»Bin im Moment etwas neben der Spur – hab an jeder Front nur Stress«, erklärte mein Gegenüber mit gepresst klingender Stimme.
Sie war so konzentriert auf unser Gespräch, dass sie kaum bemerkte, wie ein plötzlicher lauer Windstoß ihren perfekt geschnittenen Bob durcheinanderbrachte. Ich hob den Kopf. Zwischen dem dichten Blätterwerk sah ich Wolken aufziehen.
»Stress mit meinem Freund, das heißt Exfreund, und im Job auch«, fuhr sie fort. »Meine Probezeit ist bald zu Ende, und ich weiß immer noch nicht, ob ich übernommen werde. Da will man natürlich alles zweihundertprozentig erledigen. Sogar wenn so ein komischer Klient am Sonntagabend anruft, wie heute. Ein Spezi vom Chef. Morgen fliegt er in die USA, deshalb diese unmögliche Uhrzeit.«
Mit einem Mal tat sie mir leid. Ich wollte etwas sagen, aber da fuhr sie schon mit leicht verstellter Stimme fort: »Geduld, meine liebe Frau Maikammer, Sie erfahren es früh genug. Das ist alles, was mein Chef dazu sagt. Meine liebe Frau Maikammer – dass ich nicht lache.« Sie biss sich auf die Unterlippe, kratzte sich an der zu groß geratenen Nase. »Aber, das ist natürlich nicht Ihr Problem. In Zukunft parke ich den Wagen jedenfalls nicht mehr vor Ihrer Einfahrt. Fest versprochen.«
Unentwegt trat sie von einem Fuß auf den anderen. Auf ihren zehn Zentimeter hohen Stöckelschuhen mit aufgenähter Rosette und in ihrem akkurat gebügelten anthrazitgrauen Kostüm, die Aktentasche verkrampft unter den Arm geklemmt, wirkte sie mit ihren siebenundzwanzig, achtundzwanzig Jahren mit einem Mal erschreckend verletzlich. Wie eine Seiltänzerin, jung und unerfahren, die im frisch gestärkten Tutu und voller Erwartung über ein fast unsichtbares Seil balancierte, der Abgrund darunter beängstigend tief. Nur ein falscher Schritt, und schon war alles vorbei.
»Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie bald eine gute Nachricht von Ihrem Chef bekommen.« Ich versuchte, so aufmunternd wie möglich zu klingen, und streckte ihr lächelnd die Hand entgegen. »Ich heiße übrigens Anna.«
Überrascht ergriff sie meine Rechte. Ihr Händedruck war kurz und fest. »Freut mich. Britt Maikammer.«
»Also, dann – schönen Abend, Britt.« Ich zwinkerte ihr zu. »Und viel Erfolg mit Ihrem komischen Klienten.«
Ich wandte mich um und lief weiter in Richtung Donau.
»Danke schön!«, hörte ich sie mir nachrufen.
Im Laufen drehte ich mich um und sah, wie sie mir zulachte, mit einem Mal ganz unbeschwert. Dann verschwand sie hinter der schweren Eichentür, die in die Kanzlei führte.
Das war das letzte Mal, dass ich sie lebend sah.
Eine gute Stunde, zwanzig Minuten länger als sonst, lief ich am Donauufer entlang, vorbei am denkmalgeschützten Salzstadel, einem Lagerhaus aus dem 17.Jahrhundert, über die achthundert Jahre alte Steinerne Brücke, die noch immer renoviert wurde, hinunter in die Badstraße auf der Wöhrdinsel und weiter über den Eisernen Steg mit seinen unzähligen Liebesschlössern am Geländer.
Überall traf ich auf Spaziergänger, mit und ohne Hund, gut gelaunte Jugendliche auf dem Weg zum Donauufer, eine Bierflasche oder Cola-Dose in der Hand, schick zurechtgemachte Frauen und Männer, die auf dem Bismarckplatz den schwülwarmen Abend genießen und anderen Flanierenden nachsehen würden, so wie sie ihrerseits begutachtet wurden. Sehen und gesehen werden – das gleiche Motto wie in Italien, meiner alten Heimat.
Als ich in die abseits gelegene Lederergasse einbog, war es schon lang dunkel und ein Gewitter im Anmarsch. Bereits auf meinem Weg zur Steinernen Brücke waren die Wolken immer dichter geworden, irgendwann verschluckten sie den letzten Rest Dämmerung, auch der Wind wurde von Minute zu Minute stärker. Aber jetzt hatte ich es zum Glück nicht mehr weit.
Beim Naturkundemuseum und im dahinterliegenden Renaissancegarten war es um diese Uhrzeit wie immer ruhig und in der Prebrunnallee, an deren Ende sich mein Haus befand, gewohnt menschenleer. Bis auf den Verkehrslärm in der Ferne und meinen eigenen, inzwischen etwas aus dem Takt geratenen Atem hörte ich nur eine einzige unbeirrbare Amsel, die noch immer sang. Der Herzogspark zu meiner Rechten, der sich an den Renaissancegarten anschloss, lag dunkel und verlassen da. Inzwischen war es nach halb elf, und der idyllisch angelegte Park mit seinen teils einheimischen, teils exotischen Baumriesen hatte schon lang seine Pforten geschlossen.
Ich hatte nur noch wenige Meter bis nach Hause. Im ersten Stock, in Vincenzos Zimmer, brannte Licht, offenbar hatte er seine Hausaufgaben wieder einmal bis zur letzten Sekunde aufgeschoben. Auch in der Küche hatte ich die Lampe angelassen. Die Laubkronen der Ahornbäume waren aber so dicht, dass sowohl der Lichtschein aus meinem Zuhause als auch der der einzigen Laterne hier in der Allee nicht bis zu mir drangen. Ich freute mich auf ein großes Glas Wasser und eine kalte Dusche und spürte den ersten Regentropfen.
Das Bürogebäude, in dem sich die Anwaltskanzlei befand, ragte schwarz und düster in den Nachthimmel. Also ist auch Britt endlich auf dem Weg in den verdienten Feierabend, dachte ich noch, als mein Fuß plötzlich gegen etwas Weiches stieß. Eine Katze, war mein erster Gedanke.
Ich versuchte, etwas in der Dunkelheit zu erkennen. Neben mir parkte ein Lieferwagen, der zusätzlich die Sicht auf den Gehweg versperrte. Nur auf die Motorhaube und den Grünstreifen zwischen Gehweg und Straße fiel ein schwacher Lichtschein. Auf dem Grünstreifen lag etwas. Ein Frauenschuh mit hohem Absatz und etwas Rundem auf der Spitze – eine aufgenähte Rosette.
Ich bückte mich, tastete nach dem Hindernis. Ein Körper. Reglos und schwer lag er auf dem Boden. Im Schatten des Lieferwagens und der Bäume sah ich kaum etwas, aber doch so viel, dass ich im nächsten Moment die groben Umrisse eines Menschen erkennen konnte.
»Können Sie mich hören?«, fragte ich. »Haben Sie sich verletzt?«
Keine Reaktion.
Ich tastete weiter. Der Kopf lag mit dem Gesicht nach unten, verborgen unter seidigem Haar, das Einzige, was mir in der Dunkelheit hell entgegenschimmerte. Die Arme waren unter dem Gewicht des schlaffen Körpers begraben, die Beine seitlich verkrümmt. Ich fühlte verklebten Stoff, an manchen Stellen offenbar feucht, vor allem im oberen Brustbereich. Ein süßlicher, Übelkeit erregender Geruch stieg mir in die Nase. Mit einem Mal wurde mir bewusst, dass ich in einer schwarzen, ebenfalls klebrigen Lache kniete.
Wieder ein Regentropfen.
Jemand stöhnte.
Das musste ich gewesen sein.
Ich versuchte festzustellen, ob Britt – inzwischen war ich sicher, dass dieses reglose Bündel vor mir Britt war – noch atmete, konnte aber weder etwas fühlen noch hören. Ich fasste nach ihrem Hals.
Kein Puls.
Ihr Körper war noch warm.
Plötzlich ein leises Geräusch schräg hinter mir.
Ich fuhr in die Höhe, lauschte, nur einen Wimpernschlag lang, sprang sofort zur Seite, duckte mich hinter den Lieferwagen.
Wieder dieses feine, schnelle Geräusch, das ich nicht einordnen konnte.
Ob er noch da war?
Britts Mörder?
Ich atmete flach und so leise wie möglich, während ich meinte, mein Atem, stampfend und dröhnend, wäre noch in zehn Metern Entfernung zu hören.
Nichts geschah.
Nur in der Ferne das eine oder andere vorbeifahrende Auto, Musikfetzen wehten von irgendwoher in die schwarze Allee, vereinzelt klopften Regentropfen auf die Motorhaube des Lieferwagens, Donner grollte.
Dann hörte ich es erneut.
Und jetzt erst verstand ich, was es war: das leise Trippeln winziger Füße, die in Windeseile über den Asphalt sausten, zum Stillstand kamen, unter den Bäumen verschwanden.
Eine Ratte.
Vielleicht auch ein Eichhörnchen.
Laut atmete ich aus. Mein Herz hämmerte gegen den Brustkorb. Dann zog ich das Handy aus der Tasche der Laufhose und tippte mit Blut an den Händen die Notrufnummer ein.
2
Sonntag, 31.Mai, 23.57Uhr
»Du hast also noch mit ihr gesprochen?«, fragte mich Paolo mehr als eine Stunde später halb ungläubig, halb irritiert und schickte den auf eine Anweisung wartenden Streifenpolizisten mit wenigen, aber präzisen Worten nach draußen.
Paolo hieß eigentlich Paul Wolf, war Kriminalhauptkommissar bei der Kripo Regensburg und im Moment alles andere als erfreut, ausgerechnet seine geschiedene Frau als Zeugin in einem Mordfall vernehmen zu müssen. Das Trillern seines Handys hatte ihn aus einer feuchtfröhlichen Geburtstagsfeier gerissen, wie er mir vor wenigen Minuten mürrisch erklärt hatte. Lilo, seine Lebensgefährtin, war nicht begeistert gewesen, den restlichen Abend ohne ihn verbringen zu müssen.
Dass Britt Maikammer einem gewaltsamen Tod zum Opfer gefallen war, hatte schon die kurze Untersuchung des Notarztes ergeben. Dem ersten Anschein nach ein einziger gezielter Schnitt durch die Kehle. Sie war sofort tot gewesen, so die Einschätzung des Arztes, ein Hüne Ende vierzig, mit grotesk abstehenden Ohren und traurigen Hundeaugen.
Zumindest hat sie nicht leiden müssen, dachte ich immer wieder, wie ein lautloses Gebet wiederholte ich stumm diese Worte. Ich sah sie vor mir, wie sie mir zum Abschied zugelacht hatte: eine junge Frau, voller Zweifel und Hoffnung, das Leben lag noch vor ihr. Und von einer Sekunde auf die andere war nichts mehr übrig von diesem zu kurzen Leben. Außer einem verrenkten Bündel aus Armen und Beinen, besudelt mit dem eigenen Blut, weggeworfen wie ein Sack Müll.
Benommen nippte ich an meinem Tee. Die Tasse aus dünnwandigem Porzellan war übersät mit lilafarbenen Blümchen. Das heiße Getränk wärmte mich. Denn trotz der noch immer lauen Nacht war mir eiskalt. Wieder grollte der Donner, inzwischen ganz nah, Wetterleuchten kündigte schon seit einiger Zeit das Gewitter an. Aber mehr als ein paar Tropfen Regen hatte es bisher nicht gegeben.
Mein Exmann und ich saßen in der Küche meiner Jugendstilvilla, die ich wie das Porzellan und die Möbel von meiner italienischen Großmutter geerbt hatte. Vincenzo, unser gemeinsamer zwölfjähriger Sohn, rumorte im ersten Stockwerk. Er fand alles, was sich draußen abspielte, mega aufregend, und an Schlaf war natürlich nicht zu denken. Das Aufgebot an Einsatzfahrzeugen, Notarzt- und Rettungswagen hielt ihn wach, ständig flammte irgendwo Scheinwerferlicht auf, ein unaufhörliches Kommen und Gehen und von den Polizeikameras ein ständiges Blitzlichtgewitter. Unser Sprössling war so oft an der Küchentür vorbeigelaufen, jedes Mal auf dem Weg zu einem anderen Fenster mit womöglich noch besserem Blick und in der Hoffnung, von unserem Gespräch so viel wie möglich aufzuschnappen, dass wir ihn schließlich genervt nach oben verbannt hatten.
»Was hat die Maikammer gesagt?«, hakte Paolo wieder nach, als ich nach mehreren Schlucken Tee noch immer keine Antwort gegeben hatte.
»Sie hat sich bei mir entschuldigt«, antwortete ich schließlich und erzählte ihm von der lästigen Angewohnheit der jungen Anwältin, immer wieder vor meiner Einfahrt zu parken, gleichgültig, wie lang ihre Auswärtstermine dauerten. Und dass ich vergangenen Freitag schließlich die Geduld verloren und den Abschleppdienst angerufen hatte.
»Sie hatte heute Abend noch einen Termin«, fiel mir plötzlich ein. Kerzengerade richtete ich mich auf. »Mit einem Klienten.«
»Sonntagabend?«
»Ja, komisch, nicht? Das hat sie auch selbst so formuliert, aber er war offenbar ein Freund von ihrem Chef.« Ich versuchte, mich an den genauen Wortlaut von Britt Maikammers Erklärung zu erinnern. »Der Klient muss sie kurz zuvor angerufen haben. Morgen fliegt er in die USA, hat sie gesagt, deshalb hat er auf den späten Termin bestanden.«
»Wann genau hast du sie getroffen?«
»Kurz vor halb zehn.«
»Weißt du den Namen des Klienten?«
»Madonna, chi è la polizia – tu oppure io?« Ich verdrehte die Augen. »Du bist doch der Bulle. Streng dich an und find es raus, Signor Commissario.«
Er schnaubte, machte sich aber gehorsam eine Notiz.
»Sie hatte eine Aktentasche dabei.« Gedankenverloren wickelte ich mir eine meiner langen tizianroten Haarsträhnen um den Zeigefinger. »Vielleicht ist da was drin, was Aufschluss über diesen Klienten geben könnte.«
»Die haben wir gefunden, neben der Leiche. Netbook, Handy, Papiere, Geldbeutel, Notizblock, war alles da. Die Auswertung der Geräte und Unterlagen wird ein wenig dauern.« Wieder schrieb er etwas auf seinen Block. »Vielleicht weiß ja ihr Chef, wer sie angerufen und in die Kanzlei bestellt hat. Sonst noch was?«
»Sie hatte Stress mit ihrem Freund. Nein, Exfreund, hat sie gesagt.«
»Name?«
Ich stöhnte nur und sparte mir meinen Kommentar.
»Hast du was gehört, bevor du in die Allee gebogen bist?« Paolo fuhr sich durch die kurzen schwarzen Haare und musterte mich mit seinen fast ebenso dunklen Augen angespannt. Mit seiner sommers wie winters gebräunten Haut sah er im Gegensatz zu mir wie ein waschechter Italiener aus. »Schreie, Stimmen, Geräusche? Oder irgendwas beobachtet?«
Ich überlegte, versuchte, mich an jedes Detail der wenigen Momente zu erinnern, während ich ahnungslos in Richtung der Toten gejoggt war. War mir nicht in einer der Gassen vor dem Naturkundemuseum jemand begegnet? Dann aber schüttelte ich entschieden den Kopf.
Es stand zwar noch nicht eindeutig fest, ob der Fundort der Leiche auch der Tatort war, so wusste ich von Paolo. Erst die Arbeit der Spurensicherung und die gerichtsmedizinischen Untersuchungen würden diese Frage endgültig klären. Doch allein die Unmengen an Blut, in denen Britt gelegen hatte, legten diesen Schluss nahe.
»War was im Geldbeutel?«, fragte ich.
»An die zweihundert Euro.«
»Also kein Raubmord.«
»Bisher scheint auch kein sexuelles Motiv vorzuliegen. Zumindest, wenn man vom Zustand ihrer Kleidung ausgeht. Genaues wissen wir natürlich erst nach der Obduktion.«
Von draußen hörte man Männer rufen, und nun klatschten doch immer mehr Regentropfen auf das Fensterbrett. Im Moment untersuchten Spezialisten der Spurensicherung jeden Millimeter der Toten und des Fundorts fieberhaft nach möglichen Indizien. Man hatte bereits zwei Zelte aufgebaut. Aber sobald das Gewitter richtig losbrach, würde der Regen dennoch Spuren vernichten. Ansonsten herrschte das geordnete Durcheinander aus Sanitätern, Streifenpolizisten und Paolos sonstigen Kollegen, das ich aus meiner Zeit als Schutzpolizistin noch gut kannte. Auch heute Abend waren es sicher die Schaulustigen, angelockt durch das Aufgebot an Einsatzfahrzeugen, die für mehr Wirbel sorgten als alle anderen. Manche der Sensationslustigen wollten sich nichts entgehen lassen. Sie würden versuchen, den in weißen Overalls steckenden Beamten vom Erkennungsdienst auf die Finger zu schauen, wie sie Blutspuren und unsichtbares Beweismaterial in kleine Plastiktüten verpackten.
»Es muss doch irgendwem etwas aufgefallen sein«, überlegte ich. »Hast du Leute rausgeschickt, die mit den Anwohnern in den umliegenden Straßen reden?«
An Paolos rechter Schläfe zuckte ein Muskel. Mein Ex hatte es noch nie leiden können, wenn ich ihm sagte, wie er seine Arbeit zu erledigen hatte.
»Weißt du schon was über die Tatwaffe?«
Dieses Mal reagierte Paolo nicht gereizt, sondern seufzte kaum hörbar. »Dem ersten Anschein nach könnte es sich um dasselbe Messer handeln wie bei der Toten am Dom. Ihr hat man übrigens auch die Kehle durchgeschnitten.«
Wortlos sahen wir uns an.
Natürlich hatte auch ich von Anfang an daran gedacht, schon als ich Britts Leiche fand, und ich wusste genau, was jetzt durch Paolos Kopf geisterte: Zweite Frauenleiche gefunden – Serienmörder in der Domstadt? Diese oder eine ähnliche Schlagzeile würde spätestens übermorgen das Titelblatt der Mittelbayerischen Zeitung zieren und meinem Ex das Leben schwer machen. Was in einer solchen Situation zählte, waren Ergebnisse. Und zwar sofortige und vor allem solche, die sowohl die aufgebrachte Bevölkerung als auch die Staatsanwaltschaft beruhigten.
Am vergangenen Wochenende hatte ein Angestellter der Dombauhütte im Domgarten, einer kleinen Gasse zwischen dem weltberühmten Dom St.Peter und der Dombauhütte, eine Regensburger Geschäftsfrau gefunden, mit einem Messer getötet. Mitten am helllichten Tag war der Mann, der an diesem Samstagnachmittag am Arbeitsplatz sein vergessenes Handy holen wollte, buchstäblich über die beim Tor liegende Leiche gestolpert. Sie musste unmittelbar vor dem Eintreffen des Arbeiters an Ort und Stelle ermordet worden sein. Die auch tagsüber erstaunlich ruhige Gasse – obwohl sie eine zentrale Lage hatte, war sie doch sehr versteckt gelegen – war zu diesem Zeitpunkt menschenleer. Ich kannte die Gegend gut. Florian, Vincenzos bester Freund, wohnte nur wenige Ecken weiter in der Lindnergasse im obersten Stock eines alten Patrizierhauses mit direktem Blick auf Donau und Steinerne Brücke.
Trotz unermüdlicher Ermittlungsarbeit und vermutlich schon jetzt unzähliger Überstunden der Soko-Mitglieder gab es noch immer keinen Hinweis auf den Täter. Keiner der wenigen Anwohner im Domgarten hatte etwas gehört oder beobachtet. Auch die bisherigen Ermittlungen im persönlichen und beruflichen Umfeld der Geschäftsfrau hatten keinen Anhaltspunkt auf den Täter geliefert, wie ich aus der Zeitung wusste.
»Gibt es sonst irgendwelche Gemeinsamkeiten bei den beiden Opfern?«, fragte ich meinen Ex.
»Im Gegenteil. Die Anwältin war noch nicht mal dreißig, das erste Opfer Anfang fünfzig. Auch vom Aussehen her sind sie völlig verschieden, die eine spindeldürr und blond, die andere eher mollig und schwarzhaarig.« Paolo massierte sich die Schläfen und betrachtete mich hoffnungsvoll. »Vielleicht stellt sich bei der Obduktion raus, dass es sich doch um verschiedene Tatwaffen handelt, und die beiden Fälle haben gar nichts miteinander zu tun.«
»Du denkst an einen Trittbrettfahrer? In der Zeitung hat aber doch nichts darüber gestanden, wie die Tote beim Dom ermordet worden ist.«
Mein Ex nickte. »Trotzdem kann immer was durchsickern.«
»Oder der Täter hatte, falls es doch derselbe sein sollte, eine persönliche Beziehung zu seinen Opfern.«
Wieder sah ich das lachende Gesicht der jungen Anwältin vor mir. Noch keine drei Stunden war es her, dass sie die Kanzlei nebenan betreten hatte. Ich trank einen Schluck. Mit einem Mal schmeckte der Tee schal. Und obwohl mir vor wenigen Minuten noch kalt gewesen war, raubte die schwüle Hitze, die in der Küche hing, mir jetzt fast den Atem. Aber es war nicht die Hitze. Ich hatte noch immer damit zu kämpfen, dass ausgerechnet ich Britts Leiche gefunden hatte. Dass die junge Frau plötzlich tot war.
Ermordet.
Direkt vor meinem Haus.
Ich schob die Tasse zur Seite, stand auf, öffnete die Tür zur Veranda noch weiter. Inzwischen hatte sich der leichte Wind in stoßartige Böen verwandelt, doch sie kühlten kaum. Es donnerte, dieses Mal noch näher. Der Regen wurde stärker.
Ich ging zur Spüle, drehte den Wasserhahn auf, klatschte mir Wasser auf Stirn und Hals. Und auch wenn an meinen Händen schon lang keine Blutspuren mehr festzustellen waren, seifte ich sie wieder gründlich ein und hielt sie ausgiebig unter den kalten Strahl. Dann öffnete ich den Kühlschrank, holte eine Flasche gut gekühlten italienischen Weißwein heraus und goss mir ein Glas ein.
»Willst du auch?«, fragte ich. Dabei wusste ich genau, dass Paolo ablehnen würde. Schließlich war er im Dienst.
Plötzlich stand Vincenzo in der Tür.
»Super, dass morgen Montag ist«, verkündete er gut gelaunt und fuhr sich durch die borstigen schwarzen Haare, die er wie die zu jeder Jahreszeit gebräunte Haut von seinem Vater geerbt hatte. Normalerweise verabscheute unser Sohn Montage aus tiefster Seele.
»Der Florian wird Augen machen, wenn er hört, was bei uns heut los ist«, fuhr er aufgekratzt fort, zog das Smartphone aus der Tasche und fing sofort an, wie wild darauf herumzutippen.
»Untersteh dich!«, wies ich ihn sofort zurecht. »Heute Abend hast du Handyverbot.«
Ich wusste genau, was er sonst seinem Busenfreund noch heute Abend über WhatsApp oder Facebook mitteilen würde. Und noch etlichen anderen sogenannten Freunden, die wiederum ihrerseits alle nahen und fernen Facebook-Bekanntschaften über sein aufregendes Erlebnis informieren würden.
Paolos Handy trillerte. Mit einem Seitenblick auf unseren Sprössling verließ er die Küche und nahm das Gespräch im Flur an. Wir hörten ihn leise Anweisungen in das Gerät murmeln. Wenige Sekunden später, während deren Vincenzos Ohren länger und länger zu werden schienen, steckte er den Kopf zur Tür herein.
»Ich muss raus, die brauchen mich, gleich geht das Gewitter los. Deine Aussage hat Zeit bis morgen. Am besten, du kommst am Vormittag ins Büro«, sagte er in meine Richtung und klang plötzlich besorgt. »Soll ich nicht doch einen von den Sanis reinschicken, Prinzessin?«
Vermutlich würde sich mein Ex dieses Kosewort nie abgewöhnen. Ich entstamme einer alten toskanischen Adelsfamilie und darf mich zwar eine Contessa nennen, keinesfalls aber eine Principessa. Schon immer hatte Paolo mich mit dieser liebevollen Übertreibung genervt, irgendwann hatte ich sie stillschweigend akzeptiert. Alles vergeht, aber Paolos Angewohnheiten bleiben, dachte ich dankbar, während ich gleichzeitig den Kopf schüttelte. Dann trank ich einen großen Schluck Weißwein. Ich hatte ihn bitter nötig. Ich stand noch immer unter Schock.
»Und du«, Paolos Blick heftete sich auf Vincenzo, der unschlüssig auf sein Handy starrte, »hast ja gehört, was deine Mutter gesagt hat. Schließlich ist das eine ultrageheime Polizeiermittlung. Ich zähle auf dich. Kein Wort zu niemandem, verstanden?«
Unser Sohn nickte verschwörerisch. Paolo klopfte ihm auf die Schulter und verschwand.
Ich setzte mich wieder, stellte das Glas vor mich auf den Tisch und überlegte, ob ich Maximilian anrufen sollte, meinen Geliebten. Gegen acht hatten wir kurz miteinander telefoniert, er war auf dem Weg zu einem Abendessen mit Kollegen gewesen. Im Moment aber war ich zu aufgewühlt. Ich würde ihm später eine SMS schreiben.
Zu Vincenzos Überraschung schickte ich ihn nicht ins Bett. Keiner von uns hätte jetzt Schlaf gefunden, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Es donnerte schon wieder. Der Regen platschte nun auch auf die Verandafliesen vor der geöffneten Tür, irgendwo zuckte ein Blitz, dann krachte es direkt über uns.
Mein Sohn quetschte sich neben mich auf die Eckbank und griff nach meiner Hand.
»Alles wird gut, Mama«, sagte er sanft. »Morgen geht’s dir viel besser.«
Einmal, als Vincenzo vom Baum gefallen war, und ein anderes Mal, als er sich beim Spielen böse das Knie aufgeschlagen hatte, waren neben einer zärtlichen Umarmung genau diese Worte das Einzige gewesen, was ihn trösten konnte.
Com’è cresciuto, il mio piccolino, dachte ich und drückte seine Hand. Wie groß mein Kleiner doch geworden war.
3
Montag, 1.Juni, 7.02Uhr
Am nächsten Morgen kam Vincenzo nicht aus den Federn. Ich musste ihn vier Mal wecken. Während er im Bad lärmte, brühte ich Tee auf, den schweren Assam, den ich so liebte, und richtete das Pausenbrot für ihn. Nicht einmal für ein Glas Saft hatte er Zeit, bevor er zur Bushaltestelle rannte.
Ich folgte ihm nach draußen und sah ihm nach, vom Jugendstilportal meiner Villa aus, das mich immer wieder an einen Pariser Metro-Eingang erinnerte. Seine Jeans hingen fast in den Kniekehlen, während er an den weißen Zelten vorbeischoss, die den Fundort der Leiche markierten. Fast die ganze Nacht über waren Beamte im Einsatz gewesen, teilweise in strömendem Regen und tosenden Windböen. Wie befürchtet hatten die Zelte die Wassermassen kaum abhalten können, und inzwischen waren alle Spuren, die man nicht vor Beginn des Gewitters gesichert hatte, schon lang weggespült.
Wieder war ein sonnenheller Frühsommermorgen, der kaum noch ahnen ließ, dass hier in der vergangenen Nacht ein so heftiger Sturm wie seit Langem nicht mehr gewütet hatte. Nur noch in den Baumkronen hing ein wenig Feuchtigkeit, und trotz der zunehmenden Hitze roch es noch immer wie frisch gewaschen. Ein Trupp Spatzen lärmte aufgeregt vor den Rosenbüschen, die den Kiesweg vom Portal bis zum Gartentor säumten.
Ich sperrte den verschnörkelten schmiedeeisernen Briefkasten auf, ein Originalimport aus Florenz, der an einer Säule neben der Eingangstür hing. Die Zeitung fiel mir entgegen. An diesem Morgen würde es noch keinen Artikel zu den Vorkommnissen vom vergangenen Abend geben. Dennoch überflog ich die Schlagzeilen. Die Bewohner in Norditalien litten unter starken Regenfällen, in Griechenland zeigten die anhaltenden Sparmaßnahmen noch immer nicht die gewünschten Erfolge, die Enttäuschung der Regensburger über den Abstieg des SV Jahn und der damit verbundene Ärger in der Chefriege waren der Hoffnung gewichen, bald wieder in die Zweite Bundesliga aufzusteigen. Im Lokalteil, weit nach hinten abgerutscht, schließlich eine Reihe von Spekulationen über den sogenannten Dom-Mörder und zu seinem Motiv, manche davon geradezu haarsträubend. Wollte der Täter mit der direkten Nähe zu Regensburgs größtem Gotteshaus etwa ein blasphemisches Zeichen setzen und dem Bischof oder der Stadt selbst, deren Geschichte seit Jahrhunderten untrennbar mit dieser gotischen Kathedrale verwoben war, einen Dolchstoß versetzen?
Eine Frage stellte sich allerdings nicht nur der phantasiebegabte Redakteur, sondern auch ich mir: Wie kaltblütig musste man sein, um an einem Samstagnachmittag mitten in der Altstadt eine solche Tat zu begehen, während in einer Entfernung von nur wenigen Metern Busladungen von Touristen und Trauben von Einkaufsbummlern vorbeiströmten?
Ich blätterte weiter. Wann wohl die Reporter meine Adresse herausfinden und mich belagern würden – die bisher einzige Zeugin einer weiteren Schreckenstat, die vielleicht auf das Konto desselben Täters ging?
Ich hatte eine unruhige Nacht verbracht und kaum geschlafen, aber nicht nur wegen des lang kreisenden Gewitters. Unentwegt rief ich mir den Ablauf des Abends ins Gedächtnis, die wenigen Worte, die ich mit Britt Maikammer gewechselt hatte, die Details am Tatort. War mir auf dem Rückweg, wenige Meter vor dem Naturkundemuseum, nicht doch jemand begegnet?, überlegte ich immer wieder. Ein Mann? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Auch der Gedanke, dass alles anders gekommen wäre, wenn ich an diesem Abend nicht zwanzig Minuten länger als sonst gelaufen wäre, kam mir immer wieder in den Sinn. Hätte ich die junge Anwältin vielleicht retten können? Oder hätte der Täter dann mir aufgelauert, wäre ich sein nächstes Opfer gewesen?
»Sie müssen Melissa finden!«, hörte ich plötzlich eine atemlose Stimme hinter mir.
Zu Tode erschrocken wandte ich mich um. Vor mir stand eine Frau, aufgetaucht wie aus dem Nichts, und trotz der unübersehbaren Beule an der Stirn die vielleicht schönste Frau, der ich je begegnet war. Alabasterfarbene Haut, Schwanenhals, locker über die Schultern fallendes Haar und noch länger als meines, golden funkelte es in der Morgensonne.
»Wer ist Melissa?«, fragte ich und riss mich vom Anblick ihrer vollen roten Lippen los, deren Sinnlichkeit mich verwirrte. »Betreten Sie immer die Privatgrundstücke fremder Leute, ohne zu läuten?«
»Bitte, Sie müssen mir helfen! Sie ist verschwunden, einfach so, ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll …«
Ihre ohnehin schon großen Augen wurden noch größer. Jetzt sah ich, dass auch ihre linke Wange geschwollen und das Kinn aufgeschürft waren.
»Sie sind doch Anna di Santosa, die Privatdetektivin?«
Mit einer heftigen Bewegung fuhr sie sich über die Stirn und die perfekt geschwungenen Augenbrauen in einem dunklen Weizengelb, verkrampfte dann die feingliedrigen Finger fest ineinander, musterte mich angespannt. Sie musste in meinem Alter sein, also Mitte dreißig.
Erst im Winter vor einem halben Jahr hatte ich meinen ersten Auftrag als Privatermittlerin übernommen. Einen sehr persönlichen Auftrag: Jemand hatte versucht, meinen früheren Liebhaber zu töten, der dadurch ins Koma gefallen war. Damals hatte ich mir das Honorar noch selbst bezahlt und keinen Cent dabei verdient. Inzwischen aber hatte sich der Name meiner Detektei herumgesprochen. Seit Kurzem dachte ich sogar darüber nach, eine Aushilfskraft für die Büroarbeiten einzustellen. Von den Honoraren und den monatlichen Einnahmen aus dem BellaDonna, meiner Boutique für hochwertige Second-Hand-Mode und erschwingliche Designermodelle aus Italien, konnten Vincenzo und ich bisher unbeschwert leben. Ein hundert Jahre altes Haus mit an die zwanzig Zimmer zu unterhalten, war allerdings eine besondere Herausforderung. Die Ersparnisse, die mir Nonna Emilia zusammen mit der damals schon renovierungsbedürftigen Villa hinterlassen hatte, würden nicht ewig ausreichen.
Ich nickte, klemmte mir die Zeitung unter den Arm und klappte den Deckel des Briefkastens zu, während ich meinen unerwarteten Besuch weiterhin aufmerksam betrachtete.
»Wie heißen Sie? Und wer ist Melissa?«
»Ach so, ja. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt.« Ihre Mundwinkel zitterten, sie schluckte angestrengt. »Braun, Sara Braun. Meine Tochter ist verschwunden. Melissa. Gestern Abend, da war sie mit ihrer Freundin auf dieser Feier, und eigentlich sollte sie um zehn zu Hause sein. Aber heute Morgen, als ich sie wecken wollte, war sie nicht in ihrem Bett. Und der Roller ist auch weg.«
»Wie alt ist Ihre Tochter?«
»Sechzehn. Vor zwei Wochen hatte sie Geburtstag.«
»Vielleicht ist sie bei ihrer Freundin geblieben?«
»Dann hätte sie mich angerufen, und Chiara hat ja auch gesagt, dass Melissa nicht bei ihr ist und …«
Sie beendete den Satz nicht, sah mich nur an aus ihren riesigen schilfgrünen Augen.
Hilflos.
So unendlich hilflos.
»Am besten, Sie kommen erst mal mit.« Sanft berührte ich ihren Arm, fühlte, wie sie bebte. »Was halten Sie von einer schönen Tasse Tee?«
Ich wartete ihre Antwort nicht ab, sondern schob sie ins Hausinnere. Ihr Parfüm war sehr dezent und duftete nach irgendetwas Blumigem, vielleicht Magnolie.
Nach der Hitze auf der Veranda – schon vor acht Uhr morgens war die Temperatur auf fast fünfundzwanzig Grad gestiegen – empfand ich die Kühle in dem alten Haus als wohltuend. Ich führte meinen unangemeldeten Besuch in die Küche und setzte Teewasser auf. Normalerweise brachte ich potenzielle Klienten direkt in die Bibliothek und kümmerte mich dann um die Bewirtung. Aber ich wollte die verstörte Frau nicht allein lassen.
»Ich hoffe, Sie mögen Schwarztee.« Ich deutete auf die Holzbank mit den bunt gemusterten Polstern aus Lucca, einer Kleinstadt in meiner alten Heimat, in der ich gern Shoppen ging. »Oder lieber original italienischen Espresso?«
Sara Braun setzte sich. »Tee ist okay. Ich habe heute noch gar nichts getrunken.«
Sie sprach mit tiefer Tonlage und einem sehr weichen Akzent. Dem Anschein nach stammte sie aus Österreich, lebte aber schon so lang in Deutschland, dass ihre Herkunft nur noch zu erahnen war. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass sie unruhig am Kragen ihrer hochgeschlossenen, langärmeligen Bluse zupfte, feinstes Crêpe de Chine. Im Gegensatz zu mir, die ich mich heute für ein luftiges Sommerkleid entschlossen hatte, trug sie trotz der Wärme eine lange Hose aus Leinen.
»Brauchen Sie eine Salbe für Ihr Gesicht?«, fragte ich und löffelte die Teeblätter in das Sieb.
»Wie? Nein, nein, halb so wild.« Flüchtig berührte sie ihr aufgeschürftes Kinn. Der feine Parfümduft wehte in meine Richtung. »Ich bin gestolpert und habe mich gestoßen.«
Ich warf ihr einen zweifelnden Blick zu. Die Verletzungen waren nicht so harmlos, wie sie behauptete. Die Beule an der Stirn sah böse aus, und die aufgeschürfte Stelle schien zu nässen.
»Wann ist das passiert?«
»Vergangene Nacht. Als ich nach Hause gekommen bin.« Sie räusperte sich unbehaglich. »Ich war müde und habe nicht aufgepasst auf der Treppe, es war ja schon so spät – unterwegs war ein Stau. Das war auch der Grund, warum ich nicht nach Melissa gesehen habe. Sonst gehe ich nach der Arbeit nämlich immer in ihr Zimmer.«
Sie hustete, verschluckte sich, hustete wieder. Ich holte zwei Tassen und Löffel aus dem Küchenbüffet, dazu die mit bunten Lilien verzierte Zuckerdose, den Wappenblumen der Toskana, und stellte alles auf den Tisch.
»Melissa wollte mit Chiara auf eine Party«, fügte sie mit rauer Stimme hinzu. »In Stadtamhof. Irgendeine Freundin von Chiara hatte Geburtstag.«
Der Kessel summte. Ich nahm ihn vom Herd und goss das Wasser in die Kanne aus ziseliertem Silber. Dann setzte ich mich auf den Polsterstuhl meiner Besucherin gegenüber.
»Ja, und heute Morgen war Melissas Bett leer«, fuhr sie gepresst fort, klang aber nicht mehr so aufgewühlt wie zuvor. »Da habe ich es sofort auf ihrem Handy probiert, ich weiß nicht, wie oft. Aber es war immer aus. Und als ich bei Chiara angerufen habe, wusste die gar nicht, was ich von ihr wollte.« Ihre Finger klopften in einem unruhigen Takt auf die Tischplatte. »Zumindest hat sie so getan. Was für eine Geburtstagsfeier?, meinte sie genervt, und angeblich habe sie keine Ahnung, wo Melissa sein könnte. Dann hat sie aufgelegt.« Der Rhythmus ihres Trommelns wurde schneller, ging über in ein fiebriges Hämmern. »Die beiden sind seit Jahren die besten Freundinnen – sie muss doch wissen, wo meine Tochter steckt!«
Sara Braun sprang auf, so plötzlich, dass sie gegen den Tisch stieß. Die Tischbeine kratzten über den Dielenboden.
»Sie müssen mit Chiara reden! Sie will mir nicht sagen, wo Melissa sich versteckt hat. Bitte, ich muss wissen, wo mein Kind …«
Ein unkontrolliertes Zittern ging durch ihren Körper. Sie hielt sich am Tisch fest.
»Warum sollte Ihre Tochter sich verstecken?« Ich wollte ihr eine Hand auf den Arm legen, doch etwas hielt mich zurück. »Hat sie etwas ausgefressen?«
Sie antwortete nicht, blickte an mir vorbei.
»Hatten Sie Streit?«
Sarah Braun starrte durch die Verandatür nach draußen. Ich war sicher, dass sie weder die sattgrünen Rhododendronbüsche noch das schimmernde Perlmutt der Pfingstrosen sah.
»Natürlich nicht«, sagte sie erst nach einer Weile und fiel schwer zurück auf die Bank.
Der Tee hatte lang genug gezogen. Während ich die Kanne und das Milchkännchen zum Tisch brachte, sagte meine Besucherin kein Wort. Eine fast greifbare Spannung lag in der Luft. Ich goss beide Tassen voll, gab einen Schuss Milch für mich dazu, setzte mich wieder, wartete.
»Mein Gott, die Schule, ja.« Sie holte tief Luft. »Es gibt Probleme. Melissa ist in einem schwierigen Alter. Aber das ist ja in vielen Familien so. Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie, wovon ich rede.«
Ich dachte an Vincenzos Fünf in Mathe und die Mitteilung seiner Lehrerin, dass er einen Verweis bekommen würde, wenn sie ihn wieder beim Rauchen erwischte.
»Noch lang nicht erwachsen, aber auch kein Kind mehr«, sagte ich.
Sara Braun reagierte nicht, fixierte nur ihre Tasse.
»Was für Probleme?«, hakte ich nach.
»Der Druck auf die Kinder ist enorm, das G8 ein absoluter Reinfall – diese ewige Lernerei und viel zu früh die Entscheidung, was mache ich nach dem Abitur.« Ihre Stimme klang so, als hätte sie das alles auswendig gelernt. Mit einer fahrigen Geste fuhr sie sich über die Stirn. »Dabei sind so viele andere Dinge wichtiger, wenn die Hormone verrücktspielen.«
Plötzlich sackte sie in sich zusammen, bedeckte das Gesicht mit beiden Händen, begann lautlos zu weinen. Ihre Schultern zuckten, Tränen strömten zwischen den feingliedrigen Fingern hervor, über ihren langen, schlanken Hals, versickerten in der Bluse. Im ersten Moment wusste ich nicht, ob ich sie trösten oder wieder in Ruhe lassen sollte. Aber dann berührte ich sie doch an der Schulter. Sie ließ es geschehen.
»Bitte«, flüsterte sie kaum hörbar. »Helfen Sie mir.«
»Und Melissas Vater?«, fragte ich leise. »Was sagt er dazu, dass sie verschwunden ist?«
Sofort straffte sie den Rücken, saß kerzengerade da.
»Der ist schon lang weg.« Mit einer wütenden Bewegung wischte sie die Tränen fort. »Damals war Melissa noch ganz klein. Wir haben keinerlei Kontakt zu ihm.«
Ich trank einen Schluck Tee. Auch ich war alleinerziehend. Mit dem Unterschied, dass mein Sohn ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte. Wie zum Glück auch ich. Ich wusste, dass beides nicht selbstverständlich war.
»Deshalb mache ich diesen verdammten Job«, hörte ich Sara Braun mit bitterem Ton sagen. »Nachts, wenn andere Eltern Feierabend haben, ziehe ich meine Show ab, so lange, bis ich am liebsten umfallen würde. Ich brauche das Geld.« Ihre Stimme wurde laut. »Ich will selbstständig sein, von niemandem abhängig, will nicht mehr betteln müssen. Und Melissa soll es gut haben. Das hat sie verdient.«
»Was arbeiten Sie, wenn ich fragen darf?«
»Ich bin Pianistin und Sängerin. In Passau, in einem Jazzclub.«
»Ziemlich weit zu fahren.«
»Dafür stimmt die Kohle.« Schnell griff sie nach ihrer Handtasche, die neben ihr auf der Bank lag, zog ihren Geldbeutel hervor. »Was kostet es, wenn Sie mir mein Kind wiederbringen?«
»Warum kommen Sie zu mir und gehen nicht zur Polizei? Es wäre immerhin möglich, dass Melissa etwas zugestoßen ist.«
Sie wusste noch nichts von dem zweiten Mord am vergangenen Abend, hatte nicht gefragt, warum draußen in der Allee die weißen Zelte standen. Falls wirklich ein und derselbe Täter beide Frauen auf dem Gewissen haben und es sich tatsächlich um einen Serientäter handeln sollte, so war es zwar unwahrscheinlich, dass er sich in derselben Nacht das nächste Opfer suchen würde. Aber jede Mutter würde sich um ihr verschwundenes Kind sorgen und alles daransetzen, es so schnell wie möglich und vor allem wohlbehalten wieder in die Arme schließen zu können.
»Soll ich die Polizei etwa zu Chiara schicken?«, blaffte Sara Braun mich an. Mit einem dumpfen Ton ließ sie die Börse auf den Tisch fallen. Ihr Blick wurde noch anklagender. »Was sagen dann ihre Eltern? Und erst die Lehrer? In der Schule habe ich Melissa krankgemeldet. Wir brauchen nicht noch mehr Theater.«
Es irritierte mich, wie sie von absoluter Verzweiflung in diese plötzliche Aggressivität wechselte. Doch ich ließ mir nichts anmerken.
»Also, was verlangen Sie?«
Im Grunde war es leicht verdientes Geld. Mädchen in Melissas Alter rissen gern aus. Probleme gab es genug in dieser Entwicklungsphase: zu wenig Taschengeld, das ewige Thema der Ausgehzeiten, die erste Liebe, schlechte Noten, falsche Freunde, durch die man in schlechte Kreise geriet. Oft kam Alkohol mit ins Spiel, oder es gab Schwierigkeiten mit anderen Drogen. Die meisten jugendlichen Ausreißer kamen nach ein, zwei Tagen wieder zurück, voller Scham und Reue oder Hass und neuer Anklagen. Zudem wusste ich aus meiner Erfahrung als ehemalige Polizistin, dass zum Glück nur den wenigsten Kindern, die als vermisst gemeldet wurden, etwas zustieß. Doch was trotz all meiner Überlegungen am schwersten wog: Wenn ich diesen Auftrag nicht annahm, wie sollte ich je vergessen, dass ich eine verzweifelte Mutter im Stich gelassen hatte?
Ich nannte meiner neuen Auftraggeberin eine angemessene Summe. Sie zählte mehrere Scheine ab und legte sie auf den Tisch. Der Betrag war doppelt so hoch wie der, den ich genannt hatte. Ich nahm die überzähligen Scheine und streckte sie ihr entgegen. Doch sie stopfte nur hastig die Börse zurück in die Tasche, während sie schon anfing, mir die wichtigsten Informationen zu geben: Chiaras vollständigen Namen, wie sie aussah, Adresse der Schule. Unter keinen Umständen sollte ich Chiara zu Hause aufsuchen, um unnötiges Gerede zu vermeiden. Melissas Roller war eine Honda AF 29 in Metallicorange, gerade erst neu gekauft, ein schwarzer Streifen zog sich über beide Seiten. Dann holte Sara Braun einen verknitterten Kinderausweis aus der Tasche.
»Das Foto ist schon ein paar Jahre alt. Aber sie hat sich nicht groß verändert.«
Das Gesicht flächig und rund, die Wangen eine Spur zu voll, dunkle, fast schwarze Augen, die mir vorwurfsvoll entgegenstarrten. Keinerlei Ähnlichkeit zu ihrer Mutter. Das fransige, kurz geschnittene Haar hatte die Farbe von herabtropfendem Pech, beim Anblick der dicken, geraden Brauen musste ich an Zartbitterschokolade denken, die Wangenknochen waren hoch. Nur eines war gleich: Weder Mutter noch Tochter konnte ich mir fröhlich vorstellen, geschweige denn lachend.
4
Montag, 1.Juni, 8.59Uhr
Nachdem Sara Braun gegangen war, tippte ich die Nummer der Autowerkstatt ins Telefon ein, bei der ich meinen Maserati am vergangenen Freitag abgestellt hatte. Zugegeben, der Weg dorthin war weit – die Werkstatt befand sich im Osten der Stadt in der Nähe des Hafens –, aber alle Reparaturen wurden zuverlässig und zu einem akzeptablen Preis erledigt. Nein, es würde noch dauern, bekam ich wieder zu hören, ein Ersatzteil fehlte, ja, leider. Am besten, ich probierte es am Nachmittag noch einmal, dann wüsste man vielleicht mehr.
Im zweiten Stock hörte ich meine Untermieterin Mona herumtrippeln, wie immer in Eile. Ich schnappte mir die Tasche, die auf dem Vertiko neben dem Telefon lag. Mein Handy meldete sich mit dem Kinderlachen, das ich als Signal für eingehende SMS eingespeichert hatte.
Guten Morgen, meine Schöne, bin grade auf dem Weg zum OP und spät dran. Du bist so still. Alles okay bei dir? Du fehlst mir. Tausend einsame Küsse mitten im Trubel, M. PS: Morgen Abend haben wir endlich wieder Zeit für uns …
Maximilian, mein Geliebter – ich hatte noch immer keine Gelegenheit gehabt, ihm von den neuesten Ereignissen zu berichten. Seit Tagen unterwies er eine Gruppe von Arztkollegen aus der Ukraine in einer neuartigen Operationsmethode, an deren Entwicklung er mitgearbeitet hatte. Die Betreuung der Kollegen umfasste nicht nur medizinische Workshops, sondern auch zeitraubende Abendveranstaltungen wie gestern, außerdem musste er als Oberarzt und Neurochirurg natürlich auch auf seiner Station in der Uniklinik nach dem Rechten sehen. Vor drei Tagen hatten wir uns das letzte Mal gesehen.
In der letzten Nacht hatte ich immer wieder, wenn ich wach gelegen hatte, eine SMS an ihn ins Handy getippt, sie aber jedes Mal gelöscht. Bin vor meinem Haus über eine Leiche gestolpert und ziemlich durch den Wind war sicher nicht die Nachricht, die er in aller Herrgottsfrühe und noch dazu vor einem mit Terminen angefüllten Tag lesen wollte. Ich hoffte, heute Abend ausführlich mit ihm telefonieren zu können. Und morgen hatten wir endlich Gelegenheit zu einem ungestörten Abendessen zu zweit – und hoffentlich auch mehr. Lilo, Paolos Lebensgefährtin, hatte sich am morgigen Dienstag mit meinem Sohn zu ihrem monatlichen Kinoabend verabredet.
Ich schickte Maximilian eine unverfängliche Antwort zurück, mit dem Hinweis, dass ich ihm abends etwas erzählen wollte, und tippte die Nummer der Taxizentrale ein. Gerade noch rechtzeitig inspizierte ich den Geldbeutel und legte wieder auf, bevor die Verbindung hergestellt war. Als Viertelitalienerin wollte ich ungern auf einen fahrbaren Untersatz verzichten. Aber dafür reichte das bisschen Bargeld leider nicht mehr aus.
Notgedrungen holte ich das Fahrrad aus der Garage, die an der rückwärtigen Einfahrt zu einer Nebenstraße lag. Im selben Moment kam Semiramis angesprungen, die Katze meiner Untermieterin. Schnurrend legte sie sich auf den Kiesweg. Die kohlrabenschwarze Katzendame genoss den Frühsommer in vollen Zügen. Zuletzt war sie vor zwei Tagen aufgetaucht. Nur anhand der herumliegenden Vogelfedern und Mäusekadaver, die sie mir dann und wann als Geschenk auf die Terrasse legte, konnte ich feststellen, dass sie mich noch immer ins Herz geschlossen hatte.
Melissas Schule lag nur einen Kilometer entfernt, zwei Straßen hinter dem westlichen Ende des Stadtparks. Ich trat kräftig in die Pedale und passierte die großen Villen und herrschaftlichen Jugendstilhäuser, die für diese Wohngegend am Rande der westlichen Altstadt typisch waren und meinem eigenen Haus ähnelten. An jeder Ecke Türmchen, farbige Fensterläden, Balkone mit kunstvoll geschmiedeten Eisengittern, darüber hohe Giebel, von Efeu umrankte Mauern und Terrassen. Im Gegensatz zu meiner Villa waren aber fast alle Gebäude perfekt renoviert. Der tropfende Wasserhahn im Gäste-WC fiel mir ein, außerdem die losen Fliesen im Speisekeller und die lang nicht geschnittene Ligusterhecke, die den riesigen Garten umzäunte, fast schon ein Park mit seinen vielen alten Eichen, Linden und Buchen.
Ich bog in die Gerlichstraße und passierte das westliche Ende des Stadtparks. Überall grünte und blühte es, in den großen alten Bäumen, Heckenrosen und Holunderbüschen zwitscherten Vögel, kein einziges Wölkchen zeigte sich am tiefblauen Himmel. Das Gewitter der vergangenen Nacht war auch hier nur mehr Geschichte. Auf der Terrasse des La Gondola, einer alteingesessenen Pizzeria in einem kultigen, aus den sechziger Jahren stammenden Gebäude, wischte man die Stühle und Tische sauber. Noch vor zwei Wochen hatte es unentwegt geregnet. Nach den Eisheiligen war es dann aber innerhalb von wenigen Tagen warm und trocken geworden, und inzwischen stöhnte fast jeder über die schwülwarmen Temperaturen. Auch heute würden wir die Dreißig-Grad-Grenze wieder locker schaffen.
Tief atmete ich die nach Blumen duftende, sich schnell aufheizende Luft ein, ein Geruch, der mich an den Frühsommer in der Toskana erinnerte, wo ich bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr gelebt hatte. Nicht umsonst bezeichnet so mancher Regensburg als die nördlichste Stadt Italiens, mit seinen mittelalterlichen Wohntürmen, den unzähligen Kirchen und dem in jeder Gasse und auf jedem Platz gegenwärtigen mediterranen Flair, besonders in der warmen Jahreszeit. Und tatsächlich ist die Donaumetropole in meinen Augen die einzige deutsche Stadt, in der man als italienischstämmige Frau leben kann.
Ein Lehrer mit Rauschebart und sonorer Bassstimme, dem ich kurz darauf in der Eingangshalle des Goethe-Gymnasiums begegnete, schickte mich in den zweiten Stock des Hauptgebäudes. Dort würde ich die zehnten Klassen finden, erfuhr ich. In höchstens einer Viertelstunde sei die erste große Pause.
Ich stieg die Treppe hinauf. Am Ende eines langen, muffigen Korridors entdeckte ich das gesuchte Klassenzimmer. Nach wenigen Minuten hallte ein lautes Ding-Dong durch den verlassenen Gang. Im nächsten Moment wurden auf allen Seiten die Türen aufgerissen. Mädchen und Jungen der verschiedensten Altersstufen strömten heraus. Man rief laut durcheinander, lachte, schubste sich herum. Sneakers und Chucks trampelten über den Linoleumboden, dazwischen Stöckelschuhe, irgendwo piepste ein Handy, ein Rucksack krachte zu Boden.
Sara Braun hatte mir die Freundin ihrer Tochter genau beschrieben. Aber auch ohne die detaillierte Beschreibung hätte ich Chiara sofort erkannt. Alles an ihrer fülligen, fast barocken Gestalt war schwarz: das struppige, bis zum Kinn reichende Haar, die dick umrandeten Augen ebenso wie der Lack auf den Fingernägeln, ihr schwerer tropfenförmiger Schmuck an Ohren, Händen und Hals, das fast bodenlange Trägerkleid und die Springerstiefel. An der rechten Augenbraue hatte sie drei Piercings, ein schwarzer Jett-Stein glänzte am linken Nasenflügel.
»Entschuldige bitte, hast du einen Moment Zeit?«, sprach ich sie an, als sie sich zwischen mir und einer Gruppe kichernder Mädchen in Hotpants und eng anliegenden Tops vorbeiquetschen wollte. »Ich bin eine Bekannte von Melissas Mutter.«
»Seit wann hat die denn ’ne Bekannte?« Ihr zweifelnder Blick streifte mich. »Was wollen Sie überhaupt von mir?«
Ich stellte mich vor. »Weißt du, wo ich Melissa finden kann? Sie ist seit gestern Abend verschwunden. Ihre Mutter macht sich große Sorgen.«
Die quietschenden Mädchen waren schon auf dem Weg zur Treppe. Noch immer quollen Trauben von Kindern und Jugendlichen aus den Klassenzimmern und schoben sich an uns vorbei.
»Die hat doch heute schon angerufen. Zweimal.« Genervt verdrehte Chiara die gruselig bemalten Augen. »Ich hab echt keine Ahnung, wo die Melli steckt, und außerdem null Bock …«
Ein großer, schlaksiger Junge in Poloshirt und glatt gebügelten schneeweißen Shorts, der in Chiaras Alter sein musste und eine rote, etwas schief geratene Nase hatte, rempelte sie unsanft an.
»Verpiss dich, fette Schlampe!«
Er drängte sie so heftig gegen den Türpfosten des Klassenzimmers, dass sie zur Seite kippte und in die Knie ging. Fast im selben Moment holte er mit der geballten Hand aus, erspähte dann aber mich. Sofort ließ er die Faust sinken, grinste frech und machte, dass er davonkam.
»Che cazzo sei, vieni qua – ascolta, vieni subito!«, rief ich ihm wütend nach. »He, was soll das, komm sofort zurück!«
Er reagierte nicht und gesellte sich zu ein paar gleichaltrigen Jungs. Sie hatten die gleiche gestylte Kurzhaarfrisur wie er und versuchten gerade, mit großspurigem Gehabe ein anmutiges, schmales Mädchen zu beeindrucken, wie Gockel auf dem Hühnerhof. Die Kleine lachte. Der Kerl, der Chiara angerempelt hatte, legte den Arm um sie und zog sie weiter. Die drei anderen schlenderten lässig hinterher.
Ich wandte mich um, fasste nach Chiaras Arm und half ihr hoch. »Alles okay?«
Sie sah mich nicht an, griff sich an die Schulter, mit der sie gegen den Türpfosten geprallt sein musste, und presste die schwarzen Lippen aufeinander. Ihre Rechte schnellte in die Höhe und zeigte mit ausgestrecktem Mittelfinger in die Richtung des Jungen.
»Wichser!«, schrie sie ihm hinterher, obwohl er sie wohl ohnehin nicht mehr hören konnte. »Das nächste Mal kriegst du eine in die Fresse, du dreckiges Arschloch!«
Mit lautem Knall flog eine Tür zu, und ein Lehrer bat eine Schülerin, sie möge ihn wegen der mündlichen Note das nächste Mal ansprechen, er müsse dringend zum Lehrerzimmer.
»Hast du dir wehgetan?«, fragte ich Chiara besorgt.
»Halb so wild«, murmelte sie. »Geht schon wieder.«
»Kennst du den Kerl? Willst du dich über ihn beschweren?«