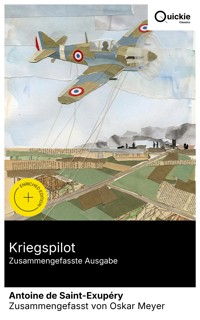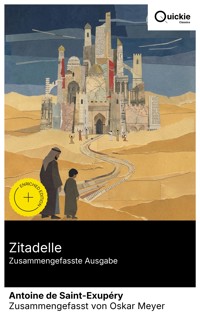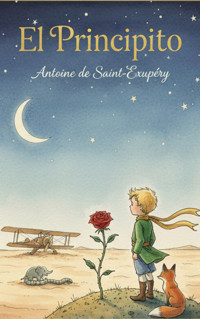2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
›NACHTFLUG‹ - der legendäre Roman von Antoine de Saint-Exupéry - neu aufgelegt mit der Geschichte seines Lebens in Bildern »Sollte ich abgeschossen werden, werde ich rein gar nichts bedauern. Vor dem künftigen Termitenhaufen graust mir. Und ich hasse die Robotertugend. Ich war dazu geschaffen, Gärtner zu sein.«, schloss 1944 der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry einen seiner letzten Briefe, bevor er auf seinem Aufklärungsflug über dem Mittelmeer verschwand. Nach dem Krieg wurde sein ›Der kleine Prinz‹ mit 80 Millionen Exemplaren zu einem der weltweit erfolgreichsten Bücher, sein übriges Werk blieb dagegen ein wenig in dessen Schatten. Seine autobiographisch geprägten Romane wie sein berühmtester, ›Nachtflug‹, schildern die heroische Anfangsphase der Fliegerei: nächtliche Kurierflüge über Patagonien und Afrika, Taifune und Unwetter, die Überquerung der Meere mit stotternden Motoren und rasendem Herz. Mut, Freundschaft, Entschiedenheit, die Moral für die anderen einzustehen - das sind die Motoren all seiner Werke: sein literarisches Vermächtnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Antoine de Saint-Exupéry
Nachtflug
Die Geschichte seines Lebens in Bildern
Über dieses Buch
Der Nachtflug auf der Strecke Rio-Buenos Aires, 1928 erstmals unternommen, war noch ein gefährliches Wagnis, als wenig später Antoine de Saint-Exupéry seinen Roman über ihn schrieb- der berühmteste seiner autobiographischen Romane: ein Liebesbrief an Consuelo, der er im Cockpit hoch über Buenos Aires einen Heiratsantrag machte, eine Hymne an die heroische Phase der Luftfahrt, wo die endgültige Rückkehr der Flugzeuge aus der Nacht nie sicher war.
Doch wer war der Schöpfer des Kleinen Prinzen wirklich? Sein Leben, die Legenden um ihn, seine heroischen Alleinflüge und um seinen mysteriösen Tod werden in einer ausführlich bebilderten Biographie dargestellt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: buxdesign, München
Coverabbildung: Ian Huebert
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die französische Originalausgabe erschien 1931
unter dem Titel Vol de Nuit
© Gallimard
Für die deutsche Ausgabe:
Copyright by S.Fischer Verlag, Berlin 1932
© S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403310-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Inhalt
Nachtflug
Widmung
Vorwort
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
Saint-Exupéry Die Geschichte seines Lebens in Bildern
Gibt es ein Leben nach der Kindheit?
Saint-Maurice
Der Sonnenkönig
Gefangen in Sainte-Croix
Aus Ritter Aklin wird Pique-la-Lune
Tod des Bruders
Ein Bohemien macht sich auf, in den Krieg zu ziehen
Fliegen lernen
Eine unglückliche Liebe
Latécoère
Cap Juby
Buenos Aires
Consuelo
Nachtflug
Ein gescheiterter Langstreckenrekord und andere Abstürze
Wind, Sand und Sterne
Flug nach Arras
Der melancholischste Franzose von ganz New York erhält Besuch vom Kleinen Prinzen
Der Kleine Prinz zieht in den Krieg
Epilog
Zu diesem Buch
Verwendete Literatur
Bildteil
Inhalt
Vorwort von André Gide
Nachtflug
Die Geschichte seines Lebens in Bildern
Zu diesem Buch
Verwendete Literatur
Nachtflug
Für Didier Daurat
Vorwort
Es handelte sich für die Luftverkehrsgesellschaften darum, an Schnelligkeit mit den anderen Beförderungsmitteln zu wetteifern. »Das ist für uns«, sagt Rivière, prachtvolle Führergestalt, in diesem Buche, »eine Lebensfrage, weil wir den Vorsprung, den wir tagsüber vor den Eisenbahnen und Dampfern gewonnen haben, jede Nacht wieder verlieren.« Dieser Nachtdienst, anfangs heftig umstritten, dann zugelassen und schließlich nach Überwindung der ersten großen Schwierigkeiten allgemein durchgeführt, war zu der Zeit, in der diese Erzählung spielt, noch eine sehr gewagte Sache; denn zu all den unberechenbaren Gefahren, die jede Fluglinie umlauern, kam nun noch das Trügerische und Bedrohliche der Finsternis hinzu. Ich beeile mich festzustellen, dass diese Gefahr, so groß sie auch heute noch ist, sich von Tag zu Tag verringert; denn jede neue Fahrt trägt das Ihre dazu bei, die nächstfolgende müheloser und sicherer zu gestalten. Aber ebenso wie die Geschichte der Forschungsreisen hat auch die Geschichte der Luftfahrt ihre heroische Erstlingsepoche, und dieser ›Nachtflug‹, der uns das tragische Abenteuer eines jener Pioniere der Luft schildert, klingt mit Fug und Recht wie ein Heldengedicht.
Ich liebe das erste Buch von Saint-Exupéry, aber dieses hier noch viel mehr. Im ›Südkurier‹ waren die mit packender Schärfe wiedergegebenen Erlebnisse des Fliegers verwoben mit einer Herzensgeschichte, die uns den Helden gefühlsmäßig nahebrachte, indem sie das Menschliche, Liebebedürftige, Verwundbare an ihm zeigte. Der Held des ›Nachtflugs‹ ist sicherlich auch nur ganz einfach ein Mensch, aber er wächst dennoch irgendwie ins unpersönlich Übermenschliche empor. Ich glaube, was mir so besonders an dieser leidenschaftlichen Erzählung gefällt, ist das Adelige an ihr. Die Schwächen, die Hilflosigkeit, das Versagen des Menschen sind uns genugsam bekannt, und die Literatur von heute versteht sich nur allzugut darauf, sie bloßzulegen; aber die Selbstüberwindung kraft eigener Willensanspannung, die tut uns besonders not, die soll man uns schildern.
Bewundernswerter noch als die Gestalt des Fliegers erscheint mir die seines Vorgesetzten Rivière. Rivière handelt zwar nicht selbst, aber er treibt die andern zum Handeln, zur Tat; er impft seinen Piloten seine eigene sittliche Kraft ein, er fordert das Höchste von ihnen, er zwingt sie zum Heldentum. Seine unnachgiebige Entschlossenheit duldet keine Schwäche, er straft unerbittlich das geringste Versagen. Seine Strenge könnte auf den ersten Blick unmenschlich und übertrieben erscheinen. Aber sie richtet sich nicht gegen die Menschen selber, die Rivière nur für seinen Zweck zurechtschmieden will, sondern gegen das Unvollkommene an sich. Man spürt in dieser Schilderung die ganze Bewunderung des Verfassers für diese Gestalt, und ich persönlich weiß ihm besonderen Dank dafür, dass er die paradoxe Wahrheit ins rechte Licht gerückt hat, die für mich von außerordentlicher psychologischer Bedeutung ist: dass das Glück des Menschen nicht in der Freiheit besteht, sondern in der Hingabe an eine Pflicht. Jeder Einzelne in diesem Buch ist leidenschaftlich und ausschließlich dem hingegeben, was er tun muss, der gefahrvollen Aufgabe, deren Erfüllung allein ihm Beruhigung und Glück verheißt. Und man erkennt sehr wohl, dass auch Rivière keineswegs gefühllos ist (nichts Ergreifenderes als die Schilderung, wie die Frau des Vermissten zu ihm kommt) und dass für ihn nicht weniger Mut dazu gehört, seine Befehle zu geben, als für seine Piloten, sie auszuführen. »Um geliebt zu werden«, sagt er einmal, »braucht man nur zu bemitleiden. Ich bemitleide so gut wie nie, oder ich verberge es.« Und ferner: »Man soll die lieben, über die man befiehlt, aber man soll es ihnen nicht sagen.«
Darin spricht sich die ›dunkle Empfindung‹ aus ›von einer Pflicht, höher als Liebe‹; das Gefühl, dass der Mensch seinen Endzweck nicht in sich selber findet, sondern sich unterzuordnen und sich zu opfern hat irgendeinem Etwas, das Macht über ihn hat und von ihm lebt. Das ist die gleiche ›dunkle Empfindung‹ – ich erkenne es mit Genugtuung wieder –, die meinem Prometheus die paradoxen Worte eingab: »Ich liebe den Menschen nicht, aber ich liebe das, was ihn verzehrt.« Das ist die Quelle alles Heldischen: »Wir handeln«, sagt Rivière, »als ob es etwas gäbe, das das Menschenleben an Wert übertrifft … Aber was?« Und abermals: »Vielleicht gibt es etwas anderes, Dauerhafteres, das es zu bewahren gilt; vielleicht ist es dieses Teil des Menschen, um dessentwillen ich arbeite.« Zweifeln wir nicht daran.
In einer Zeit, in der der Begriff des Heldischen mehr und mehr aus der Armee verschwindet, weil sich in den Kriegen von morgen, deren Schrecknisse uns die Chemiker vorausmalen, für Mannesmut kaum noch Verwendung finden dürfte – ist in dieser Zeit die Luftfahrt nicht derjenige Bereich, wo wir den Mut am bewundernswertesten und nutzbringendsten sich entfalten sehen? Was an sich Tollkühnheit wäre, wird hier zur einfachen Dienstpflicht. Der Pilot, der unablässig sein Leben aufs Spiel setzt, hat einiges Anrecht darauf, die Vorstellung, die wir uns für gewöhnlich von ›Mut‹ machen, zu belächeln. Wird Saint-Exupéry mir erlauben, einen schon lange zurückliegenden Brief von ihm zu zitieren? Er stammt aus der Zeit, in der er als Flieger in Mauretanien Dienst tat, um die Linie Casablanca–Dakar zu sichern:
›Ich weiß nicht, wann ich zurückkommen werde, ich habe so viel zu tun seit einigen Monaten: nach vermissten Kameraden suchen, Flugzeuge wieder flottmachen, die in aufständischem Gebiet notlanden mussten, und ein paar Kurierflüge über Dakar.
Ich habe glücklich eine kleine Heldentat vollbracht: zwei Tage und zwei Nächte unterwegs, mit elf Mauren und einem Mechaniker an Bord, um ein Flugzeug zu bergen. Allerlei heftige Schießerei. Zum ersten Mal hab’ ich Kugeln mir übern Kopf pfeifen hören. Jetzt weiß ich wenigstens endlich, wie so etwas auf mich wirkt: ich war viel ruhiger als die Mauren. Aber ich habe auch begriffen, was mich immer verwundert hatte: weshalb Plato (oder Aristoteles?) dem Mut die niedrigste Rangstufe unter den Tugenden zuweist. Nicht gerade sehr edle Gefühle, aus denen er sich zusammensetzt: ein bisschen Wut, ein bisschen Eitelkeit, ein gut Teil Trotz und ganz gewöhnliche Sportlust. Vor allem auch ein gesteigertes Gefühl physischer Kraft, obwohl die eigentlich nichts dabei zu tun hat. Man kreuzt die Arme über dem offenen Hemd und atmet tief. Alles in allem eher ein Wohlgefühl. Wenn es bei Nacht passiert, mischt sich darein das Gefühl, eine ungeheure Dummheit begangen zu haben. Nie wieder werd’ ich einen Menschen bewundern, der nichts als mutig ist.‹
Als Nachwort dazu könnte ich eine Stelle aus dem Buch von Quinton[1] zitieren (dem ich übrigens durchaus nicht immer beistimme): ›Man verbirgt seinen Mut ebenso wie seine Liebe‹, oder noch besser: ›Die Mutigen verhehlen ihre Taten, wie die Rechtschaffenen ihre Almosen. Sie verheimlichen sie oder schützen andere Motive vor.‹ Alles, was Saint-Exupéry erzählt, trägt den Stempel des Selbsterlebten. Dies: dass er selber mehr als einmal der Gefahr die Stirn geboten hat, gibt dem Buche den Reiz des Echten und Unnachahmlichen. Lediglich der Phantasie entsprungene Geschichten von Krieg und Abenteuern gibt es in großer Zahl; sie mögen zuweilen von einer gewissen Einfühlungskraft des Verfassers zeugen; den wirklichen Abenteurern und Kämpfern werden sie jedoch meist nur ein Lächeln abnötigen. Die vorliegende Erzählung, die ich als literarisches Werk bewundere, hat zugleich den Wert eines Dokuments; und diese beiden so unverhofft vereinigten Eigenschaften geben diesem ›Nachtflug‹ seine ungewöhnliche Bedeutung.
André Gide
Fußnoten
[1]
René Quinton, »Maximes sur la Guerre«, Paris 1930.
I
Die Höhenzüge, tief unter dem Flugzeug, gruben schon ihre Schattenfurchen ins Gold des Abends. Aber die Ebenen glommen noch in hartnäckigem Licht: sie können sich dortzulande nie entschließen, ihr Gold herzugeben, ebenso wie sie nach dem Winter nie von ihrem Schnee lassen wollen.
Und der Pilot Fabien, der das Postflugzeug Patagoniens vom äußersten Süden her nach Buenos Aires zurückführte, steuerte in den nahenden Abend wie in die Gewässer eines Hafens: Stille weithin, kaum gefurcht von ein paar leichten, regungslosen Wolken. Glückliche Geborgenheit einer riesigen Reede.
Es war ihm auch, als schlenderte er langsam durch diesen Frieden dahin, fast wie ein Hirte. Die Hirten Patagoniens ziehen gemächlich von Herde zu Herde: Er zog von Stadt zu Stadt, er war der Hirt der kleinen Städte. Alle zwei Stunden traf er auf welche, zur Tränke gedrängt ans Ufer der Flüsse oder weidend auf ihrer Ebene.
Manchmal, nach hundert Kilometern Steppe, unbewohnter als das Meer, überflog er eine verlorene Farm, die ihre Fracht Menschenleben nach rückwärts durch die Wogen der Prärie davonzutragen schien wie eine Arche, dann grüßte er mit seinen Flügeln.
»San Julian ist in Sicht; wir landen in zehn Minuten.«
Der Bordfunker gab die Nachricht an alle Stationen der Linie weiter.
Auf zweitausendfünfhundert Kilometer, von der Magalhãesstraße bis Buenos Aires, reihten sich die Stationen gleichförmig gestaffelt; aber die, der man jetzt zuflog, erschien wie ein letzter Grenzort am Rande der Nacht, gleich einem jener letzten unterworfenen afrikanischen Nester am Rande des Unbekannten.
Der Funker schob dem Piloten einen Zettel zu:
»Es sind so viele Gewitter in der Luft, dass ich die Hörer ganz voll habe davon. Werden Sie in San Julian übernachten?«
Fabien lächelte: der Himmel war still wie ein Aquarium, und alle Stationen vor ihnen meldeten: »Klarer Himmel, kein Wind.« Er antwortete:
»Wir fliegen weiter.«
Aber der Funker dachte an Gewitter, die sich sicher irgendwo eingenistet hatten, wie Würmer in einer Frucht; mochte die Nacht noch so schön sein, sie war angefault: etwas in ihm sträubte sich dagegen, sich in dieses verwesungsreife Dunkel hineinzubegeben.
Während Fabien mit gedrosseltem Motor auf San Julian niederglitt, fühlte er sich müde. Alles, was das Dasein der Menschen behaglich macht, wuchs ihm entgegen: ihre Häuser, ihre kleinen Cafés, die Bäume ihrer Promenade. Er war wie ein Eroberer, der sich am Abend seines Siegs über die Lande des Reiches beugt und zum ersten Mal das bescheidene Menschenglück gewahrt. Ein Verlangen war in ihm, die Waffen abzulegen, die Schwere und Steifheit seiner Glieder zu spüren, denn auch Mühsal schafft Behagen, und hier nur noch ein einfacher Mensch zu sein, der durch sein Fenster hinausschaut auf ein Daseinsbild, das sich nun nie mehr wandelt. Dieses winzige Nest, er hätte es gerne akzeptiert: hat man einmal gewählt, so gibt man sich zufrieden mit dem Zufall seines Daseins und kann sein Herz daran hängen. Es gewährt den Segen der Beschränkung, wie die Liebe. Fabien hätte gewünscht, lange Zeit hier zu leben, sein Teil Ewigkeit hier an sich zu nehmen; denn sie erschienen ihm wie etwas Ewiges, außerhalb seines Ich, diese kleinen Städte, in denen er immer nur eine Stunde verbrachte, und diese Gärten, umhegt von alten Mauern, die er überflog. Und die Ortschaft stieg der Besatzung entgegen und öffnete sich ihr. Und Fabien dachte an die Freundschaften, an die zärtlichen Mädchen, an die Traulichkeit der weißen Tischtücher, an alles, was sich gemächlich einrichtet auf die Ewigkeit. Und die kleine Stadt glitt schon dicht unter den Flügeln dahin und enthüllte das Geheimnis ihrer geschlossenen Gärten, die ihre Mauern nicht mehr beschützten. Aber Fabien wusste, als er gelandet war, dass er nichts gesehen hatte als die langsame Bewegung von ein paar Menschen zwischen ihren Steinen. Diese Stadt hielt ihre Leidenschaften hinter ihrer Unbeweglichkeit verborgen, diese Stadt gab ihre Süße nicht preis: um sie zu gewinnen, hätte man auf die Tat verzichten müssen.
Als die zehn Minuten Aufenthalt um waren, musste Fabien wieder scheiden.
Er schaute auf San Julian zurück: es war nur noch eine Handvoll Lichter, dann Sterne, dann verlor sich der Staub, der ihn zum letzten Mal in Versuchung geführt hatte.
»Ich sehe die Zeiger nicht mehr: ich mache Licht.«
Er schaltete die Instrumentenbeleuchtung ein, aber die roten Lampen warfen in diesem Dämmerblau nur ein so schwaches Licht auf die Zeiger, dass es sie nicht färbte. Er hielt seine Finger vor eine Birne: sie röteten sich kaum.
»Zu früh.«
Indessen stieg die Nacht herauf wie dunkler Rauch und füllte schon die Täler. Sie waren nicht mehr von den Ebenen zu unterscheiden. Dafür blitzten jetzt die Dörfer auf, Sternbilder, die einander antworteten. Und auch er ließ mit dem Finger seine Positionslichter blinken zur Antwort. Die ganze Erde war übersponnen von Lichtgrüßen, jedes Haus zündete seinen Stern an vor der unendlichen Nacht, so wie man das Feuer eines Leuchtturms gegen das Meer wendet. Alles, was Menschenleben barg, glitzerte. Fabien schwoll das Herz: wie in einen Hafen war diesmal die Einfahrt in die Nacht, sacht und schön.
Er beugte sich zum Schaltbrett. Das Radium der Zeiger begann zu leuchten. Eine nach der andern prüfte der Pilot die Ziffern und war zufrieden. Man saß ganz solide hier in diesem Himmelsraum. Er tippte mit dem Finger an einen Stahlspanten und fühlte das Leben durch das Metall rieseln: dieser Stahl vibrierte nicht, er lebte. Die fünfhundert Pferdestärken des Motors weckten in der Materie einen ganz sanften Strom, der ihre Eishärte in samtweiches Fleisch verwandelte. So war es immer. Weder Schwindel noch Rausch empfand man im Flug, sondern nur das geheimnisvolle Arbeiten eines lebendigen Organismus.
Er hatte sich jetzt seine Welt wiederhergerichtet und machte es sich mit den Ellbogen darin bequem.
Er griff an die elektrische Schalttafel, prüfte die Schalter der Reihe nach, rückte ein wenig herum, lehnte sich tiefer in den Sitz und suchte nach der besten Stellung, um das Schaukeln der fünf Tonnen Metall recht zu spüren, die die leise bewegte Nacht auf ihren Schultern trug. Dann tastete er umher, schob seine Notlampe an ihren Platz, ließ sie los, fand sie wieder, vergewisserte sich, dass sie nicht rutschen konnte, ließ sie wieder los, um an jeden Hebel zu rühren und seine Finger zu üben, wie für eine Welt von Blinden. Dann, als er seiner Hände ganz sicher war, erlaubte er sich, eine Lampe anzuzünden, seine Präzisionsinstrumente zu schmücken, und überwachte nach den Zifferblättern sein Eintauchen in die Nacht. Dann, als nichts schwankte, nichts vibrierte, nichts zitterte und sein künstlicher Horizont, sein Höhenmesser und der Tourenzähler ganz ruhig blieben, streckte er sich ein wenig, lehnte seinen Nacken gegen das Leder des Sitzes und begann sich der tiefen Beschaulichkeit des Flugs hinzugeben, die einen wohlig mit einer unerklärlichen Hoffnung erfüllt.