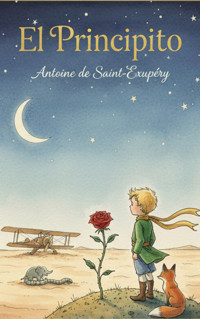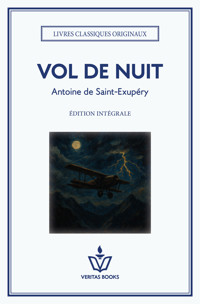Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lempertz Edition und Verlagsbuchhandlung
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Saint-Exupérys Buch schildert einen einstündigen Flug und das Erlebnis der Todesgefahr über der brennenden Stadt Arras, über den Kolonnen der Flüchtlinge. Er bekommt während einer bereits verlorenen Schlacht 1939 in Frankreich den Auftrag in niedriger Höhe feindliche Panzersammlungen zu beobachten, obwohl ihre Informationen keinem mehr nützen. Während dieser hoffnungslosen Mission philosophiert er über den Sinn der Dinge und das Schicksal der menschlichen Netur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antoine de Saint-Exupéry
Flug nach Arras
Herrn Major Alias, allen meinen Kameraden der Fernaufklärergruppe 2/33, insbesondere dem Beobachter-Hauptmann Moreau und den Beobachter-Oberleutnanten Azambre und Dutertre, die nacheinander meine Bordkameraden im Laufe aller meiner Kriegseinsätze im Feldzug 1939/40 gewesen sind, in lebenslänglicher, treuer Freundschaft.
1
KEIN ZWEIFEL: Ich träume. Ich bin wieder auf dem Pennal, ein Junge von fünfzehn Jahren. Ich sitze brav über meine Geometrieaufgabe. Ich stütze mich auf den schwarzen Arbeitstisch und hantiere eifrig, friedlich mit Zirkel, Lineal und Winkelmesser. Kameraden plaudern leise neben mir. Einer schreibt Zahlenreihen an die schwarze Wandtafel. Andere, weniger arbeitsam, spielen Bridge. Von Zeit zu Zeit vertiefe ich mich weiter in meinen Traum und werfe einen Blick zum Fenster hinaus. Ein Baum schwankt leise im Sonnenlicht. Lang schaue ich ihm zu, ich bin wenig bei der Sache... Beglückt spüre ich die Sonne von damals, koste jenen Geruch der Kindheit, der von Pult, Kreide und Schultafel ausströmt. Mit welcher Wonne kapsele ich mich in jene wohlbehütete Kinderzeit ein! Ich weiß es nur zu gut: Mit dem Kindsein fängt es an, dem Gymnasium, den Kameraden, dann kommt der Tag, da heißt es Examina bestehen, da bekommst du dein Abgangszeugnis. Beklommenen Herzens gehst du durch eine gewisse Pforte, dahinter bist du dann auf einmal ein Mann. Dann lastet dein Schritt gewichtiger auf der Erde, du gehst schon deinen eigenen Lebensweg. Die allerersten Schritte. Schließlich versuchst du deine Waffen an richtigen Gegnern. Lineal, Winkelmaß und Zirkel, die brauchst du nun und baust dir damit eine Welt oder triumphierst mit ihnen über deine Feinde. Aus ist das Spiel!
Ich weiß schon: sonst hat ein Pennäler keine Angst, es mit dem Leben aufzunehmen. Er brennt vor Ungeduld. Qualen, Gefahren, Bitternisse des Lebens als Mann schrecken keinen Pennäler.
Doch ich bin ein ganz merkwürdiger Kerl von einem Pennäler. Ich bin einer, der weiß um sein Glück und hat es gar nicht eilig, es mit dem Leben aufzunehmen.
Da geht Dutertre. Ich rufe ihn.
«Setz dich her, wir spielen uns eins...»
Wie glücklich bin ich, wenn ich ihm sein Pique-As hole. Dutertre sitzt mir gegenüber auch auf so einem schwarzen Arbeitstisch wie meiner und läßt die Beine baumeln. Er grinst. Ich lächle still vergnügt. Pénicot kommt dazu und legt den Arm um meine Schulter:
«Na, Alter?»
Mein Gott! Wie warm wird mir dabei!
Einer von der Aufsicht — ist es auch wirklich einer?... — öffnet die Tür und ruft zwei Kameraden heraus. Sie legen Lineal und Zirkel hin, stehen auf und gehen. Wir sehen ihnen nach. Für sie ist die Schule aus. Sie werden ins Leben entlassen, werden ihr Wissen anwenden. Als Männer werden sie an ihren Gegnern das Fazit ihres Rechnens erproben. Was für eine merkwürdige Schule, einer nach dem andern verläßt sie! Ohne groß Abschied zu nehmen. Eben die beiden Kameraden haben nicht einmal nach uns hingesehen. Dabei wirbelt sie der Zufall im Leben vielleicht weiter weg als nach China. So viel weiter! Wenn das Leben die Männer nach der Schule zerstreut, sind sie dann so sicher, sich wiederzusehen?
Und wir, die in der wohligen, friedlichen Wärme Zurückbleiben, wir senken die Köpfe...
«Hör doch, Dutertre, heute abend...»
Doch dieselbe Tür öffnet sich ein zweites Mal. Ich höre wie einen Vollstreckungsbefehl:
«Hauptmann de Saint-Exupery und Oberleutnant Dutertre zum Kommandeur!»
Aus ist die Schule. Das Leben beginnt.
«Du, hast du gewußt, daß wir jetzt dran sind?»
«Pénicot ist heute morgen geflogen.»
Zweifellos fliegen wir in besonderem Auftrag, da wir gerufen werden. Es ist Ende Mai 1940, mitten im Rückzug, im vollen Zusammenbruch. Besatzungen werden geopfert, als gösse man glasweise Wasser in einen Waldbrand. Wie soll einer die einzelne Gefahr auch abwägen, da alles zusammenbricht? Für ganz Frankreich sind wir noch fünfzig Fernaufklärer-Besatzungen. Fünfzig Besatzungen zu je drei Mann. Davon haben wir dreiundzwanzig in unserer Gruppe 2/33. In drei Wochen haben wir siebzehn von unseren dreiundzwanzig Besatzungen verloren. Wie Wachs in der Sonne sind wir zusammengeschmolzen. Gestern habe ich zu Oberleutnant Gavoille gesagt:
«Erst nach dem Kriege werden wir dahinterkommen.»
Und Oberleutnant Gavoille hat mir geantwortet:
«Sie denken doch wohl nicht, diesen Krieg zu überleben, Herr Hauptmann?»
Gavoille spaßte nicht. Wir wissen nur zu gut, daß gar nichts anderes übrigbleibt, als uns in den Brand zu schleudern, so nutzlos die Geste auch sein mag. Wir sind fünfzig für ganz Frankreich. Auf unseren Schultern ruht die gesamte Kampfführung der französischen Armee! Ein riesiger Wald brennt lichterloh, und zum Löschen stehen nur ein paar Glas Wasser zur Verfügung: Sie werden geopfert.
Ist ganz in der Ordnung. Wer denkt daran, sich zu beklagen? Hat die Antwort je anders gelautet als: «Jawohl, Herr Major. Gewiß, Herr Major. Vielen Dank, Herr Major. Verstanden, Herr Major.» Doch im Laufe dieses zu Ende gehenden Krieges überwiegt ein Eindruck alle andern, der des Absurden. Rings um uns kracht alles. Alles bricht zusammen. Das ist so allgemein, daß selbst der Tod einem absurd vorkommt. Der Tod hat nicht den richtigen Ernst in diesem Durcheinander...
Wir treten bei Kommandeur Alias ein. — Er befehligt heute noch in Tunis dieselbe Gruppe 2/33. —
«Guten Morgen, Saint-Ex. Guten Morgen, Dutertre. Nehmen Sie Platz!»
Wir setzen uns. Der Kommandeur breitet auf dem Tisch eine Karte aus und wendet sich nach der Ordonnanz:
«Holen Sie mir den Wetterbericht.»
Dann trommelt er mit dem Bleistift auf den Tisch. Ich beobachte ihn. Er ist übermüdet. Er hat nicht geschlafen. Auf der Suche nach einem sagenhaften Stab, dem Divisionsstab, dem Geschwaderstab ist er mit seinem Wagen kreuz und quer im Gelände herumgefahren ... Er hat versucht, gegen die Nachschublager anzugehen, die keine Ersatzteile lieferten. Auf der Straße ist er in heillose Verstopfungen hineingeraten. Er hat auch unsere letzte Verlagerung geleitet, unseren letzten Platz bezogen; denn wir ändern unsern Standort wie arme Teufel, hinter denen der Vollstreckungsbeamte unerbittlich her ist. Jedesmal noch hat Alias seine Flugzeuge, seine Lastwagen und zehn Tonnen Material retten können. Wir ahnen jedoch, daß er am Ende seiner Kräfte, seiner Reserven ist.
«Also, folgendes ...»
Er trommelt noch auf den Tisch und sieht an uns vorbei.
«Es ist sehr unangenehm...»
Dann zuckt er mit den Schultern.
«Ein unangenehmer Auftrag. Beim Stab legen sie aber Wert darauf. Großen Wert sogar. Ich habe dagegen geredet, aber sie lassen nicht davon ab ... Es ist nun mal so.»
Dutertre und ich sehen durchs Fenster einen ruhigen Himmel. Ich höre die Hühner gackern; denn das Geschäftszimmer des Kommandeurs ist in einem Bauernhof, die Nachrichtenstelle in einer Schule eingerichtet. Ich kann den Sommer, die Früchte, die reifen, die Küken, die wachsen, das Korn, das sich streckt, nicht gegen den Tod anführen, der uns naht. Ich verstehe nicht, wieso die sommerliche Ruhe zum Sterben nicht passen will, auch nicht, wieso das süße Leben zur Ironie wird. Doch eines wird mir undeutlich bewußt: Dies ist ein Sommer, der aus dem Geleise geriet, der eine Panne bekam... Ich habe verlassene Dreschmaschinen, verlassene Mähbinder gesehen. In den Straßengräben aufgegebene Wagen, die eine Panne hatten. Verlassene Dörfer. Dort lief in einem menschenleeren Dorf der Brunnen weiter. Das klare Wasser wurde zur Pfütze und hatte die Menschen doch so viel Mühe gekostet. Plötzlich kommt mir ein absurdes Bild: Die Uhren, die stehengeblieben sind. Alle die Uhren, die nicht mehr gehen. Kirchturmuhren in den Dörfern, Bahnhofsuhren, Wanduhren über dem Kamin in den leeren Häusern. Auch im Schaufenster des Uhrmachers, der geflüchtet war, all die Gerippe toter Uhren. So ist der Krieg... Keiner zieht die Uhren mehr auf. Keiner erntet die Rüben, keiner setzt die Wagen instand. Und das Wasser, das aufgespeichert wurde, um den Durst zu löschen oder herrliche Spitzen vom ländlichen Sonntagsstaat zu bleichen, wird zur Pfütze vor der Kirche. Und es heißt sterben, jetzt zur Sommerszeit...
Mir ist, als wäre ich krank. Eben sagt der Arzt zu mir: «Es ist sehr unangenehm...» Eigentlich müßte ich an den Notar, an die Hinterbliebenen denken. Dutertre und ich haben jedenfalls verstanden, daß es sich um einen Auftrag auf Leben und Tod handelt: «Unter den jetzigen Umständen», schließt der Kommandeur, «kann man sich um das Gefahrenmoment nicht allzusehr kümmern...»
Gewiß. Man kann «nicht allzusehr». Und jeder hat recht. Wir, die melancholisch werden, auch der Kommandeur, dem nicht recht wohl ist. Auch der Stab, der seine Befehle gibt. Der Kommandeur ist verdrießlich, weil seine Befehle absurd sind. Wir wissen es auch, der Stab weiß es sogar selber. Er befiehlt; denn es muß befohlen werden. Im Kriege gibt der Stab eben seine Befehle. Er vertraut sie schmucken Kavalleristen oder zeitgemäßen Motorfahrern an. Da, wo Durcheinander und Verzweiflung herrschen, springt dann ein jeder von den schmucken Reitern vom dampfenden Roß. Er weist die Zukunft, wie der Stern der Weisen. Er bringt die Wahrheit. Und die Befehle rücken die Welt wieder zurecht.
So sieht der Krieg, das farbige Phantasiegemälde des Krieges aus. Und jeder strengt sich an, so gut er kann, damit dieser Krieg dem wahren Kriege gleicht. Gewissenhaft bemüht sich ein jeder, die Spielregeln brav einzuhalten. Vielleicht kommt es dahin, daß dieser Krieg doch noch einem richtigen Krieg ähnlich wird. Und eben damit er einem wirklichen Kriege gleicht, werden ohne genaues Ziel Besatzungen geopfert. Keiner gibt sich selbst zu, daß dieser Krieg mit nichts zu vergleichen ist, daß an ihm alles sinnlos ist, kein Schema auf ihn paßt, daß in allem Ernst an Fäden gezogen wird, die nicht mehr zu den Marionetten führen. Pflichtgemäß erlassen die Stäbe ihre Befehle, die nie an Ort und Stelle eintreffen. Sie verlangen Erkundungen von uns, die unmöglich einzuholen sind. Die Fliegerei kann nicht die Aufgabe übernehmen, den Stäben den Krieg zu erklären. Mit Hilfe ihrer Beobachtungen kann die Fliegerei zwar Annahmen nachprüfen; hier gibt es aber gar keine Annahmen mehr. Dabei verlangt man von etwa fünfzig Besatzungen in allem Ernst, sie sollten das Gesicht eines Krieges verändern, der gar keines hat. Sie wenden sich an uns wie an ein Volk von Wahrsagern. Ich betrachte Dutertre, meinen Beobachtungs-Wahrsager. Gestern wandte er einem Obersten von der Division ein: «Und wie soll ich Ihnen zehn Meter über dem Boden bei fünfhundert Stundenkilometern die Stellungen ausfindig machen?» «Na, das merken Sie schon, wenn Sie beschossen werden. Wo auf Sie geschossen wird, da sind die deutschen Stellungen.»
«Ich hab' hinterher richtig lachen müssen», schloß Dutertre.
Denn der französische Soldat hat niemals einen französischen Flieger gesichtet. Es sind knapp tausend, von Dünkirchen bis ins Elsaß verstreut. Oder richtiger gesagt, sie sind ins Unendliche aufgelöst. Wenn also an der Front ein Flieger herunterbraust, ist es bestimmt ein deutscher. Daher sucht man ihn auch abzuschießen, bevor er seine Bomben abwirft. Sein Brummen allein schon löst das Bellen der Maschinengewehre und leichten Flak aus.
«Mit einer solchen Methode», fuhr Dutertre fort, «bekommen sie ein herrliches Nachrichtenmaterial.» Und darauf bauen sie auf; denn theoretisch muß man sich im Kriege nach den Erkundungen richten!... Gewiß! Aber auch der ganze Krieg ist aus dem Leim. Zum Glück — und das wissen wir sehr wohl — verwertet kein Mensch unsere Erkundungen. Wir können sie gar nicht weitergeben. Die Straßen sind verstopft, die Telefone gehen nicht, der Stab wird in aller Eile wieder verlegt sein. Die wichtigen Nachrichten über die feindlichen Stellungen liefert der Feind selber. Vor ein paar Tagen diskutierten wir in der Nähe von Laon über die mögliche Lage der Stellungen. Wir schickten einen Verbindungsoffizier zum General. Halbwegs zwischen unserm Gefechtsstand und dem General stößt der Wagen des Oberleutnants auf eine schwere Zugmaschine, die, quer über die Straße gestellt, zwei Panzerwagen zur Deckung dient. Der Oberleutnant macht kehrt. Doch eine Maschinengewehrgarbe tötet ihn auf der Stelle und verwundet den Fahrer. Es waren deutsche Panzerwagen.
Im Grunde ähnelt der Stab einem Bridge-Spieler, der aus dem Nebenzimmer gefragt wird:
«Was soll ich mit meiner Pique-Dame machen?»
Er würde nebenan mit der Schulter zucken. Was sollte er auch antworten, da er nichts vom Spiel zu sehen bekommen hat?
Doch ein Stab darf nicht mit der Schulter zucken. Wenn er noch einige Truppenteile an der Hand hat, muß er sie handeln lassen, um sie in der Hand zu behalten und alle Möglichkeiten zu versuchen, solange eben der Krieg noch dauert. Wenn er auch nichts sehen kann, muß er sich doch rühren und andere in Bewegung halten.
Es ist jedoch schwierig, aufs Geratewohl mit einer Pique-Dame aufzutrumpfen. Wir haben schon, und zwar zunächst überrascht, dann mit einer gewissen Selbstverständlichkeit festgestellt — was wir übrigens hätten voraussehen können —, daß einem nichts zu tun bleibt, wenn der Zusammenbruch beginnt. Man meint, der Unterlegene ersticke unter einer Flut von Problemen, setze, um sie zu lösen, mit letzter Anspannung seine Infanterie, Artillerie, Panzer und Flugzeuge ein... Die Niederlage sabotiert jedoch zunächst einmal alle Probleme. Man versteht überhaupt nichts mehr vom Spiel, weiß nicht, was man mit den Flugzeugen, den Panzern, der Pique-Dame anfangen soll... Man wirft sie aufs Geratewohl auf den Tisch, nachdem man sich zuvor den Kopf zerbrochen hat, eine wirksame Rolle für sie ausfindig zu machen. Es wird einem übel und keineswegs fiebrig. Der Sieg allein bringt einen in Fieber. Nur der Sieg bringt Ordnung, baut auf. Dann plagt sich jeder ab und trägt sein Teil zu ihm bei. Die Niederlage jedoch schafft um die Menschen eine Atmosphäre des mangelnden Zusammenhangs, des Müßig- und vor allem des Überflüssigseins.
Denn zunächst sind sie überflüssig, die Aufträge, die von uns verlangt werden. Jeden Tag überflüssiger. Blutiger und dabei überflüssiger. Um sich dem Bergrutsch entgegenzustemmen, wissen die Befehlenden sich nicht anders zu helfen, als daß sie ihre letzten Trümpfe auf den Tisch werfen.
Dutertre und ich sind solche Trümpfe und hören dem Kommandeur zu. Er entwickelt uns den Plan für den Nachmittag. Wir sollen befehlsgemäß in siebenhundert Meter Höhe die Panzerwagenansammlungen in der Gegend von Arras auf dem Rückweg von einem langen Rundflug in zehntausend Meter Höhe erkunden. Seine Stimme klingt dabei, als wollte er sagen:
«Dann gehen Sie die zweite Straße rechts, bis Sie an die Ecke eines freien Platzes kommen. Dort ist ein Tabakladen, da holen Sie mir eine Schachtel Streichhölzer...»
«Jawohl, Herr Major.»
Der Auftrag bezweckt nicht mehr und nicht weniger. Die Sprache, in der er angekündigt wird, ist ganz ebenso prosaisch.
Ich sage mir: Ein Auftrag auf Leben und Tod. Ich denke... denke so vielerlei. Wenn ich am Leben bleibe, will ich die Nacht abwarten zum Überlegen. Wenn ich am Leben bleibe... Ist der Auftrag leicht, dann kommt von dreien einer wieder. Ist er etwas «unangenehm», dann wird es offenbar mit dem Wiederkommen schwieriger. Und hier im Geschäftszimmer des Kommandeurs kommt mir der Tod weder erhaben noch majestätisch, weder heroisch noch erschütternd vor. Er ist nichts weiter als ein Zeichen, eine Auswirkung der Verwirrung. Die Gruppe verliert uns, wie einem beim Umsteigen auf der Eisenbahn Gepäckstücke abhanden kommen.
Nicht etwa, daß ich nicht an den Krieg, an Tod, Opfer, an Frankreich, an alles mögliche denke, mir fehlt jedoch ein leitender Gedanke, eine klare Sprache. Ich denke in Widersprüchen. Meine Wahrheit besteht aus Bruchstücken, und ich kann nur eines nach dem andern von ihnen betrachten. Wenn ich am Leben bleibe, will ich die Nacht zum Überlegen abwarten. Die heißgeliebte Nacht. Nachts, da schläft der menschliche Verstand, und die Dinge sind nur noch ganz einfach da. Alles, was wirklich wichtig ist, gewinnt wieder Gestalt, ersteht neu aus der zerstörenden Zergliederung des Tages. Der Mensch setzt seine Bruchstücke aneinander und wird wieder geruhsam, einem Baume gleich.
Der Tag gilt häuslichen Auseinandersetzungen, kommt aber die Nacht, dann mündet der Streit in die große Liebe ein. Denn die Liebe ist größer als all der Schwall von Worten. Und unter dem gestirnten Himmel lehnt sich der Mann ans Fenster, tritt wieder ein für seine schlafenden Kinder, sein Brot für morgen, sein schlummerndes Weib, das schwach, zart wie ein Hauch dort ruht. Um Liebe streitet sich niemand. Sie ist einfach da. Daß doch die Nacht käme und mir jene Klarheit brächte, die der Liebe würdig ist! Damit Gesittung, Menschenlos und Drang nach Liebe für mein Land mein Denken erfülle! Auf daß ich der Wahrheit dienen mag, die bezwingt, auch wenn sie noch nicht in Worte faßbar ist...
Nun bin ich ganz dem Christen gleich, den die Gnade verworfen hat. Wohl spiele ich mit Dutertre meine Rolle in Ehren — das versteht sich —, doch so, wie einer Riten achtet, die ihren Inhalt verloren haben, nachdem die Gottheit aus ihnen entwichen ist. Ich warte auf die Nacht. Wenn ich noch am Leben bleibe, werde ich mich ein wenig auf der Landstraße ergehen, die durch das Dorf führt. Meine geliebte Einsamkeit wird mich umfangen. Dann werde ich zu begreifen suchen, warum ich sterben soll.
2
ICH ERWACHE aus meinem Traum. Der Kommandeur überrascht mich mit einem seltsamen Vorschlag:
«Wenn Ihnen dieser Auftrag lästig ist... Wenn Sie sich nicht in Form fühlen, dann kann ich ...»
«Aber Herr Major!»
Der Kommandeur weiß sehr wohl, wie absurd ein solcher Vorschlag ist. Doch wenn die Besatzung vom Feindflug nicht zurückkehrt, fallen einem die ernsten Gesichter vor dem Abflug wieder ein. Dieser Ernst wird dann als Zeichen einer Vorahnung gedeutet. Man wirft sich vor, daß man nicht darauf geachtet habe.
Das Bedenken des Kommandeurs erinnert mich an Israel. Vorgestern rauchte ich am Fenster des Nachrichtenraumes. Als ich Israel vom Fenster aus gewahrte, hatte er es sehr eilig. Seine Nase war ganz rot, eine große, richtig jüdische, dabei feuerrote Nase. Diese rote Nase Israels fiel mir plötzlich auf.
Ich war diesem Israel, dessen Nase ich bemerkte, herzlich zugetan. Er war einer der schneidigsten Fliegerkameraden der Gruppe. Einer der schneidigsten und dabei einer der bescheidensten. Sie hatten ihm so oft von der jüdischen Vorsicht gesprochen, daß er seinen Schneid für Vorsicht halten mußte. Siegen heißt vorsichtig sein. Seine große rote Nase fiel mir also auf. Bei der Schnelligkeit, mit der Israel und seine Nase vorbeieilten, leuchtete sie nur einen kurzen Augenblick. Ganz im Ernst drehte ich mich nach Gavoille um:
«Wo hat er bloß so eine Nase her?»
«Die hat er von seiner Mutter», antwortete Gavoille. Doch fuhr er fort:
«Ein verrückter Auftrag zum Tiefflug. Er startet.»
«Ach!»
Und abends, als wir es aufgaben, auf Israels Rückkehr zu warten, erinnerte ich mich noch ganz genau an diese Nase, die mitten in einem völlig bewegungslosen Gesicht ganz für sich allein in geradezu genialischer Weise das tiefste Nachdenken ausdrückte. Hätte ich den Befehl zum Abflug Israels zu geben gehabt, dann wäre mir das Bild dieser Nase noch lange wie ein Vorwurf nachgegangen. Sicherlich hatte Israel beim Startbefehl nichts weiter geantwortet als: «Jawohl, Herr Major. Gewiß, Herr Major. Verstanden, Herr Major.» Sicherlich hatte Israel mit keinem Muskel seines Gesichts gezuckt. Doch langsam, heimlich, verräterisch war die Nase angegangen. Seine Gesichtszüge konnte Israel beherrschen, doch nicht die Farbe seiner Nase. Das hatte die Nase denn auch wahrgenommen und manifestierte schweigend ganz für sich. Ohne daß Israel es merkte, hatte seine Nase dem Kommandeur ihre starke Mißbilligung ausgedrückt.
Aus diesem Grunde will der Kommandeur vielleicht keine Leute starten lassen, von denen er die Empfindung hat, sie fühlten sich von schlimmen Vorahnungen bedrückt. Zwar täuschen Vorahnungen fast immer, doch geben sie militärischen Befehlen einen Beigeschmack nach Verurteilung. Alias ist ein Chef, kein Richter.
So war es auch neulich mit Feldwebel T.
So mutig Israel war, so angstbesessen war T. Er ist der einzige Mann, den ich kennengelernt habe, der wirklich Furcht empfand. Ein militärischer Befehl, den T. erhielt, löste in ihm einen bizarren Schwindelanfall aus. Die Sache vollzog sich ganz einfach, unabänderlich und langsam. Nach und nach wurde T. von unten nach oben ganz steif. Aus seinem Gesicht war jeder Ausdruck wie weggewischt. Und seine Augen begannen zu glimmen.
Im Gegensatz zu Israel, an dem seine Nase mir so verdutzt, verdutzt und gleichzeitig über Israels möglichen Tod empört vorkam, zeigte T. keinerlei innere Bewegungen. Er reagierte überhaupt nicht, er sah aus wie ein Vogel in der Mauser. Hatte man mit T. zu Ende geredet, dann merkte man, daß man ganz einfach die Angst in ihm heraufbeschworen hatte. Ganz allmählich überzog die Angst glimmend sein ganzes Gesicht. Von da ab war T. wie unzugänglich. Man fühlte, wie sich zwischen dem All und ihm eine leere, öde Gleichgültigkeit ausbreitete. Nirgends sonst bei einem Menschen auf der ganzen Welt habe ich diese Form des Außersichseins kennengelernt.
«Ich hätte ihn damals einfach nicht starten lassen sollen», sagte der Kommandeur hinterher.
Als der Kommandeur damals T. den Flugauftrag erteilte, war dieser nicht nur blaß geworden, sondern hatte sogar zu lächeln begonnen. Ganz einfach zu lächeln. Vielleicht handeln so die Gemarterten, wenn der Folterknecht sein Maß wirklich überschreitet.
«Sie fühlen sich nicht recht wohl. Ein anderer wird an Ihrer Stelle...»
«Nein, Herr Major. Ich bin an der Reihe, ich bin dran.» Und T. steht vor dem Kommandeur stramm und sieht ihm unbeweglich ins Gesicht.
«Wenn Sie sich aber nicht ganz in der Hand haben...»
«Ich bin an der Reihe, Herr Major, ich bin dran.»
«Aber so hören Sie doch, T. ...»
«Herr Major...»
Der Mann war wie versteinert.
Und Alias schloß:
«Da hab ich ihn eben starten lassen.»
Was dann kam, hat sich nie ganz aufklären lassen. T., der als Bordschütze eingesetzt war, wurde von einem feindlichen Jäger angegriffen. Doch der Jäger bekam Ladehemmung und drehte ab. Der Flugzeugführer und T. unterhielten sich miteinander, bis sie in die Nähe ihres Landeplatzes kamen, ohne daß dem Flugzeugführer irgend etwas Ungewöhnliches auffiel. Doch fünf Minuten vor der Landung bekam er keine Antwort mehr.
Abends fand man T. auf. Sein Kopf war von der hinteren Stabilisierungsfläche des Flugzeuges gespalten worden. Er war unter den unglücklichsten Bedingungen bei voller Geschwindigkeit mit dem Fallschirm über eigenem Gebiet abgesprungen, als überhaupt keine Gefahr mehr drohte. Das Intermezzo mit dem Jäger hatte ihn unwiderstehlich angezogen.
«Machen Sie sich einsatzbereit», sagte uns der Kommandeur, «und starten Sie um 5 Uhr 30.»
«Ich melde mich ab, Herr Major.»
Der Kommandeur antwortete mit einer vagen Geste. Ist es Aberglaube? Meine Zigarette ist ausgegangen, und da ich vergebens in meinen Taschen suche, sagt er: «Warum haben Sie denn nie Streichhölzer bei sich?» Stimmt. Und nach diesem Abschied gehe ich durch die Türe und frage mich dabei: «Warum habe ich denn nie Streichhölzer bei mir?»
«Der Auftrag paßt ihm gar nicht», sagt Dutertre.
Ich denke: Es ist ihm ganz egal. Doch meine ich gar nicht Alias bei dieser grundlosen Übellaune. Zu meiner Bestürzung werde ich mir über etwas klar, was keiner zugeben will: Das Geistige lebt nur mit Unterbrechungen. Die Intelligenz allein lebt dauernd oder doch nahezu ständig. Meine Fähigkeiten im Zergliedern schwanken wenig. Der Geist dagegen betrachtet nicht die Dinge, sondern den Sinn, der sie miteinander verknüpft. Er liest das Gesicht durch und durch. Und eben der Geist wechselt von völliger Hellsicht zu völliger Blindheit. Für den, der sein Gut liebt, kommt die Stunde, da er in ihm nur noch wahllose Dinge angehäuft findet. Wer seine Frau liebt, für den kommt der Augenblick, da er in der Liebe nur noch Sorgen, Widrigkeiten, Zwang erkennt. Wer eine bestimmte Musik liebt, für den schlägt die Stunde, wo sie nicht mehr zu ihm findet. Kommt die Stunde, wie eben jetzt, wo ich mein Land nicht mehr verstehe. Eine Heimat ist nicht die Summe von Landschaften, Bräuchen, Dingen, die mein Verstand jederzeit zu erfassen vermag. Sie ist ein lebendiges Wesen. Es kommt die Stunde, wo ich entdecke, daß ich für lebendige Wesen blind bin.
Kommandeur Alias hat die Nacht beim General verbracht und über reine Logik diskutiert. Eine Logik aber zerrüttet das Leben des Geistes. Auf der Straße hat er sich dann in endlosen Verstopfungen erschöpft. Bei der Rückkehr zur Gruppe ist er auf hunderterlei äußerliche Schwierigkeiten gestoßen, die einem zusetzen, wie sich ein Bergrutsch tausendfältig auswirkt, der sich nicht aufhalten läßt. Schließlich hat er uns kommen lassen und uns in ein unmögliches Unternehmen geworfen. Wir sind weiter nichts als Objekte in dem allgemeinen Tohuwabohu. Für ihn sind wir nicht Saint-Exupery oder Dutertre mit ihrer eigenen Gabe, die Dinge zu betrachten oder nicht zu betrachten, zu denken, zu marschieren, zu trinken und zu lachen. Wir sind Bruchstücke eines großen Baues, den in seinem Zusammenhalt zu erkennen mehr Zeit, mehr Schweigen und mehr Abstand erfordert. Hätte ich ein nervöses Zucken im Gesicht gehabt, würde Alias nur dieses Zucken erkennen. Er würde über Arras nur diese Vorstellung eines Gesichtszuckens schicken. In dem Gewirr der Probleme, die da auftauchen, in diesem Zusammenbruch zerfallen wir selbst in Einzelteile. Hier eine Stimme, da eine Nase, dort dieses Zucken. Und die Bruchstücke sind ohne Gefühl.
Es geht hier nicht um Kommandeur Alias, sondern um alle Menschen. Wenn wir einen Toten beerdigen, lieben wir ihn, doch mit dem Tod selbst haben wir keine Berührung. Der Tod ist etwas Großes. Er knüpft neue Bande mit den Ideen, Dingen, den Gewohnheiten des Toten. Er ordnet die Welt neu. Scheinbar hat sich nichts geändert, und doch ist alles anders geworden. Die Seiten des Buches sind wohl noch die gleichen, aber der Sinn des Buches fehlt. Um ein Verständnis für den Tod zu bekommen, müssen wir uns die Stunden vorstellen, wo wir des Toten bedürfen. Dann fehlt er uns. Müssen wir uns die Stunden vorstellen, da er uns gebraucht hätte. Aber er braucht uns nicht mehr. Müssen wir uns die Stunde eines Freundesbesuches vorstellen. Und wir finden sie inhaltslos. Wir müssen das Leben aus der Perspektive betrachten. Aber am Tag der Beerdigung sind Perspektive und Abstand dahin. Der Tote besteht nur noch aus Bruchstücken. Am Tage seiner Beerdigung finden wir keine rechte Zeit vor lauter Herumstehen, Händeschütteln bei wahren und falschen Freunden, äußerlichen Beschäftigungen. Erst morgen wird der Tote sterben, wenn es still geworden ist. Dann zeigt er sich in seiner Ganzheit und reißt sich erst völlig von unserem Wesen los. Dann schreien wir auf; denn dann erst geht er wirklich von uns, und wir können ihn nicht halten.