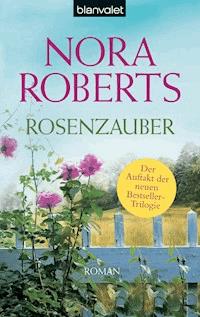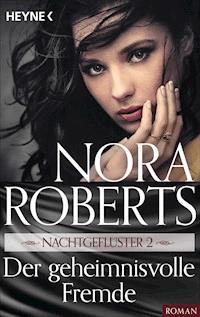
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Nachtgeflüster-Serie
- Sprache: Deutsch
Die Erfolgsserie von Nora Roberts: Spannend, geheimnisvoll, aufregend wie ein Flüstern in der Nacht
Als die junge Anwältin Deborah O’Roarke auf dem Nachhauseweg überfallen wird, eilt ihr ein maskierter Fremder zu Hilfe – und verschwindet gleich wieder im Dunkel der Nacht. Der Schattenmann wird Nemesis genannt und will die Stadt vom Verbrechen erlösen, koste es, was es wolle. Die idealistische Deborah kämpft auf ihre Weise gegen die Kriminalität: mit dem Gesetz. Sie teilt seine Leidenschaft für Gerechtigkeit, aber nicht seine unkonventionellen Methoden. Dennoch verdankt sie ihm ihr Leben und empfindet eine tiefe Sehnsucht nach dem mysteriösen Mann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nora Roberts
Nachtgeflüster 2
Der geheimnisvolle Fremde
Roman
Aus dem Amerikanischen von M. R. Heinze
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
1. KAPITEL
Er durchstreifte die Nacht. Allein. Rastlos. Und immer bereit. In Schwarz gekleidet und maskiert, war er ein Schatten unter Schatten, wie ein Raunen zwischen dem Wispern und Flüstern der Dunkelheit.
Er hielt ständig Ausschau nach denjenigen, die den Hilflosen und Verwundbaren nachstellten. Unbekannt, ungesehen, unerwünscht – so verfolgte er die Jäger im dampfenden Dschungel der Großstadt. Ungehindert bewegte er sich in den finsteren Gegenden, in ausweglosen Einfahrten und in Straßen, in denen die Gewalt herrschte. Wie Rauch trieb er über hoch aufragende Dachfirste und hinunter in feuchte Keller.
Wenn er gebraucht wurde, brach er wie Donner herein, voller Macht und Wut. Dann gab es nur den Blitz, das sichtbare Echo, das eine elektrische Entladung am Himmel zurückließ.
Sie nannten ihn Nemesis, und er war überall.
Er durchstreifte die Nacht, wich dem Lachen aus, dem fröhlichen Lärm von Feiernden. Stattdessen wurde er angezogen vom Wimmern und den Tränen der Einsamen und von dem hoffnungslosen Flehen der Opfer. Nacht für Nacht kleidete er sich in Schwarz, maskierte sein Gesicht und pirschte durch die wilden dunklen Straßen. Nicht für das Gesetz. Das Gesetz wurde zu leicht von denjenigen manipuliert, die es verachteten. Es wurde oft gebrochen und verdreht von denjenigen, die behaupteten, es hochzuhalten. Er wusste es, oh ja, er wusste es. Und er konnte nicht vergessen.
Wenn er unterwegs war, dann für Gerechtigkeit – für die allzu oft blinde Justitia.
Gerechtigkeit schuf Vergeltung und einen Ausgleich der Waagschalen.
Deborah O’Roarke bewegte sich rasch. Sie war immer in Eile, um mit ihren ehrgeizigen Zielen Schritt zu halten. Jetzt klackten eilte sie mit ihren gepflegten, praktischen Schuhen über die zersprungenen Bürgersteige des East Ends von Urbana. Nicht Angst trieb sie zu ihrem Wagen zurück, obwohl das East End für eine attraktive Frau eine gefährliche Gegend war – besonders bei Nacht. Es war die Aufregung nach einem Erfolg. In ihrer Eigenschaft als stellvertretende Staatsanwältin hatte sie soeben ein Gespräch mit einem Zeugen geführt, der eine jener Schießereien aus fahrendem Auto beobachtet hatte, die in Urbana zunehmend zu einer Plage wurden. In Gedanken war sie ausschließlich bei dem Bericht, den sie schreiben musste, sobald sie in ihr Büro zurückgefahren war. Erst dann konnten die Räder der Justiz sich zu drehen beginnen. Sie glaubte an die Justiz, an jeden einzelnen ihrer geduldigen, hartnäckigen und systematischen Schritte. Die Mörder des jungen Rico Mendez würden sich für ihr Verbrechen verantworten müssen. Und mit ein wenig Glück würde sie die Anklage vertreten können.
Vor dem baufälligen Gebäude, in dem Deborah gerade eine Stunde lang hartnäckig zwei verängstigte Jungen nach Informationen ausgequetscht hatte, war die Straße dunkel. Bis auf zwei Straßenlaternen waren alle Lampen zerborsten, ihre Reste lagen nutzlos auf dem mit Rissen übersäten Bürgersteig. Der Mond lieferte nur gelegentlich etwas Licht. Deborah wusste, dass die Schatten in den engen Hauseingängen Betrunkene, Dealer oder Prostituierte waren. Mehr als einmal hatte sie sich ins Gedächtnis gerufen, dass auch sie in einem dieser traurigen, heruntergekommenen Gebäude hätte landen können – wäre da nicht die wilde Entschlossenheit ihrer älteren Schwester gewesen, die dafür gesorgt hatte, dass sie ein schönes Zuhause und eine gute Ausbildung bekam.
Jedes Mal, wenn Deborah einen Fall zur Verhandlung brachte, hatte sie das Gefühl, sie würde einen Teil dieser Schuld zurückzahlen.
Mit langen, zielstrebigen Schritten ging sie auf ihren Wagen zu. Sie wollte gerade einsteigen, als jemand sie von hinten packte.
»Ooh, Baby, du bist ja süß.«
Der Mann war zwanzig Zentimeter größer als sie und sehr muskulös. Und er stank, aber nicht nach Fusel. In dem Sekundenbruchteil, den sie brauchte, um in seinen glasigen Augen zu lesen, begriff sie, dass er nicht mit Whisky, sondern mit chemischen Drogen vollgepumpt war. Mit Aufputschmitteln, die ihn schnell statt träge machten. Sie nahm beide Hände zur Hilfe und rammte ihm ihren ledernen Aktenkoffer in den Unterleib. Er grunzte und lockerte seinen Griff. Deborah riss sich los und rannte, wobei sie hektisch nach ihren Schlüsseln suchte.
Als sie ihre Hand um das klirrende Metall in der Jackentasche schloss, packte er sie. Seine Finger gruben sich in den Kragen ihrer Jacke. Sie hörte den Stoff reißen und drehte sich entschlossen um. Dann sah sie das Springmesser, die Klinge, die einmal aufblitzte, bevor sie sich gegen die weiche Haut an ihrem Hals presste.
»Ich hab dich!«, sagte er und lachte.
Deborah erstarrte, wagte kaum zu atmen. In seinen Augen erkannte sie eine bösartige Freude. Dieser Mann wäre für Bitten oder Argumente taub. Dennoch sprach sie leise und ruhig.
»Ich habe nur fünfundzwanzig Dollar.«
Ohne die Messerspitze von ihrem Hals zu nehmen, beugte er sich vertraulich zu ihr hinunter. »Oh nein, Baby, du hast viel mehr als fünfundzwanzig Dollar.« Er griff ihr ins Haar und riss daran. Als sie aufschrie, zerrte er sie in eine noch dunklere Einfahrt. »Na los, schrei!« Er lachte ihr höhnisch ins Ohr. »Ich mag’s, wenn ihr schreit. Na los.« Er ritzte sie mit der Klinge am Hals. »Schrei!«
Sie tat es. Ihr Schrei klang durch die finstere Straße und hallte in den Häuserschluchten wider. Aus den Straßen ertönten Anfeuerungsrufe – für den Angreifer. Hinter verdunkelten Fenstern ließen Leute ihre Lichter ausgeschaltet und taten, als hätten sie nichts gehört.
Als er sie gegen die feuchte Mauer des Durchgangs stieß, war Deborah vor Entsetzen zu Eis erstarrt.
Ich werde zu einer Zahl in der Statistik, dachte die dumpf. Nur eine weitere Zahl in der stetig wachsenden Opferstatistik.
Langsam, doch mit wachsender Macht fraß sich Wut durch den eisigen Schirm ihrer Angst. Sie wollte sich nicht winden und wimmern. Sie wollte sich nicht kampflos unterwerfen. Erst jetzt spürte sie den scharfen Druck ihrer Schlüssel, die sie immer noch fest umklammerte. Sie konzentrierte sich und schob die Spitzen zwischen ihre steifen Finger, sog den Atem ein und versuchte, ihre ganze Kraft in den Arm zu legen.
Gerade wollte sie den Arm aus der Tasche ziehen, da schien sich der Angreifer in die Luft zu erheben. Auf einmal flog er mit rudernden Armen gegen ein paar Mülltonnen.
Deborah befahl ihren Beinen zu laufen. So rasend wie ihr Herz jetzt schlug, war sie sicher, im Handumdrehen in ihrem Wagen sein zu können, die Türen verschlossen, den Motor gestartet. Doch dann sah sie ihn.
Er war schwarz gekleidet, ein langer, schlanker Schatten zwischen Schatten. Er stand über dem messerschwingenden Junkie, die Beine gespreizt, den Körper angespannt.
»Bleiben Sie weg«, befahl er, als sie automatisch einen Schritt vorwärts tat. Seine Stimme war teils ein Flüstern, teils ein Grollen.
»Ich denke …«
»Denken Sie nicht«, befahl er scharf, ohne sie eines Blickes zu würdigen.
Noch während sie sich über seinen Ton ärgerte, sprang der Junkie heulend auf und ließ sein Messer einen tödlichen Bogen beschreiben. Deborah beobachtete benommenen und fasziniert, wie etwas vor ihren Augen aufblitzte. Sie hörte einen Schmerzensschrei und das Klappern des Messers, das auf dem Beton davon schlitterte.
Schneller als man Atem holen kann, stand der Mann in Schwarz wie zuvor da. Der Junkie lag auf den Knien und hielt sich stöhnend den Magen.
»Das war …«, Deborah suchte in ihren durcheinanderwirbelnden Gedanken nach einem Wort, »… beeindruckend. Ich … ich schlage vor, dass wir die Polizei rufen.«
Ihr Retter ignorierte sie weiterhin, während er aus seiner Tasche ein Seil holte und dem noch immer stöhnenden Drogenabhängigen Hände und Füße zusammenband. Er hob das Messer auf, drückte einen Knopf. Fast lautlos verschwand die Klinge. Erst jetzt drehte er sich zu ihr um.
Die Tränen trocknen bereits auf ihren Wangen. Und obwohl ihr Atem leicht stockte, schien sie nicht in Ohnmacht zu fallen oder hysterisch zu werden. Er konnte nicht anders, als ihre Ruhe zu bewundern.
Sie ist außerordentlich schön, stellte er leidenschaftslos fest. Ihre Haut hob sich hell wie Elfenbein von einer zerzausten Wolke pechschwarzen Haars ab. Ihre Züge waren weich, zart, fast zerbrechlich. Es sei denn, man schaute ihr in die Augen. Darin fand man eine Härte und Entschlossenheit, die dem Zittern ihres schlanken Körper widersprach.
Ihre Jacke war zerrissen, die Bluse war aufgeschlitzt worden und enthüllte eisblaue Spitze und Seide eines Unterkleides. Ein interessanter Kontrast zu dem schlichten, fast maskulinen Businesskostüm.
Er taxierte sie nicht wie ein Mann eine Frau, sondern so, wie er es mit unzähligen anderen Opfern unzähliger Jäger getan hatte. Die unerwartete und sehr natürliche Reaktion, die er verspürte, irritierte ihn. So etwas war viel gefährlicher als jedes Springmesser.
»Sind Sie verletzt?« Seine Stimme war leise und emotionslos, und er hielt sich im Schatten.
»Nein. Nein, eigentlich nicht.« Es würde eine Menge wunder Stellen geben, sowohl auf ihrer Haut als auch auf ihrer Seele, doch darum wollte sie sich später kümmern. »Nur ein wenig verstört. Ich wollte Ihnen danken, dass …« Während sie sprach, war sie näher zu ihm getreten. In dem schwachen Widerschein der Straßenbeleuchtung erkannte sie, dass sein Gesicht maskiert war. »Nemesis«, murmelte sie. »Ich dachte, Sie wären nur das Produkt einer überdrehten Fantasie.«
»Ich bin so real wie er.« Mit einem Kopfnicken deutete er auf die stöhnende Gestalt zwischen den Abfällen. An der Kehle der jungen Frau entdeckte er einen dünnen Blutfaden. Aus Gründen, die zu verstehen er gar nicht versuchte, machte es ihn wütend. »Was sind Sie bloß für eine Närrin?«
»Wie bitte?« Als ihre Pupillen sich weiteten, bemerkte er, dass sie blau waren. Ein elektrisierend leuchtendes Blau.
»Das hier ist die Kloake der Stadt. Sie gehören nicht hierher. Niemand mit etwas Verstand kommt hierher, sofern er eine andere Wahl hat.«
Ihr Temperament drohte mit Deborah durchzugehen, aber sie hielt es unter Kontrolle. Immerhin hatte er ihr geholfen. »Ich hatte hier etwas zu erledigen.«
»Nein«, verbesserte er sie. »Sie haben hier nichts zu erledigen, es sei denn, Sie wollen in einer Toreinfahrt vergewaltigt und ermordet werden.«
»Das wollte ich absolut nicht.« Mit dem düsteren Gesichtsausdruck trat auch ihr Südstaatenakzent stärker hervor. »Ich kann auf mich selbst aufpassen.«
Sein Blick fiel auf ihre zerschnittene Bluse und kehrte zu ihrem Gesicht zurück. »Offensichtlich.«
Sie konnte die Farbe seiner Augen nicht erkennen. In dem trüben Licht wirkten sie schwarz. Aber in ihnen konnte sie Zurückweisung und eine gewisse Arroganz lesen. »Ich habe mich schon für Ihre Hilfe bedankt, obwohl ich keine Hilfe brauchte. Ich war gerade dabei, diesen schleimigen Kerl selbst zu erledigen.«
»Wirklich?«
»Wirklich. Ich wollte ihm die Augen auskratzen.« Sie hielt ihre Schlüssel hoch, die wie tödliche Spitzen nach außen ragten. »Damit.«
Wieder betrachtet er sie und nickte langsam. »Ja, ich glaube, dazu wären Sie imstande.«
»Verdammt richtig!«
»Dann scheine ich meine Zeit verschwendet zu haben.« Er zog ein schwarzes Stück Stoff aus der Tasche. Nachdem er das Messer darin eingewickelt hatte, reichte er es ihr. »Sie werden das als Beweis brauchen.«
In dem Moment, in dem sie das Messer berührte, erinnerte sie sich an ihr Entsetzen und die Hilflosigkeit. Mit einer leisen Verwünschung unterdrückte sie ihren Ärger. Wer immer er war, was immer er war, er hatte sein Leben riskiert, um ihr zu helfen. »Ich bin Ihnen dankbar.«
»Ich will keine Dankbarkeit.«
Sie hob das Kinn. »Was dann?«
Er sah sie an, sah in sie hinein. Etwas trat in seine Augen und schwand wieder, etwas, das ihr erneut einen eisigen Schauer über die Haut jagte, sowie sie seine Antwort hörte. »Gerechtigkeit.«
»Das ist nicht der richtige Weg«, setzte sie an.
»Es ist mein Weg. Wollten Sie nicht die Polizei rufen?«
»Ja.« Sie presste die Hand gegen ihre Schläfe. Sie war etwas benommen, und ihr war mehr als nur ein wenig übel. Das war eindeutig nicht der richtige Zeitpunkt, um mit einem kampfeslustigen maskierten Mann über Moral und die Arbeitsweise der Justiz zu diskutieren. »Ich habe ein Telefon im Auto.«
»Dann schlage ich vor, dass Sie es benützen.«
»In Ordnung.« Sie war zu müde, um zu widersprechen. Fröstelnd verließ sie die Einfahrt, hob ihren Aktenkoffer auf und verstaute erleichtert das Springmesser darin.
Nachdem sie 911 gerufen und ihren Standort und die Lage geschildert hatte, kehrte sie zu der Einfahrt zurück.
»Sie schicken einen Streifenwagen.« Erschöpft strich sie sich das Haar aus dem Gesicht. Sie schaute den Junkie an, der sich auf dem Beton zusammengerollt hatte. Seine Augen waren groß und der Blick wild. Nemesis hatte ihm angekündigt, was passieren würde, sollte er noch einmal bei einer versuchten Vergewaltigung erwischt werden.
Selbst durch den Drogennebel hindurch musste die Drohung sehr finster geklungen haben.
»Hallo?« Mit einem verwirrten Stirnrunzeln sah Deborah sich in der Einfahrt um.
Nemesis war verschwunden.
»Verdammt, wo ist er hin?« Sie atmete tief aus und lehnte sich gegen die feuchte Mauer. Sie war noch nicht mit ihm fertig, noch lange nicht.
Er war ihr so nahe, dass er sie fast berühren konnte, dennoch bemerkte sie ihn nicht. Das war seine besondere Fähigkeit, die Wiedergutmachung für verlorene Tage.
Er streckte die Hand nicht aus und fragte sich, warum er überhaupt den Wunsch danach verspürte. Er beobachtete sie bloß und prägte sich die Form ihres Gesichts ein, ihre Haut, die Farbe und den Schimmer ihres Haars, das sich sanft um ihren Kopf schmiegte.
Wäre er ein romantischer Mann, hätte er in Begriffen der Poesie oder Musik gedacht. So aber sagte er sich, dass er nur abwartete, bis sie in Sicherheit war.
Als eine Sirene die Nacht durchschnitt, sah er, wie die Frau die Maske der Beherrschung wiederherstellte, Schicht um Schicht. Sie tat tiefe, beruhigende Atemzüge, während sie ihre ruinierte Jacke über der zerschnittenen Bluse zuknöpfte. Mit einem letzten Atemzug verstärkte sie ihren Griff um den Aktenkoffer, reckte ihr Kinn hoch und ging mit selbstsicheren Schritten zur Mündung der Einfahrt.
Während er allein zurückblieb, fing er den subtil erotischen Duft ihres Parfüms auf.
Zum ersten Mal seit vier Jahren verspürte er den süßen und stillen Schmerz des Verlangens.
Deborah war gar nicht in der Stimmung für eine Party. In ihrer Fantasie war sie nicht in ein trägerloses rotes Kleid eingezwängt, dessen Korsage ihr die Luft abdrückte. Sie trug keine Schuhe mit acht Zentimeter hohen Absätzen. Und sie lächelte nicht, bis sie meinte, ihr Gesicht würde zerspringen. In ihrer Fantasie lag sie mit einer großen Tasse heißer Schokolade und einem guten Krimi in der Badewanne.
Es war immerhin eine Feier, die von Arlo Stuart gegeben wurde, dem Hotelmagnaten, und zwar als Wahlkampfparty für Tucker Fields, den Bürgermeister von Urbana. Stuart hoffte ebenso wie die gegenwärtige Stadtverwaltung, dass der Wahlkampf im November mit einer Wiederwahl des Bürgermeisters enden würde.
»Himmel, du siehst großartig aus.« Jerry Bower, schlank und attraktiv in seinem Smoking, das blonde Haar in Wellen um sein gebräuntes freundliches Gesicht gelegt, blieb neben Deborah stehen, um ihr einen raschen Kuss auf die Wange zu drücken. »Tut mir leid, dass ich keine Zeit zum Reden hatte. Ich musste so viele Leute begrüßen und mit ihnen sprechen.«
»Immer viel zu tun für die rechte Hand des Big Boss.« Sie lächelte und prostete ihm zu. »Eine schöne Party.«
»Stuart hat alle Reserven mobilisiert.« Mit dem Auge eines Politikers betrachtete Jerry die Menge. Die Mischung aus Reichen, Berühmten und Einflussreichen gefiel ihm. Es gab natürlich auch andere Aspekte des Wahlkampfes: sich zeigen, Kontake knüpfen mit Geschäftseigentümern und Fabrikarbeitern, ferner Pressekonferenzen, Reden und Erklärungen. Doch Jerry hatte verstanden, dass man die Vorteile nutzen sollte, die es mit sich brachte, einen Teil seines Achtzehnstundentages mit dem Naschen von Kanapees zwischen teuer gekleideten Menschen zu verbringen.
»Ich bin gebührend beeindruckt«, versicherte Deborah.
»Schön, aber es ist deine Stimme, die wir wollen.«
»Ihr könnt sie bekommen.«
»Wie fühlst du dich?« Er nutzte die Gelegenheit und begann, einen Teller mit Horsd’œuvres zu füllen.
»Gut.« Sie blickte lässig auf die verblassenden blauen Flecke der Prellung an ihrem Unterarm. Andere, farbige Male waren unter dem roten Seidenkleid verborgen.
»Wirklich?«
Erneut lächelte sie. »Wirklich. Es war eine Erfahrung, die ich nicht wiederholen möchte, aber sie hat mir klargemacht, absolut klargemacht, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, bevor die Straßen von Urbana sicher sind.«
»Du hättest nicht da draußen sein sollen«, murmelte Jerry.
Er hätte genauso gut versuchen können, ihr den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Ihre Augen blitzten, ihre Wangen röteten sich, und sie reckte das Kinn vor. »Warum? Warum sollte es einen Ort geben, irgendeinen Ort in der Stadt, an dem man sich nicht sicher bewegen kann? Sollen wir einfach die Tatsache hinnehmen, dass es Teile von Urbana gibt, in denen sich anständige Menschen nicht zeigen dürfen? Wenn wir …«
»Warte, warte!« Er hob ergeben eine Hand. »Die einzige Person, die man in der Politik nicht mühelos niederreden kann, ist ein Jurist. Ich stimme dir ja zu, in Ordnung?« Er schnappte sich ein Glas Wein von einem vorbeieilenden Kellner und erinnerte sich, dass es sein einziges an diesem langen Abend sein könnte. »Ich habe lediglich eine Feststellung gemacht. Das heißt nicht, dass ich die Zustände in unserer Stadt richtig finde, aber es ist wahr.«
»Es sollte nicht wahr sein.« Ihre Augen hatten sich aus Ärger und Frustration verdunkelt.
»Der Bürgermeister hat eine harte Kampagne gegen das Verbrechen gestartet«, erinnerte Jerry sie und nickte lächelnd den vorbeischlendernden Wählern zu. »Niemand in dieser Stadt kennt die Statistiken besser als ich. Sie sind hässlich, kein Zweifel, aber wir werden die Zahlen senken. Es dauert nur seine Zeit.«
»Ja.« Seufzend zog sie sich von dem drohenden Streit zurück, den sie mit Jerry bereits unzählige Male ausgefochten hatte. »Aber es dauert zu lange.«
In den nächsten Minuten schlang Deborah Kanapees hinunter und ordnete in Gedanken den Gesichtern, die den Royal Stuart Ballsaal erfüllten, Namen und Steuerklassen zu. Jerrys kluge und prägnante Kommentare ließen sie leise auflachen. Als sie einen Rundgang durch die Menge begannen, hakte sie sich lässig bei ihm unter. Es war ein Zufall, dass sie den Kopf wandte und sich in diesem Meer von Menschen auf ein einzelnes Gesicht konzentrierte.
Der Mann stand in einer Gruppe von fünf oder sechs Personen, wobei ihm zwei schöne Frauen förmlich an den Armen hingen. Attraktiv, ja, dachte Deborah. Allerdings war der Saal voll von attraktiven Männern. Sein dichtes, dunkles Haar umrahmte ein schmales, etwas durchgeistigtes Gesicht. Sie sah seine ausgeprägten Wangenknochen und tief liegenden Augen – braune Augen, dunkel wie Schokolade. Im Moment blickten sie leicht gelangweilt drein. Sein Mund war voll und verzog sich gerade in der leichten Andeutung eines Lächelns.
Er trug den Smoking, als wäre er darin geboren worden. Leicht, lässig. Mit dem kleinen Finger strich er eine feurige Locke von der Wange der Rothaarigen neben ihm, während er sich näher zu ihr herunterbeugte. Sein Lächeln wurde breiter, während sie etwas sagte.
Und dann, ohne den Kopf zu drehen, ließ er seinen Blick durch den Ballsaal schweifen. Gleichgültig betrachtete er die Umstehenden, bis sein Blick an Deborah hängen blieb.
»Jerry, wer ist das? Dort drüben. Mit der Rothaarigen auf der einen Seite und der Blondine auf der anderen.«
Jerry schaute hinüber, verzog das Gesicht und zuckte mit den Schultern. »Überrascht mich, dass er nicht auch noch eine Brünette auf den Schultern sitzen hat. Frauen pflegen an ihm zu kleben, als wäre sein Smoking aus Fliegenpapier.«
Sie brauchte nicht gesagt zu bekommen, was sie mit eigenen Augen sah. »Wer ist das?«
»Guthrie, Gage Guthrie.«
Sie kniff die Augen ein wenig zusammen und spitzte die Lippen. »Wieso kommt mir der Name bekannt vor?«
»Der Gesellschaftsteil der ›World‹ ist damit jeden Tag buchstäblich zugekleistert.«
»Ich lese den Gesellschaftsteil nicht.« Sie war sich wohl bewusst, dass es unhöflich war, trotzdem starrte Deborah hartnäckig auf den Mann auf der anderen Seite des Saals. »Ich kenne ihn«, murmelte sie. »Ich kann ihn nur nicht einordnen.«
»Du hast wahrscheinlich seine Geschichte gehört. Er war Cop.«
»Ein Cop?« Deborahs Augenbrauen hoben sich überrascht. Er fühlte sich viel zu wohl, wirkte viel zu sehr wie ein Teil der reichen und privilegierten Umgebung, um ein Cop zu sein.
»Offenbar sogar ein guter, genau hier in Urbana. Vor ein paar Jahren gerieten er und sein Partner in Schwierigkeiten. Große Schwierigkeiten. Sein Partner wurde getötet. Guthrie wurde für tot gehalten und liegen gelassen.«
Etwas blitzte in ihrem Gedächtnis auf. »Jetzt erinnere ich mich. Ich habe seine Geschichte verfolgt. Lieber Himmel, er lag im Koma etwa …«
»Neun oder zehn Monate«, ergänzte Jerry. »Sie hatten ihn an lebenserhaltende Geräte angeschlossen, und als sie ihn schon aufgeben wollten, öffnete er die Augen und kam ins Leben zurück. Er konnte nicht mehr im Außendienst arbeiten, und wollte keinen Schreibtischposten im Urbana Police Department. Er hat eine fette Erbschaft gemacht, während er im Koma lag. Man könnte sagen, er hat das Geld genommen und sich verdünnisiert.«
So einfach war es bestimmt nicht, dachte sie. Keine Geldsumme konnte kompensieren, was Gage Guthrie erlebt hatte. »Es muss schrecklich gewesen sein. Er hat fast ein Jahr seines Lebens verloren.«
Jerry suchte in der kleiner werdenden Auswahl auf seinem Teller nach etwas Interessantem. »Er hat die verlorene Zeit nachgeholt. Frauen finden ihn offenbar unwiderstehlich. Natürlich kann das auch etwas damit zu tun haben, dass er seine Dreimillionen-Dollar-Erbschaft in dreißig Millionen verwandelt hat.« Während er eine Garnele verspeiste, beobachtete Jerry, wie Gage Guthrie sich von der Gruppe löste und in ihre Richtung kam. »So, so«, sagte er leise. »Sieht so aus, als wäre das Interesse gegenseitig.«
Gage war sich ihrer von dem Moment an bewusst gewesen, in dem sie den Ballsaal betreten hatte. Er hatte geduldig beobachtet, wie sie sich unter die Leute mischte und sich dann zurückzog. Er hatte eine gesellige Unterhaltung weitergeführt, obwohl er jede einzelne ihrer Bewegungen genau beobachtet hatte. Er hatte gesehen, wie sie Jerry zulächelte, hatte bemerkt, wie Jerry sie geküsst und vertraulich mit der Hand ihre Schulter berührt hatte.
Er wollte herausfinden, welche Beziehung zwischen den beiden bestand.
Obgleich das gar keine Rolle spielte. Keine Rolle spielen konnte, verbesserte er sich. Gage hatte keine Zeit für sinnliche Schwarzhaarige mit intelligenten Augen. Dennoch ging er unaufhaltsam auf sie zu.
»Jerry.« Gage lächelte. »Schön, Sie wiederzusehen.«
»Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Mr Guthrie. Unterhalten Sie sich gut?«
»Natürlich.« Sein Blick wanderte von Jerry zu Deborah. »Hallo.«
Aus irgendeinem lächerlichen Grund schnürte sich ihr die Kehle zu.
»Deborah, darf ich dir Gage Guthrie vorstellen? Und das ist die stellvertretende Staatsanwältin Deborah O’Roarke.«
»Eine stellvertretende Staatsanwältin.« Gage strahlte charmant. »Es ist beruhigend zu wissen, dass die Gerechtigkeit in so schönen Händen liegt.«
»In tüchtigen Händen«, entgegnete sie. »Ich bevorzuge ›tüchtig‹.«
»Natürlich.« Auch wenn sie ihm nicht die Hand reichte, ergriff er sie und hielt sie für ein paar kurze Sekunden fest.
Pass auf! Die Warnung zuckte in dem Moment durch Deborahs Gedanken, in dem sich ihre Hände berührten.
»Wenn ich mich entschuldigen darf.« Jerry legte erneut die Hand auf Deborahs Schulter. »Der Bürgermeister gibt mir Zeichen.«
»Sicher.« Sie brachte für ihn ein Lächeln zustande, obwohl sie zu ihrer Schande eingestehen musste, dass sie ihn bereits vergessen hatte.
»Sie sind noch nicht lange in Urbana«, bemerkte Gage.
Trotz ihres Unbehagens schaute Deborah ihm direkt in die Augen. »Ungefähr anderthalb Jahre. Warum?«
»Weil ich das gewusst hätte.«
»Wirklich? Führen Sie Buch über alle stellvertretenden Staatsanwälte?«
»Nein.« Er strich mit einem Finger über den Perlenanhänger an ihrem Ohr. »Nur über die attraktiven.« Das blitzartige Misstrauen in ihren Augen amüsierte ihn. »Möchten Sie tanzen?«
»Nein.« Sie stieß einen langen, ruhigen Atemzug aus. »Nein, danke. Ich kann wirklich nicht länger bleiben, Ich muss arbeiten.«
Er sah auf seine Uhr. »Es ist schon nach zehn.«
»Das Gesetz hat keine Stechuhr, Mr Guthrie.«
»Gage. Ich fahre Sie.«
»Nein.« Eine unbegründete Panik stieg plötzlich in ihr auf. »Nein, das ist nicht nötig.«
»Wenn es nicht nötig ist, dann muss es ein Vergnügen sein.«
Er war charmant, viel zu charmant für einen Mann, der gerade eine Blondine und eine Rothaarige abgeschüttelt hatte. Deborah verspürte keine Lust, das Trio abzurunden.
»Oh nein. Bitte. Mr Guthrie, ich möchte Sie nicht von der Party fortreißen.«
»Ich bleibe nie lange auf Partys.«
»Gage.« Die Rothaarige schwebte heran und zog einen Schmollmund. Sie fasste ihn an den Arm. »Honey, du hast nicht mit mir getanzt. Kein einziges Mal.«
Deborah nutzte die Gelegenheit, um schnurstracks den Ausgang anzusteuern.
Es war albern, das räumte sie ein, aber ihr inneres Warnsystem hatte verrückt gespielt bei dem Gedanken, mit ihm in einem Auto allein zu sein. Reiner Instinkt, vermutete sie, denn oberflächlich betrachtet war Gage Guthrie ein glatter, charmanter und ansprechender Mann. Doch sie spürte etwas. Energien. Dunkle, gefährliche Energien. Deborah fand, dass sie sich schon mit genügend Problemen herumschlagen musste. Sie brauchte nicht auch noch Gage Guthrie auf die Liste zu setzen.
Sie trat in die schwüle Sommernacht hinaus.
»Soll ich Ihnen ein Taxi rufen, Miss?« fragte der Portier.
»Nein.« Gage legte seine feste Hand an ihren Ellbogen. »Danke.«
»Mr Guthrie …«, setzte sie an.
»Gage. Mein Wagen steht gleich hier, Miss O’Roarke.« Er deutete auf eine lange Limousine in schimmerndem Schwarz.
»Ein schöner Wagen«, stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, »aber ein Taxi reicht völlig für meine Bedürfnisse.«
»Aber nicht für meine.« Er nickte dem großen, massigen Mann zu, der vom Fahrersitz glitt, um die hintere Tür zu öffnen. »Die Straßen sind nachts gefährlich. Ich möchte ganz einfach sicherstellen, dass Sie dort, wo Sie hinwollen, auch sicher ankommen.«
Sie trat zurück und betrachtete ihn lange und eingehend, so wie sie das Polizeifoto eines Verdächtigen betrachtete. Er wirkte jetzt mit diesem halben Lächeln um seinen Mund nicht mehr so gefährlich wie noch vor einigen Minuten. Sie fand sogar, dass er ein wenig traurig aussah. Ein wenig einsam.
Sie wandte sich zu der Limousine um. Damit sie nicht zu nachgiebig wirkte, warf sie ihm einen scharfen Blick über die Schulter zu. »Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie hartnäckig sind, Mr Guthrie?«
»Schon oft, Miss O’Roarke.«
Er setzte sich neben sie und überreichte ihr eine langstielige rote Rose.
»Sie haben sich gut vorbereitet«, murmelte sie und fragte sich, ob die Blume für die Blondine oder die Rothaarige bestimmt gewesen war.
»Ich bemühe mich. Wohin möchten Sie fahren?«
»Zum Justizgebäude. Das ist auf der Sechsten …«
»Ich weiß, wo das ist.« Gage drückte einen Knopf, und die Glasscheibe, die sie von dem Fahrer trennte, öffnete sich lautlos. »Zum Justizgebäude, Frank.«
»Ja, Sir.« Die Scheibe schloss sich wieder und sie waren unter sich.
»Wir haben früher auf derselben Seite gearbeitet«, bemerkte Deborah.
»Welche Seite ist das?«
»Das Gesetz.«
Er wandte sich ihr zu. Seine Augen waren dunkel, fast hypnotisch und brachten sie dazu, sich zu fragen, was er gesehen hatte, als er all diese Monate in jener seltsamen Welt des Halb-am-Leben-Seins dahingetrieben war. Oder des Halb-tot-Seins.
»Sie verteidigen das Gesetz?«
»Das möchte ich doch meinen.«
»Trotzdem wären Sie nicht abgeneigt, auf einen Handel einzugehen und Anklagen zurückzunehmen.«
»Das System ist überlastet«, sagte sie abwehrend.
»Oh ja, das System.« Mit einer leichten Bewegung seiner Schultern schien er das alles abzutun. »Woher kommen Sie?«
»Denver.«
»Nein, Ihre Stimme klingt gar nicht so nach Zypressen und Magnolienblüten wie typisch für Denver.«
»Ich wurde in Georgia geboren, aber meine Schwester und ich sind ziemlich viel herumgekommen. In Denver habe ich lange gelebt, bevor ich dann in den Osten nach Urbana zog.«
Ihre Schwester, registrierte er. Nicht ihre Eltern, nicht ihre Familie, bloß ihre Schwester. Er drängte nicht weiter. Noch nicht. »Warum sind Sie hierhergekommen?«
»Weil es eine Herausforderung war. Ich wollte mein langjähriges Studium für etwas Sinnvolles nutzen. Ich möchte daran glauben, dass ich etwas bewirken kann.« Sie dachte an den Mendez-Fall und an die vier Gangmitglieder, die verhaftet worden waren und jetzt auf ihren Prozess warteten. »Ich habe etwas bewirkt.«
»Sie sind Idealistin.«
»Vielleicht. Was ist daran falsch?«
»Idealisten werden oft tragisch enttäuscht.« Er betrachtete sie einen Moment schweigend. Das Licht der Straßenlaternen und entgegenkommenden Autos fiel grell in den Wagen und entschwand wieder. Sie war schön, sowohl im Licht als auch im Schatten. Mehr als schön. In ihren Augen schimmerte eine Macht. Jene Macht, die aus der Verschmelzung von Intelligenz und Entschlossenheit stammt.
»Ich möchte Sie vor Gericht sehen«, sagte er.
Ihr Lächeln fügte der Macht und der Schönheit noch ein Element hinzu. Ehrgeiz. Es war eine sagenhafte Kombination.
»Ich bin ein Killer.«
»Darauf möchte ich wetten.«
Er wollte sie berühren, nur mit einer Fingerspitze über diese schönen weißen Schultern streichen. Er fragte sich, ob das genug wäre, nur eine Berührung. Weil er fürchtete, es könnte nicht genug sein, widerstand er. Mit Erleichterung und Frustration bemerkte er, wie die Limousine an den Straßenrand fuhr und hielt.
Deborah drehte sich um und blickte aus dem Fenster auf das alte, hoch aufragende Justizgebäude. »Das war schnell«, murmelte sie, verblüfft über ihre eigene Enttäuschung. »Danke für die Fahrt.« Als der Fahrer ihr die Tür öffnete, schwang sie die Beine ins Freie.
»Ich werde Sie wiedersehen.«
Zum zweiten Mal schaute sie ihn über die Schulter an. »Vielleicht. Gute Nacht.«
Er saß einen Moment in dem weichen Sitz, von ihrem Duft umhüllt, den sie zurückgelassen hatte.
»Nach Hause?«, wollte der Fahrer wissen.
»Nein.« Gage holte tief Luft, um sich zu beruhigen. »Bleiben Sie hier und bringen Sie sie nach Hause, wenn sie fertig ist. Ich brauche jetzt einen Spaziergang.«
2. KAPITEL
Wie ein Boxer, der von zu vielen Schlägen benommen war, kämpfte Gage sich aus dem Albtraum. Er tauchte an die Oberfläche, atemlos und schweißgebadet. Als die grässliche Übelkeit nachließ, legte er sich zurück und starrte an die verzierte Decke seines Schlafzimmers.
Fünfhundertdreiundzwanzig Rosetten waren in den Stuck geschnitten. Er hatte sie Tag für Tag gezählt während seiner langen und zähen Genesung. Fast wie bei einer Beschwörung begann er sie erneut zu zählen und wartete darauf, dass sein Pulsschlag sich beruhigte.