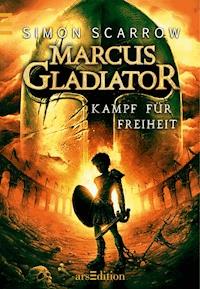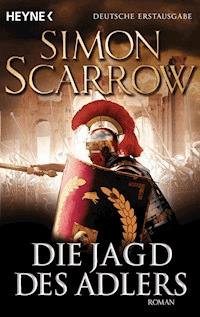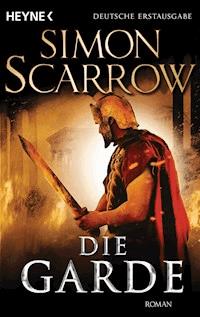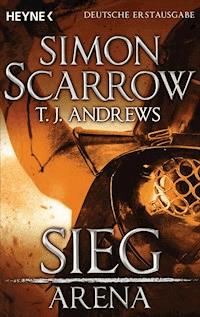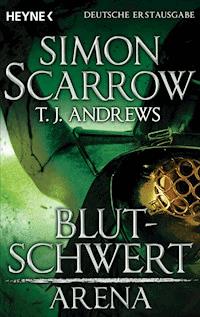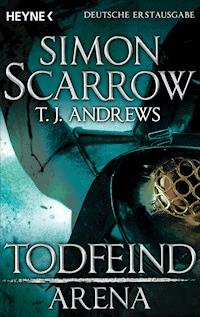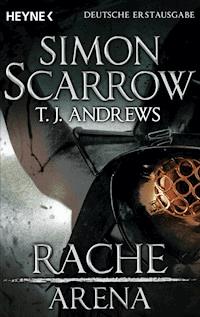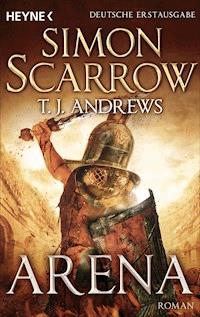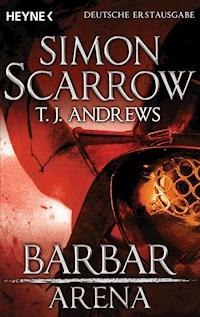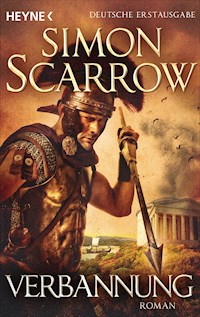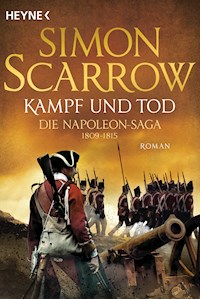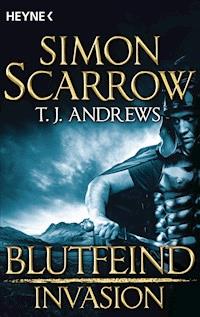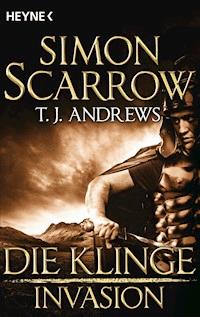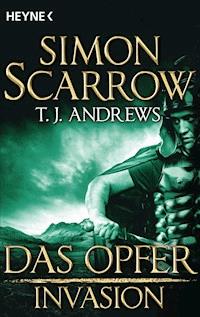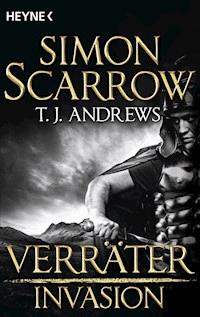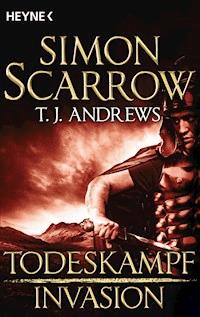12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Im ›Dritten Reich‹ kann jede Entscheidung fatal sein | »Ein fesselnder, atmosphärischer Pageturner.« Steve Cavanagh Berlin, Januar 1940: In einer eiskalten Nacht kehren ein SS-Arzt und seine Frau von einem Konzertabend zurück. Als die Sonne aufgeht, liegt der Arzt leblos in einer Blutlache vor seinem Schreibtisch, darauf ein Abschiedsbrief. Doch seine Witwe ist überzeugt, dass es sich um Mord handelt, und wendet sich an Kriminalinspektor Horst Schenke. Gegen den Willen seiner Vorgesetzten ermittelt Schenke und stößt auf immer weitere brisante Details. Er ahnt, dass er einem schrecklichen Geheimnis größeren Ausmaßes auf der Spur ist und seine Ermittlungen möglicherweise nicht überleben wird ... Der zweite Fall für Kriminalinspektor Horst Schenke von SPIEGEL-Bestsellerautor Simon Scarrow – ein rasanter Thriller im eisigen Berlin der Nazi-Zeit. »Ein Außenseiter in Bedrängnis, eine Welt voller lauernder Gefahren und eine erschreckend glaubwürdige Auflösung.« Owen Matthews »Ein knallharter Pageturner, der ein eisiges Berlin der 1940er Jahre heraufbeschwört, das immer weiter auf moralische Abwege gerät, während die Schrecken des Nazi-Regimes immer schwerer zu ignorieren sind.« S.G. MacLean
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten:
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Nachtkommando« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Aus dem Englischen von Kristof Kurz
Für meinen Freund Bharat Goswami,
der mich gelehrt hat, über das Denken nachzudenken
© Simon Scarrow 2023
Titel der englischen Originalausgabe: »Dead of Night«, Headline, London 2023
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Peter Hammans
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Patrick Insole
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Karte
Befehlsstruktur
Vorbemerkung des Autors
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Historische Nachbemerkung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorbemerkung des Autors
Einen Roman über das Leben in Deutschland während des Dritten Reichs zu verfassen, bedeutet zwangsläufig, mit den tiefsten Abgründen der menschlichen Natur konfrontiert zu werden. Redlich über diese Zeit zu schreiben, ohne auf die Ideologie und Terminologie des herrschenden Regimes zurückzugreifen, ist unmöglich. Ich hoffe, dass ich diesen Aspekt des Romans mit dem nötigen Feingefühl behandelt habe.
Prolog
Berlin, 28. Januar 1940
Chor und Orchester erreichten das Ende der Reprise von Fortuna Imperatrix Mundi. Der Dirigent beendete die Darbietung mit einem letzten Schwung des Taktstocks und ließ den Kopf wie vor Erschöpfung hängen. Sofort erklangen Jubelrufe aus dem Publikum, dann donnerte Applaus durch die Philharmonie. Als sich der Dirigent umdrehte, erhoben sich erst einzelne und schließlich alle Konzertbesucher zu frenetischem Beifall.
Dr. Manfred Schmesler seufzte und stand mit vor Kälte steifen Gliedern auf. Wie die anderen Anwesenden trug er Mantel und Handschuhe, hatte aber trotz der winterlichen Temperaturen den Hut abgenommen, um die Musik besser hören zu können. Aufgrund des Kohlemangels war der Saal nicht beheizt und immer noch eiskalt, obwohl sich das Publikum seit mittlerweile eineinhalb Stunden darin aufhielt. Schmesler musste die Musiker bewundern, die unter diesen Bedingungen zu spielen vermochten. Aber womöglich lenkte sie die Konzentration auf die Musik ja von der klirrenden Kälte ab.
Seine Frau Brigitte drückte leicht seinen Arm, und er drehte sich zu ihr um. Sie sagte etwas Unverständliches, dann räusperte sie sich und sprach etwas lauter, während er sich zu ihr vorbeugte. »Ein ganz wunderbares Konzert, habe ich gesagt.«
»Ja«, pflichtete er ihr bei. »Vor allem unter diesen Umständen.«
Unter dem anhaltenden Beifall des Publikums verbeugte sich auf Wilhelm Furtwänglers Zeichen hin zuerst das Orchester und dann der Chor. Dann verebbte der Applaus allmählich, und die Menge drängte zu den Ausgängen. Schmesler, seine Frau und das Ehepaar, mit dem sie das Konzert besucht hatten – der Anwalt Hans Ebermann und seine Frau Eva –, verließen ebenfalls den Saal. Die Schmeslers hatten die Ebermanns vor einigen Monaten bei einem Fest kennengelernt und sich seither hin und wieder zu gesellschaftlichen Anlässen verabredet.
Ebermann bemerkte seinen Blick. »Wie schön, dass der Eintritt frei war«, sagte er gerade so laut, dass nur Schmesler ihn verstehen konnte.
Schmesler musste grinsen. Inzwischen kannte er Ebermann so gut, dass ihm die Ironie in seiner Bemerkung nicht entgangen war. Seit der Machtübernahme waren viele Musiker und Komponisten ins Exil gegangen, und die, die geblieben waren, mussten ihr Repertoire im Großen und Ganzen auf deutsche Musik beschränken. Deshalb bot das Konzertprogramm der Hauptstadt nur wenig Abwechslung. Zumindest war Wagner ihnen heute Abend erspart geblieben, dachte Schmesler.
Die Menge drängte weiter und rüstete sich mit Schals und Hüten gegen die Kälte. Berlin erlebte den härtesten Winter seit Menschengedenken: Die Spree und ihre Kanäle waren zugefroren, eine Schneedecke lag über der Stadt. Und abermals befand sich das Land im Krieg. Schmesler hatte im letzten großen Krieg gedient und wurde noch immer von der Erinnerung an das Grauen heimgesucht, das er an der Westfront erlebt hatte. Es sei der Krieg, der allen Kriegen ein Ende setzen sollte, hatte es damals geheißen, doch kaum mehr als zwanzig Jahre später war der Krieg nach Deutschland zurückgekehrt, was zur Rationierung von Lebensmitteln und einer Verdunkelungsverordnung geführt hatte, die Berlin nach Sonnenuntergang in vollkommene Finsternis tauchte.
Durch die zunehmende Kohleknappheit wurde Heizen ein Luxus, den sich nur wenige leisten konnten, hauptsächlich Parteibonzen und deren Freunde. Wie so viele andere Ärzte – oder Anwälte wie sein neuer Freund Ebermann – hatte auch Schmesler die Zeichen der Zeit früh erkannt und war der Partei beigetreten. Und tatsächlich war die Parteizugehörigkeit inzwischen unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn sowie für gewisse Annehmlichkeiten im Privatleben. Diejenigen, die bereits in der Weimarer Republik Parteimitglied gewesen waren, blickten allerdings verächtlich auf die Neuzugänge und ihre plötzliche Begeisterung für die nationalsozialistische Sache herab und dachten gar nicht daran, ihre Vorräte an Kohle mit ihnen zu teilen.
Erstaunlich, dachte Schmesler, wie ein einst so gewöhnliches Gut plötzlich so knapp und wertvoll hatte werden können. Darüber hinaus war Koks die Sorte, die in der Hauptstadt noch zu bekommen war: entgaste Kohle ohne den öligen Schimmer hochwertigerer Kohle. Sie setzten den Boiler in ihrem Haus in Pankow inzwischen nur noch am Wochenende sowie am Dienstag- und Donnerstagabend in Betrieb, sofern es die Kohlevorräte erlaubten. Um sich die übrige Zeit warm zu halten und genug Wasser zum Waschen erhitzen zu können, waren Brigitte und er gezwungen, Holz zu verfeuern, und selbst das ging langsam zur Neige. Schmesler hoffte inständig, dass dieser ungewöhnlich lange und harte Winter bald zu Ende ging.
Als sie sich dem Ausgang des Saals näherten, übertönte eine barsche Stimme die Unterhaltungen der Konzertbesucher: »Winterhilfe! Spendet für das Winterhilfswerk!«
Im Foyer standen vier Männer, die lange Mäntel und die braunen Kappen der SA trugen. Einer schüttelte mit lautem Klappern eine Spendenbüchse, bevor er den Ruf wiederholte.
»Verdammt noch mal«, murmelte Ebermann. »Als würden sie nicht schon oft genug vor der Haustür stehen.«
Schmesler holte eine Handvoll Abzeichen aus der Tasche und suchte die des Winterhilfswerks heraus, die er bei anderer Gelegenheit erhalten hatte. Er gab Ebermann eines und steckte sich das eigene gut sichtbar ans Revers. Ebermann grinste bei der Vorstellung, die Parteischergen zu übertölpeln, die vor den Ausgängen standen und die Leute durch ihr einschüchterndes Auftreten förmlich zu einer Spende zwangen. Jemandem, der nur auf Besuch in Berlin war, mochte dies wie eine Wohltätigkeitsaktion erscheinen, die Einheimischen dagegen wussten es besser – es handelte sich um organisierten Straßenraub.
Ein SA-Mann, den Mund zu einem spöttischen Grinsen verzogen, versperrte gerade einer kleinen Gruppe vor Schmesler den Weg. »Eine Spende für die Bedürftigen, Volksgenosse.«
Es war keine höfliche Frage, sondern ein Befehl. Die Konzertbesucher, die kein Abzeichen vorweisen konnten, bezahlten und eilten schnell davon. Ein SA-Mann trat vor Schmesler und hob die Dose. »Winterhilfswerk.«
Schmesler hob leicht die Schulter, damit sein Abzeichen besser zu sehen war. Daraufhin winkte der Mann die beiden Ehepaare durch, um sich sofort den Nachfolgenden in den Weg zu stellen. Schmesler nahm seine Frau am Arm und führte sie schnellen Schrittes durch das Foyer und die Drehtür hinaus auf die Straße. Sofort spürten sie die Nadelstiche der klirrend kalten Nachtluft auf der Haut. Sie zogen die Köpfe ein, schlugen die Kragen hoch und stießen Atemwolken aus.
Ebermann wollte das Abzeichen zurückgeben, doch Schmesler schüttelte den Kopf. »Kannst du behalten. Wer weiß, wie viel SA sich heute Abend auf den Straßen herumtreibt.«
»Danke.«
Trotz der Verdunkelungsverordnung warfen die mit Schlitzblenden versehenen Scheinwerfer der Autos und der fahle Glanz der Schneehaufen noch genug Licht auf die Straße, sodass man sich zurechtfinden konnte. Schmesler zwängte sich heraus aus der Menge vor dem Theater und ging dann etwas langsamer, bis das befreundete Ehepaar zu ihm und Brigitte aufgeschlossen hatte. Sie hielt sich an seinem Arm fest, um auf dem Weg zur U-Bahn nicht auf dem zu einer Eisschicht festgetrampelten Schnee auszurutschen. Unter diesen Bedingungen gestaltete sich jegliche Konversation schwierig, und sie schwiegen, bis sie die Treppe zum Bahnsteig erreicht hatten. Dort trennten sich ihre Wege: Schmesler und seine Frau würden den nächsten Zug nach Pankow nehmen, die Ebermanns konnten ihre Wohnung in der Parallelstraße zu Fuß erreichen.
»Wie wäre es mit dem Richard-Strauss-Konzert nächsten Freitag?«, erkundigte sich Eva.
Ihr Ehemann schnaubte verächtlich. »Nicht dass es dieser Tage viel Auswahl gäbe.«
Sie gab ihm einen spielerischen Klaps auf die Schulter. »Strauss mag zwar nicht zu den erstklassigen Komponisten gehören, die du so schätzt, aber als zweitklassiger Komponist ist er erstklassig.«
Alle vier lachten kennerhaft. »Offenbar darf kein deutsches Musikstück so anspruchsvoll sein, dass man es nicht auf einem Reichsparteitag schmettern könnte.«
»So schlimm ist es nun auch wieder nicht«, sagte Schmesler. »Musik ist und bleibt eine willkommene Abwechslung im Krieg. Das Konzert wird uns guttun.«
»Ja, wahrscheinlich schon …«
»Also, abgemacht! Aber du bist an der Reihe, die Eintrittskarten zu besorgen, mein Lieber.«
Schmesler hörte einen herannahenden Zug und warf einen Blick zum Stationseingang hinüber. »Wir müssen.« Er wandte sich wieder seinem Freund zu. »Gilt unsere Verabredung zum Mittagessen am Montag noch? Du wolltest doch eine wichtige Angelegenheit mit mir besprechen.«
Ebermann schüttelte den Kopf. »So wichtig ist es nicht mehr. Vielleicht ein andermal.«
Die Paare gaben sich die Hand und verabschiedeten sich, dann eilten die Schmeslers die Treppe hinunter. Als sie den Bahnsteig erreichten, fuhr gerade ein Zug in nördlicher Richtung ein. Die Türen öffneten sich scheppernd, Fahrgäste stiegen aus und ein, dann blies der Schaffner in seine Pfeife. Der Zug setzte sich ruckartig in Bewegung, sodass Schmesler und seine Frau, die noch auf dem Weg zu einer Sitzbank waren, beinahe das Gleichgewicht verloren. Beide fühlten sich an einen der ersten Abende erinnert, an dem sie zusammen ausgegangen waren. Damals war sie durch den Ruck eines anfahrenden Zuges gegen ihn getaumelt, und damit sie nicht hinfiel, hatte er instinktiv den Arm um sie gelegt. Sie hatten nervös gelacht, und das hatte das Eis gebrochen. Nun lächelten sie sich bei dieser unverhofften Erinnerung glücklich an.
In den letzten Jahren war es immer schwieriger geworden, sich in der U-Bahn zu unterhalten. Die Leute achteten penibel auf ihre Worte, um zu vermeiden, dass ein Spitzel auf sie aufmerksam wurde. Die beiden Eheleute saßen schweigend da und hielten sich an den Händen, bis der Zug ihre Haltestelle in Pankow erreichte. Sie verließen den Wagen und eilten durch die kalten, dunklen Straßen ihres gediegenen Wohnviertels nach Hause.
Schmesler hatte das bescheidene zweistöckige Haus aus der Mitte des letzten Jahrhunderts vor drei Jahren von seinem jüdischen Vorbesitzer Josef Frankel erworben, mit dem er an der Berliner Universität studiert hatte und früher gut befreundet gewesen war. Nach der Machtübernahme war eine solche Freundschaft selbstverständlich unmöglich geworden. Sie hatten sich in der Öffentlichkeit nicht mehr zusammen gezeigt und sich nur noch heimlich getroffen. Als man Frankel verbot, seinen Beruf weiter auszuüben, und sich die Lage für die jüdische Bevölkerung Deutschlands zusehends verschlechterte, war er mit seiner Familie ausgewandert. Das Haus hatte er zuvor für einen Spottpreis an seinen guten Freund Schmesler verkauft und sich mit dem wenigen Geld, das ihm noch geblieben war, eine neue Existenz in New York aufgebaut. Tragischerweise war Frankel gezwungen gewesen, eine seiner Töchter, die noch relativ junge Ruth, zurückzulassen, da ihre Geburtsurkunde nirgendwo zu finden war. Dann war der Krieg ausgebrochen, und nun saß Ruth in Berlin fest.
Die Schmeslers gingen die wenigen Stufen zur Haustür unter dem kleinen Vordach hinauf und kratzten sich an einer Eisenstange den Schnee von den Schuhen. Schmesler öffnete die Tür und schloss sie schnell wieder, nachdem sie eingetreten waren. Erst dann schaltete er das Licht ein, da er nach Möglichkeit vermeiden wollte, dass ihm der Blockwart ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Verdunkelungsverordnung aufdrückte.
Im Haus war es so kalt, dass sie die Mäntel und Handschuhe anbehielten und nur ihre Kopfbedeckungen an die Garderobe neben der Tür hängten. Schmesler gab seiner Frau einen Kuss auf die Stirn. »Geh doch schon mal ins Bett, ich komme gleich nach.«
»Musst du noch arbeiten?« Sie seufzte.
Er nickte. »Die Zentrale ist hoffnungslos unterbesetzt, der Wehrpflicht sei Dank.«
»Mussten sie dir denn gleich alle Assistenten wegnehmen?«
»Schatz, in Kriegszeiten ist das Militär auf jeden verfügbaren Arzt angewiesen.«
Brigitte schüttelte den Kopf. »Der Führer, ein Mann des Friedens … so viel dazu.«
Ohne zu überlegen, hatte sich Schmesler unwillkürlich umgesehen. »Zu Hause kannst du ja so reden«, sagte er und lächelte verlegen. »Aber sei bloß vorsichtig, wem du dich anvertraust.«
»Ich will doch sehr hoffen, dass ich mit dem Mann, mit dem ich seit zwanzig Jahren verheiratet bin, offen sprechen kann.«
Er zwinkerte ihr zu. »Man kann ja nie wissen …«
»Ach, du!« Sie kniff ihm in die Wange.
»Gib dem Führer wenigstens eine Chance. Polen ist zerschlagen. Wieso sollten Frankreich oder Großbritannien den Krieg noch fortsetzen wollen? Du wirst sehen, im Frühling haben wir Frieden, also mach dir keine Sorgen. Aber jetzt ins Bett mit dir, sonst zeige ich dich wegen Verbreitung undeutscher Propaganda bei der Gestapo an.«
Er sah ihr hinterher, wie sie die Treppe hinaufging, das Licht in der Galerie einschaltete und im Flur verschwand. Dann ging er ins Wohnzimmer, setzte sich vor den Ofen und öffnete die Klappe. Warme Luft schlug ihm entgegen, und eine kleine Rauchfahne stieg auf. Selbst durch die dicken Handschuhe spürte er, wie heiß das schwere Eisen noch war. Er sah ein schwaches Glimmen und legte Kienspan darauf. Sobald dieser Feuer gefangen hatte und die ersten kleinen Flammen züngelten, legte er ein paar Holzscheite nach und schloss die Ofenklappe wieder. Mit einem zufriedenen Lächeln spürte er, wie die vom Gusseisen abgestrahlte Wärme in seinen Körper drang.
Er warf einen Blick zu der Aktentasche, die auf dem Schreibtisch vor dem mit Verdunklungsvorhängen versehenen Fenster lag. Obwohl er sich dringend um die Krankenberichte darin kümmern musste, hatte er es den ganzen Tag über vor sich hergeschoben, erst im Büro und dann zu Hause, doch nun konnte die Angelegenheit nicht mehr länger warten. Schmesler stand auf, ging zu einem kleinen Beistelltisch hinüber, auf dem eine Karaffe mit Brandy und mehrere Gläser standen, und goss sich großzügig ein. Dann setzte er sich mit dem Rücken zum Feuer in den Ledersessel, öffnete die Tasche und entnahm ihr eine Mappe. Er griff nach einem Stift, schlug die Mappe auf und überflog das erste Formular darin, wobei er nur einer handschriftlichen Bemerkung am unteren Seitenrand größere Beachtung schenkte. Die Spitze des Stiftes in seiner rechten Hand schwebte über dem Papier, doch er zögerte. Dann trank er den Brandy in einem Zug aus. Während die Flüssigkeit in der Kehle brannte, stellte er das Glas mit einem Knall auf den Tisch und versah das letzte Kästchen des Formulars mit einem »+«. Anschließend legte er das Blatt beiseite und widmete sich dem nächsten Fall.
Die Uhr auf dem Kaminsims tickte wie ein Metronom. Hin und wieder stand Schmesler auf, um Holz nachzulegen. Es war spät in der Nacht, als er alle Formulare auf zwei Stapel verteilt hatte: Die auf dem höheren wiesen alle dieselbe Anmerkung auf wie das erste, bei denen auf dem kleineren Stapel hatte er das Kästchen leer gelassen und lediglich unterzeichnet.
Im ersten Stock schlief seine Frau in einem dicken Nachthemd alleine in ihrem Bett unter mehreren Decken. Sie lag auf der Seite und atmete ruhig, bis sie in den frühen Morgenstunden durch einen lauten Knall aus ihrem traumlosen Schlaf gerissen wurde. Eine Zeit lang war sie sich nicht sicher, ob sie sich das Geräusch nur eingebildet hatte. Dann schob sie den Arm unter die Decke, ertastete auf der Seite ihres Mannes jedoch nur kalte, klamme Laken. Nachdem sie mehrere Minuten lang gewartet und nach weiteren Geräuschen gelauscht hatte, schaltete sie die Nachttischlampe an. Mit gegen das helle Licht zusammengekniffenen Augen sah sie auf den Wecker. Es war kurz nach drei. Arbeitete er um diese Zeit etwa noch?
Sie schwang die Beine aus dem Bett, ließ die Füße in die Pantoffeln gleiten und ging zur Treppe.
»Manfred«, rief sie. »Manfred …«
Keine Antwort. Verärgert schnalzte sie mit der Zunge, während sie die Treppe hinunter ins Arbeitszimmer ging. Sie öffnete die Tür, warme Luft schlug ihr entgegen. Warme Luft und beißender Pulverdampf.
»Manfred …?«
Sie sah ihren Mann nicht sofort. Papiere waren auf dem Schreibtisch und dem Boden verstreut. Der Stuhl war umgekippt. Dahinter war ein ausgestreckter Arm zu erkennen. Gleich neben den gekrümmten Fingern lag eine schwarze Pistole.
1
31. Januar
Kriminalassistent Hauser blickte auf, als sich kurz vor Mittag die Tür zu den Räumlichkeiten der Kriminalpolizeiabteilung Pankow öffnete, ein Mann im dunklen Mantel eintrat und seinen Hut an den Hutständer hängte. Er ging schnurstracks zum Ofen in der Mitte des Raumes, drehte sich um und wärmte sich den Rücken, dann nickte er Hauser zum Gruß zu. Der Kriminalassistent, der gerade dabei gewesen war, einen Bericht zu schreiben, laborierte immer noch an einer Schussverletzung an der Schulter. Es war zwar nur eine Fleischwunde gewesen, doch gelegentlich waren die Schmerzen noch so groß, dass er eine Schlinge tragen musste.
»Wie war’s, Chef?«, erkundigte sich Hauser.
Sein Vorgesetzter, Kriminalinspektor Horst Schenke, kam soeben von der Beerdigung von Graf Anton Harstein und dessen Frau zurück, mit denen er viele Jahre lang gut befreundet gewesen war. Das ältere Ehepaar war kurz vor Weihnachten ermordet worden, doch wegen des bei der Ermittlung anfallenden Papierkrams sowie des gefrorenen Erdbodens hatte es fünf Wochen gedauert, bis man die Toten endlich bestatten konnte. Graf Harstein war früher Finanzier der Silberpfeile gewesen, des Rennstalls, für den Schenke gefahren war, bis ein Unfall seiner Motorsportkarriere ein Ende gesetzt und dafür gesorgt hatte, dass er zeit seines Lebens humpeln würde. Nach dem Unfall hatte sich Schenke neu orientieren müssen und war zur Polizei gegangen.
Er holte tief Luft. »Wie Beerdigungen eben so sind.«
Obwohl die Harsteins als Aristokraten in den besten Kreisen verkehrt hatten, waren außer Schenke und seiner Bekannten Karin nur wenige Trauergäste gekommen. Er hatte kaum zehn Personen gezählt, darunter auch Harsteins Sohn. Der Offizier hatte Sonderurlaub erhalten, um dem Begräbnis beiwohnen zu können, während die bittere Kälte viele andere Bekannte der Harsteins von der Teilnahme abgehalten hatte. Der mit den Zähnen klappernde Pfarrer hatte den Trauergottesdienst etwas schneller abgehalten, als es sich gehörte. Die Ermordung seiner Freunde hatte Schenke den letzten Rest an Weihnachtsstimmung verdorben, und insgeheim trauerte er weiterhin um sie, obwohl er es sich nicht anmerken ließ.
»Was macht Ihre Verwundung?«, fragte er Hauser.
»Die verheilt unerklärlicherweise so langsam, dass ich unmöglich bei der Hausarbeit helfen kann.« Hauser grinste. »Aber ich rechne mit einer baldigen Besserung, weil Helga allmählich Lunte riecht.«
»Sie leben gefährlich, mein Freund.« Schenke hatte Hausers Gattin nur ein paarmal getroffen, doch sie hatte bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen. »Auch wenn man gerade mal nicht auf Sie schießt.«
Beide Männer schwiegen einen Augenblick lang, als sie an den Vorfall im Hauptquartier der Abwehr zurückdachten, bei dem Hauser die Kugel abbekommen hatte. Dann drehte sich der Kriminalassistent zu einem Schreibtisch um, an dem ein dünner Mann von Mitte zwanzig saß. Er hatte feines, weißblondes Haar, eine Brille und trug im Gegensatz zu den anderen keinen Mantel über dem einfachen schwarzen Anzug mit Schlips. Offenbar schien ihm die Kälte nichts auszumachen. Er las den Aufmacher des Völkischen Beobachters, in dem es um den heldenhaften Widerstand der finnischen Armee gegen die Invasion der schlecht ausgerüsteten, unfähigen Legionen Stalins ging. Trotz des Nichtangriffspakts, den Deutschland und Russland im letzten August geschlossen hatten, hielt der Artikel mit seiner Sympathie für die Finnen nicht hinter dem Berg. Russland in die Schranken gewiesen, lautete die Schlagzeile. Schenke fragte sich, wie lange dieser Pakt zwischen diesen beiden diametral entgegengesetzten Ideologien wohl Bestand haben würde. Es war bemerkenswert: Dort tobte ein richtiger Krieg mit vielen Toten – jedenfalls auf russischer Seite –, während sich die Kriegsanstrengungen Deutschlands nach dem Fall Polens auf gelegentliche Scharmützel und den Abwurf von Propagandaflugzetteln beschränkten. Wie so viele hoffte er immer noch auf eine friedliche Lösung des Konflikts, ahnte aber, dass das Schlimmste noch bevorstand.
»Liebwitz, sehen Sie mal nach, ob das Labor mit der Untersuchung der Essensmarken fertig ist, die heute Morgen reingekommen sind«, kommandierte Hauser.
»Ja, Herr Kriminalassistent.« Liebwitz stand zackig auf, nickte ihnen zu und verließ das Büro.
Ein wenig tat er Schenke leid. Die Gestapo hatte ihm Liebwitz zur Unterstützung bei der Aufklärung der Mordserie zugeteilt, die sich vor Weihnachten ereignet hatte. Mit seiner steifen, überkorrekten Haltung hatte er sich dort wohl keine Freunde gemacht, und Schenke vermutete, dass man ihn zur Kripo abkommandiert hatte, um ihn loszuwerden. Nun wartete er auf die offizielle Bestätigung der Versetzung. Da die Mühlen der Bürokratie wie üblich langsam mahlten, war Liebwitz nach wie vor Mitglied der Gestapo, was ihn für Hauser zur Zielscheibe machte. Der Kriminalassistent behandelte ihn wie den Laufburschen der Abteilung.
»Nehmen Sie ihn nicht so hart ran«, sagte Schenke.
»Er muss Lehrgeld bezahlen, so wie wir alle.«
»Er hat gute Arbeit geleistet und muss uns nichts mehr beweisen.«
»Vorerst …«
Schenke ließ es dabei bewenden. So schnell würde er die Vorbehalte des Kriminalassistenten dem Neuen gegenüber nicht zerstreuen können. Er sah sich um. Die Schreibtische waren verwaist. »Wo sind die anderen?«
»Frieda und Rosa befragen eine Frau in einem Fall von häuslicher Körperverletzung. Persinger und Hofer sammeln ein paar der uns bekannten Fälscher und Hehler ein, damit wir ihnen wegen der falschen Essensmarken auf den Zahn fühlen können. Irgendeiner wird schon etwas darüber wissen.«
Schenke nickte. Persinger und Hofer waren erfahrene Polizisten, vierschrötige Männer, die Übung darin besaßen, Verdächtige auch ohne den Einsatz von Gewalt, lediglich durch ihr einschüchterndes Auftreten zum Reden zu bringen. Die zuverlässige und fleißige Frieda Echs hingegen war bereits jenseits der vierzig und hatte genug Erfahrung damit, auch etwas delikatere Situationen zu meistern. Rosa Mayer, die zweite Frau in der Abteilung, war schlank, blond, hübsch und ebenso gut in ihrem Beruf wie darin, Annäherungsversuche abzuwehren.
»Schmidt und Baumer sind bei einer politischen Schulung unten am Alex.«
»Das wird ihren Horizont sicherlich erweitern«, sagte Schenke leise. Schmidt und Baumer waren erst nach der Machtübernahme zur Polizei gegangen und galten deshalb offenbar als empfänglicher für die Propaganda, die bei diesen Schulungen im Polizeihauptquartier am Alexanderplatz verbreitet wurde. Dies war wohl auch der Grund, weswegen man sie dorthin bestellt hatte. Schenke war jedoch zuversichtlich, dass die beiden intelligenten, gut ausgebildeten Ermittler das, was man ihnen dort beibrachte, zumindest heimlich infrage stellten. Auch Hauser war Parteimitglied, ohne sich allzu sehr für den Nationalsozialismus zu engagieren. Ihm erschien es wie Schenke als lächerliche Zeitverschwendung, eine Ermittlung nach »arischen Gesichtspunkten« durchführen zu sollen.
»Irgendwann werden sie uns wohl ebenfalls zu einer politischen Schulung schicken.«
Hauser zuckte mit den Achseln. »Zweifellos. Aber bis dahin machen wir doch schön brav unsere Arbeit, richtig?« Hauser wollte Schenke mit dieser subtilen Warnung daran erinnern, seine Kritik an der Partei auf gelegentliche Bemerkungen zu beschränken.
Sie drehten sich um, als Liebwitz die Tür zum Büro öffnete und sie einem übergewichtigen Mann mit sauertöpfischer Miene aufhielt. Dieser schob den offen stehenden Mantel, den er über dem Anzug trug, zurück und steckte die Hände in die Taschen. Liebwitz eilte an ihm vorbei zu seinem Schreibtisch, während der Neuankömmling die beiden Kripobeamten neben dem Ofen beäugte und den Blick schließlich auf Hauser richtete.
»Inspektor Schenke?«
Hauser deutete auf seinen Vorgesetzten. »Versuchen Sie’s mit dem da.«
Der Mann sah Schenke an. »Doktor Albert Widmann vom Chemischen Labor, Kriminaltechnisches Institut am Werderschen Markt«, sagte er, ohne ihm die Hand zu geben.
»Kriminalinspektor Horst Schenke. Haben Sie sich die letzten Marken angesehen, die wir geschickt haben? Was halten Sie davon?«
Widmann dachte kurz nach. »Die sind gut. Für das ungeübte Auge praktisch nicht von echten Essensmarken zu unterscheiden. Für einen Experten wie mich ist aber selbstverständlich sofort ersichtlich, dass es sich um Fälschungen handelt.«
»Ach so?« Hauser hob eine Augenbraue. »Und woran macht ein Experte wie Sie das fest?«
Widmann warf sich in die Brust. »An bestimmten Unregelmäßigkeiten der Perforation beispielsweise. Bei einer einzelnen Marke ist das nicht zu sehen, an einem ganzen Bogen hingegen kann man es sofort erkennen.«
»Stammen sie aus derselben Quelle wie die Marken, die wir bereits beschlagnahmt haben?«, wollte Schenke wissen.
»Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, aber um das zu bestätigen, muss ich die Zusammensetzung der Farben und des Papiers im Labor prüfen. Glauben Sie, dass es das Werk eines Einzeltäters ist? Oder einer oder gar mehrerer Fälscherbanden?«
»Das wissen wir noch nicht. Schon möglich.«
»Wir hoffen, dass es mehrere Banden sind. Das würde uns die Arbeit sehr erleichtern«, fügte Hauser hinzu.
Widmann runzelte die Stirn. »Wieso?«
Amüsiert wechselten Schenke und Hauser einen Blick. »Wenn es sich um einen einzelnen Fälscherring handelt, haben wir es mit einer größeren Organisation zu tun, die sich nicht nur unserem Zugriff bisher entziehen konnte, sondern uns auch überhaupt nicht bekannt war. Wenn mehrere Banden dahinterstecken, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir ein paar Mitglieder bereits kennen und unsere Informanten auf sie ansetzen können.«
Widmann nickte. »Verstehe. Sehr gut. Klar.«
Hauser räusperte sich. »Vielleicht sollten Sie uns mal eine Weile begleiten. Es schadet sicher nicht, wenn Sie ein bisschen Kripoarbeit auf der Straße erleben.«
»Bei dieser Arschkälte?«, fragte Widmann. »Auf keinen Fall. Da bleibe ich lieber in meinem schönen warmen Labor, herzlichen Dank auch.«
Alle drei lachten. Widmann knöpfte den Mantel zu. »Dann nehme ich mal die Proben mit und mache mich wieder auf den Weg.«
»Teilen Sie uns die Ergebnisse bitte so schnell wie möglich mit«, sagte Schenke.
»Sie sind nicht die einzigen Ermittler, die etwas von mir wollen. Ich muss mich zuerst um ein paar andere Fälle kümmern.«
Schenke trat zwischen Widmann und die Tür. »Wenn wir den Fälschern nicht bald das Handwerk legen, werden viele Menschen in diesem Winter hungern, und ich glaube nicht, dass die viel Verständnis für Ihre Prioritäten haben. Und Heydrich auch nicht, wenn er erfährt, dass das Volk unzufrieden ist. Was meinen Sie, Liebwitz? Sie sind schließlich bei der Gestapo und können die Reaktion des Gruppenführers sicher besser einschätzen.«
Liebwitz blickte wie immer mit völlig ausdrucksloser Miene von seinen Unterlagen auf. »Unzufriedenheit im Volk ist durchaus dazu angetan, Gruppenführer Heydrichs Missfallen zu erregen, Herr Inspektor.«
Sobald der Name des Chefs des Reichssicherheitshauptamts fiel, machte Widmann große Augen und schluckte nervös. »Ich werde mein Möglichstes tun.«
»Zweifellos.« Schenke lächelte. »Vielen Dank.«
Sobald der Chemiker die Tür hinter sich geschlossen hatte, drehte sich Schenke mit einem Grinsen im Gesicht zu Liebwitz um. »Der hätte sich vor Angst gleich fast in die Hose geschissen. Gut gemacht.«
»Ich habe nur wahrheitsgetreu geantwortet, Herr Inspektor. Der Gruppenführer pflegt sich durch aufmerksame Lektüre der Stimmungsberichte über die Befindlichkeiten des deutschen Volkes auf dem Laufenden zu halten. Ich kenne seine Reaktion auf unliebsame Nachrichten aus erster Hand.«
Schenke war sich noch nicht ganz sicher, ob Liebwitz’ befremdliches Verhalten von übertriebener Professionalität herrührte oder eher mangelnden Fähigkeiten im Umgang mit Menschen zu verdanken war.
»Selbstverständlich«, sagte er und sah auf die Uhr. »Ich gehe in die Mittagspause. Wenn Persinger und Hofer vor mir wieder da sind, sollen sie schon einmal mit den Verhören anfangen.«
Hauser nickte. Der Inspektor verließ das Büro und schlug den Mantelkragen hoch, bevor er auf die bitterkalte Straße trat.
Obwohl es seit Neujahr nur sporadisch geschneit hatte, lag der Schnee noch immer in schmutzigen, teilweise schulterhohen Massen am Straßenrand, sodass man die Straßen nur an den Kreuzungen überqueren konnte, wo sich Lücken in der Schneemauer befanden. Schottersprenkel überzogen die graue, vereiste Oberfläche der Gehwege. Trotz der Kälte waren nicht wenige Menschen schnellen Schrittes auf den Straßen unterwegs, mit eingezogenem Kopf und Atemwolken hinter sich herziehend. An dem fehlenden Schnee auf den Dachziegeln war gut zu erkennen, in welchen Gebäuden noch normal geheizt wurde. Dazu gehörte auch das örtliche Parteibüro, wie Schenke auffiel. Ein SA-Mann stand davor und überklebte ein Plakat, das durch die Darstellung eines Skeletts, das auf einem britischen Flugzeug saß und eine Bombe warf, zur Verdunkelung mahnte. Jemand hatte einen schwarzen Zweifingerbart und eine Frisur mit strengem Scheitel auf den Schädel gemalt.
Der SA-Mann sah sich um, und einen Augenblick lang fürchtete Schenke, er würde den Arm zum »Deutschen Gruß« heben und ihn zwingen, die Hand aus der Tasche zu nehmen und es ihm gleichzutun. Doch der Mann warf nur einen Blick auf den Kleisterpinsel in seiner Hand und verdrehte die Augen. Schenke ging grinsend an ihm vorbei.
Am Ende der Straße wandte er sich nach links und betrat ein Arbeiterviertel mit zahlreichen Bierkellern und Lokalen. Er überquerte die Straße und ging auf das Café Wehler zu, wo es noch echten Kaffee gab. Eine Glocke über dem Eingang klimperte, als er durch die Tür trat und sie hinter sich schnell wieder schloss. Die warme, rauchige Luft, die ihm entgegenschlug, war zum Schneiden. Der Tresen am anderen Ende der eng mit Tischen und Stühlen vollgestellten Gaststube reichte von einer Wand zur anderen, der Spiegel dahinter ließ den Raum doppelt so groß erscheinen.
Das Lokal war besonders um die Mittagszeit immer gut besucht, dennoch gelang es Schenke, einen Platz in einer heimeligen Nische an einem zur Straße zeigenden Fenster zu ergattern. Er öffnete den Mantel und lockerte den Schal. Durch die beschlagene Fensterscheibe waren die Passanten nur schemenhaft als dunkle Schatten zu erkennen, und so bemerkte er auch die Gestalt nicht, die ihm von der Dienststelle aus gefolgt war und nun scheinbar ratlos auf der anderen Straßenseite stand.
Schenke dachte darüber nach, was Widmann über die Fälscherbande gesagt hatte. Wenn sie tatsächlich einem Fälscherring auf die Spur gekommen waren, von dessen Existenz sie bislang nichts gewusst hatten, würde er nicht so einfach auszuheben sein. Die Nazis hatten die organisierten Kriminellen Berlins zusammengetrieben und entweder liquidiert oder weggesperrt – immerhin das hatten sie geschafft. Und da sie sich nicht mit solchen juristischen Feinheiten wie Beweisführung oder einem ordentlichen Gerichtsverfahren aufhielten, war es tatsächlich zu einem deutlichen Rückgang des organisierten Verbrechens gekommen. Einzeltäter hingegen – Diebe, Betrüger, Schläger, Straßenräuber, Sittenstrolche, Mörder – gab es nach wie vor, und es würde sie auch immer geben, solange es Menschen gab, egal, wer gerade an der Macht war. Er zwang sich, nicht mehr an die Arbeit, sondern an Karin zu denken. Sie hatten sich für heute Abend verabredet, um sich in einem Ufa-Kino in der Nähe den neuesten Film mit Heinrich George anzuschauen. Er freute sich schon darauf, sie wiederzusehen.
Eine Frau nahm ihm gegenüber auf der Sitzbank in der Nische Platz. Schenke blickte mit einem höflichen Lächeln auf, froh um etwas Gesellschaft beim Mittagessen. Doch sein Lächeln erstarrte, als er ihr Gesicht sah, und plötzlich spürte er das eisige Kribbeln der Furcht im Nacken.
2
Ruth Frankel war sehr dünn und trug einen fadenscheinigen braunen Mantel, die Naht eines Handschuhs löste sich, und ihr Gesicht war selbst für eine Berlinerin mitten im Winter ungewöhnlich blass. Ihre dunklen Augen unter den dünnen Brauen sahen ihn nervös an. Der spitze Ansatz ihrer dunklen Locken lugte unter der Filzmütze hervor.
»Hallo, Herr Schenke.« Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Wie geht es Ihnen?«
Schenke sah sich um. Niemand blickte in ihre Richtung oder schien ihnen Beachtung zu schenken. »Was machen Sie denn hier?«, fragte er leise.
»Ich muss mit Ihnen reden. Ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll.«
Er beugte sich vor. »Was wollen Sie? Geld?«
Mit leicht gekränkter Miene schüttelte sie den Kopf. »Nein, ich will kein Geld von Ihnen. Aber ich frage mich, wie Sie nur auf diese Idee kommen? Doch nicht zufällig wegen der vielen Plakate und Zeitungsartikel über die geldgierigen Juden, die die Partei so gerne druckt? Glauben Sie allen Ernstes, dass ich das Risiko eingehen würde, Sie zu erpressen?«
Schenke holte tief Luft, um sich zu beruhigen. »Frau Frankel, ich bitte Sie vielmals um Verzeihung. Aber Sie wissen doch, wie gefährlich es für uns beide ist, wenn jemand herausfindet, wer Sie sind, und uns denunziert.«
Ihre Miene verhärtete sich. »Das klingt, als wäre ich eine Sache und keine Person. Bin ich das für Sie?«
Schenke war zunächst gekränkt, dann bekam er Gewissensbisse. Ruth hatte maßgeblich dazu beigetragen, dem Verbrecher das Handwerk zu legen, der in den letzten Monaten des vergangenen Jahres die Verdunkelung dazu genutzt hatte, mehrere Frauen zu ermorden. Außerdem wäre sie ihm beinahe selbst zum Opfer gefallen. Hätte sie seinen Angriff nicht erfolgreich abgewehrt und Schenke und seinen Leuten entscheidende Informationen über den Mörder zukommen lassen, wäre der Mann wohl noch immer auf freiem Fuß. Obwohl ihre Zusammenarbeit nur von kurzer Dauer gewesen war, hatte sie Mitleid in Schenke geweckt und Scham für die Schikanen, denen sie ausgesetzt war. In einem anderen Deutschland hätte er sie wirklich gerne näher kennengelernt.
»Ich hätte nicht erwartet, Sie noch einmal wiederzusehen.«
Sie lächelte traurig. »Ich hatte auch nicht die Absicht. Eigentlich wollte ich untertauchen und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist und ich nicht mehr riskieren muss, dass mich jemand erkennt, weil er mein Bild in der Zeitung gesehen hat. Was übrigens Ihre Schuld war.«
»Ich hatte keine andere Wahl. Der Befehl kam vom Chef der Gestapo persönlich.«
»Wenn Sie das sagen.«
Ein Kellner kam an ihrem Tisch vorbei. Schenke winkte ihn zu sich, während Ruth sich zurücklehnte und so tat, als suchte sie etwas in ihrer Handtasche.
Er nickte dem Mann zum Gruß zu. »Die Tagessuppe, bitte. Und Kaffee.«
»Bedaure, der Herr, aber Kaffee ist aus. Ich kann Ihnen Kaffee-Ersatz anbieten.«
Beim Gedanken an den bitteren Muckefuck verzog Schenke das Gesicht. »Dann nehme ich einen Tee.«
»Jawohl. Und die Dame?«
Schenke war von dieser Frage völlig überrumpelt. Er hatte nicht vorgehabt, mit Ruth zusammen zu essen, und war davon ausgegangen, dass sie ihr Anliegen vortragen und dann schnell und unauffällig wieder verschwinden würde. Jeder Augenblick, den er in ihrer Gegenwart verbrachte, erhöhte die Gefahr – vor allem für sie selbst. Eine Jüdin, die in aller Öffentlichkeit mit einem Arier verkehrte, würde höchstwahrscheinlich ohne Wiederkehr in ein Arbeitslager geschickt. Und Schenke würde aus dem Polizeidienst entlassen und mehrere Monate inhaftiert werden, konnte dann zusehen, wie er ein Dasein am Rande der Gesellschaft fristete. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als so zu tun, als hätten sie eine ganz normale und völlig legale Verabredung zum Mittagessen.
»Für mich dasselbe«, sagte Ruth.
»Jawohl.« Der Kellner drehte sich um und entfernte sich. Nun hatten sie wieder einen Augenblick Ruhe. Schenke verschränkte die Arme, um vor etwaigen Beobachtern deutlich zu machen, dass sie kein Paar waren. Doch dann sah er an ihrem blassen Gesicht mit den eingefallenen Wangen, dass Ruth eine anständige Mahlzeit vertragen konnte, und ihn überkam der plötzliche Drang, ihr zu helfen.
»Worum geht es denn?«, fragte er in sanftem Ton. »Sie wollen mit mir reden, haben Sie gesagt. Warum gerade mit mir?«
»Weil Sie Polizist sind.«
»Und damit eigentlich der Letzte, den Sie um Hilfe bitten sollten.«
»Da haben Sie natürlich recht, Herr Schenke. Aber ich kenne Sie. Sie sind ein guter Mensch mit dem Herz auf dem rechten Fleck.«
»Ich will dem Gesetz dienen und alle, die dagegen verstoßen, der Gerechtigkeit zuführen. Mehr nicht.«
Sie sah ihn wissend an. »Das können Sie jemand anderem erzählen, ich glaube Ihnen kein Wort. Sie haben mehr Anstand als die meisten. Und Mitgefühl.«
Es hatte keinen Sinn, dies abzustreiten und so zu tun, als befände sich kein weicher Kern unter der harten Polizistenschale, mit der er sich umgab. Während der Mordermittlung hatte sie seine gütige, aufmerksame Seite erlebt; zumindest hatte er Mitgefühl für sie gehabt. Er war versucht, mehr für sie zu empfinden, ein Wunsch, den er sofort unterdrückte. »Na gut. Ich werde mir anhören, was Sie zu sagen haben, aber ansonsten kann ich Ihnen nichts versprechen, so gerne ich Ihnen auch helfen möchte.«
»Verstehe.« Ruth blickte auf ihre behandschuhten Hände herab und überlegte, wie sie anfangen sollte. »Ich bin im Auftrag einer Freundin meiner Familie hier. Einer sehr engen Freundin. Sie hat vor ein paar Tagen ihren Mann verloren. Vielleicht haben Sie ja davon gehört. Manfred Schmesler.«
»Schmesler?« Schenke kramte in seinem Gedächtnis, und ihm fiel ein knapper Bericht ein, den er im Völkischen Beobachter gelesen hatte. »Ja, richtig. Ein Arzt aus Pankow, wenn ich mich nicht irre.«
»Arzt und SS-Mitglied«, sagte sie, und man konnte ihr die Abscheu förmlich ansehen. »Aber lange bevor er der SS und der Partei beitrat, war er gut mit meiner Familie bekannt. Er hat mit meinem Vater zusammen studiert. Sie waren enge Freunde, solange das noch möglich war, und auch danach haben sie den Kontakt nicht abgebrochen, auch wenn sie ihn geheim halten mussten. Schmesler und seine Frau haben uns hin und wieder Lebensmittel oder Geld gegeben.« Sie hielt inne. »Das muss selbstverständlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass seine Witwe in Schwierigkeiten gerät. Sie hat schon genug durchzustehen, da muss sie nicht auch noch ins Visier von Polizei oder Gestapo geraten.«
»Natürlich. Erzählen Sie weiter.«
»In den Zeitungen steht zwar nichts über die Todesursache, aber die offizielle Version lautet, dass Manfred Schmesler Selbstmord begangen hat. Zu diesem Schluss sind jedenfalls die Polizisten gekommen, die als Erste am Tatort waren. Seine Witwe Brigitte dagegen ist felsenfest davon überzeugt, dass er sich niemals selbst getötet hätte. Er stand beruflich unter einem gewissen Druck, aber er hat das Leben genossen und seine Frau geliebt.« Sie sprach das Wort »Frau« in einem merkwürdigen Tonfall aus.
»Der Schein kann trügen«, sagte er. »Manche Leute können ihre wahren Gefühle so gut verbergen, dass selbst ihre Familie nichts ahnt. Hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen?«
»Ja«, musste Ruth einräumen.
»Und?«
»Seine Frau glaubt nicht, dass er echt ist.«
»Gut, aber was steht drin?«
Ruth schüttelte den Kopf. »Das weiß ich nicht. Sie war viel zu aufgewühlt und durcheinander, um es mir zu erzählen. Aber es gab keinen Hinweis darauf, dass er der Meinung gewesen wäre, den Tod verdient zu haben. Sie ist sich ganz sicher, dass er sich nicht selbst umgebracht hat.«
»Also war es Mord?« Schenke runzelte die Stirn. »Wie ist es passiert?«
»Kopfschuss. Sie hat ihn im Arbeitszimmer gefunden. Neben seiner Hand lag eine Pistole.«
»War es seine eigene Waffe?«
Ruth nickte.
»Und der Abschiedsbrief lag wo?«
»Auf dem Tisch.«
»In seiner Handschrift?«
Ruth dachte einen Augenblick lang nach. »Das sagt zumindest Brigitte. Seine Frau … seine Witwe.«
»Also auf den ersten Blick ist ein Selbstmord nicht völlig von der Hand zu weisen.«
Der Kellner unterbrach das Gespräch. Er brachte ein Tablett mit zwei dampfenden Suppentellern, zwei Teetassen samt Unterteller und einer Teekanne darauf. Als er alles zusammen mit zwei Löffeln auf den Tisch gestellt hatte, entfernte er sich wieder.
»Und was hat das alles mit mir zu tun?«, fragte Schenke, sobald der Kellner außer Hörweite war.
»Brigitte Schmesler möchte, dass Sie den Tod ihres Mannes untersuchen und herausfinden, ob es wirklich Selbstmord war. Sie weiß, dass ich Ihnen letztes Jahr dabei geholfen habe, diesen Frauenmörder zu schnappen. Ich habe ihr gesagt, dass Sie ein guter Mensch sind. Sie hielt es für das Beste, dass Ihnen jemand, den Sie persönlich kennen, ihr Anliegen überbringt. Daher habe ich mich bereit erklärt, mit Ihnen zu sprechen.«
Schenke nickte langsam und sah ihr in die Augen. »Sie gehen um Ihrer Freundin willen ein sehr hohes Risiko ein«, sagte er. »Wenn die Kollegen feststellen, dass es Selbstmord war, werden sie schon ihre Gründe gehabt haben.«
»Brigitte ist überzeugt davon, dass sie sich irren.«
Plötzlich fiel Schenke ein, wie äußerst merkwürdig es aussehen musste, dass sie beide untätig vor vollen Tellern saßen. Er nahm den Löffel in die Hand und schlürfte etwas Suppe. Ruth folgte seinem Beispiel. Beide aßen eine Weile schweigend, während er über das nachdachte, was sie ihm soeben erzählt hatte. Hätte es auch nur den geringsten Zweifel daran gegeben, dass Schmesler Selbstmord begangen hatte, wäre der Fall sofort an die Kripoabteilung in Pankow weitergeleitet worden. Für die Kollegen von der Ordnungspolizei war es offensichtlich ein klarer Fall gewesen. Ungewöhnlich war jedoch, dass sie so schnell zu diesem Schluss gekommen waren – vor allem trotz Brigitte Schmeslers fester Überzeugung, dass ihr Mann sich niemals das Leben genommen hätte. Selbst wenn man in Betracht zog, dass der Krieg und der durch die Einberufungen verursachte Personalmangel den vorschriftsmäßigen Dienst erschwerten, hätte der Fall an die Kripo weitergegeben werden müssen. Da die Orpo ihn bereits abgeschlossen hatte, konnte er die Ermittlungen nicht einfach wiederaufnehmen, ohne zumindest einen Grund dafür vorzuweisen. Er würde sich etwas umhören müssen, ohne Verdacht zu erregen, bis er genug in Erfahrung gebracht hatte, um Brigitte Schmesler davon zu überzeugen, dass es dennoch Selbstmord gewesen war.
Doch was, wenn sie recht hatte? Oder der Fall längst nicht so eindeutig war, wie die Orpo dachte? Was dann? Schenke hatte mit den gefälschten Essensmarken alle Hände voll zu tun und praktisch für nichts anderes mehr Zeit. Eine weitere Ermittlung wäre eine gewaltige Belastung. Doch dann rief er sich in Erinnerung, dass der Mörder, der vor Weihnachten die Hauptstadt unsicher gemacht hatte, ohne Ruth Frankel wohl immer noch auf freiem Fuß wäre. Er schuldete ihr einen Gefallen.
»Was sagen Sie dazu?« Sie starrte ihn an. »Werden Sie sich die Sache einmal ansehen?«
»Und wenn ich auch zu dem Schluss komme, dass es Selbstmord war? Werden Sie die Angelegenheit dann auf sich beruhen lassen?«
Sie nickte. »Sie darauf anzusprechen war riskant genug. Wenn Sie mir sagen, dass Manfred sich tatsächlich umgebracht hat, lasse ich Sie in Frieden und bringe es Brigitte schonend bei. Allerdings kann ich nicht dafür garantieren, dass Sie sich damit abfinden wird.«
»Also gut. Mal sehen, was ich tun kann. Geben Sie mir zwei Tage Zeit.«
»Sollen wir uns wieder hier treffen?«
»Lieber nicht. Hier sind Sie nicht sicher. Wir treffen uns um zwölf Uhr mittags bei dem Zeitungskiosk vor der U-Bahn-Station. Viel werden wir ja so oder so nicht zu besprechen haben.«
Sie warf einen Blick auf ihren Suppenteller. Schenke begriff, dass sie auf ein weiteres Mittagessen spekulierte. »Na schön, wir treffen uns hier. Aber vergewissern Sie sich, dass Ihnen niemand folgt. Wenn ich jemanden sehe, der Sie beschattet, treffen wir uns am Tag darauf beim Kiosk. Einverstanden?«
Ruth nickte. »Vielen Dank.«
Sie aßen schweigend und tunkten den letzten Rest Suppe mit Graubrot auf. Dann lehnte sich Schenke zurück und sah sie mitfühlend an. »Wie ist es Ihnen ergangen? Wohnen Sie noch bei dieser alten Frau?«
»Die hat mich hinausgeworfen, als sie gehört hat, dass ich mit der Polizei zu tun hatte.«
»Und wo sind Sie dann hin?«
»Ich konnte ein paar Tage bei einer Freundin unterkommen«, sagte sie und sah ihn argwöhnisch an.
»Von mir haben Sie nichts zu befürchten«, sagte Schenke. »Was Sie und Ihre Leute treiben, interessiert mich nicht. Ich muss mich um wichtigere Angelegenheiten kümmern.«
Sie hob die Tasse und nahm einen Schluck Tee. »Und wenn die Juden irgendwann zur wichtigen Angelegenheit erklärt werden?«
»Dann ist das hoffentlich nicht mein Problem.«
»Aber meines. Was, wenn es Ihre Vorgesetzten zu Ihrem Problem machen? Werden Sie mich jagen, wenn man es Ihnen befiehlt?«
Schenke dachte kurz über diese Frage nach. »Nur wenn Sie eine Straftat begehen, die in den Zuständigkeitsbereich der Kripo fällt, sonst nicht. Dann würde ich schon irgendwie dafür sorgen, dass Ihnen nichts zustößt.«
»Ich hoffe, dass ich Sie nie beim Wort nehmen muss. Für uns Juden wird die Lage immer hoffnungsloser. Gerüchten zufolge behandeln Ihre Herrn und Meister die Polen wie Tiere. Wie werden sie dann erst uns behandeln?«
»Was haben Sie vor?«
»Ich habe einen Plan für den Fall, dass die Partei beschließt, uns Juden zu entfernen.«
»Sie können sich nicht ewig verstecken.«
»Muss ich ja vielleicht auch nicht.« Sie senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Nur lange genug, bis Deutschland den Krieg verliert und der Führer mit seiner Mörderbande nicht mehr an der Macht ist.«
Schenke schüttelte den Kopf. »Das ist doch Irrsinn. Der Krieg ist so gut wie vorbei. Polen wurde erobert, und damit haben England und Frankreich keinen Grund, noch weiterzukämpfen. Selbst die britischen Kolonien kommen allmählich zur Vernunft. General Hertzog und seine Buren drängen das Parlament Südafrikas zu einem Separatfrieden mit Deutschland. Wenn sie Erfolg haben und ihr Beispiel in anderen Teilen des britischen Weltreichs Schule macht, wird England bald nicht mehr kämpfen können. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir in ein paar Monaten Frieden haben.«
»Glauben Sie das wirklich? Halten Sie den Führer allen Ernstes für einen Mann, dem an Frieden gelegen ist? Im Gegenteil. Er braucht und will den Krieg. Eines Tages wird er sich mit einer Nation anlegen, die mächtig genug ist, Deutschland zu zerschmettern.«
Ungeachtet dessen, was Schenke vom gegenwärtigen Regime hielt, war er doch Patriot und von ihren Worten gekränkt. »Sie haben doch gesehen, mit welcher Leichtigkeit unsere Armee Polen überrannt hat. Das haben die anderen Länder auch mitbekommen, und sie werden es sich zweimal überlegen, ob sie es mit uns aufnehmen wollen. Deutschland wird siegen, und sich das Gegenteil zu wünschen ist Landesverrat.«
Ruth sah ihn nachdenklich an. »Bemisst sich die Schwere des Landesverrats denn nicht an dem Schaden, den der Verräter seinem Land zufügt? Und hat uns die Geschichte nicht gelehrt, dass man das erst hinterher weiß? Nicht selten richten diejenigen, die ihren Patriotismus am lautesten verkünden, den größten Schaden an. Ich glaube, das gilt für den Führer, seine Partei und diejenigen, die ihm blind folgen … Glauben Sie das nicht auch?«
Schenke sagte nichts. Wut stieg in ihm auf und gleichzeitig ein winziger Funken Angst davor, dass sich ihre Worte bewahrheiten könnten – wie es in dem großen Krieg, der in diesem Jahrhundert bereits getobt hatte, der Fall gewesen war.
Ruth trank ihren Tee aus. »Ich muss los. Ich habe Spätschicht bei Siemens.«
»Dann bis übermorgen.« Impulsiv griff er über den Tisch und nahm ihre Hand. »Passen Sie auf sich auf, Ruth.«
Sie sahen sich einen Herzschlag lang an, dann zog Schenke die Hand zurück und räusperte sich verlegen.
»Mir passiert schon nichts.« Sie zwang sich zu einem Lächeln, dann stand sie auf und ging, wobei sie sorgfältig darauf achtete, nicht zu schnell zu laufen und so Aufmerksamkeit zu erregen.
Sobald sie das Lokal verlassen hatte, seufzte Schenke tief, trank seinen Tee aus, winkte den Kellner zu sich, um zu bezahlen, und trat auf die Straße hinaus. Der graue Himmel hatte sich verfinstert und ein eisiger Wind war aufgekommen, der kleine Schneeflocken verwirbelte. Er schlug den Kragen hoch, steckte die Hände in die Taschen und machte sich auf den Rückweg zum Revier.
3
Das Dienststellengebäude, in dem sich unter anderem die Räumlichkeiten der Kripoabteilung Pankow befanden, war eine ehemalige Kaserne aus der Bismarck-Ära – einer Epoche, in der die preußische Armee als unbezwingbar gegolten hatte. Die Stallungen im rückwärtigen Teil waren zu Garagen und Lagerhallen umfunktioniert worden. Die Mannschaftsquartiere dagegen waren zum Teil noch erhalten: Dort hatte man die Beamten aus anderen Zweigstellen untergebracht, wenn anlässlich von Kundgebungen oder Aufmärschen zusätzliche Sicherheitskräfte angefordert worden waren. Doch die unruhigen Jahre der Weimarer Republik, in denen kommunistische Demonstrationen niedergeschlagen oder die rechtsradikalen Wehrverbände in ihre Schranken verwiesen werden mussten, waren längst vorbei. Den Großteil des Hauptgebäudes hatte die Ordnungspolizei in Beschlag genommen, und dorthin war Schenke nun unterwegs, um mit dem Beamten zu sprechen, der für das Revier, in dem sich das Haus der Schmeslers befand, zuständig war: ein gewisser Hauptmann Sperlemann, der erst vor Kurzem nach Pankow versetzt worden war, wie Schenke durch den »Flurfunk« der Dienststelle erfahren hatte. Persönlich begegnet war er ihm noch nicht.
An der Tür zu Sperlemanns Büro am Ende eines Korridors im dritten Stock prangten auf einem polierten Messingschild Name und Dienstgrad in der altmodischen Frakturschrift, die bei der Partei als angeblicher Ausdruck deutscher Kultur so beliebt war. Schenke klopfte an die lackierte Holztür. Keine Antwort. Er versuchte es noch einmal, wartete und drückte dann die Klinke herunter. Die Tür war nicht verschlossen. Er öffnete sie und betrat das Büro.
In dem holzvertäfelten Raum brannte ein Feuer im Stubenofen, es war angenehm warm. Die beiden Fenster gingen zum Innenhof hinter dem Dienststellengebäude hinaus. Gegenüber dem Ofen stand ein großer Schreibtisch. Zwei Holzablagen waren akkurat auf der rechten Seite der Tischplatte aufgestellt, eine Schreibgarnitur mit Federhalter und Tintenfass stand auf der linken. In der Mitte ein Telefon. Über dem Ledersessel hinter dem Schreibtisch hing ein Dreiviertelporträt des Führers, der tief in Gedanken versunken die Eisblumen auf dem gegenüberliegenden Fenster anzustarren schien.
Schenke überlegte gerade, ob er Sperlemann eine Nachricht hinterlassen sollte, als er Schritte hörte. Er warf einen Blick in den Flur. Ein Offizier in einem zweireihigen Mantel kam mit gereizter Miene auf ihn zu. »Sie lassen ja die ganze Wärme raus. Sofort rein mit Ihnen.«
Schenke tat wie befohlen. Kurz darauf schloss der Offizier die Tür, zog die Lederhandschuhe aus und musterte seinen Besucher. »Sie sind von der Kripo, richtig?« Er sprach mit gepresster Stimme, und als er Hut und Schal ablegte, kamen darunter fleischige Wangen zum Vorschein. Auf der linken war eine kleine Narbe zu sehen, bei der es sich um einen Schmiss oder das Überbleibsel eines Unfalls handeln konnte. Sperlemanns Augen waren so braun wie das an den Seiten kurz rasierte, von der Stirn zurückgekämmte und mit Zuckerwasser fixierte Haar. Sein Kopf hatte die Form einer Kartoffel, und sein Teint war kränklich blass. Schenke schätzte ihn auf Mitte vierzig. Somit war es höchst unwahrscheinlich, dass man ihn noch befördern würde.
Schenke räusperte sich. »Kriminalinspektor Horst Schenke, Abteilungsleiter Kripo.«
Sperlemann musterte ihn ein weiteres Mal. »Da sollte man doch einen älteren und erfahreneren Beamten erwarten. Offen gestanden, frage ich mich, weshalb man einen Mann Ihres Alters noch nicht eingezogen hat.«
»Ich wurde wegen einer alten Beinverletzung für wehruntauglich erklärt, Herr Hauptmann.«
»Eine Beinverletzung, soso.« Die leichte Skepsis in seiner Stimme ärgerte Schenke. Sperlemann war alt genug, um im letzten Krieg gekämpft zu haben. Wahrscheinlich gehörte er zu denjenigen, die mit Verachtung auf die für den Dienst an der Waffe Untauglichen herabsahen. Schenke schämte sich ja selbst dafür, dass er nicht für sein Land kämpfen konnte, aber da war nichts zu machen.
»Was soll das denn für eine Beinverletzung sein?«, bohrte Sperlemann nach.
»Ein Motorsportunfall.«
»Motorsport?« Er hob eine Augenbraue, dann ging ihm ein Licht auf, und er machte große Augen. »Schenke! Schenke, der Silberpfeil.«
»So haben mich einige Zeitungen früher bezeichnet, ja«, gab Schenke widerwillig zu.
»Sie sind zu bescheiden. Ich habe Sie mal fahren gesehen. Sie sind als Zweiter ins Ziel, hinter irgend so einem verdammten Italiener. Das war das Rennen vor …« Sperlemann unterbrach sich peinlich berührt.
»Vor dem Unfall. Ja.« Schenke wurde nicht gerne an seine Vergangenheit erinnert, insbesondere nicht an das schlagartige, schmerzliche Ende seiner Rennfahrerkarriere. Seine großen Tage als gefeierter Motorsportler waren längst Geschichte, und geblieben war ihm davon nur ein steifes Bein, das ihn hinken ließ und gelegentlich wehtat. Jetzt war er Kriminalpolizist und strengte in erster Linie seinen Kopf und weniger seinen Körper an.
Sperlemann ließ es dabei bewenden, als er Schenkes Unbehagen bemerkte, hängte Hut und Schal an eine Garderobe neben der Tür und knöpfte den Mantel auf. Auf der Uniformjacke darunter kam ein Eisernes Kreuz zum Vorschein. »Also, was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs?«
»Ich hätte ein paar Fragen zu einem Todesfall, der sich kürzlich ereignet hat und der unter Umständen eine weitere Ermittlung durch die Kripo erforderlich macht.«
»Ein Todesfall? Um wen geht’s denn?« Sperlemann warf den Mantel über eine Stuhllehne und stellte sich mit in die Hüften gestemmten Händen vor den Ofen, um sich den Rücken zu wärmen.
»Um einen Arzt namens Schmesler. Seine Frau hat ihn tot in seinem Arbeitszimmer gefunden.«
»Ja, ich weiß. Selbstmord. Hat sich in den Kopf geschossen. Was ist mit ihm?«
»Angeblich gab es einen Abschiedsbrief.«
»In der Tat. Kurz und auf den Punkt. Schmesler hat geschrieben, dass ein letaler Gehirntumor bei ihm diagnostiziert worden sei, dass er keine Hoffnung mehr habe und einen langen und qualvollen Tod vermeiden wolle.«
Ein Hirntumor? Schenke fragte sich, warum ihm Ruth nichts davon erzählt hatte. »Stand noch mehr in dem Brief?«
Sperlemann dachte einen Augenblick nach, dann zuckte er mit den Schultern. »Ein paar liebende Worte an seine Frau. Er hat sie um Verzeihung gebeten.«
»Sonst nichts?«
»Was wollen Sie denn noch? Eine philosophische Abhandlung über die Sinnlosigkeit des Lebens? Schmesler war ein begabter Arzt auf der Höhe seiner Kunst. Der hatte alles, was man sich nur wünschen kann. Und dann hat ihm der Tumor einen Strich durch die Rechnung gemacht. So spielt das Leben. Jedenfalls ist der Fall geklärt, und die Kripo hat sicher auch Besseres zu tun. Weshalb interessiert Sie das überhaupt? Glauben Sie, dass die Orpo geschlampt hat?«
Schenke hatte sich auf diese Frage vorbereitet. »Schmesler war bei der SS. Es würde Himmler sicher nicht gefallen, wenn unter den Teppich gekehrt wird, dass einer seiner Offiziere unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist. Ich könnte natürlich auch das Reichssicherheitshauptamt davon in Kenntnis setzen, dass ich der Meinung bin, die Angelegenheit sollte noch einmal untersucht werden. Aber mir wäre natürlich lieber, wenn das Ganze unter uns bleibt und ich in Ruhe ermitteln kann.«
Sperlemann sah ihn schweigend an. Schenke ahnte, was er dachte: Er wollte keinesfalls den Zorn der SS-Führung auf sich ziehen, indem er Schenke bei seinen Ermittlungen behinderte. Genau diese Furcht vor der Obrigkeit hatte dazu geführt, dass sich viele vorauseilenden Gehorsam angewöhnt hatten.
»Na schön. Was wollen Sie wissen?«
»Es wäre wohl am einfachsten, wenn Sie mir die Akte aushändigen. Sie haben sicher viel zu tun, da will ich nicht mehr von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen als unbedingt nötig.«
Doch Sperlemann war ein schlechter Verlierer. »Ich werde Ihnen die Akte für heute überlassen. Morgen früh liegt sie wieder auf meinem Schreibtisch, ist das klar?«
»Wie Sie wünschen.«
Er ging zu seinem Schreibtisch und nahm eine braune Akte aus einer der darauf angeordneten Ablagen. Schenke trat vor, um sie in Empfang zu nehmen, und bemerkte erleichtert, dass sie relativ dünn war.
»Vielen Dank.« Schenke wandte sich zum Gehen.
»Morgen Vormittag, vergessen Sie das nicht!«, rief ihm Sperlemann hinterher.
Schenke kehrte in sein Büro in der Kripoabteilung zurück. Er ließ die Tür offen stehen, damit etwas Wärme von dem Ofen aus dem durch dünne Holzwände und Fenster abgetrennten Bereich, der ihm als Vorgesetzten zustand, ins Hauptbüro drang. Nachdem er Liebwitz befohlen hatte, ihm eine Tasse Kaffee-Ersatz zu bringen, setzte er sich, öffnete die Akte und überflog den Inhalt: Neben der kurzen Aussage des Polizisten, der als Erster vor Ort gewesen war, fanden sich darin ein ausführlicher Bericht des für die Ermittlung zuständigen Beamten samt seinen Schlussfolgerungen, eine grobe Skizze von Schmeslers Arbeitszimmer, das Protokoll der Befragung seiner Frau Brigitte sowie mehrere, aus verschiedenen Winkeln aufgenommene Fotografien des Leichnams. Er sah sich die Bilder genau an. Möglicherweise hatte sich der Arzt am Schreibtisch sitzend erschossen, woraufhin sein Körper zwischen Sessel und Tisch auf den Boden gerutscht war. Wahrscheinlicher war jedoch, dass er den Schuss im Stehen abgegeben hatte.
Vorausgesetzt, dass er wirklich auf diese Weise das Zeitliche gesegnet hatte.
Die Position der Pistole auf dem Boden ließ ebenfalls keine eindeutigen Schlüsse zu. Manchmal verkrampften sich die Finger des Selbstmörders um die Waffe, manchmal glitt sie ihm in den letzten Zuckungen aus der Hand. Schenke warf einen Blick auf das Zimmer im Hintergrund. Die Verdunkelungsvorhänge waren zugezogen. Es gab keine Hinweise auf gewaltsames Eindringen. Die Papiere des Arztes lagen ordentlich auf dem Schreibtisch, auf dem Blut und Hirnmasse dunkle Flecken hinterlassen hatten. Das breit gefächerte Spritzmuster ließ darauf schließen, dass sich beides aus relativ geringer Höhe über den Tisch verteilt hatte. Schenke folgerte daraus, dass sich Schmesler wahrscheinlich doch im Sitzen getötet hatte.
Auch eine Fotografie des Abschiedsbriefs lag der Akte bei. Schenke las die letzten Worte des Arztes:
Meine liebste Brigitte,
ich kann dir gar nicht sagen, wie schwer es mir fällt, diese Welt – und dich – zu verlassen. Unsere lange und glückliche Ehe auf diese Weise zu beenden, schmerzt mich sehr. Meine Niedergeschlagenheit in letzter Zeit wird dir sicher aufgefallen sein. In den vergangenen Monaten litt ich unter immer stärkeren Kopfschmerzen, und die Konsultation eines Facharztes bestätigte meine Befürchtungen. Ich habe einen bösartigen Tumor im Gehirn, der so rapide wächst, dass mir nur noch Monate, wenn nicht gar Wochen geblieben wären – ein grässlicher Todeskampf, den ich dir und mir ersparen wollte. Deshalb nehme ich auf diese Weise Abschied. Möge Gott mir vergeben.
Dein dich liebender Ehemann,
Manfred
»Kurz und bündig, genau wie Sperlemann gesagt hat«, murmelte Schenke. Als er den Brief ein weiteres Mal las, erschien ihm jedoch gerade diese Kürze verdächtig. Er versuchte, sich in die Lage des Arztes hineinzuversetzen. Was würde er in einem Abschiedsbrief an Karin schreiben? Gewiss wären seine letzten Worte emotionaler, und er würde auf ihre Gefühle Rücksicht nehmen. Doch vielleicht war Schmesler ja von Natur aus eher gefühlskalt gewesen oder hatte seiner Frau allzu viele Einzelheiten ersparen wollen …
Schenke suchte nach dem Bericht des Gerichtsmediziners und fand ihn ganz am Ende, dahinter folgte nur noch das von Sperlemann ausgefüllte Formular, mit dem er den Fall für abgeschlossen erklärt und alle zugehörigen Dokumente zur Archivierung im Keller der Dienststelle freigegeben hatte. Laut Gerichtsmedizin war der Tod als Folge eines Schusses in die Stirn eingetreten, welcher – der versengten Haut rund um die Eintrittswunde nach zu urteilen – aufgesetzt oder zumindest aus nächster Nähe erfolgt sein musste. Das Fazit des Leichenbeschauers war ähnlich knapp wie der Abschiedsbrief und bestätigte, dass es sich um Selbstmord handelte. Schenke bemerkte verwundert, dass der Gehirntumor mit keinem Wort erwähnt wurde.
Alle Unterlagen in der Akte erweckten den Eindruck geradezu schamloser Schludrigkeit. Irgendetwas war hier faul. Schenke blätterte zum Protokoll der Befragung von Brigitte Schmesler zurück. Während er es las, stellte er sich die Situation vor. Wahrscheinlich hatte sie Rede und Antwort stehen müssen, während man den Leichnam ihres Ehemanns aus dem Arbeitszimmer geschafft hatte, um ihn ins Leichenschauhaus zu bringen. Ihre Verwirrung und ihr Schock waren leicht zwischen den Zeilen des in nüchterner Beamtensprache verfassten Protokolls zu lesen. Frau Schmesler hatte felsenfest behauptet, dass ihr Mann niemals Hand an sich gelegt hätte, Tumor hin oder her. Außerdem hätte er eine so schwerwiegende Diagnose niemals vor ihr verheimlicht. Sie hätten eine glückliche Ehe geführt, sich gegenseitig vertraut und keine Geheimnisse voreinander gehabt. Auch war ihr niemand eingefallen, der einen Groll gegen ihren Mann gehegt oder sonst einen Grund gehabt hätte, ihm zu schaden. Schmesler hatte einen großen Freundeskreis gehabt und war bei seinen Kollegen beliebt und geachtet gewesen.
In der Ausbildung zum Kriminalpolizisten hatte Schenke gelernt, dass viele Menschen dazu neigten, die Augen vor den dunkelsten Geheimnissen ihrer Ehepartner zu verschließen, selbst wenn man sie mit eindeutigen Beweisen konfrontierte. Manchmal leugneten sie aus Schock und Trauer sogar unwiderlegbare Tatsachen – Frau Schmeslers Aussage war zu diesem Zeitpunkt daher mit Vorsicht zu genießen.
Danach folgte der Bericht über die Untersuchung der Schusswaffe. Es war eine Mauser C96, eine sogenannte »Besenstiel«-Mauser. Eine ungewöhnliche Waffe, wurden gegenwärtig doch kleinere und leichtere Pistolen bevorzugt. Ein einziger Schuss war daraus abgegeben worden, und die Kugel hatte sich, nachdem sie Schmeslers Kopf durchschlagen hatte, in ein Buch auf einem Regal hinter dem Schreibtisch gebohrt. Schenke sah sich zuerst das Bild der Mauser genau an, dann legte er die Fotografie beiseite und versuchte, sich die Tat vorzustellen, indem er die rechte Hand zur Pistole formte und damit auf die Mitte seiner Stirn zielte.
»So schlimm wird es schon nicht sein, oder?«
Er blickte auf und sah Hauser in der Tür stehen. Mit einem verlegenen Lächeln ließ Schenke die Hand sinken.
»Was sehen Sie sich denn da an?«, fragte Hauser und legte den Kopf schief, um die geöffnete Akte besser erkennen zu können.