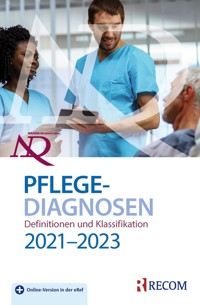
NANDA-I-Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 2021-2023 E-Book
64,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Recom
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Standardwerk für Theorie und Praxis in der Pflege Die neue Ausgabe der Pflegeklassifikation von NANDA International 2021–2023 hält 46 neue und 67 überarbeitete Diagnosen für Sie bereit; 17 Pflegediagnosentitel wurden auf Basis aktueller Fachliteratur angepasst, um eine menschliche Reaktion noch treffender auszudrücken. Dieser hohe Grad an Standardisierung bietet auch ein verlässliches Niveau der Indikatorenbegriffe (bestimmende Merkmale, beeinflussende Faktoren, Risikofaktoren). Ein wichtiges Kriterium, gerade weil die Pflegediagnostik fest in der neuen generalistischen Pflegeausbildung verankert ist. Konkrete Anwendungsszenarien der Pflegediagnosen werden anschaulich beschrieben. Nicht zuletzt, um den vielfachen Anwendungsmöglichkeiten der Pflegeklassifikation gerecht zu werden. Hierzu wurden auch die einleitenden Kapitel zu Aufbau, Hintergründen, Anwendung und Verbreitung der Pflegediagnosen gründlich überarbeitet. Dass internationaler Standard großgeschrieben wird, zeigen auch die neuen differenzierten Kriterien der Evidenzlevel, die eine fachliche Einschätzung zum Entwicklungsstand der einzelnen Diagnosen ermöglichen. Mit dieser neuen Ausgabe von NANDA-I erhalten Sie professionelle Informationen in Form von insgesamt 267 aktuellen Pflegediagnosen, um eine diagnostische Einordnung des vorliegenden Pflegephänomens im klinischen Kontext vornehmen zu können. Das Fachbuch liefert grundlegendes Wissen zur Pflegediagnostik und eignet sich in besonderer Weise für Lehr- und Lernzwecke. Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
NANDA-I-Pflegediagnosen
Definitionen und Klassifikation 2021-2023
T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru, Camila Takáo Lopes
Widmung
Dieses Buch ist den Pflegefachpersonen gewidmet, die im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie an vorderster Front stehen. Dies hat der Vorstand von NANDA-I, Inc. aus aktuellem Anlass entschieden. Wir bewundern euren Mut und euer Engagement in dieser schwierigen Zeit. Mit großem Respekt gedenken wir dabei insbesondere der Pflegefachpersonen, die bei der Pflege von Patienten und Familienmitgliedern ihr Leben verloren haben.
Vorwort
Das Internationale Jahr der Pflegenden und Hebammen begann mit dem Kampf gegen COVID-19. Medizinischen Fachkräften kann man nicht genug für ihre Bereitschaft danken, Patienten zu versorgen, obwohl zeitweise nicht einmal genügend Schutzausrüstung für sie selbst zur Verfügung stand. Während ich dies schreibe, halten die Auswirkungen von COVID-19 weltweit noch immer an. Ich hoffe inständig, dass bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie diesen Text lesen, wirksame Behandlungsmöglichkeiten und Präventionsmaßnahmen entdeckt wurden, die allen Menschen zur Verfügung stehen.
Vor einiger Zeit fragte mich eine Pflegefachperson mitten in der Pandemiebekämpfung: „Welche Pflegediagnose soll ich bei COVID-19-Patienten anwenden?“ Ihre Frage zeigt, dass wir nicht oft genug betonen können, was unter einer Pflegediagnose zu verstehen ist. Das Wichtigste dabei ist: nicht alle Patienten mit einer bestimmten medizinischen Diagnose zeigen zwangsläufig die gleiche menschliche Reaktion (Pflegediagnosen). Entsprechend zeigen auch Patienten, bei denen derselbe Genotyp einer Coronavirusinfektion nachgewiesen wurde, nicht unbedingt die gleiche menschliche Reaktion. Aus diesem Grund führen Pflegefachpersonen ein Pflegeassessment durch und identifizieren die individuellen Reaktionen (Pflegediagnosen) ihrer Patienten, bevor sie die jeweilige Person mit passenden Pflegemaßnahmen versorgen. Auch in Zeiten wie diesen müssen Pflegefachpersonen herausfinden, was die Pflege in Bezug auf die Patienten und ihre Familien eigenständig diagnostiziert und behandelt – und das ist nicht zu verwechseln mit der medizinischen Diagnose. Wenn Pflegefachpersonen die Pflegediagnosen von Patienten mit COVID-19 und ihren Angehörigen sorgfältig dokumentieren, wird es uns in naher Zukunft möglich sein, international beobachtete Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren menschlichen Reaktionen ausfindig zu machen.
Mit der vorliegenden Version 2021–2023 umfasst die Taxonomie nun insgesamt 267 Diagnosen, darunter 46 neue. Jede einzelne Pflegediagnose ist dem Engagement eines oder mehrerer unserer vielen NANDA-I-Freiwilligen zu verdanken, und die meisten Diagnosen verfügen über eine definierte Evidenzbasis. Jede neue Diagnose wurde zunächst von den Mitgliedern des Diagnosenentwicklungskomitees (Diagnosis Development Committee, DDC) als Erstgutachter sowie von Fachexperten überarbeitet und präzisiert, bevor sie vom DDC genehmigt wurde. Wurde eine Diagnose vom DDC genehmigt, bedeutet dies keineswegs, dass die Diagnose „abgeschlossen“ oder in sämtlichen Ländern und Fachbereichen vorbehaltlos genutzt werden kann. Wir alle wissen, dass sich die pflegerische Praxis, aber auch die gesetzlichen Vorschriften für die professionelle Pflege von Land zu Land unterscheiden. Wir hoffen, dass die Veröffentlichung der neuen Diagnosen in verschiedenen Teilen der Welt zum Anlass genommen wird, weitere Validierungsstudien durchzuführen, die zu einem höheren Evidenzlevel beitragen werden.
Einreichungen für neue Pflegediagnosen sind uns jederzeit willkommen. Gleichzeitig müssen etliche bestehende Diagnosen überarbeitet werden, damit sie den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht werden. In der vorherigen Ausgabe wurden etwa 90 Diagnosen ausfindig gemacht, denen bisher kein Evidenzgrad (engl. level of evidence, LOE) zugeordnet wurde oder die umfassend aktualisiert werden müssen. Dank der Unterstützung etlicher Freiwilliger konnte ein großer Teil dieser Diagnosen mittlerweile so überarbeitet werden, dass sie die Voraussetzungen für unsere LOE-Kriterien erfüllen. Die meisten Mitwirkenden werden im Abschnitt 1.3 (Überarbeitete Pflegediagnosen) namentlich genannt. Dennoch ist es uns nicht gelungen, sämtliche Überarbeitungen abzuschließen, sodass sich nach wie vor 32 Diagnosen in der Klassifikation befinden, für die noch kein Evidenzgrad bestimmt werden konnte. Diese verbleibenden Diagnosen sollen bis zur nächsten Ausgabe überarbeitet oder aus der Klassifikation entfernt werden. An dieser Stelle appelliere ich an alle Studierenden und Forschenden: Leiten Sie Ihre Forschungsergebnisse zu Pflegediagnosen an die NANDA-I weiter, um die Evidenzbasis der Terminologie zu stärken!
Die NANDA-I-Terminologie wird in mehr als 20 verschiedene Sprachen übersetzt. Die Übersetzung abstrakter englischer Begriffe in andere Sprachen stellt dabei eine große Herausforderung dar. Für die aktuelle Ausgabe wurde entschieden, die Medical Subject Headings, das heißt, die standardisierten Begriffe der US-Nationalbibliothek für Medizin einzubinden, damit sich die Übersetzung künftig einfacher gestaltet. Enthalten die diagnostischen Indikatoren dort, wo es möglich und sinnvoll ist, sog. MeSH-Terms, so können Übersetzerinnen und Übersetzer bei ihrer Arbeit auf standardisierte Definitionen für bestimmte Begriffe zurückgreifen. Wir gehen davon aus, dass dies ihre Arbeit erleichtern wird.
Die Jahre seit der Erscheinung der letzten Ausgabe markierten auch den Beginn der Zusammenarbeit mit unserem wissenschaftlichen Kooperationspartner, der Connell School of Nursing des Boston College (BC), die hoffentlich noch viele Jahre andauern wird. Unter der Leitung von Dr. Dorothy Jones wurde das Marjory Gordon Program for Knowledge Development and Clinical Reasoning ins Leben gerufen. Die erste Konferenz zu diesem neuen Programm fand 2018 am Boston College statt. Eine zweite Konferenz war für 2020 geplant, musste aber leider pandemiebedingt abgesagt werden. Was jedoch abgeschlossen werden konnte, ist die Arbeit an einem E-Learning-Modul, das als Gemeinschaftsprojekt des BC und der NANDA-I realisiert wurde. Außerdem wurden mehrere Postdoc-Stipendiaten aus verschiedenen Teilen der Welt in das Programm aufgenommen (Brasilien, Italien, Spanien, Nigeria). Die Zusammenarbeit wird weiterhin fortgesetzt. Wir freuen uns auf weitere Konferenzen, Möglichkeiten zur Fortbildung, Postdoc-Stipendien und Erfahrungen, die die Partnerschaft mit BC in Zukunft mit sich bringen wird. Dr. Jones, Dean Susan Gennaro und dem stellvertretenden Dekan Christopher Grillo danke ich ganz herzlich für ihre Zusammenarbeit, ihre Kollegialität und ihr Engagement, das die Begründung dieser Partnerschaft ermöglicht hat.
Auch den vielen NANDA-I-Freiwilligen, Komiteemitgliedern, Vorsitzenden und Vorstandsmitgliedern möchte ich an dieser Stelle meine Anerkennung für ihre Zeit, ihr Engagement, ihre Hingabe und ihre kontinuierliche Unterstützung aussprechen. Mein Dank gebührt außerdem den verschiedenen Expertinnen und Experten, die – obwohl sie nicht Mitglied von NANDA International sind – unzählige Stunden damit verbrachten, Diagnosen aus ihrem jeweiligen Kompetenzbereich zu begutachten und zu überarbeiten. Nicht zuletzt möchte ich den Einsatz und die Unterstützung unserer Mitarbeiter unter Leitung unserer Geschäftsführerin, Dr. T. Heather Herdman, würdigen.
Mein besonderer Dank gilt dabei den Mitgliedern des Diagnosenentwicklungskomitees und des Expert Clinical Advisory Panels: Sie haben sich außerordentlich darum bemüht, die in diesem Buch enthaltene Terminologie innerhalb kürzester Zeit zu prüfen und zu lektorieren. Zu guter Letzt möchte ich insbesondere unserer neuen DDC-Vorsitzenden danken, Dr. Camila Takáo Lopes, die dieses Amt seit 2019 bekleidet. Dieses außergewöhnliche Komitee, in dem Menschen aus Nord- und Südamerika sowie Europa vertreten sind, ist der Motor, der die stetige Wissenserweiterung der NANDA-I vorantreibt. Ich bin zutiefst beeindruckt und erfreut über die erstaunliche und intensive Arbeit, die die Freiwilligen in diesem Durchgang geleistet haben, und ich bin überzeugt, dass Sie von dem Ergebnis ebenso begeistert sein werden wie ich.
Es war mir eine Ehre und ein Privileg, diesem engagierten Zusammenschluss internationaler Pflegefachpersonen als Präsidentin dienen zu dürfen, und ich freue mich darauf, zu sehen, wohin sich unsere Arbeit in Zukunft entwickeln wird.
Shigemi Kamitsuru, PhD, RN, FNIPräsidentin, NANDA International, Inc.
Danksagungen
In dieser Ausgabe wurden grundlegende Änderungen vorgenommen. Dies wäre nicht möglich gewesen, hätten nicht etliche Pflegefachpersonen rund um den Globus einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit geopfert, um dieses Projekt zu unterstützen. Daher möchten wir insbesondere die Arbeit folgender Personen hervorheben:
Autoren der einzelnen KapitelEinreichung neuer Diagnosen: Neue Evidenzkriterien
Marcos Venícios de Oliveira Lopes, PhD, RN, FNI. Universidade Federal do Ceará, Brasilien
Viviane Martins da Silva, PhD, RN, FNI. Universidade Federal do Ceará, Brasilien
Diná Monteiro da Cruz, PhD, RN, FNI. Universidade de São Paulo, Brasilien
Grundlagen der Pflegediagnosen; Pflegediagnosen: Eine internationale Terminologie
Susan Gallagher-Lepak, PhD, RN. University of Wisconsin – Green Bay, USA
Klinische Entscheidungsfindung: Vom Assessment zur Diagnosestellung
Dorothy A. Jones, EdD, RNC, ANP, FNI, FAAN. Boston College, USA
Rita de Cássia Gengo e Silva Butcher, PhD, RN. The Marjory Gordon Program for Clinical Reasoning and Knowledge Development, Boston College, USA
Spezifizierungen und Definitionen in der NANDA-International-Taxonomie der Pflegediagnosen
Sílvia Caldeira, PhD, RN. Universidade Católica Portuguesa, Portugal
BeratungHinweis auf Inhaltsexperten für die Task Force des DDC 2019
Emilia Campos de Carvalho, PhD, RN, FNI. Universidade de São Paulo, Brasilien
Diagnostischer Inhalt zur seelischen Gesundheit
Jacqueline K. Cantor, MSN, RN, PMHCNS-BC, APRN. West Hartford, USA
Diagnostischer Inhalt zur medizinischen Grundversorgung
Ángel Martín García, RN. Centro de Salud San Blas, Spanien
Martín Rodríguez Álvaro, PhD, RN. Universidad de la Laguna, Spanien
Diagnostischer Inhalt zur Intensivpflege
Fabio D’Agostino, PhD, RN. Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences, Italien
Gianfranco Sanson, PhD, RN. Università degli studi di Trieste, Italien
Technische UnterstützungDer besondere Dank der Herausgeberinnen gilt Mary Kalinosky, leitende technische Entwicklerin bei Thieme Publishers in New York. Sie hat die Datenbank für die NANDA-I-Terminologie aufgebaut und angepasst. Dadurch wurde es für uns deutlich einfacher, die Begriffe in der Klassifikation auszuwerten und zu überarbeiten. Für ihr Engagement in diesem riesigen Projekt können wir ihr gar nicht genug danken.
Bitte schreiben Sie uns an [email protected], wenn Sie inhaltliche Fragen haben oder wenn Sie Fehler finden, damit diese in kommenden Veröffentlichungen und Übersetzungen korrigiert werden können.
Die Herausgeberinnen
T. Heather Herdman, PhD, RN, FNI, FAANShigemi Kamitsuru, PhD, RN, FNICamila Takáo Lopes, PhD, RN, FNINANDA International, Inc.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Widmung
Vorwort
Danksagungen
Teil I Allgemeine Hinweise zur Terminologie der NANDA International
1 Worin unterscheidet sich die neue Ausgabe (2021–2023) von früheren Versionen?
1.1 Übersicht über Änderungen und Neuerungen in Ausgabe 2021–2023
1.2 Neue Pflegediagnosen
1.3 Überarbeitete Pflegediagnosen
1.4 Änderungen an den Titeln der Pflegediagnosen
1.5 Pflegediagnosen, die in der aktuellen Ausgabe nicht mehr enthalten sind
1.6 NANDA-I-Pflegediagnosen: Standardisierung der Indikatorenbegriffe
1.6.1 Die Übersetzung der Klassifikation wird einfacher
1.6.2 Die terminologische Konsistenz wird erhöht
1.6.3 Die Kodierung der diagnostischen Indikatoren wird einfacher
2 Hinweise zur internationalen Verwendung der NANDA-I-Pflegediagnosen
Teil II Forschungsempfehlungen zur Verbesserung der Terminologie
3 Ausblick: Geplante Verbesserungen der NANDA-I-Terminologie
3.1 Forschungsschwerpunkte
3.2 Diagnosen, die präzisiert oder anderweitig bearbeitet werden sollten
3.3 Literaturangaben
4 Einreichung neuer Diagnosen: Neue Evidenzkriterien
4.1 Einleitung
4.2 Die Begriffe „Klinische Evidenz“ und „Theorie der Validität“
4.3 Evidenzlevel für die Validität der NANDA-I-Diagnosen
4.3.1 Level 1: Dem DDC unterbreiteter Vorschlag zur Entwicklung
4.3.2 Level 2: Aufnahme in die Terminologie und Erprobung in der Praxis
4.3.3 Schlussbetrachtungen
4.4 Literaturangaben
Teil III Die Anwendung der NANDA-International-Pflegediagnosen
5 Grundlagen der Pflegediagnosen
5.1 Grundlegendes zur pflegerischen Diagnostik: Eine Einführung
5.2 Grundlegendes zur pflegerischen Diagnostik: Diagnosestellung
5.3 Grundlegendes zur pflegerischen Diagnostik: Kenntnis der pflegerischen Konzepte
5.4 Assessment
5.5 Diagnosestellung
5.6 Planung/Durchführung
5.7 Kamitsurus dreiteiliges Modell der pflegerischen Praxis
5.8 Evaluation
5.9 Grundlegendes zur pflegerischen Diagnostik: Anwendung in der Praxis
5.10 Kurze Zusammenfassung des Kapitels
5.11 Literaturangaben
6 Pflegediagnosen: Eine internationale Terminologie
6.1 Gemeinsamkeiten der Pflege weltweit: Eine Bestandsaufnahme
6.2 Pflegerische Ausbildung und Berufspraxis
6.3 Fachgesellschaften und Pflegeklassifikationen
6.4 Weltweite Implementierung
6.4.1 Brasilien
6.4.2 Japan
6.4.3 Mexiko
6.4.4 Peru
6.4.5 Irland
6.4.6 Spanien
6.4.7 Vereinigte Staaten
6.5 Zusammenfassung
6.6 Danksagungen der Personen, die an diesem Kapitel mitgewirkt haben
6.7 Literaturangaben
7 Klinische Entscheidungsfindung: Vom Assessment zur Diagnosestellung
7.1 Klinische Entscheidungsfindung: Einführung
7.2 Klinische Entscheidungsfindung im Pflegeprozess
7.3 Der Pflegeprozess
7.4 Literaturangaben
8 Anwendung in der klinischen Praxis: Datenanalyse als Voraussetzung für das Stellen von Pflegediagnosen
8.1 Informationen gruppieren/Muster erkennen
8.2 Mögliche Pflegediagnosen identifizieren (diagnostische Hypothesen)
8.3 Die Diagnose präzisieren
8.4 Potenzielle Pflegediagnosen bestätigen/widerlegen
8.5 Infrage kommende Diagnosen ausschließen
8.6 Neue Diagnosen, die infrage kommen
8.7 Ähnliche Diagnosen voneinander abgrenzen
8.8 Stellen der Diagnose/Priorisieren
8.9 Zusammenfassung
8.10 Literaturangaben
9 Einführung in die NANDA-International-Taxonomie der Pflegediagnosen
9.1 Einführung in die Taxonomie
9.2 Wie kann pflegerisches Wissen systematisch geordnet werden?
9.3 Wie arbeitet man mit der NANDA-I-Taxonomie?
9.3.1 Pflege-Curricula strukturieren
9.3.2 Pflegediagnosen identifizieren, die über das eigene Fachgebiet hinausgehen
9.4 Die Entstehung der NANDA-I-Taxonomie der Pflegediagnosen II im Überblick
9.5 Literaturangaben
10 Spezifizierungen und Definitionen in der NANDA-International-Taxonomie der Pflegediagnosen
10.1 Die Struktur der Taxonomie II
10.2 Die NANDA-I-Taxonomie II: Ein multiaxiales System
10.3 Definitionen der Achsen
10.3.1 Achse 1: Fokus der Diagnose
10.3.2 Achse 2: Subjekt der Diagnose
10.3.3 Achse 3: Beurteilung
10.3.4 Achse 4: Lokalisation
10.3.5 Achse 5: Alter
10.3.6 Achse 6: Zeit
10.3.7 Achse 7: Status der Diagnose
10.4 Entwickeln und Einreichen einer Pflegediagnose
10.5 Ausblick: Die Arbeit mit den Achsen
10.6 Literaturangaben
11 Glossar
11.1 Pflegediagnose
11.1.1 Problemfokussierte Pflegediagnose
11.1.2 Gesundheitsförderungsdiagnose
11.1.3 Risikopflegediagnose
11.1.4 Syndrom
11.2 Diagnostische Achsen
11.2.1 Achse
11.2.2 Definitionen der Achsen
11.3 Bestandteile einer Pflegediagnose
11.3.1 Diagnosetitel (engl. diagnosis label)
11.3.2 Definition
11.3.3 Bestimmende Merkmale (engl. defining characteristics)
11.3.4 Risikofaktoren (engl. risk factors)
11.3.5 Beeinflussende Faktoren (engl. related factors)
11.3.6 Risikopopulationen (engl. at-risk populations)
11.3.7 Assoziierte Bedingungen (engl. associated conditions)
11.4 Definitionen von Begriffen, die mit Pflegediagnosen in Verbindung gebracht werden
11.4.1 Eigenständige pflegerische Interventionen
11.4.2 Pflegesensitive Outcomes
11.4.3 Pflegeplanung
11.5 Definitionen zur Klassifikation von Pflegediagnosen
11.5.1 Klassifikation
11.5.2 Abstraktionsgrad
11.5.3 Terminologie
11.5.4 Taxonomie
11.6 Literaturangaben
Teil IV Die NANDA-International-Pflegediagnosen
12 Domäne 1. Gesundheitsförderung
12.1 Klasse 1. Gesundheitsbewusstsein
12.1.1 Vermindertes Engagement in ablenkenden Aktivitäten
12.1.2 Bereitschaft für eine verbesserte Gesundheitskompetenz
12.1.3 Bewegungsarmer Lebensstil
12.2 Klasse 2. Gesundheitsmanagement
12.2.1 Risiko eines Weglaufversuchs
12.2.2 Frailty-Syndrom im Alter
12.2.3 Risiko eines Frailty-Syndroms im Alter
12.2.4 Bereitschaft für ein verbessertes Engagement für physische Bewegung
12.2.5 Unzureichender Gesundheitszustand einer Gemeinde
12.2.6 Risikobehaftetes Gesundheitsverhalten
12.2.7 Ineffektive Verhaltensweisen zur Erhaltung der Gesundheit
12.2.8 Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement
12.2.9 Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheits-Selbstmanagement
12.2.10 Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement der Familie
12.2.11 Ineffektive Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung
12.2.12 Risiko ineffektiver Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung
12.2.13 Bereitschaft für verbesserte Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung
12.2.14 Ineffektiver Selbstschutz
13 Domäne 2. Ernährung
13.1 Klasse 1. Nahrungsaufnahme
13.1.1 Unausgeglichene Ernährung: weniger als der Körper benötigt
13.1.2 Bereitschaft für eine verbesserte Ernährung
13.1.3 Unzureichende Muttermilchproduktion
13.1.4 Ineffektives Stillen
13.1.5 Unterbrochenes Stillen
13.1.6 Bereitschaft für verbessertes Stillen
13.1.7 Ineffektive Ernährungsweise von Jugendlichen
13.1.8 Ineffektive Ernährungsweise von Kindern
13.1.9 Ineffektive Ernährungsweise von Säuglingen
13.1.10 Adipositas
13.1.11 Übergewicht
13.1.12 Risiko eines Übergewichts
13.1.13 Ineffektive Saug-Schluck-Reaktion des Säuglings
13.1.14 Beeinträchtigtes Schlucken
13.2 Klasse 2. Verdauung
13.2.1 Diese Klasse enthält derzeit keine Diagnosen
13.3 Klasse 3. Absorption
13.3.1 Diese Klasse enthält derzeit keine Diagnosen
13.4 Klasse 4. Metabolismus
13.4.1 Risiko eines instabilen Blutglukosespiegels
13.4.2 Neonatale Hyperbilirubinämie
13.4.3 Risiko einer neonatalen Hyperbilirubinämie
13.4.4 Risiko einer beeinträchtigten Leberfunktion
13.4.5 Risiko eines metabolischen Syndroms
13.5 Klasse 5. Flüssigkeitszufuhr
13.5.1 Risiko eines unausgeglichenen Elektrolythaushalts
13.5.2 Risiko eines unausgeglichenen Flüssigkeitsvolumens
13.5.3 Defizitäres Flüssigkeitsvolumen
13.5.4 Risiko eines defizitären Flüssigkeitsvolumens
13.5.5 Übermäßiges Flüssigkeitsvolumen
14 Domäne 3. Ausscheidung und Austausch
14.1 Klasse 1. Harntraktfunktion
14.1.1 Behinderungsassoziierte Harninkontinenz
14.1.2 Beeinträchtigte Harnausscheidung
14.1.3 Mischharninkontinenz
14.1.4 Stressharninkontinenz
14.1.5 Drangharninkontinenz
14.1.6 Risiko einer Drangharninkontinenz
14.1.7 Harnretention
14.1.8 Risiko einer Harnretention
14.2 Klasse 2. Magen-Darm-Funktion
14.2.1 Obstipation
14.2.2 Risiko einer Obstipation
14.2.3 Wahrgenommene Obstipation
14.2.4 Chronische funktionelle Obstipation
14.2.5 Risiko einer chronischen funktionellen Obstipation
14.2.6 Beeinträchtigte Stuhlkontinenz
14.2.7 Diarrhö
14.2.8 Dysfunktionale gastrointestinale Motilität
14.2.9 Risiko einer dysfunktionalen gastrointestinalen Motilität
14.3 Klasse 3. Hautfunktion
14.3.1 Diese Klasse enthält derzeit keine Diagnosen
14.4 Klasse 4. Respiratorische Funktion
14.4.1 Beeinträchtigter Gasaustausch
15 Domäne 4. Aktivität/Ruhe
15.1 Klasse 1. Schlaf/Ruhe
15.1.1 Schlafstörung
15.1.2 Schlafmangel
15.1.3 Bereitschaft für einen verbesserten Schlaf
15.1.4 Gestörtes Schlafmuster
15.2 Klasse 2. Aktivität/Bewegung
15.2.1 Verminderte Aktivitätstoleranz
15.2.2 Risiko einer verminderten Aktivitätstoleranz
15.2.3 Risiko eines Inaktivitäts-Syndroms
15.2.4 Beeinträchtigte Mobilität im Bett
15.2.5 Beeinträchtigte physische Mobilität
15.2.6 Beeinträchtigte Mobilität mit dem Rollstuhl
15.2.7 Beeinträchtigtes Sitzen
15.2.8 Beeinträchtigtes Stehen
15.2.9 Beeinträchtigte Transferfähigkeit
15.2.10 Beeinträchtigte Gehfähigkeit
15.3 Klasse 3. Energiehaushalt
15.3.1 Unausgeglichenes Energiefeld
15.3.2 Fatigue
15.3.3 Ruheloses Umhergehen
15.4 Klasse 4. Kardiovaskuläre/pulmonale Reaktionen
15.4.1 Ineffektives Atemmuster
15.4.2 Verminderte Herzleistung
15.4.3 Risiko einer verminderten Herzleistung
15.4.4 Risiko einer beeinträchtigten kardiovaskulären Funktion
15.4.5 Ineffektives Selbstmanagement eines Lymphödems
15.4.6 Risiko eines ineffektiven Selbstmanagements eines Lymphödems
15.4.7 Beeinträchtigte Spontanatmung
15.4.8 Risiko eines instabilen Blutdrucks
15.4.9 Risiko einer Thrombose
15.4.10 Risiko einer verminderten kardialen Gewebedurchblutung
15.4.11 Risiko einer ineffektiven zerebralen Gewebedurchblutung
15.4.12 Ineffektive periphere Gewebedurchblutung
15.4.13 Risiko einer ineffektiven peripheren Gewebedurchblutung
15.4.14 Dysfunktionales Weaning
15.4.15 Dysfunktionales Weaning bei Erwachsenen
15.5 Klasse 5. Selbstversorgung
15.5.1 Selbstversorgungsdefizit Körperpflege
15.5.2 Selbstversorgungsdefizit Sich-Kleiden
15.5.3 Selbstversorgungsdefizit Nahrungsaufnahme
15.5.4 Selbstversorgungsdefizit Toilettenbenutzung
15.5.5 Bereitschaft für eine verbesserte Selbstversorgung
15.5.6 Selbstvernachlässigung
16 Domäne 5. Wahrnehmung/Kognition
16.1 Klasse 1. Aufmerksamkeit
16.1.1 Einseitiger Neglect
16.2 Klasse 2. Orientierung
16.2.1 Diese Klasse enthält derzeit keine Diagnosen
16.3 Klasse 3. Empfindung/Wahrnehmung
16.3.1 Diese Klasse enthält derzeit keine Diagnosen
16.4 Klasse 4. Kognition
16.4.1 Akute Verwirrtheit
16.4.2 Risiko einer akuten Verwirrtheit
16.4.3 Chronische Verwirrtheit
16.4.4 Labile emotionale Kontrolle
16.4.5 Ineffektive Impulskontrolle
16.4.6 Defizitäres Wissen
16.4.7 Bereitschaft für verbessertes Wissen
16.4.8 Beeinträchtigte Gedächtnisleistung
16.4.9 Gestörter Denkprozess
16.5 Klasse 5. Kommunikation
16.5.1 Bereitschaft für eine verbesserte Kommunikation
16.5.2 Beeinträchtigte verbale Kommunikation
17 Domäne 6. Selbstwahrnehmung
17.1 Klasse 1. Selbstkonzept
17.1.1 Hoffnungslosigkeit
17.1.2 Bereitschaft für verbesserte Hoffnung
17.1.3 Risiko einer gefährdeten Menschenwürde
17.1.4 Gestörte persönliche Identität
17.1.5 Risiko einer gestörten persönlichen Identität
17.1.6 Bereitschaft für ein verbessertes Selbstkonzept
17.2 Klasse 2. Selbstwertgefühl
17.2.1 Chronisch geringes Selbstwertgefühl
17.2.2 Risiko eines chronisch geringen Selbstwertgefühls
17.2.3 Situationsbedingtes geringes Selbstwertgefühl
17.2.4 Risiko eines situationsbedingten geringen Selbstwertgefühls
17.3 Klasse 3. Körperbild
17.3.1 Gestörtes Körperbild
18 Domäne 7. Rollenbeziehungen
18.1 Klasse 1. Versorgungsrollen
18.1.1 Beeinträchtigte elterliche Fürsorge
18.1.2 Risiko einer beeinträchtigten elterlichen Fürsorge
18.1.3 Bereitschaft für eine verbesserte elterliche Fürsorge
18.1.4 Rollenüberlastung der pflegenden Person
18.1.5 Risiko einer Rollenüberlastung der pflegenden Person
18.2 Klasse 2. Familienbeziehungen
18.2.1 Risiko einer beeinträchtigten Bindung
18.2.2 Syndrom einer gestörten Familienidentität
18.2.3 Risiko für ein Syndrom einer gestörten Familienidentität
18.2.4 Dysfunktionale Familienprozesse
18.2.5 Unterbrochene Familienprozesse
18.2.6 Bereitschaft für verbesserte Familienprozesse
18.3 Klasse 3. Erfüllung einer Rolle
18.3.1 Ineffektive Beziehung
18.3.2 Risiko einer ineffektiven Beziehung
18.3.3 Bereitschaft für eine verbesserte Beziehung
18.3.4 Elterlicher Rollenkonflikt
18.3.5 Ineffektive Erfüllung einer Rolle
18.3.6 Beeinträchtigte soziale Interaktion
19 Domäne 8. Sexualität
19.1 Klasse 1. Sexuelle Identität
19.1.1 Diese Klasse enthält derzeit keine Diagnosen
19.2 Klasse 2. Sexualfunktion
19.2.1 Sexuelle Dysfunktion
19.2.2 Ineffektives Sexualverhalten
19.3 Klasse 3. Fortpflanzung
19.3.1 Ineffektiver Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlauf
19.3.2 Risiko eines ineffektiven Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlaufs
19.3.3 Bereitschaft für einen verbesserten Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlauf
19.3.4 Risiko einer gestörten Mutter-Fötus-Dyade
20 Domäne 9. Coping/Stresstoleranz
20.1 Klasse 1. Posttraumatische Reaktionen
20.1.1 Risiko einer komplizierten Immigrationstransition
20.1.2 Posttraumatisches Syndrom
20.1.3 Risiko eines posttraumatischen Syndroms
20.1.4 Vergewaltigungssyndrom
20.1.5 Relokationsstresssyndrom
20.1.6 Risiko eines Relokationsstresssyndroms
20.2 Klasse 2. Coping-Reaktionen
20.2.1 Ineffektive Aktivitätenplanung
20.2.2 Risiko einer ineffektiven Aktivitätenplanung
20.2.3 Angst
20.2.4 Defensives Coping
20.2.5 Ineffektives Coping
20.2.6 Bereitschaft für ein verbessertes Coping
20.2.7 Ineffektives gemeinschaftliches Coping
20.2.8 Bereitschaft für ein verbessertes gemeinschaftliches Coping
20.2.9 Gefährdetes familiäres Coping
20.2.10 Eingeschränktes familiäres Coping
20.2.11 Bereitschaft für ein verbessertes familiäres Coping
20.2.12 Todesangst
20.2.13 Ineffektive Verleugnung
20.2.14 Furcht
20.2.15 Fehlangepasstes Trauern
20.2.16 Risiko eines fehlangepassten Trauerns
20.2.17 Bereitschaft für ein verbessertes Trauern
20.2.18 Beeinträchtigte Stimmungsregulation
20.2.19 Machtlosigkeit
20.2.20 Risiko einer Machtlosigkeit
20.2.21 Bereitschaft für eine verbesserte Selbstbestimmung
20.2.22 Beeinträchtigte Resilienz
20.2.23 Risiko einer beeinträchtigten Resilienz
20.2.24 Bereitschaft für eine verbesserte Resilienz
20.2.25 Chronischer Kummer
20.2.26 Stressüberlastung
20.3 Klasse 3. Neurobehavioraler Stress
20.3.1 Akutes Substanzentzug-Syndrom
20.3.2 Risiko eines akuten Substanzentzug-Syndroms
20.3.3 Autonome Dysreflexie
20.3.4 Risiko einer autonomen Dysreflexie
20.3.5 Neonatales Entzugssyndrom
20.3.6 Desorganisiertes Verhalten des Säuglings
20.3.7 Risiko eines desorganisierten Verhaltens des Säuglings
20.3.8 Bereitschaft für eine verbesserte Organisation des Verhaltens des Säuglings
21 Domäne 10. Lebensprinzipien
21.1 Klasse 1. Werte
21.1.1 Diese Klasse enthält derzeit keine Diagnosen
21.2 Klasse 2. Glauben
21.2.1 Bereitschaft für ein verbessertes spirituelles Wohlbefinden
21.3 Klasse 3. Übereinstimmung von Werten/Glauben/Handlung
21.3.1 Bereitschaft für eine verbesserte Entscheidungsfindung
21.3.2 Entscheidungskonflikt
21.3.3 Beeinträchtigte emanzipierte Entscheidungsfindung
21.3.4 Risiko einer beeinträchtigten emanzipierten Entscheidungsfindung
21.3.5 Bereitschaft für eine verbesserte emanzipierte Entscheidungsfindung
21.3.6 Moralischer Disstress
21.3.7 Beeinträchtigte Religiosität
21.3.8 Risiko einer beeinträchtigten Religiosität
21.3.9 Bereitschaft für eine verbesserte Religiosität
21.3.10 Spiritueller Disstress
21.3.11 Risiko eines spirituellen Disstresses
22 Domäne 11. Sicherheit/Schutz
22.1 Klasse 1. Infektion
22.1.1 Risiko einer Infektion
22.1.2 Risiko einer Infektion der chirurgischen Eingriffsstelle
22.2 Klasse 2. Physische Verletzung
22.2.1 Ineffektive Atemwegsclearance
22.2.2 Risiko einer Aspiration
22.2.3 Risiko einer Blutung
22.2.4 Beeinträchtigter Zahnstatus
22.2.5 Risiko einer Augentrockenheit
22.2.6 Ineffektives Selbstmanagement einer Augentrockenheit
22.2.7 Risiko einer Mundtrockenheit
22.2.8 Risiko eines Sturzes bei Erwachsenen
22.2.9 Risiko eines Sturzes bei Kindern
22.2.10 Risiko einer Verletzung
22.2.11 Risiko einer Hornhautverletzung
22.2.12 Verletzung des Mamillen-Areola-Komplexes
22.2.13 Risiko einer Verletzung des Mamillen-Areola-Komplexes
22.2.14 Risiko einer Harnwegsverletzung
22.2.15 Risiko eines perioperativen Lagerungsschadens
22.2.16 Risiko einer thermischen Verletzung
22.2.17 Beeinträchtigte Integrität der Mundschleimhaut
22.2.18 Risiko einer beeinträchtigten Integrität der Mundschleimhaut
22.2.19 Risiko einer peripheren neurovaskulären Dysfunktion
22.2.20 Risiko eines physischen Traumas
22.2.21 Risiko einer vaskulären Verletzung
22.2.22 Druckschädigung bei einem Erwachsenen
22.2.23 Risiko einer Druckschädigung bei einem Erwachsenen
22.2.24 Druckschädigung bei einem Kind
22.2.25 Risiko einer Druckschädigung bei einem Kind
22.2.26 Druckschädigung bei einem Säugling
22.2.27 Risiko einer Druckschädigung bei einem Säugling
22.2.28 Risiko eines Schocks
22.2.29 Beeinträchtigte Integrität der Haut
22.2.30 Risiko einer beeinträchtigten Integrität der Haut
22.2.31 Risiko eines plötzlichen Kindstodes
22.2.32 Risiko einer Erstickung
22.2.33 Verzögerte postoperative Erholung
22.2.34 Risiko einer verzögerten postoperativen Erholung
22.2.35 Beeinträchtigte Integrität des Gewebes
22.2.36 Risiko einer beeinträchtigten Integrität des Gewebes
22.3 Klasse 3. Gewalt
22.3.1 Risiko einer weiblichen Genitalverstümmelung
22.3.2 Risiko einer gegen andere Personen gerichteten Gewalttätigkeit
22.3.3 Risiko einer gegen sich selbst gerichteten Gewalttätigkeit
22.3.4 Selbstverstümmelung
22.3.5 Risiko einer Selbstverstümmelung
22.3.6 Risiko eines suizidales Verhaltens
22.4 Klasse 4. Umweltgefahren
22.4.1 Kontamination
22.4.2 Risiko einer Kontamination
22.4.3 Risiko für eine berufsbedingte Verletzung
22.4.4 Risiko einer Vergiftung
22.5 Klasse 5. Abwehrprozesse
22.5.1 Risiko einer nachteiligen Reaktion auf jodhaltige Kontrastmittel
22.5.2 Risiko einer allergischen Reaktion
22.5.3 Risiko einer allergischen Reaktion auf Latex
22.6 Klasse 6. Thermoregulation
22.6.1 Hyperthermie
22.6.2 Hypothermie
22.6.3 Risiko einer Hypothermie
22.6.4 Neonatale Hypothermie
22.6.5 Risiko einer neonatalen Hypothermie
22.6.6 Risiko einer perioperativen Hypothermie
22.6.7 Ineffektive Thermoregulation
22.6.8 Risiko einer ineffektiven Thermoregulation
23 Domäne 12. Comfort
23.1 Klasse 1. Physischer Comfort
23.1.1 Beeinträchtigter Comfort
23.1.2 Bereitschaft für verbesserten Comfort
23.1.3 Übelkeit
23.1.4 Akuter Schmerz
23.1.5 Chronischer Schmerz
23.1.6 Chronisches Schmerzsyndrom
23.1.7 Geburtsschmerz
23.2 Klasse 2. Umweltbedingter Comfort
23.2.1 Beeinträchtigter Comfort
23.2.2 Bereitschaft für verbesserten Comfort
23.3 Klasse 3. Sozialer Comfort
23.3.1 Beeinträchtigter Comfort
23.3.2 Bereitschaft für verbesserten Comfort
23.3.3 Risiko der Vereinsamung
23.3.4 Soziale Isolation
24 Domäne 13. Wachstum/Entwicklung
24.1 Klasse 1. Wachstum
24.1.1 Diese Klasse enthält derzeit keine Diagnosen
24.2 Klasse 2. Entwicklung
24.2.1 Verzögerte kindliche Entwicklung
24.2.2 Risiko einer verzögerten kindlichen Entwicklung
24.2.3 Verzögerte motorische Entwicklung des Säuglings
24.2.4 Risiko einer verzögerten motorischen Entwicklung des Säuglings
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Teil I Allgemeine Hinweise zur Terminologie der NANDA International
1 Worin unterscheidet sich die neue Ausgabe (2021–2023) von früheren Versionen?
2 Hinweise zur internationalen Verwendung der NANDA-I-Pflegediagnosen
NANDA International, Inc. Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 2021–2023, 12th Edition.Edited by T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru and Camila Takáo Lopes© 2021 NANDA International, Inc. Published 2021 by Thieme Medical Publishers, Inc., New York.© 2022 RECOM GmbH für die deutsche ÜbersetzungUnterstützende Originalliteratur ist verfügbar unter: www.recom.eu/nanda-2021-2023-literatur.
1 Worin unterscheidet sich die neue Ausgabe (2021–2023) von früheren Versionen?
T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru, Camila Takáo Lopes
1.1 Übersicht über Änderungen und Neuerungen in Ausgabe 2021–2023
Teil 1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Änderungen, die mit dieser Ausgabe vorgenommen wurden: neue und überarbeitete Diagnosen, nicht mehr gebräuchliche Diagnosen, weitere Schritte zur Standardisierung von Diagnoseindikatoren, neue Evidenzkriterien für die Einreichung neuer Pflegediagnosen, Vorschläge zur Präzisierung der Terminologie sowie erste Empfehlungen zu Pflegediagnosen, die einer weiteren Bearbeitung bedürfen.
Wir hoffen, dass der Aufbau der vorliegenden Ausgabe zu einem effizienten und effektiven Gebrauch beiträgt. Über Ihr Feedback freuen wir uns: Wenn Sie Änderungsvorschläge oder Anregungen haben, schicken Sie sie bitte per E-Mail an [email protected].
Die Änderungen, die mit der vorliegenden Ausgabe vorgenommen wurden, gehen auf das Feedback der Personen zurück, die mit der Klassifikation arbeiten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sowohl die Bedürfnisse von Studierenden als auch die von Praxis und Wissenschaft berücksichtigt werden. Auch Ausbildung und Praxisanleitung soll unterstützt werden. Neue Informationen wurden zur Prüfung aufgenommen. Ein international besetztes Team des Diagnosenentwicklungskomitees hat etliche Diagnosen überarbeitet, um ihr Evidenzlevel zu verbessern. Außerdem wurden die Diagnoseindikatoren sämtlicher Diagnosen überarbeitet, um Mehrdeutigkeit möglichst zu vermeiden und für mehr Klarheit zu sorgen. Dabei orientierten sich die Herausgeberinnen nach Möglichkeit an den Medical Subject Headings (MeSH, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh): Übersetzer können dadurch auf standardisierte Definitionen zurückgreifen, sodass ein einheitlicher Sprachgebrauch über Sprachgrenzen hinweg gewährleistet ist. Zu guter Letzt werden neue Evidenzkriterien vorgestellt. Sie sollen sicherstellen, dass sämtliche Diagnosen, die künftig zur Aufnahme in die Klassifikation vorgeschlagen werden, ein geeignetes Evidenzlevel aufweisen, das dem aktuellen Kenntnisstand der professionellen Pflege entspricht.
Nutzer, die mit früheren Ausgaben dieses Textes vertraut sind und damit gearbeitet haben, werden feststellen, dass der Fokus der Diagnose im Diagnosetitel nicht länger hervorgehoben ist. Stattdessen findet sich das theoretische Schlüsselkonzept der Diagnose nun in der Klassifikation, unter dem jeweiligen Diagnosetitel. Mit dieser Änderung soll die Suche nach diagnostischen Fokussen in verschiedenen Sprachen erleichtert werden.
1.2 Neue Pflegediagnosen
Ein Großteil der neuen und überarbeiteten Pflegediagnosen wurde dem NANDA-I-Diagnosenentwicklungskomitee von Außenstehenden zur Bearbeitung oder Aufnahme vorgeschlagen. Die Herausgeberinnen möchten an dieser Stelle all denjenigen gratulieren, denen es gelungen ist, mit ihren Einreichungen oder Änderungsvorschlägen die Evidenzkriterien zu erfüllen. 46 neue Diagnosen wurden vom Diagnosenentwicklungskomitee zur Bearbeitung angenommen und dem NANDA-I-Vorstand vorgelegt ( ▶ Tab. 1.1 ). Sie wurden in die Klassifikation aufgenommen und stehen nun Mitgliedern und Nutzern der Terminologie zur Verfügung. Die Personen, die Diagnosen zur Aufnahme vorgeschlagen haben, sind unter der nachstehenden Tabelle namentlich aufgeführt.
Tab. 1.1
Neue NANDA-I-Pflegediagnosen, 2021–2023*
Domäne
Diagnose
1. Gesundheitsförderung
Risiko eines Weglaufversuchs (00290)
Bereitschaft für ein verbessertes Engagement für physische Bewegung (00307)
Ineffektive Verhaltensweisen zur Erhaltung der Gesundheit (00292)*
Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement (00276)*
Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheits-Selbstmanagement (00293)*
Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement der Familie (00294)*
Ineffektive Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung (00300)*
Risiko ineffektiver Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung (00308)
Bereitschaft für verbesserte Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung (00309)
2. Ernährung
Ineffektive Saug-Schluck-Reaktion des Säuglings (00295)*
Risiko eines metabolischen Syndroms (00296)*
3. Ausscheidung und Austausch
Behinderungsassoziierte Harninkontinenz (00297)*
Mischharninkontinenz (00310)
Risiko einer Harnretention (00322)
Beeinträchtigte Stuhlkontinenz (00319)*
4. Aktivität/Ruhe
Verminderte Aktivitätstoleranz (00298)*
Risiko einer verminderten Aktivitätstoleranz (00299)*
Risiko einer beeinträchtigten kardiovaskulären Funktion (00311)
Ineffektives Selbstmanagement eines Lymphödems (00278)
Risiko eines ineffektiven Selbstmanagements eines Lymphödems (00281)
Risiko einer Thrombose (00291)
Dysfunktionales Weaning bei Erwachsenen (00318)
5. Wahrnehmung/Kognition
Gestörter Denkprozess (00279)
7. Rollenbeziehungen
Syndrom einer gestörten Familienidentität (00283)
Risiko für ein Syndrom einer gestörten Familienidentität (00284)
9. Coping/Stresstoleranz
Fehlangepasstes Trauern (00301)*
Risiko eines fehlangepassten Trauerns (00302)*
Bereitschaft für ein verbessertes Trauern (00285)
11. Sicherheit/Schutz
Ineffektives Selbstmanagement einer Augentrockenheit (00277)
Risiko eines Sturzes bei Erwachsenen (00303)*
Risiko eines Sturzes bei Kindern (00306)
Verletzung des Mamillen-Areola-Komplexes (00320)
Risiko einer Verletzung des Mamillen-Areola-Komplexes (00321)
Druckschädigung bei einem Erwachsenen (00312)
Risiko einer Druckschädigung bei einem Erwachsenen (00304)*
Druckschädigung bei einem Kind (00313)
Risiko einer Druckschädigung bei einem Kind (00286)
Druckschädigung bei einem Säugling (00287)
Risiko einer Druckschädigung bei einem Säugling (00288)
Risiko eines suizidales Verhaltens (00289)*
Neonatale Hypothermie (00280)
Risiko einer neonatalen Hypothermie (00282)
13. Wachstum/Entwicklung
Verzögerte kindliche Entwicklung (00314)
Risiko einer verzögerten kindlichen Entwicklung (00305)*
Verzögerte motorische Entwicklung des Säuglings (00315)
Risiko einer verzögerten motorischen Entwicklung des Säuglings (00316)
*Da es für die Taxonomie erforderlich war, wurde der ursprünglich vergebene Code entfernt und ein neuer Code zugewiesen, wenn ein Diagnosetitel samt Definition überarbeitet wurde.
Personen, die Pflegediagnosen eingereicht haben In dieser Liste sind alle Personen aufgeführt, die neue Diagnosen vorgeschlagen oder bestehende Diagnosen überarbeitet haben. Dabei können sowohl Änderungen an Titel oder Definition als auch bedeutende inhaltliche Änderungen vorgenommen worden sein. Personen, die als Gruppe zusammengearbeitet haben, sind entsprechend gemeinsam aufgeführt. Haben mehrere Gruppen oder Einzelpersonen unabhängig voneinander Inhalte vorgeschlagen, sind diese entsprechend getrennt aufgeführt.
Die namentlich genannten Personen stammen aus folgenden Ländern: 1. Brasilien, 2. Deutschland, 3. Iran, 4. Mexiko, 5. Spanien, 6. Türkei, 7. USA
Domäne 1: Gesundheitsförderung
Risiko eines Weglaufversuchs
Amália F. Lucena, Ester M. Borba, Betina Franco, Gláucia S. Policarpo, Deborah B. Melo, Simone Pasin, Luciana R. Pinto, Michele Schmid1
Bereitschaft für ein verbessertes Engagement für physische Bewegung
Raúl Fernando G. Castañeda4
Ineffektive Verhaltensweisen zur Erhaltung der Gesundheit
Rafaela S. Pedrosa, Andressa T. Nunciaroni1
Camila T. Lopes1
Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement
Camila S. Carneiro, Agueda Maria R. Z. Cavalcante, Gisele S. Bispo, Viviane M. Silva, Alba Lucia B.L. Barros1
Maria G.M.N. Paiva, Jéssica D.S. Tinôco, Fernanda Beatriz B.L. Silva, Juliane R. Dantas, Maria Isabel C.D. Fernandes, Isadora L.A. Nogueira, Ana B.A. Medeiros Marcos Venícios O. Lopes, Ana L.B.C. Lira1
Richardson Augusto R. Silva, Wenysson N. Santos, Francisca M.L.C. Souza, Rebecca Stefany C. Santos, Izaque C. Oliveira, Hallyson L.L. Silva, Dhyanine M. Lima1
Camila T. Lopes1
Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheits-Selbstmanagement
Diagnosenentwicklungskomitee (DDC)
Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement der Familie
Andressa T. Nunciaroni, Rafaela S. Pedrosa1
Camila T. Lopes1
Ineffektive Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung, Risiko ineffektiver Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung, Bereitschaft für verbesserte Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung
Ángel Martín-García5
Diagnosenentwicklungskomitee (DDC)
Domäne 2: Ernährung
Ineffektive Saug-Schluck-Reaktion des Säuglings
T. Heather Herdman7
Risiko eines metabolischen Syndroms
Diagnosenentwicklungskomitee (DDC)
Domäne 3: Ausscheidung und Austausch
Behinderungsassoziierte Harninkontinenz, Mischharninkontinenz
Juliana N. Costa, Maria Helena B.M. Lopes, Marcos Venícios O. Lopes1
Risiko einer Harnretention
Aline S. Meira, Gabriella S. Lima, Luana B. Storti, Maria Angélica A. Diniz, Renato M. Ribeiro, Samantha S. Cruz, Luciana Kusumota2
Juliana N. Costa, Micnéias L. Botelho, Erika C.M. Duran, Elenice V. Carmona, Ana Railka S. Oliveira-Kumakura, Maria Helena B.M. Lopes2
Beeinträchtigte Stuhlkontinenz
Diagnosenentwicklungskomitee (DDC)
Barbara G. Anderson7
Domäne 4: Aktivität/Ruhe
Verminderte Aktivitätstoleranz, Risiko einer verminderten Aktivitätstoleranz
Jana Kolb, Steve Strupeit2
Risiko einer beeinträchtigten kardiovaskulären Funktion
María B.S. Gómez5, Gonzalo D. Clíments5, Tibelle F. Mauricio1, Rafaela P. Moreira1, Edmara C. Costa1
Gabrielle P. da Silva, Francisca Márcia P. Linhares, Suzana O. Mangueira, Marcos Venícius O. Lopes, Jaqueline G.A. Perrelli, Tatiane G. Guedes1
Ineffektives Selbstmanagement eines Lymphödems, Risiko eines ineffektiven Selbstmanagements eines Lymphödems
Gülengün Türk, Elem K. Güler, İzmir Demokrasi6
Diagnosenentwicklungskomitee (DDC)
Risiko einer Thrombose
Eneida R.R. Silva, Thamires S. Hilário, Graziela B. Aliti, Vanessa M. Mantovani, Amália F. Lucena1
Diagnosenentwicklungskomitee (DDC)
Dysfunktionales Weaning bei Erwachsenen
Ludmila Christiane R. Silva, Tânia C.M. Chianca 1
Domäne 5: Wahrnehmung/Kognition
Gestörter Denkprozess
Paula Escalada-Hernández, Blanca Marín-Fernández5
Domäne 7: Rollenbeziehungen
Syndrom einer gestörten Familienidentität, Risiko für ein Syndrom einer gestörten Familienidentität
Mitra Zandi, Eesa Mohammadi3
Diagnosenentwicklungskomitee (DDC)
Domäne 9: Coping/Stresstoleranz
Fehlangepasstes Trauern, Risiko eines fehlangepassten Trauerns, Bereitschaft für ein verbessertes Trauern
Martín Rodríguez-Álvaro, Alfonso M. García-Hernández, Ruymán Brito-Brito5
Diagnosenentwicklungskomitee (DDC)
Domäne 11: Sicherheit/Schutz
Ineffektives Selbstmanagement einer Augentrockenheit
Elem K. Güler, İsmet Eşer6Diego D. Araujo, Andreza Werli-Alvarenga, Tânia C.M. Chianca1
Jéssica N. M. Araújo, Allyne F. Vitor1
Diagnosenentwicklungskomitee (DDC)
Risiko eines Sturzes bei Erwachsenen
Flávia O.M. Maia1
Danielle Garbuio, Emilia C. Carvalho1
Dolores E. Hernández1
Camila T. Lopes1
Silvana B. Pena, Heloísa C.Q.C.P. Guimarães, Lidia S. Guandalini, Mônica Taminato, Dulce A. Barbosa, Juliana L. Lopes, Alba Lucia B.L. Barros1
Risiko eines Sturzes bei Kindern
Camila T. Lopes, Ana Paula D.F. Guareschi1
Neonatale Hypothermie, Risiko einer neonatalen Hypothermie
T. Heather Herdman7
Verletzung des Mamillen-Areola-Komplexes, Risiko einer Verletzung des Mamillen-Areola-Komplexes
Flaviana Vely Mendonca Vieira 1
Agueda Maria Ruiz Zimmer Cavalcante 1
Druckschädigung bei einem Erwachsenen, Risiko einer Druckschädigung bei einem Erwachsenen
Amália F. Lucena, Cássia T. Santos, Taline Bavaresco, Miriam A. Almeida1
T. Heather Herdman7
Druckschädigung bei einem Kind, Risiko einer Druckschädigung bei einem Kind, Druckschädigung bei einem Säugling, Risiko einer Druckschädigung bei einem Säugling
T. Heather Herdman7
Amália F. Lucena, Cássia T. Santos, Taline Bavaresco, Miriam A. Almeida1
Risiko eines suizidales Verhaltens
Girliani S. Sousa, Jaqueline G.A. Perrelli, Suzana O. Mangueira, Marcos Venícios O. Lopes, Everton B. Sougey1
Domäne 13: Wachstum/Entwicklung
Verzögerte kindliche Entwicklung
Juliana M. Souza, Maria L.O.R. Veríssimo1
T. Heather Herdman7
Risiko einer verzögerten kindlichen Entwicklung, Verzögerte motorische Entwicklung des Säuglings, Risiko einer verzögerten motorischen Entwicklung des Säuglings
T. Heather Herdman7
1.3Überarbeitete Pflegediagnosen
In diesem Bearbeitungszyklus wurden 67 Diagnosen von der Task Force des Diagnosenentwicklungskomitees überarbeitet. Die Diagnosen sind in ▶ Tab. 1.2 aufgeführt. Personen, die an der Überarbeitung bestehender Diagnosen mitgewirkt haben, sind unter der nachstehenden Tabelle namentlich genannt. Diagnosen, bei denen sich die Überarbeitung auf die Präzisierung einzelner Phrasen oder geringfügige redaktionelle Änderungen beschränkt, sind nicht enthalten. In der Tabelle finden sich nur Diagnosen, die eine inhaltliche Änderung erfahren haben (Änderung des Titels, Überarbeitung der Diagnosedefinition oder Änderung von Diagnoseindikatoren).
Tab. 1.2
Überarbeitete NANDA-I-Pflegediagnosen, 2021–2023
Diagnose
Geändert wurde:
Definition
Best. Merkm. hinzugefügt
Best. Merkm. entfernt
Beeinfl. Fakt./Risikofakt. hinzugefügt
Beeinfl. Fakt./Risikofakt. entfernt
Domäne 1: Gesundheitsförderung
Bewegungsarmer Lebensstil
X
X
X
X
Ineffektiver Selbstschutz
X
X
Domäne 2: Ernährung
Unausgeglichene Ernährung: weniger als der Körper benötigt
X
X
X
X
Beeinträchtigtes Schlucken
X
Risiko eines instabilen Blutglukosespiegels
X
Risiko eines unausgeglichenen Flüssigkeitsvolumens
X
Defizitäres Flüssigkeitsvolumen
X
Risiko eines defizitären Flüssigkeitsvolumens
X
Übermäßiges Flüssigkeitsvolumen
X
X
Domäne 3: Ausscheidung und Austausch
Beeinträchtigte Harnausscheidung
X
Stressharninkontinenz
X
X
X
Drangharninkontinenz
X
X
Risiko einer Drangharninkontinenz
X
Harnretention
X
X
X
Obstipation
X
X
X
X
X
Risiko einer Obstipation
X
Wahrgenommene Obstipation
X
Diarrhö
X
X
Beeinträchtigter Gasaustausch
X
X
X
Domäne 4: Aktivität/Ruhe
Schlafstörung
X
X
X
X
X
Beeinträchtigte Mobilität im Bett
X
X
Beeinträchtigte Mobilität mit dem Rollstuhl
X
X
Fatigue
X
X
X
X
Ineffektives Atemmuster
X
X
X
X
Domäne 5: Wahrnehmung/Kognition
Chronische Verwirrtheit
X
Defizitäres Wissen
X
X
X
Beeinträchtigte Gedächtnisleistung
X
Beeinträchtigte verbale Kommunikation
X
X
Domäne 6: Selbstwahrnehmung
Hoffnungslosigkeit
X
X
X
X
Bereitschaft für verbesserte Hoffnung
X
X
Chronisch geringes Selbstwertgefühl
X
X
X
Risiko eines chronisch geringen Selbstwertgefühls
X
Situationsbedingtes geringes Selbstwertgefühl
X
X
X
Risiko eines situationsbedingten geringen Selbstwertgefühls
X
Gestörtes Körperbild
X
X
X
X
X
Domäne 7: Rollenbeziehungen
Beeinträchtigte elterliche Fürsorge
X
X
X
Risiko einer beeinträchtigten elterlichen Fürsorge
X
X
Bereitschaft für eine verbesserte elterliche Fürsorge
X
X
Beeinträchtigte soziale Interaktion
X
X
Domäne 9: Coping/Stresstoleranz
Angst
X
X
X
X
X
Todesangst
X
X
X
Furcht
X
X
X
X
X
Machtlosigkeit
X
X
X
X
Risiko einer Machtlosigkeit
X
X
Domäne 10: Lebensprinzipien
Bereitschaft für ein verbessertes spirituelles Wohlbefinden
X
X
Spiritueller Disstress
X
X
X
X
X
Risiko eines spirituellen Disstresses
X
X
Domäne 11: Sicherheit/Schutz
Risiko einer Infektion
X
Ineffektive Atemwegsclearance
X
X
X
X
X
Risiko einer Aspiration
X
X
Risiko einer Augentrockenheit
X
X
Risiko einer Harnwegsverletzung
X
Risiko eines perioperativen Lagerungsschadens
X
Risiko eines Schocks
X
X
Beeinträchtigte Integrität der Haut
X
X
X
Risiko einer beeinträchtigten Integrität der Haut
X
Verzögerte postoperative Erholung
X
X
Risiko einer verzögerten postoperativen Erholung
X
Beeinträchtigte Integrität des Gewebes
X
X
X
Risiko einer beeinträchtigten Integrität des Gewebes
X
Risiko einer allergischen Reaktion auf Latex
X
X
Hypothermie
X
X
Risiko einer Hypothermie
X
Risiko einer perioperativen Hypothermie
X
X
Domäne 12: Comfort
Chronisches Schmerzsyndrom
X
X
Geburtsschmerz
X
Soziale Isolation
X
X
X
Liste der Personen, die Pflegediagnosen überarbeitet haben In dieser Liste sind alle Personen aufgeführt, die bestehende Diagnosen überarbeitet haben.
Die namentlich genannten Personen stammen aus folgenden Ländern: 1. Österreich, 2. Brasilien, 3. Deutschland, 4. Italien, 5. Japan, 6. Mexiko, 7. Portugal, 8. Spanien, 9. Schweiz, 10. Türkei, 11. USA
Domäne 1: Gesundheitsförderung
Bewegungsarmer Lebensstil
Marcos Venicios O. Lopes, Viviane Martins da Silva, Nirla G. Guedes, Larissa C.G. Martins, Marcos R. Oliveira2
Laís S. Costa, Juliana L. Lopes, Camila T. Lopes, Vinicius B. Santos, Alba Lúcia B.L. Barros2
Ineffektiver Selbstschutz
Livia M. Garbim, Fernanda T.M.M. Braga, Renata C.C.P. Silveira2
Domäne 2: Ernährung
Unausgeglichene Ernährung: weniger als der Körper benötigt
Renata K. Reis, Fernanda R.E.G. Souza2
Beeinträchtigtes Schlucken
Renan A. Silva, Viviane M. Silva2
Risiko eines instabilen Blutglukosespiegels
Grasiela M. Barros, Ana Carla D. Cavalcanti, Helen C. Ferreira, Marcos Venícios O. Lopes, Priscilla A. Souza2
Risiko eines unausgeglichenen Flüssigkeitsvolumens, Defizitäres Flüssigkeitsvolumen, Risiko eines defizitären Flüssigkeitsvolumens, Übermäßiges Flüssigkeitsvolumen
Mariana Grassi, Rodrigo Jensen, Camila T. Lopes2
Domäne 3: Ausscheidung und Austausch
Beeinträchtigte Harnausscheidung, Harnretention
Aline S. Meira, Gabriella S. Lima, Luana B. Storti, Maria Angélica A. Diniz, Renato M. Ribeiro, Samantha S. Cruz, Luciana Kusumota2
Juliana N. Costa, Micnéias L. Botelho, Erika C.M. Duran, Elenice V. Carmona, Ana Railka S. Oliveira-Kumakura, Maria Helena B.M. Lopes2
Stressharninkontinenz, Drangharninkontinenz, Risiko einer Drangharninkontinenz
Juliana N. Costa, Maria Helena B.M. Lopes, Marcos Venícios O. Lopes2
Aline S. Meira, Gabriella S. Lima, Luana B. Storti, Maria Angélica A. Diniz, Renato M. Ribeiro, Samantha S. Cruz, Luciana Kusumota2
Obstipation, Risiko einer Obstipation
Barbara G. Anderson11
Cibele C. Souza, Emilia C. Carvalho, Marta C.A. Pereira2
Shigemi Kamitsuru5
Wahrgenommene Obstipation
Diagnosenentwicklungskomitee (DDC)
Diarrhö
Barbara G. Anderson11
Beeinträchtigter Gasaustausch
Marcos Venícios O. Lopes, Viviane M. Silva, Lívia Maia Pascoal, Beatriz A. Beltrão, Daniel Bruno R. Chaves, Vanessa Emile C. Sousa, Camila M. Dini, Marília M. Nunes, Natália B. Castro, Reinaldo G. Barreiro, Layana P. Cavalcante, Gabriele L. Ferreira, Larissa C.G. Martins2
Domäne 4: Aktivität/Ruhe
Schlafstörung
Lidia S. Guandalini, Vinicius B. Santos, Eduarda F. Silva, Juliana L. Lopes, Camila T. Lopes, Alba Lucia B. L. Barros2
Beeinträchtigte Mobilität im Bett
Allyne F. Vitor, Jéssica Naiara M. Araújo, Ana Paula N.L. Fernandes, Amanda B. Silva, Hanna Priscilla da Silva 2
Beeinträchtigte Mobilität mit dem Rollstuhl
Allyne F. Vitor, Jéssica Naiara M. Araújo, Ana Paula N.L. Fernandes, Amanda B. Silva, Hanna Priscilla da Silva 2
Camila T. Lopes2
Fatigue
Rita C.G.S. Butcher, Amanda G. Muller, Leticia C. Batista, Mara N. Araújo2
Vinicius B. Santos, Rita Simone L. Moreira2
Ineffektives Atemmuster
Viviane M. Silva, Marcos Venícios O. Lopes, Beatriz A. Beltrão, Lívia Maia Pascoal, Daniel Bruno R. Chaves, Livia Zulmyra C. Andrade, Vanessa Emile C. Sousa2
Patricia R. Prado, Ana Rita C. Bettencourt, Juliana. L. Lopes2
Domäne 5: Wahrnehmung/Kognition
Chronische Verwirrtheit, Beeinträchtigte Gedächtnisleistung
Priscilla A. Souza2, Kay Avant11
Defizitäres Wissen
Cláudia C. Silva, Sheila C.R.V. Morais e Cecilia Maria F.Q. Frazão2
Camila T. Lopes2
Beeinträchtigte verbale Kommunikation
Amanda H. Severo, Zuila Maria F. Carvalho, Marcos Venícios O. Lopes, Renata S.F. Brasileiro, Deyse C.O. Braga2
Vanessa S. Ribeiro, Emilia C. Carvalho2
Domäne 6: Selbstwahrnehmung
Hoffnungslosigkeit
Ana Carolina A.B. Leite, Willyane A. Alvarenga, Lucila C. Nascimento, Emilia C. Carvalho2
Ramon A., Cibele Souza, Marta C.A. Pereira2
Camila T. Lopes2
Bereitschaft für verbesserte Hoffnung
Renan A. Silva2, Geórgia A.A. Melo2, Joselany A. Caetano2, Marcos Venícios O. Lopes2, Howard K. Butcher11, Viviane M. Silva2
Chronisch geringes Selbstwertgefühl, Risiko eines chronisch geringen Selbstwertgefühls
Natalia B. Castro, Marcos Venícios O. Lopes, Ana Ruth M. Monteiro2
Camila T. Lopes2
Situationsbedingtes geringes Selbstwertgefühl
Natalia B. Castro, Marcos Venícios O. Lopes, Ana Ruth M. Monteiro2
Francisca Marcia P. Linhares, Gabriella P. da Silva, Thais A.O. Moura2
Camila T. Lopes2
Risiko eines situationsbedingten geringen Selbstwertgefühls
Natalia B. Castro, Marcos Venícios O. Lopes, Ana Ruth M. Monteiro2
Francisca Marcia P. Linhares, Ryanne Carolynne M. Gomes, Suzana O. Mangueira2
Camila T. Lopes2
Gestörtes Körperbild
Julie Varns11
Domäne 7: Rollenbeziehungen
Beeinträchtigte elterliche Fürsorge, Risiko einer beeinträchtigten elterlichen Fürsorge, Bereitschaft für eine verbesserte elterliche Fürsorge
T. Heather Herdman10
Beeinträchtigte soziale Interaktion
Hortensia Castañedo-Hidalgo6
Domäne 9: Coping/Stresstoleranz
Angst, Furcht
Aline A. Eduardo2
Todesangst
Claudia Angélica M.F. Mercês, Jaqueline S.S. Souto, Kênia R.L. Zaccaro, Jackeline F. Souza, Cândida C. Primo, Marcos Antônio G. Brandão2
Machtlosigkeit, Risiko einer Machtlosigkeit
Renan A. Silva2, Álissan Karine L. Martins2, Natália B. Castro2, Anna Virgínia Viana2, Howard K. Butcher11, Viviane M. Silva2
Domäne 10: Lebensprinzipien
Bereitschaft für ein verbessertes spirituelles Wohlbefinden
Chontay D. Glenn11
Silvia Caldeira, Joana Romeiro, Helga Martins7
Camila T. Lopes2
Spiritueller Disstress, Risiko eines spirituellen Disstresses
Silvia Caldeira, Joana Romeiro, Helga Martins7
Chontay D. Glenn11
Domäne 11: Sicherheit/Schutz
Risiko einer Infektion
Camila T. Lopes, Vinicius B. Santos, Daniele Cristina B. Aprile, Juliana L. Lopes, Tania A. M. Domingues, Karina Costa2
Ineffektive Atemwegsclearance
Viviane M. Silva, Marcos Venícios O. Lopes, Daniel Bruno R. Chaves, Livia M. Pascoal, Livia Zulmyra C. Andrade, Beatriz A. Beltrão, Vanessa Emile C. Sousa2
Silvia A. Alonso, Susana A. López, Almudena B. Rodríguez, Luisa P. Hernandez, Paz V. Lozano, Lidia P. López, Ana Campillo, Ana Frías María E. Jiménez, David P. Otero, Respiratory Nursing Group Neumomadrid8
Gianfranco Sanson4
Risiko einer Aspiration
Fernanda R.E.G. Souza, Renata K. Reis2
Nirla G. Guedes, Viviane M. Silva, Marcos Venícios O. Lopes2
Risiko einer Augentrockenheit
Elem K. Güler, İsmet Eşer10
Diego D. Araujo, Andreza Werli-Alvarenga, Tânia C.M. Chianca2
Jéssica N. M. Araújo, Allyne F. Vitor2
Risiko einer Harnwegsverletzung
Danielle Garbuio, Emilia C. Carvalho, Anamaria A. Napoleão2
Risiko eines perioperativen Lagerungsschadens
Danielle Garbuio, Emilia C. Carvalho2
Camila Mendonça de Moraes, Namie Okino Sawada2
Risiko eines Schocks
Luciana Ramos Corrêa Pinto, Karina O. Azzolin, Amália de Fátima Lucena2
Beeinträchtigte Integrität der Haut, Risiko einer beeinträchtigten Integrität der Haut, Beeinträchtigte Integrität des Gewebes, Risiko einer beeinträchtigten Integrität des Gewebes
Edgar Noé M. García6
Camila T. Lopes2
Verzögerte postoperative Erholung, Risiko einer verzögerten postoperativen Erholung
Thalita G. Carmo, Rosimere F. Santana, Marcos Venícios O. Lopes, Simone Rembold2
Risiko einer allergischen Reaktion auf Latex
Sharon E. Hohler11
Camila T. Lopes2
Hypothermie, Risiko einer Hypothermie
T. Heather Herdman11
Risiko einer perioperativen Hypothermie
Manuel Schwanda1, Maria Müller-Staub9, André Ewers1
Domäne 12: Comfort
Chronisches Schmerzsyndrom
Thainá L. Silva, Cibele A.M. Pimenta, Marina G. Salvetti2
Geburtsschmerz
Luisa Eggenschwiler, Monika Linhart, Eva Cignacco9
Soziale Isolation
Hortensia Castañeda-Hidalgo6
Amália de Fátima Lucena2
1.4Änderungen an den Titeln der Pflegediagnosen
Mit der vorliegenden Ausgabe wurden 17 Titel von Pflegediagnosen geändert. Damit soll sichergestellt werden, dass die in den Titeln verwendete Terminologie mit den Begriffen in der aktuellen Fachliteratur übereinstimmt und dass sie auch tatsächlich eine menschliche Reaktion beschreibt. Die geänderten Diagnosetitel sind in ▶ Tab. 1.3 aufgelistet. Da auch bei den Definitionen und den Diagnoseindikatoren umfassende Änderungen vorgenommen wurden, wurden die ursprünglichen Diagnosen aus der Klassifikation entfernt und durch neue Diagnosen ersetzt. Den neuen Diagnosen wurden neue Codes zugewiesen.
Tab. 1.3
Änderungen an den Titeln der NANDA-I-Pflegediagnosen, 2021–2023
Domäne
Früherer Diagnosetitel
Aktueller Diagnosetitel
1. Gesundheitsförderung
Ineffektive Gesundheitserhaltung (00099)
Ineffektive Verhaltensweisen zur Erhaltung der Gesundheit (00292)
Ineffektives Gesundheitsmanagement (00078)
Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement (00276)
Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheitsmanagement (00162)
Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheits-Selbstmanagement (00293)
Ineffektives familiäres Gesundheitsmanagement (00080)
Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement der Familie (00294)
Beeinträchtigte Haushaltsführung (00098)*
Ineffektive Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung (00300)
2. Ernährung
Ineffektives Ernährungsmuster des Säuglings (00107)
Ineffektive Saug-Schluck-Reaktion des Säuglings (00295)
Risiko eines metabolischen Syndroms (00263)
Risiko eines metabolischen Syndroms (00296)
3. Ausscheidung und Austausch
Funktionelle Harninkontinenz (00020)
Behinderungsassoziierte Harninkontinenz (00297)
Stuhlinkontinenz (00014)
Beeinträchtigte Stuhlkontinenz (00319)
4. Aktivität/Ruhe
Aktivitätsintoleranz (00092)
Verminderte Aktivitätstoleranz (00298)
Risiko einer Aktivitätsintoleranz (00094)
Risiko einer verminderten Aktivitätstoleranz (00299)
9. Coping/Stresstoleranz
Kompliziertes Trauern (00135)
Fehlangepasstes Trauern (00301)
Risiko eines komplizierten Trauerns (00172)
Risiko eines fehlangepassten Trauerns (00302)
11. Sicherheit/Schutz
Risiko eines Sturzes (00155)
Risiko eines Sturzes bei Erwachsenen (00303)
Risiko eines Dekubitus (00249)
Risiko einer Druckschädigung bei einem Erwachsenen (00304)
Risiko eines Suizids (00150)
Risiko eines suizidales Verhaltens (00289)
13. Wachstum/Entwicklung
Risiko einer verzögerten Entwicklung (00112)
Risiko einer verzögerten kindlichen Entwicklung (00305)
*Bislang fand sich diese Diagnose in Domäne 4. Dem neuen Konzept entsprechend wurde sie nun Domäne 1 zugeordnet.
1.5Pflegediagnosen, die in der aktuellen Ausgabe nicht mehr enthalten sind
In der letzten Ausgabe der NANDA-I-Klassifikation (Version 2018–2020) wurde bei 92 Diagnosen entschieden, dass diese mit der nächsten Ausgabe entfernt werden, wenn es bis dahin niemand auf sich genommen haben wird, sie auf ein geeignetes Evidenzlevel zu bringen oder geeignete Diagnoseindikatoren ausfindig zu machen. Von diesen 92 Diagnosen wurden 52 erfolgreich überarbeitet und entweder von der DDC Task Force für NANDA-I vorgeschlagen oder von Einzelpersonen, die eigene Überarbeitungsvorschläge lieferten. Für 40 Diagnosen gingen jedoch keine Überarbeitungsvorschläge ein. Da die Übersetzungen der Klassifikation in die verschiedenen Sprachen grundsätzlich erst einige Zeit nach der Veröffentlichung der englischsprachigen Ausgabe erscheinen, entschlossen sich die Herausgeberinnen dazu, die Frist zur Entfernung dieser 40 Diagnosen zu verlängern. Interessierten Gruppen und Einzelpersonen sollte dadurch mehr Zeit gegeben werden, ihre Überarbeitungsvorschläge einzureichen. Sollte sich nach wie vor niemand finden, der die Überarbeitung dieser Diagnosen auf sich nimmt, werden sie mit Ausgabe 2024–2026 entfallen. Die Herausgeberinnen möchten an dieser Stelle betonen, dass die Überarbeitung besagter Diagnosen für NANDA-I im nächsten Bearbeitungszyklus des DDC Priorität hat.
23 der 52 Diagnosen, die von Fachexpert(inn)en begutachtet wurden, wurden aus der Klassifikation entfernt. Die jeweilige Entscheidung stützte sich auf empirische Belege. Die Diagnosen, die mit der aktuellen Ausgabe entfallen, sind in ▶ Tab. 1.4 aufgeführt.
Tab. 1.4
Diagnosen, die aus den NANDA-I-Pflegediagnosen 2021–2023 entfernt wurden
Domäne
Klasse
Diagnosetitel
Code
1
2
Ineffektive Gesundheitserhaltung
00099
2
Ineffektives Gesundheitsmanagement
00078
2
Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheitsmanagement
00162
2
Ineffektives familiäres Gesundheitsmanagement
00080
2
1
Ineffektives Ernährungsmuster des Säuglings
00107
4
Risiko eines metabolischen Syndroms
00263
3
1
Funktionelle Harninkontinenz
00020
1
Überlaufharninkontinenz
00176
1
Reflexharninkontinenz
00018
2
Stuhlinkontinenz
00014
4
4
Aktivitätsintoleranz
00092
4
Risiko einer Aktivitätsintoleranz
00094
5
Beeinträchtigte Haushaltsführung
00098
9
2
Trauern
00136
2
Kompliziertes Trauern
00135
2
Risiko eines komplizierten Trauerns
00172
3
Reduziertes intrakranielles Anpassungsvermögen
00049
11
2
Risiko eines Sturzes
00155
2
Risiko eines Dekubitus
00249
2
Risiko einer venösen Thromboembolie
00268
3
Risiko eines Suizids
00150
5
Allergische Reaktion auf Latex
00041
13
2
Risiko einer verzögerten Entwicklung
00112
Die Gründe für die Entfernung besagter Diagnosen lassen sich in drei Kategorien einteilen: (1) es liegen neue wissenschaftliche Erkenntnisse vor, die zeigen, dass die bisher gebräuchlichen Bezeichnungen veraltet sind oder in der Pflegeliteratur bereits durch neue Begriffe ersetzt wurden; (2) im Zusammenhang mit der Diagnose gibt es keine beeinflussenden Faktoren, die durch eine eigenständige pflegerische Intervention modifiziert werden könnten; (3) die Diagnose entspricht nicht der Definition einer problemfokussierten Diagnose.
Ineffektive Gesundheitserhaltung, Beeinträchtigte Haushaltsführung, Ineffektives Gesundheitsmanagement, Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheitsmanagement, Ineffektives familiäres Gesundheitsmanagement, Risiko eines metabolischen Syndroms,Stuhlinkontinenz und Funktionelle Harninkontinenz wurden entfernt, da Fachexpert(inn)en bei der Literaturrecherche auf passendere Begriffe stießen, die das theoretische Schlüsselkonzept der Diagnose besser beschreiben. Darüber hinaus ergab sich durch die Literaturrecherche eine deutlichere Abgrenzung der Definitionen und beeinflussenden Faktoren. Verschiedenes deutete darauf hin, dass alte Begriffe, die für Praktiker verwirrend sein könnten, aus NANDA-I entfernt und durch Begriffe ersetzt werden sollten, die von der aktuellen wissenschaftlichen Literatur gestützt werden. Siehe ▶ Tab. 1.3 .
Überlaufharninkontinenz wurde entfernt, da es sich dabei um ein bestimmendes Merkmal von Harnretention handelt, auf welcher der eigentliche Fokus pflegerischer Intervention liegen sollte.
In der Literatur fanden sich keinerlei beeinflussende Faktoren, die durch eine eigenständige pflegerische Intervention verändert werden können. Daher wurden Reflexharninkontinenz und Reduziertes intrakranielles Anpassungsvermögen ebenfalls entfernt.
Ineffective infant feeding pattern (Ineffektives Ernährungsmuster des Säuglings) wurde entfernt, weil die Phrase „feeding pattern“ bei der Übersetzung aus dem Englischen in andere Sprachen irreführend sein könnte und fälschlicherweise als Gefüttertwerden, verstanden werden kann, im Gegensatz zu der Fähigkeit eines Kindes, zu saugen oder den Saug-Schluck-Reflex zu koordinieren. Diese Diagnose wurde durch den neuen Titel ineffective infant suck-swallow response (00295, Ineffektive Saug-Schluck-Reaktion des Säuglings) ersetzt.
Activity intolerance (Aktivitätsintoleranz) und risk for activity intolerance (Risiko einer Aktivitätsintoleranz) wurden entfernt, um das Formulieren von Diagnosetiteln zu ermöglichen, die Beurteilungsparameter enthalten. Die beiden Diagnosen wurden durch decreased activity tolerance (00298, Verminderte Aktivitätstoleranz) und risk for decreased activity tolerance (00299, Risiko einer verminderten Aktivitätstoleranz) ersetzt.
Bei Allergische Reaktion auf Latex konnten von den Prüfern keine beeinflussenden Faktoren ausfindig gemacht werden, die durch eigenständige pflegerische Interventionen verändert werden könnten. Das Risiko einer allergischen Reaktion auf Latex (00042) können Pflegekräfte jedoch einschätzen und unabhängig von anderen Professionen darauf einwirken, weshalb diese Diagnose auch weiterhin Bestandteil der Klassifikation ist.
Trauern ist eine normale menschliche Reaktion. Daher entspricht sie nicht der Definition einer problemfokussierten Pflegediagnose. Das bedeutet jedoch nicht, dass Pflegekräfte trauernde Patienten nicht unterstützen sollen: Pflegekräfte sollten ggf. das Risiko eines fehlangepassten Trauerns (00302) und Fehlangepasstes Trauern (00301) einschätzen. Außerdem können Patienten den Wunsch erkennen lassen, ihre Trauerbewältigung zu verbessern (Bereitschaft für ein verbessertes Trauern, 00285).
Risiko eines Sturzes und Risiko eines Dekubitus wurden entfernt, da die Fachexpert(inn)en bei ihrer Literaturrecherche hinreichend unterschiedliche Risikofaktoren für Sturz und Druckschädigung bei Erwachsenen, Kindern und/oder Neugeborenen ermitteln konnten. Daher wurden diese Diagnosen durch detailliertere, spezifischere Begriffe ersetzt. Darüber hinaus wurde der diagnostische Fokus pressure ulcer (Dekubitus) in Übereinstimmung mit der aktuellen Fachliteratur in pressure injury (Druckschädigung) umbenannt.
Risiko einer venösen Thromboembolie wurde entfernt, weil nicht genügend unterschiedliche Risikofaktoren für eine venöse oder arterielle Thromboembolie ausfindig gemacht werden konnten, die durch eine eigenständige pflegerische Intervention beeinflusst werden könnten. Die neue Diagnose Risiko einer Thrombose (00291) beinhaltet Risikofaktoren für beide Arten von Thrombosen.
Risiko eines Suizids wurde entfernt, da der neue diagnostische Fokus Suizidales Verhalten das Phänomen, das in den Kompetenzbereich der Pflege fällt, besser trifft. Suizid – der Akt der Selbsttötung – wäre ein unerwünschtes Outcome, das aus einem suizidalen Verhalten hervorginge. Diese Diagnose wurde durch Risiko eines suizidales Verhaltens (00289) ersetzt.
Risiko einer verzögerten Entwicklung wurde entfernt, weil die zugrundeliegende Definition durch die Ergänzung der Angabe Kind aus der Achse Alter im Titel präziser beschrieben wird. Daher wurde diese Diagnose durch Risiko einer verzögerten kindlichen Entwicklung (00305) ersetzt.
1.6NANDA-I-Pflegediagnosen: Standardisierung der Indikatorenbegriffe
Wie schon in den vorangegangenen Ausgaben wurde auch in der vorliegenden Ausgabe der Klassifikation versucht, die Begriffsvariationen bei den bestimmenden Merkmalen, beeinflussenden Faktoren oder Risikofaktoren zu verringern. Zu diesem Zweck wurden Literaturrecherchen durchgeführt; es fanden Diskussionen statt und es wurden klinische Expert(inn)en unterschiedlicher pflegerischer Fachgebiete aus aller Welt hinzugezogen. Obwohl die technische Entwicklung es zunehmend einfacher macht, ähnliche Begriffe/Phrasen ausfindig zu machen oder diejenigen zu bestimmen, die beispielsweise eine Herausforderung für Übersetzer darstellen, war diese Aufgabe alles andere als einfach und nahm etliche Stunden in Anspruch. Dennoch ist dieser Prozess noch längst nicht abgeschlossen und wird in der nächsten Ausgabe fortgesetzt.
Beim Lesen wird Ihnen vielleicht auffallen, dass bei vielen Diagnosen kleine Korrekturen bei den Begriffen vorgenommen wurden (z. B. wird Veränderung des Stoffwechsels aus der vorherigen Ausgabe in der aktuellen Ausgabe als Beeinträchtigter Metabolismus bezeichnet). Außerdem ist – wie in der letzten Ausgabe angekündigt – die Überarbeitung sämtlicher assoziierter Bedingungen und Risikopopulationen erfolgt. Der Fokus lag dabei auf der Eindeutigkeit der Begriffe und der Standardisierung des Gebrauchs. Diese Änderungen werden nicht als inhaltliche Änderungen, sondern vielmehr als redaktionelle Änderungen betrachtet. All jene Diagnosen, die ausschließlich solche redaktionellen Änderungen erfahren haben, sind nicht in ▶ Tab. 1.2 aufgeführt.
Der einheitliche Gebrauch der Begriffe, der mit dieser Arbeit angestrebt wird, bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Die drei Wichtigsten werden nachstehend erläutert:
1.6.1Die Übersetzung der Klassifikation wird einfacher
Immer wieder erreichen uns Fragen und Anmerkungen der Übersetzer zu bisher verwendeten Begriffen. Dadurch wurde uns als Herausgeberinnen bewusst, dass wir dieses Thema nicht vernachlässigen dürfen. Eine Frage lautete zum Beispiel:
In diesem Kontext tauchen verschiedene Begriffe/Phrasen auf, für die es in meiner Sprache nur eine einzige Entsprechung gibt. Ich würde die Begriffsvarianten daher immer mit derselben Formulierung übersetzen. Ist das zulässig? Oder muss ich für die Übersetzung unbedingt unterschiedliche Formulierungen finden – auch wenn das Ergebnis dann nicht unserem tatsächlichen Sprachgebrauch entspricht? Bisher haben wir von Personen, die Pflegediagnosen einreichen möchten, nicht verlangt, dass sie die Terminologie zuvor nach bereits vorhandenen Begriffen/Phrasen durchsuchen, um einen einheitlichen Sprachgebrauch zu gewährleisten. Dadurch wuchs die Zahl der Begriffe/Phrasen für Diagnoseindikatoren in der Terminologie im Lauf der Jahre immer weiter an.
Es ist wichtig, dass beim Übersetzen von Begriffen/Phrasen die zugrundeliegenden Konzepte genau beachtet werden. Liegt bei zwei Begriffen im englischen Originaltext eine konzeptuelle Differenz vor, z. B. helplessness (Hilflosigkeit) und hopelessness (Hoffnungslosigkeit), können Übersetzer die beiden unterschiedlichen Konzepte nicht mit ein- und demselben Begriff wiedergeben. Viele Herausforderungen, mit denen Übersetzer konfrontiert sind, resultieren jedoch aus einer fehlenden Standardisierung der Begriffe/Phrasen im englischen Original. So wurde etwa in der vorherigen Ausgabe der Klassifikation der Begriff anorexia (Anorexie) in acht Diagnosen verwendet; poor appetite (schlechter Appetit) in drei Diagnosen, decrease in appetite (verminderter Appetit) in zwei Diagnosen und loss of appetite (Appetitverlust) in einer Diagnose. In manchen Sprachen wäre es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, diese Begriffe so zu übersetzen, dass sie klar voneinander unterschieden werden können.
Durch die Verringerung dieser Begriffsvariationen dürfte der Übersetzungsprozess einfacher werden, weil nun in der gesamten Terminologie nur noch ein Begriff/eine Phrase für vergleichbare diagnostische Indikatoren genutzt werden wird. In dieser Ausgabe wurde damit begonnen, die Fachbegriffe aus den Medical Subject Headings (MeSH) einzubinden, wann immer es möglich war. Die MeSH sind der Dokumentationsthesaurus der US-Nationalbibliothek für Medizin, der zum Indexieren von Artikeln in der MEDLINE®/PubMED®-Datenbank genutzt wird. Die MeSH-Begriffe sind definiert und dienen als Thesaurus mit kontrolliertem Vokabular, mit dem die Suche nach bestimmten Begriffen oder Dokumenten erleichtert wird. Zwar sind die MeSH-Begriffe in diesem Text nicht einsehbar, werden unseren Übersetzern jedoch mit den zugehörigen Definitionen an den relevanten Stellen angezeigt. Diese Neuerung soll dabei helfen, präzisere Übersetzungen zu erhalten. Im oben genannten Beispiel zum Thema Appetit wurde der MeSH-Begriff Anorexie in die Klassifikation übernommen, der als „Fehlen oder Verlust von Appetit, begleitet von einer Abneigung gegen Nahrung und dem Unvermögen, zu essen“ definiert wurde. Anstelle der vier zuvor genannten Begriffe wird also nur mehr ein einziger verwendet.
Zusammengefasst: Als Herausgeber haben wir uns bemüht, die Begriffe in der Klassifikation so weit wie möglich zu vereinheitlichen.
1.6.2Die terminologische Konsistenz wird erhöht
Als Herausgeber erreichten uns weitere Fragen, die schwer zu beantworten sind. Ein Beispiel: Wenn im Englischen etwas als „inadequate“ (inadäquat) bezeichnet wird, ist damit dann ein Qualitätsmangel gemeint? Oder ist es die Quantität, die unzureichend ist? Die Antwort lautet häufig: beides! Im Englischen ist diese Doppeldeutigkeit durchaus akzeptiert; für Praktiker in anderen Sprachen ist die fehlende Eindeutigkeit jedoch nicht hilfreich und erschwert die Übersetzung in Sprachen erheblich, in denen man je nach Kontext verschiedene Wörter benutzen würde. Leider finden sich in der Terminologie noch mehr Beispiele mit derselben Problematik, wie etwa insufficient (unzureichend), inadequate (inadäquat) oder deficient (defizitär). In dieser Ausgabe wurde entschieden, den Begriff inadequate (inadäquat) zu verwenden, wenn damit ein Mangel qualitativer und/oder quantitativer Art gemeint sein kann, wohingegen der Begriff insufficient (unzureichend) ausschließlich für einen quantitativen Mangel steht. Das Wort deficient (defizitär) hingegen wird benutzt, um das Fehlen bestimmter Elemente oder Charakteristika aufzuzeigen. Daher wurde zum Beispiel die Phrase insufficient access to ressources (unzureichender Zugang zu Ressourcen) aus der vorherigen Ausgabe in dieser Ausgabe abgeändert in inadequate access to resources (inadäquater Zugang zu Ressourcen).
Eine andere Frage macht deutlich, dass im allgemeinen Sprachgebrauch verwendete Begriffe klar differenziert werden müssen: Was ist der Unterschied, sofern es überhaupt einen gibt, zwischen „disease“ (Krankheit, Erkrankung) und „illness“ (in etwa ausgeprägtes Krankheitsgefühl)? Diese Begriffe schließen sich gegenseitig nicht völlig aus, und die englischen Definitionen können verwirrend sein. Für den konsistenten Gebrauch dieser Begriffe in der Terminologie müssen jedoch klare Regeln festgelegt werden. Der MeSH-Begriff disease ist definiert als „eindeutig pathologischer Prozess, der eine bestimmte Kombination aus sichtbaren Krankheitszeichen und darüber hinausgehenden Beschwerden erkennen lässt“. Somit wird disease für spezifische Krankheiten benutzt, die einen bestimmten Namen haben und Symptome verursachen, die behandelt werden müssen, wie zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankung oder entzündliche Darmerkrankung. Illness hingegen wird gebraucht, um das subjektive Empfinden des Patienten wiederzugeben, wenn es um Symptome und Beeinträchtigungen des Wohlbefindens geht, mit denen er zurechtkommen muss. Beispiele hierfür sind chronische Erkrankungen oder körperliche Erkrankungen.
1.6.3Die Kodierung der diagnostischen Indikatoren wird einfacher
Wir hören immer wieder von Pflegekräften und Studierenden, die angesichts der langen Liste von Diagnoseindikatoren den Überblick verlieren. Ich kann wirklich nicht sagen, ob diese Diagnose auf meinen Patienten zutrifft. Muss mein Patient alle bestimmenden Merkmale und beeinflussenden Faktoren aufweisen, die in der Diagnose genannt sind? Im derzeitigen Entwicklungsstand sind die diagnostischen Kriterien der Pflegediagnosen weniger eindeutig als die der meisten medizinischen Diagnosen. Für die Pflege ist es daher dringend geboten, mithilfe der Forschung diagnostische Kriterien zu identifizieren, die für die Pflege relevant sind. Ohne diagnostische Kriterien ist es schwierig, Pflegediagnosen korrekt zu stellen. Erschwerend hinzu kommt die Unsicherheit, ob Pflegekräfte überall auf der Welt dieselbe Pflegediagnose für eine ähnliche menschliche Reaktion verwenden.
Mit der vorliegenden Arbeit wird die Kodierung der diagnostischen Indikatoren einfacher. Dies dürfte künftig auch das Einpflegen von Daten in Assessmentdatenbanken für die elektronische Patientenakte (ePA) erleichtern. Alle Begriffe sind nun für die Verwendung in elektronischen Gesundheitsakten kodiert, was von vielen Organisationen und Anbietern immer wieder gefordert wurde. Schon bald wird man analysieren können, welche bestimmenden Merkmale in den Assessmentdaten bei einer bestimmten Pflegediagnose am häufigsten verzeichnet werden. Daraus lassen sich dann wiederum ausschlaggebende diagnostische Kriterien ableiten. Hinzu kommt, dass auch die Identifikation der am häufigsten gebrauchten beeinflussenden (ursächlichen) Faktoren der einzelnen Diagnosen dazu beitragen wird, geeignete pflegerische Interventionen zu ermöglichen. All das ermöglicht die Entwicklung von Tools, die die Entscheidungsfindung unterstützen, und zwar sowohl im Hinblick auf das Zutreffen und das Verbinden der Diagnose mit dem Assessment als auch auf das Verknüpfen von beeinflussenden Faktoren/Risikofaktoren mit geeigneten Behandlungsplänen.





























