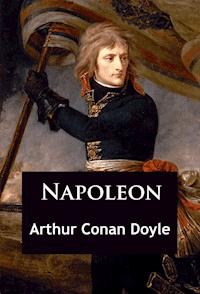
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich hatte den Brief meines Onkels wohl hundertmal gelesen und konnte ihn fast auswendig. Und doch zog ich ihn jetzt, auf dem Schiffe, wieder aus der Tasche, um ihn nochmals mit größter Aufmerksamkeit durchzulesen, als wäre es das erstemal. Die gezierten, spitzigen Schriftzüge mochten von der Hand eines Landadvokaten herrühren, und die Adresse lautete: Monsieur Louis de Laval, zu Händen des Mr. William Hargreaves, Wirt zum grünen Mann in Ashford, Kent. Mein Quartiergeber bezog nämlich große Mengen geschmuggelten Branntweins von der normannischen Küste; und durch Schmuggler hatte auch dieser Brief heimlich den Weg zu ihm gefunden. »Mein lieber Neffe,« so las ich, »jetzt, da Dein Vater tot ist, und Du in der Welt allein stehst, wirst Du unseren alten Familienzwist wohl nicht weiterzuführen gedenken. Zur Zeit der großen Unruhen stellte sich Dein Vater an die Seite des Königs, mich aber zog es zu dem Volke hin. Was weiter geschah ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arthur Conan Doyle
Napoleon
(Onkel Bernac)
idb
ISBN 9783962241933
Erstes Kapitel.
Die französische Küste.
Ich hatte den Brief meines Onkels wohl hundertmal gelesen und konnte ihn fast auswendig. Und doch zog ich ihn jetzt, auf dem Schiffe, wieder aus der Tasche, um ihn nochmals mit größter Aufmerksamkeit durchzulesen, als wäre es das erstemal. Die gezierten, spitzigen Schriftzüge mochten von der Hand eines Landadvokaten herrühren, und die Adresse lautete: Monsieur Louis de Laval, zu Händen des Mr. William Hargreaves, Wirt zum grünen Mann in Ashford, Kent.
Mein Quartiergeber bezog nämlich große Mengen geschmuggelten Branntweins von der normannischen Küste; und durch Schmuggler hatte auch dieser Brief heimlich den Weg zu ihm gefunden.
»Mein lieber Neffe,« so las ich, »jetzt, da Dein Vater tot ist, und Du in der Welt allein stehst, wirst Du unseren alten Familienzwist wohl nicht weiterzuführen gedenken. Zur Zeit der großen Unruhen stellte sich Dein Vater an die Seite des Königs, mich aber zog es zu dem Volke hin. Was weiter geschah, weißt Du. Dein Vater mußte fliehen, und ich wurde Besitzer seiner Güter in Grobois. Es mag Dich betrüben, Dich in so veränderten Verhältnissen Deinen Vorfahren gegenüber zu befinden; aber lieber als in fremden Händen wirst Du sicherlich die Ländereien in meinem Besitze wissen. Bei dem Bruder Deiner Mutter wirst Du ja immer Liebe und Entgegenkommen finden.
Und nun will ich Dir einen guten Rat geben. Ich war, wie Du weißt, immer Republikaner; aber gegen das Schicksal kann man nicht ankämpfen, und Napoleons Macht ist nicht mehr zu erschüttern. Deshalb suchte ich mich ihm nützlich zu machen. Mit gutem Erfolge. Er ist mir wohlgesinnt und gewiß auch zu Gegendiensten bereit. Wie Du wohl erfahren hast, befindet er sich augenblicklich mit seiner Armee in Boulogne, wenige Meilen von Grobois. Wenn Du hierher kommst, wird er gewiß mit Rücksicht auf die Verdienste Deines Oheims die Feindschaft gegen Deinen Vater vergessen. Zwar steht Dein Name noch auf der Liste der Proskribierten, aber mein Einfluß auf den Kaiser wird die Sache rasch in Ordnung bringen. So komm denn sofort in vollem Vertrauen auf Deinen Onkel Bernac.«
Mehr noch als der Brief selbst gab mir dessen Umschlag zu denken. Die roten Wachssiegel an den Enden zeigten den Abdruck grober Handlinien. Offenbar hatte mein Onkel statt eines Siegelringes den Daumen benutzt. Und oberhalb des einen Siegels standen hastig hingekritzelt die englischen Worte: Kommen Sie nicht! Ob von weiblicher oder männlicher Hand, war nicht zu erraten; aber sie standen da, ein unheimlicher Zusatz zu der freundlichen Einladung.
Kommen Sie nicht! War mein Oheim plötzlich anderen Sinnes geworden? Kaum; warum hätte er dann den Brief überhaupt abgesandt? Oder wollte mich jemand anderes vor dem Besuche warnen? Der Brief war französisch, die warnenden Worte englisch. Vielleicht waren sie gar erst in England hinzugefügt worden. Aber die Siegel waren ja unverletzt; und in England konnte niemand von dem Inhalte des Briefes wissen.
Das Schiff stach in See; die geschwellten Segel über mir, die rauschenden Wellen an meiner Seite, rief ich mir alles ins Gedächtnis, was ich in früheren Zeiten über meinen Oheim gehört hatte.
Mein Vater entstammte einer der ältesten und stolzesten Adelsfamilien Frankreichs; seine schöne, tugendhafte Gattin war ihm nicht ebenbürtig. Sie selbst gab ihm niemals Anlaß, seine Wahl zu bedauern; einer ihrer Brüder jedoch, der damals Rechtsanwalt war, hatte schon in den Tagen des Glanzes der Familie durch seine heuchlerische Unterwürfigkeit das Mißfallen meines Vaters erregt. Später, nach dem Sturz der Adelsherrschaft, war er der ärgste Feind meiner Familie. Der einstige Bauernketzer war nunmehr einer der werktätigsten Anhänger Robespierres geworden und wurde von diesem zum Herrn auf Orobois eingesetzt. Nach dem Sturze Robespierres wußte er die Gunst Barras' zu gewinnen. Auch keine der folgenden Umwälzungen vermochte ihn von Grobois zu verdrängen. Und nun ersah ich aus diesem Briefe, daß auch der neue Kaiser für ihn Partei ergriffen hatte; so sonderbar mir dies erschien, in Anbetracht der Vorgeschichte dieses Mannes. Was für Dienste konnte ihm mein Oheim, der Republikaner, wohl geleistet haben?
Es mag unbegreiflich erscheinen, daß ich die Einladung eines Mannes annahm, den mein Vater als Verräter gebrandmarkt hatte. Aber die jüngere Generation der damaligen Zeit war nicht geneigt, den Groll gegen die neuen politischen Verhältnisse aufrecht zu halten. Für die alten Auswanderer schien mit dem Jahre 1792 die Zeit stille zu stehen; ihre Ideale und ihre Abneigungen standen unabänderlich fest. Wir Jungen aber, die wir in der Fremde aufgewachsen waren, fühlten, daß eine neue Zeit angebrochen war. Frankreich war nicht mehr das Land der Sansculotten und der Guillotine; siegreich und doch hart bedrängt von allen Seiten rief das Vaterland nach seinen versprengten Söhnen; und mehr als der Brief meines Oheims zog mich der Kriegslärm über den Kanal hinüber nach Frankreich.
Lange schon kämpfte ich im Herzen mit der Sehnsucht nach meinem Vaterlande. Zu Lebzeiten meines Vaters sprach ich nie davon; ihm, der unter Condé gedient und bei Quiberon gefochten hatte, wäre ein solcher Wunsch geradezu verräterisch erschienen. Mit seinem Tode jedoch fiel alles weg, was mich von der Rückkehr nach Frankreich abhielt, und meine Sehnsucht wurde um so dringender, da auch Eugenie – die nun seit dreißig Jahren meine Frau ist – ebenso dachte wie ich. Ihre Eltern, ein Zweig der Familie Choiseul, hatten ebenso unbeugsame Prinzipien und Vorurteile wie mein Vater. Um die Gesinnung ihrer Kinder kümmerten sie sich wenig. So oft sie im Hause über einen französischen Sieg trauerten, sprangen wir im Garten vor Freude. Bei einem lorbeerumkränzten Fenster des Gartenhauses hatten wir nächtliche Zusammenkünfte und schlossen uns um so enger zusammen, je mehr wir uns unserer Umgebung entfremdeten. Ich entwickelte meine ehrgeizigen Pläne; und Eugenie bestärkte mich darin durch ihre begeisterte Zustimmung. So war der Brief meines Oheims nur der äußere Anlaß zur Ausführung eines längst gehegten Planes.
Außer dem Tode meines Vaters und dem Briefe meines Onkels kam noch ein anderes Ereignis meinem Entschlusse zu Hilfe. In Ashford war mir seit kurzem der Boden heiß geworden. Gewiß kamen die Engländer im allgemeinen den französischen Auswanderern sehr freundlich entgegen. Jeder von uns bewahrt England und seinen Bewohnern ein gutes Andenken. Aber überall gibt es übermütige, prahlerische Menschen, und diese fehlten auch in dem ruhigen, schläfrigen Ashford nicht. Da war besonders ein kentischer Junker, Namens Forley, der als spott- und streitsüchtig bekannt war. So oft er einem von uns begegnete, stieß er Schmähungen aus, nicht nur gegen die französische Regierung, was man einem englischen Patrioten allenfalls hätte zugute halten können, sondern gegen Frankreich selbst und gegen alle Franzosen. Lange stellten wir uns taub seinen Angriffen gegenüber, aber endlich wurde mir die Sache zu arg, und ich beschloß, ihm eine Lehre zu geben. Eines Abends saß ich mit einigen Freunden in der Wirtsstube, und am Nebentische saß Forley. Er war halb betrunken und machte unausgesetzt hämische Bemerkungen über die Franzosen. »Und jetzt, Monsieur de Laval,« schrie er endlich, seine schwere Hand auf meine Schulter legend, »jetzt müssen Sie mit mir einen Toast ausbringen: auf den Arm Nelsons, der Frankreich vernichten soll.«
»Gut,« sagte ich, »ich will mit Ihnen trinken, wenn Sie versprechen, später bei meinem Toast mitzuhalten.«
»Abgemacht,« sagte er, und wir tranken.
»Nun kommt Ihr Toast an die Reihe,« rief er.
»Wohlan denn,« entgegnete ich, »ein Hoch der Kanonenkugel, die diesen Arm zerschmettert.«
Als Antwort schüttete er mir den Wein ins Gesicht. Es kam zum Zweikampf, und ich schoß ihn durch die Schulter. Abends traf ich Eugenie an dem gewohnten Fenster; sie pflückte ein paar Blätter von den Lorbeerbüschen und bekränzte mein Haupt.
Dieser Vorfall erschütterte meine Stellung in Ashford und trug wesentlich zu meinem Entschlusse bei, die Einladung meines Oheims – jenen mahnenden Worten zum Trotz – anzunehmen. Wenn er durch seinen Einfluß den Kaiser bewegen könnte, meinen Namen von der Liste der Proskribierten zu streichen, so stand meiner Rückkehr nach Frankreich nichts mehr im Wege.
Versunken in meine Gedanken, hatte ich ganz vergessen, wo ich mich befand. Da legte der Schiffer plötzlich seine Hand auf meine Schulter und schreckte mich aus meinen Träumereien auf.
»Nun denn, Herr,« sagte er, »jetzt müssen Sie in den Kahn steigen,«
Mein aristokratisches Gefühl regte sich, und ich schob seine schmutzige Hand sanft von meinem Arm. »Die Küste ist noch weit,« bemerkte ich.
»Tun Sie, was Sie wollen,« sagte er; »ich fahre nicht weiter. Steigen Sie ins Boot oder schwimmen Sie hinüber.«
Vergeblich hielt ich dem Manne vor, daß ich den ganzen Fahrpreis gezahlt hatte. Sogar meine Uhr, ein altes Erbstück der Familie, hatte ich dafür geopfert.
»Wenig genug,« schrie er wild. »Die Segel nieder, Gin, und das Boot heran. Jetzt, Herr, steigen Sie hinein, oder kommen Sie zurück mit mir nach Dover. Südweststurm ist im Anzug; ich fahre nicht einen Faden weiter.«
»Dann steige ich ins Boot,« sagte ich.
»Es wird Ihnen wohl nichts anderes übrig bleiben,« rief er und lachte so aufreizend, daß ich ihn hätte prügeln mögen. Aber solchen Leuten gegenüber ist man ganz machtlos; wenn man den Stock gegen sie erhebt, so schlagen sie einem mit der blanken Faust die Zähne ein. So machte ich denn gute Miene zum bösen Spiel und sprang in den Kahn. Mein Bündel – ein feines Reisegepäck für einen Herrn von Laval – flog mir nach. Zwei Matrosen legten die Ruder ein und strebten mit mächtigen Schlägen der fernen Küste zu.
Eine schlimme Nacht stand uns bevor. Dunkle Wolken ballten sich am Horizont, und durch ihre zerrissenen Ränder brachen die Strahlen der untergehenden Sonne. Fahlrotes Licht ergoß sich über das Firmament und spiegelte sich in der bleischweren See. Unser kleines Boot schaukelte heftig und tanzte auf den Wellen. Ängstlich blickten die Ruderer bald nach dem Himmel, bald nach der Küste. Schon sah es aus, als ob sie umkehren und zu dem großen Segler zurückfahren wollten.
»Was sind das für Lichter, die da auf beiden Seiten durch den Nebel blitzen?« fragte ich, um ihre Gedanken von den Wettersorgen abzulenken.
»Hier im Norden ist Boulogne und im Süden Etaples,« antwortete mir einer der Ruderer höflich.
Boulogne! Etaples! Wie mich diese Namen berührten! In Boulogne hatte ich als Knabe viele Sommer zugebracht. Wie oft war ich an der Hand meines Vaters am Strand dahingeschlendert, die ehrfurchtsvollen Grüße der Fischersleute mit kindlichem Stolze erwidernd. Und gar Etaples! Da waren wir auf der Flucht nach England durchgekommen. Das rasende Volk hatte sich am Hafen angesammelt und bewarf uns mit Steinen. Meiner armen Mutter zerschmetterten sie das Knie. Der Aufschrei meines Vaters und der schrille Schreckensruf meiner eigenen Kinderstimme gellt mir noch heute in den Ohren. Und zwischen diesen beiden Orten, in dem weiten dunklen Raume, den ihre Lichter begrenzten, lag auch Grobois, die Burg meiner Väter. Wie strengte ich meine Augen an, ihr schwarzes Dach zu erspähen!
»Hier ist die Küste recht einsam,« sagte einer der Seeleute; »so manchen Ihrer Kameraden haben wir hier ausgeschifft.«
»Wofür halten Sie mich denn?« fragte ich.
»Das sage ich nicht,« entgegnete er, »es gibt Dinge, über die man am liebsten nicht spricht.«
»Sie halten mich wohl für einen Verschwörer?«
»Nun ja, wenn Sie es selbst sagen; solche Leute sind bei uns nicht selten,«
»Auf Ehrenwort, ich bin kein Verschwörer.«
»Also ein entlaufener Sträfling?«
»Auch das nicht.«
Der Mann hielt mit dem Rudern inne; ein neuer Verdacht schien ihm aufzusteigen, »Wenn Sie ein Spion Bonapartes sind . . .«
»Ich ein Spion!« rief ich entrüstet. Der Ton meiner Stimme schien ihn zu überzeugen.
»Nun gut,« sagte er, »der Teufel soll wissen, was Sie sind. Aber einen Spion hätte ich um keinen Preis ans Land gesetzt.«
»Oho,« polterte der andere Ruderer heraus, »schimpft nicht über Bonaparte; er ist unser bester Freund.«
An einem Engländer überraschte mich diese Sympathie für den Kaiser, aber die Erklärung ließ nicht lange auf sich warten.
»Daß wir armen Seeleute das bißchen Zucker und Kaffee über die Grenze bringen können,« sprach der Seemann weiter, »verdanken wir nur Bonaparte; früher haben die Kaufleute ihren Schnitt gemacht, jetzt ist die Reihe an uns.«
In der Tat hatte Bonaparte den ganzen Handel zwischen England und Frankreich den Schmugglern in die Hände geliefert.
Plötzlich hielt der Sprecher inne und wies mit der rechten Hand in die dunkle Ferne, während die linke eifrig weiter ruderte.
»Dort ist Bonaparte selbst,« rief er aus.
Bonaparte! Ihr, die ihr in einem ruhigen Zeitalter lebt, könnt den Schreck, der mir beim Klange dieses Namens durch die Glieder fuhr, nicht begreifen. Vor zehn Jahren hatte man das erstemal von dem Manne mit dem sonderbaren italienischen Namen gehört. Was erreichen gewöhnliche Sterbliche in zehn Jahren? Er aber war von einem Augenblick zum anderen aus nichts zu einem allmächtigen Manne geworden. Heuschreckenschwärmen gleich überschwemmten seine Armeen ganz Norditalien; Venedig und Genua seufzten unter dem Drucke dieses unscheinbaren, schlecht genährten Burschen. Er beschämte die tapfersten Soldaten und überlistete die schlauesten Diplomaten. Mit ungeahnter Tatkraft brach er gegen den Orient vor; und während noch die Augen Europas nach Ägypten, der neuen französischen Provinz, blickten, war er wieder zurück in Italien und schlug Österreich zum zweitenmal auf das Haupt, überall kam er überraschend; die Nachrichten über seine Bewegungen konnten mit diesen selbst nicht Schritt halten. Wohin er kam, siegte er, verschob die Grenzen und stürzte die herrschende Ordnung, Holland, Savoyen, die Schweiz, sie waren zu geographischen Begriffen herabgesunken. Nach allen Seiten streckte Frankreich seine Arme aus. Nun war er gar zum Kaiser ausgerufen worden. Die Republikaner, deren die ältesten Königsgeschlechter und der stolzeste Adel nicht Herr werden konnten, lagen vor ihm im Staube. Mit atemloser Spannung folgten wir in der Ferne seinen waghalsigen Unternehmungen. Überall heftete sich der Erfolg an seine Fersen. Wie etwas Übermenschliches, Ungeheuerliches stellte ich mir ihn vor, das einer finsteren Wolke gleich über Frankreich schwebte und ganz Europa bedrohte.
Bonaparte! In meiner überhitzten Phantasie erwartete ich, eine riesenhafte Gestalt, ein überirdisches Fabelwesen zu sehen, finster, schrecklich und unheilsschwanger, thronend über den Gewässern.
Was ich wirklich sah, entsprach meinen kindischen Erwartungen durchaus nicht.
Im Norden die langgestreckte flache Küste. Im Abendlichte grau, wie das dahinterliegende Heideland, begann bei einbrechender Dunkelheit ihr Saum zu leuchten wie schwachglühendes Eisen. Der rote Strich glich einem feurigen Schwerte, dessen Spitze gegen England wies.
»Was ist das dort?« fragte ich.
»Ein französisches Schiff; ob Bonaparte selbst an Bord ist, weiß ich nicht; das hier sind Signallichter; auf dem Wege nach Ostende könnten Sie noch viele zu sehen bekommen, Er wäre kühn genug, da herein zu kommen, der kleine Bony, wenn Nelson nicht wäre.«
»Wie kann Lord Nelson wissen, was er vorhat?« fragte ich.
Der Seemann zeigte über meine Schulter hinaus in die Finsternis; weit draußen am Horizont entdeckte ich zwei Lichter.
»Seine Wachhunde,« sagte er mit rauher Stimme.
»Andromeda. Nr. 44,« ergänzte sein Kamerad.
Wie oft habe ich mir seither dieses Bild ins Gedächtnis zurückgerufen! Der rote Küstensaum und davor die drei blinkenden Lichter, als Repräsentanten der zwei großen Rivalen, als Wahrzeichen ihres Kampfes um die Vorherrschaft zu Wasser und zu Land; des Kampfes, der seit Jahrhunderten tobt und noch Jahrhunderte dauern mag.
Das Leuchten der Küste war schwächer geworden, und das Rollen des Sandes auf dem Meeresgrunde schlug immer lauter an mein Ohr. Schon nahm ich den Anprall der Wogen an die Küste deutlich aus. Da schoß plötzlich, wie eine aus ihrem Versteck aufgescheuchte Forelle, ein langes, schwarzes Boot aus der Finsternis hervor und flog geradeswegs auf uns zu.
»Zollwächter,« rief einer der Seeleute.
»Wir sind verloren,« schrie der andere und stopfte rasch etwas unter seinen Sitz.
Aber knapp vor uns schwenkte das große Boot jählings ab und fuhr mit Windeseile davon. Die Seeleute zogen die Augenbrauen hoch und starrten ihm nach.
»Die haben auch kein reines Gewissen,« meinte der eine, »vielleicht waren es Kundschafter.«
»Jedenfalls sind wir heute nacht nicht die einzig Verdächtigen,« ergänzte der andere.
»Weiß der Teufel, wer sie waren; meinen Tabak habe ich auf alle Fälle versteckt. Mit den französischen Gefängnissen habe ich schon einmal Bekanntschaft gemacht. Die Ruder weg, Bill, wir sind da.«
Im nächsten Augenblick fuhr das Boot knirschend auf sandigen Grund. Mein Bündel flog ans Land, und ich sprang hinterdrein. Die Ruderer stießen den Kahn mit einem kräftigen Ruck ab und fuhren eiligst davon. Das glühende Rot im Westen war geschwunden. Gewitterwolken deckten den Himmel, und undurchdringliche Finsternis lag über dem Ozean. Als ich mich umwandte, dem Boote nachzuschauen, schlug mir ein feiner Regen ins Gesicht; der Sturm heulte, und das Brüllen der erregten See machte die Luft erzittern.
Ja, das war eine schreckliche Nacht, damals im Frühling des Jahres 1805, da ich nach vierzehnjähriger Verbannung zum erstenmal den Boden meines Vaterlandes wieder betrat, dessen Zierde und Stütze meine Familie Jahrhunderte hindurch gewesen. Es hatte mir übel mitgespielt, das Land meiner Väter; unsere Verdienste hat es mit Beschimpfung und Verbannung belohnt. Aber jetzt war alles vergessen. Ich fiel auf die Knie und küßte mit Inbrunst den Boden der geliebten Heimat.
Zweites Kapitel.
Das Moorland.
In den Jahren der Reife blickt der Mensch gern zurück auf den vielverschlungcnen Pfad des eigenen Lebens mit all seinen Lichtern und Schatten, Anfang und Ende seiner Wanderung sind ihm bekannt. Wohin jeder einzelne Schritt geführt, den er einst, bange Ahnungen oder stolze Hoffnungen im Herzen, unternommen hatte, heute weiß er es genau; die Zweifel, die ihn so häufig vor wichtigen Entscheidungen gequält, sind beinahe vergessen. Aber die Erinnerung an die stürmische Nacht meiner Rückkehr nach Frankreich haftet mir noch heute – trotz der vielen Jahre, die seitdem vergangen, und trotz der wechselvollen Schicksale, die ich seitdem erduldet – so treu im Gedächtnis, als hätte ich sie erst jüngst erlebt. Noch heute zaubert mir der erfrischende Geruch des Seetangs mit einer Schärfe der Erinnerung, wie sie nur der Geruchssinn zu vermitteln vermag, das Bild der sandigen Küste Frankreichs herauf.
Endlich erhob ich mich aus meiner knienden Stellung und setzte mich auf eine wogenumspülte flache Klippe. Einen Souvereign, den zehnten Teil meines gesamten Vermögens, hatte ich den Schiffern gegeben; den Rest meiner bescheidenen Barschaft verwahrte ich sorgfältig in der inneren Rocktasche. Da saß ich nun, ganz versunken in den Anblick der tobenden See, und überlegte, was zu tun sei. Kälte und Hunger quälten mich, der Wind schlug mir ins Gesicht und trieb mir den Sprühregen in die Augen; aber das Bewußtsein, nicht mehr von der Gnade der Feinde meines Vaterlandes zu leben, machte mein Herz freudig schlagen.
Schloß Grobois war, soweit ich mich erinnern konnte, gut zehn Meilen von hier entfernt. Zu so unziemlicher Zeit, noch dazu ungekämmt und durchnäßt, konnte ich meinem unbekannten Oheim nicht unter die Augen treten. Verlumpt und schmutzig zurückzuschleichen in das Schloß meiner Väter, verfolgt von den argwöhnischen und spöttischen Blicken der Diener, den Gedanken vermochte ich nicht zu ertragen. So weit hatte ich meinen Stolz noch nicht vergessen. Nein, ich mußte ein Dach suchen für diese Nacht und dann meiner äußeren Erscheinung etwas aufhelfen, ehe ich die Bekanntschaft meines Onkels machte. Aber wo fand ich dieses Dach?
Nach Etaples oder Boulogne zu gehen, wagte ich nicht. Der Name de Laval stand noch obenan auf der Liste der Geächteten; war doch mein Vater der tatkräftigste Führer der kleinen, aber einflußreichen Schar von Männern gewesen, die der alten Ordnung um jeden Preis treu geblieben waren. Trotz der Verschiedenheit meines Standpunktes konnte ich der Prinzipientreue und der Opferwilligkeit dieser tapferen Kämpfer meine Bewunderung nicht versagen. Wir Menschen haben alle einen gewissen Hang zum Märtyrertum in uns; je größere Opfer eine Sache fordert, desto anziehender erscheint sie uns; und oft ist mir der Gedanke gekommen, die Bourbonen hätten nicht so zahlreiche oder doch so edle Anhänger gehabt, wenn diese Gefolgschaft nicht so viele und schwere Opfer mit sich gebracht hätte. Vielleicht war ihnen der französische Adel treuer als der englische den Stuarts, weil er mehr zu verlieren hatte als dieser. Die Selbstverleugnung der Edlen Frankreichs kannte keine Grenzen. Ich erinnere mich eines Abends, an dem zwei Fechtmeister, drei Sprachlehrer, ein Ziergärtner und ein Übersetzer fremdsprachiger Bücher bei meinem Vater zu Gaste waren. Sie sahen ganz herabgekommen aus. Und doch gehörten diese Männer dem höchsten Adel an. Die Unterwerfung unter das neue Regime hätte ihnen Einfluß und Reichtum sofort zurückgegeben. Aber der unbedeutende, und was noch schlimmer ist, unfähige Monarch, der jetzt auf Schloß Hartwell in der Verbannung lebte, hatte den Treueid dieser altadeligen Geschlechter in Händen, Sie hatten den Glanz der königlichen Familie geteilt und standen ihr auch im Unglück treu zur Seite. Auf ihre Ergebenheit hätte der entthronte Fürst stolzer sein können als auf all die Schätze und Kostbarkeiten, die seine Prunkzimmer geziert hatten. Über die Kluft hinüber, die unser Zeitalter von jenem meines Vaters trennt, sehe ich diese schlechtgekleideten, schwermütigen Männer und ziehe den Hut vor ihnen, als den Edelsten der Edlen, die unsere Geschichte kennt.
Eine Küstenstadt zu besuchen, bevor ich meinen Oheim gesehen und die Genehmigung meiner Rückkehr erwirkt hatte, wäre gleichbedeutend gewesen mit der Auslieferung an die Gendarmen, die hier beständig nach Ankömmlingen aus England fahndeten. Es war doch etwas anderes, freiwillig vor den Kaiser hinzutreten, als aufgegriffen und ihm vorgeführt zu werden.
So kam ich endlich zu dem Entschlusse, auf gut Glück landeinwärts zu wandern; irgendeine leere Scheune oder Hütte würde ich schon finden, um die Nacht ungesehen und ungestört zu verbringen. Dann konnte ich am nächsten Morgen noch darüber nachdenken, wie ich mich am besten meinem Oheim und mit seiner Hilfe dem neuen Herrn Frankreichs nähern könnte.
Unterdessen war der Wind immer kälter geworden, und tiefe Finsternis lag über der See. Das Schiff, das mich von Dover gebracht hatte, war spurlos verschwunden. Auf der Landseite erblickte ich in undeutlichen Umrissen eine Reihe niederer Hügel, die sich in der Nähe noch viel niedriger erwiesen, als sie in dem düsteren Lichte von Ferne erschienen waren. Es waren verstreut liegende, mit Gräsern und Sträuchern bewachsene Sanddünen. Mein Bündel auf der Schulter arbeitete ich mich mühsam weiter; bei jedem Schritt in den losen Sand einsinkend und über Wurzeln stolpernd. Aber mein eigenes Ungemach, meine nassen Kleider und meine wunden Hände vergaß ich über der Erinnerung an die Leiden und Entbehrungen meiner Vorfahren. Und auch mit der fernen Zukunft beschäftigten sich meine Gedanken; mit meinen eigenen Nachkommen, die sich einst an meinem Beispiel aufrichten würden. Denn in einer großen Familie treten die Schicksale des einzelnen der Geschichte der Familie gegenüber in den Hintergrund.
Die Sanddünen schienen kein Ende nehmen zu wollen; und als ich sie endlich hinter mir hatte, wünschte ich, sie nie überschritten zu haben. Denn hier bricht die See in zahllosen Wasseradern ein und verwandelt die ganze Gegend in trostloses Moorland. Der Boden wurde immer weicher; solange er mich noch trug, glitt ich bei jedem Schritte aus und glaubte zu stürzen; bald aber versank ich bis über die Knöchel und die halben Waden im Schlamm; gurgelnde und plätschernde Geräusche begleiteten das Niederstellen und Herausziehen des Fußes aus dem Morast. Am liebsten wäre ich zu den Dünen zurückgekehrt, aber ich hatte die Richtung verloren, und der Sturm heulte so laut, daß ich die Brandung der See auf allen Seiten zu hören glaubte. Mich nach der Stellung der Sterne zu orientieren, hatte ich nicht gelernt; und selbst dem Geübten hätten die wenigen, hier und da aus den Wolken blickenden Gestirne nur geringe Anhaltspunkte geboten.
So wanderte ich denn müde und hoffnungslos, mich dem blinden Zufall überlassend, immer tiefer und tiefer in den schrecklichen Sumpf hinein. Ich war auf das Schlimmste gefaßt; meine erste Nacht in Frankreich sollte wohl auch die letzte sein; der einzige Erbe derer von Laval war verurteilt, in diesem grauenhaften Morast ein elendes Ende zu finden. Meilenweit mochte ich gewandert sein, abwechselnd durch seichteren und tieferen Sumpf, ohne jemals auf trockenen Boden zu stoßen, als plötzlich ein eigentümlich geformtes Büschel weißlich schimmernden Grases – blühendes Baumwollgras – aus der Finsternis vor mir herausleuchtete. Ich erschrak ins Innerste. Vor einer Stunde war ich an einem ganz gleich gestalteten weißlichen Grasbüschel vorbeigekommen; ich mußte also im Kreise herumgegangen sein. Um mir volle Sicherheit zu verschaffen, ging ich näher heran und schlug Feuer; richtig waren hier in dem braunen Kote meine Fußspuren deutlich und unverkennbar abgedrückt. In heller Verzweiflung blickte ich zum Himmel auf; da durchzuckte mich plötzlich ein Hoffnungsstrahl. Zwischen den fliehenden Wolken war der Mond sichtbar geworden, und auf seiner Scheibe zeichnete sich, pfeilschnell darüber hinschießend, ein langgestrecktes, spitzes Dreieck ab, die charakteristische Gestalt ziehender Entenschwärme. Ich wußte, daß alle derartigen Seevögel bei Unwetter landeinwärts flüchten. Der Richtung ihres Zuges mußte ich also folgen. Das Gesicht gerade nach vorne gerichtet, mit beiden Beinen genau gleichmäßig ausschreitend, um die Richtung ja nicht wieder zu verlieren, wanderte ich noch eine gute halbe Stunde. Da tauchte endlich ein kleines gelbliches Licht vor mir auf, ein beleuchtetes Fenster, Nahrung und Rast verheißend dem erschöpften Wanderer! Ich stapfte weiter durch Kot und Schlamm, so schnell mich meine müden Beine trugen. Heute war mir kein Dach zu schlecht, und für ein Goldstück, dachte ich, würde der Bewohner dieses öden Hauses gewiß über alles hinwegsehen, was an mir verdächtig erscheinen mochte.
Je näher ich herankam, desto unbegreiflicher erschien es mir, daß hier überhaupt jemand wohnen konnte; denn der Morast wurde hier immer tiefer, und zahllose Teiche, die der zeitweise aus den Wolken hervorblitzende Mond beleuchtete, lagen rings um das Haus. Das kleine Fenster konnte ich jetzt deutlich sehen. Plötzlich verschwand der Lichtschein, und wie in einem gelben Rahmen erschien der Schattenriß eines männlichen Kopfes. Der Mann lugte hinaus in die Finsternis, verschwand und kam wieder zum Vorschein, und alle seine Bewegungen machten den Eindruck des Verstohlenen, so daß allerlei bange Ahnungen in mir aufstiegen.
Trotz meiner elenden Lage beschloß ich daher, das Haus und dessen Hüter noch etwas näher zu betrachten, ehe ich mich ihnen anvertraute. Viel Schutz gegen Wind und Wetter versprach die Hütte nicht zu bieten; an vielen Stellen der schadhaften Mauer schien das Licht durch und das ganze Gebäude war offenbar baufällig. Vielleicht war es, dachte ich bei mir, noch sicherer, die Nacht im Sumpf zu verbringen, als in dem Standquartier eines Schmugglers der schlimmsten Sorte. Jemand anderes konnte ja hier kaum hausen. Zu meinem Glücke hatten sich wieder dichte Wolken über den Mond gelagert, und die tiefe Finsternis sicherte mich vor Entdeckung. Auf den Zehenspitzen schlich ich noch näher an das Fenster heran und schaute ins Zimmer hinein.
Das friedliche Bild, das ich darin sah, beruhigte mich sehr. Auf einem altmodischen Rost brannte ein kleines Holzfeuer, und daneben saß ein auffallend schöner, junger Mann, der eifrig in einem dickleibigen, kleinen Buche las. Sein schmales, dunkles Gesicht und sein langes, schwarzes, gelocktes Haar gaben ihm das Aussehen eines Dichters oder Künstlers, In dem warmen, gelben Lichte erschienen seine Gesichtszüge noch feiner und machten mir einen sehr angenehmen Eindruck. Mit Wohlgefallen betrachtete ich den leichtgeöffneten Mund, dessen etwas zu volle Unterlippe sich fortwährend bewegte, als wiederhole er die eben gelesenen Worte. Jetzt legte der junge Mann das Buch auf den Tisch und ging zum Fenster. Offenbar hatte er einen Schimmer meiner Gestalt im Dunkeln erhascht. Er rief mir einige Worte zu, die ich nicht verstand und winkte grüßend mit der Hand, Im nächsten Augenblick flog die Türe auf, und seine hohe schlanke Gestalt erschien auf der Schwelle.
»Endlich,« rief er aus, während er seine Augen mit beiden Händen vor dem salzigen Winde und dem Triebsande schützte; »ich glaubte schon, Ihr kommt überhaupt nicht mehr; ich warte hier seit zwei Stunden.«
Da trat ich vor ihn hin, und der volle Lichtschein fiel auf mein Gesicht.
»Ich fürchte . . .« sagte ich.
Weiter ließ er mich nicht sprechen. Wie eine wütende Katze schlug er mit beiden Händen nach mir, sprang ins Haus zurück und warf die Tür zu.
Die raschen Bewegungen und das feindselige Benehmen des jungen Mannes kontrastierten so auffallend mit seiner sanften Erscheinung, daß ich ganz sprachlos war. Aber mein Erstaunen sollte bald noch größer werden.
Eine klaffende Mauerspalte neben der Tür gewährte mir nämlich Einblick in die Stube. Auch den Winkel, wo das Feuer brannte, konnte ich sehen. Dorthin war der Mann gelaufen; er wühlte wie rasend in seinen Rocktaschen und sprang auf den Kamin. Nur seine Schuhe und Strümpfe waren für mich sichtbar, als er dort auf den Ziegeln neben dem Roste stand. Gleich darauf eilte er zurück zum Tor.
»Wer sind Sie?« rief er mit erregter Stimme.
»Ein verirrter Reisender.«
Er schien einen Augenblick zu überlegen.
»Ein Nachtlager hier dürfte Ihnen nicht viel Angenehmes bieten.«
»Ich bin müde und erschöpft; hoffentlich werden Sie mir ein Obdach für diese Nacht nicht versagen; stundenlang bin ich durch das Moor gewandert.«
»Sind Sie irgend jemand begegnet?« fragte er hastig.
»Nein.«
»Treten Sie ein wenig zurück. Hier ist es einsam und die Zeiten sind unruhig; man muß vorsichtig sein.«
Ich folgte seiner Aufforderung, und er öffnete die Türe gerade nur so weit, um den Kopf herauszustecken. Lange blickte er mich forschend an.
»Wie heißen Sie?«
»Louis Laval,« sagte ich; ich hielt es für ratsam, meinen Adel zu verleugnen.
»Wohin gehen Sie?«
»Ich suche irgendeine Unterkunft,«
»Sie sind aus England?«
»Ich bin von der Küste.«





























