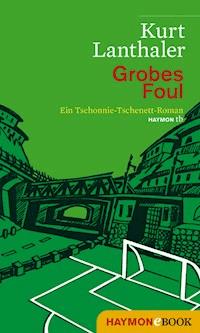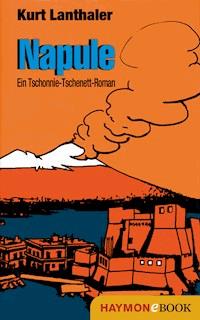
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der gewesene Matrose und Lastwagenfahrer Tschonnie Tschenett trifft seinen alten Freund Totò, Polizist mit Sonderstatus, in Napoli, wo ein gespenstisch sinnloser Kongress der europäischen Polizeien stattfindet. Mit von der Partie ist auch Ciro, genannt 'o professore; in Totòs Polizeischuljahren Aushilfslehrer, seither Inspektor in Napoli, in der Vergangenheit mit einigen der großen italienischen Verschwörungen und Verbrechen befasst. In 'o professores Büro findet sich ein geköpfter Hahn: Warnung wovor? Welcher Fall aus seiner Vergangenheit holt ihn ein? Während nach altem Brauch in den Straßen Napolis Berge von Weihnachtsbäumen brennen und die Jugend sich Straßenschlachten mit der Polizei liefert, verschwindet die Tochter von Ciros langjähriger Geliebter Nietta. Und 'o professore bekommt geheimnisvolle Botschaften. Ist es wahr, dass Do Nascimiento, der Magier, der auf italienischen TV-Kanälen Lottozahlen und Glücksbringer an Hunderttausende verkauft hat, gar nicht nach Brasilien geflüchtet ist, sondern sich samt seinen Millionen in Neapel versteckt? Und wieso lässt sich Tschenett ein Liebeselexier brauen? Eines ist gewiss: Es gilt auch für den neuen Tschonnie-Tschenett, was die Zeitschrift "Buchkultur" den ersten vier Romanen von Kurt Lanthaler attestierte: "Genaue Milieuschilderungen, feine Gedankenspiele, sauber durchgestaltete Dramaturgie…"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Lanthaler
Napule
Ein Tschonnie-Tschenett-RomanMit einem Glossar im Anhang
Der vorliegende Text folgt der Ausgabe von 2002
Diese Arbeit wurde unterstützt durchJubiläumsfonds der Literar-Mechana, Wienund
Künstlerhaus Schloß Wiepersdorf / Stiftung Kulturfonds
Bedienungsanleitung:
Es gilt alles nichts.
Also gilt das geschriebene Wort.
Mit einem Glossar
(Es herrscht Vielstimmigkeit in Napule– dem Napoli der Napoletaner –;und diese Stimmen brauchen Raum)
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Glossar
Motti
Zum Autor
1
Partono ’e bastimentepe’ terre assaje luntane
Die Weltmeere sind der Hefaistos längst zu weit geworden. Also zieht sie östlich der Säulen des Herkules ihre immergleichen, ventilaufreibenden Runden, ein dürres Schnittmuster wie zufällig zwischen heruntergekommenen Häfen gezogener Linien, ein Hin und Her, ein Auf und Ab, Sfaks, Bari, Saida, Patras, Haifa, Smirne, Beirut, Cagliari, Vassiliko, Trieste, Ajaccio, Saloniki, Istambul, Binghazi, Igoumenitsa, Ancona, Ismir, Dubrovnik, Tarabulus, Famagusta, Rijeka, Mersin, Napoli, ein Hafen folgt dem anderen und auf die Dauer werden sie sich immer gleicher, nichts als ein chaotisches Gewirr von Zollpapieren, Sprachen, Kränen, Liegezeiten, undurchschaubaren Hafenmeistern und unberechenbaren Habtachtstehern, ein Laden und Löschen, Verbringen und Verschieben von immer neuen Gütern, Schrott und Schredder, Kartoffeln, Kabelrollen, Käsekanister, Lederimitate, Luftmatratzen, Leichtlauffelgen, Mandarinen, Menschen, Maschinen, und wer vom Weizen eine Tonne zuviel und vom Zucker eine Tonne zuwenig hat, ruft nach der Hefaistos und sie folgt seinem Ruf, auf ihren verschlungenen Wegen, irgendwann, und wo Reis fehlt und Rosen welken, stehen die Händler am Hafen und halten Ausschau nach ihr, irgendwo liegt das Geschäft schon im Fax und der Gewinn auf der Hand, jetzt muß noch die Ware zum Käufer und Wasser untern Kiel, man spricht mit den Händen auf diesem Frachter, kaum einer kann mehr als zwei Worte des anderen, das eine für das Vorn, das andere für das Hinten, fürs Alltägliche reicht es, so kann man sich freundlich beschimpfen und in die Verwünschungen treiben, die dann wie Gummibälle noch übers Deck springen, von hier nach dort, selten, daß ihre Richtung voraussehbar ist, vorhersagbar schon gar nicht, und so treibt das Fluchen durchs Schiff wie die Hefaistos durchs Mittelmeer und was wie ziellos und verworren aussieht, folgt einem feingesponnenen Plan, der weitab an Land geschrieben wird, täglich neu; und ein stiller Ruf erreicht die Hefaistos und sie macht kehrt.
2
Für gewöhnlich garantiert ein Seesack die wenigen Dinge, die ein vernünftiger Mensch zum Leben braucht: Eine Handvoll Sicherheit, zwei Paar trockene Socken, ein kleines Zuhause und so viel Glück, daß von Unglück nicht mehr zu sprechen ist. Für gewöhnlich war Verlaß auf meinen Seesack. Also schulterte ich ihn, hob kurz die rechte Schulter, damit er sich an meinen Rücken legen konnte, nickte dem Ägypter zu, zog die Jacke vor der Brust zusammen und ging von Bord.
Sirenen, Autos, Bremsen, Türen, Geschrei. Und ich liege bäuchlings am Boden, mein Seesack halb auf, halb neben mir, ein oder zwei Schuhe im Kreuz, Schnee im Mund.
Denn es schneit in Napoli.
Dünne, leise Flocken. Sie wirbeln im ablandigen Wind auf und ab, ein Spiel wie ein anderes, und trotzdem denke ich: fehl am Platz. So wie du selbst.
Ich spucke kurz, versuche, zu Atem zu kommen und zu begreifen.
Vor mir, in dem schmalen Streifen zwischen dem dünnen, weißen Flaum auf dem Asphalt und dem blauen Autoblech mit den roten Buchstaben ARABI, laufen Stiefel und Turnschuhe, nach dem achten Paar habe ich aufgehört, sie zu zählen, und als ich meinen Kopf kurz nach oben drehe, sehe ich die Maschinenpistolen und die schwarzen Kapuzen.
Dann drückt ein Stiefel meinen Kopf wieder in den Schnee.
»Ist gut«, sage ich, »… schon verstanden.«
»E stai fermo!« schreit einer. »Rühr’ dich nicht.«
»Va bene«, sage ich, »bin schon brav.«
Und es fällt mir nicht einmal schwer.
Als ob so eine kleine Neugier schon eine Todsünde wäre. Als ob einer wie ich überhaupt etwas sehen könnte, das später einmal wichtig werden kann.
Und langsam wird mir naß und kalt.
Von Bord des Frachters kommen Schreie, vielsprachige Flüche. Ein neues Paar Schuhe vor meiner Nase. Der rechte kippt immer wieder auf die Außenseite. Ein nervöser Mensch. Und laut.
»Avanti! Marsch!«
Deutlich der Ton eines Norditalieners. Poebene. Polenta. Perfidie. Deutlicher Carabinieriton.
»E fissatelo, questo qui.«
Soll ich also auch noch gefesselt werden. Und schon reißt es an den Armen und klickt, schneidet ins Fleisch, drückt in den Rücken und nimmt den Atem.
Eben noch hatte ich gedacht: Macht nur. Ich habe Zeit. Und schon wird sie mir lang. Also zähle ich erst einmal Schneeflocken.
Ich hatte mich auf die Reise nach Napoli gemacht, weil es an der Zeit gewesen war. Weil ich diesen Frachter gefunden hatte. Weil ich es einem alten Freund versprochen hatte. Weil ich es eines Tages doch leid geworden war, aus dem Fenster meiner kleinen Wohnung auf einen verschneiten Hafen zu blicken.
Also hatte ich, als mich der Chef des Kafenions am Hafenrand ans Telefon gerufen hatte, Kieselstein ans Fenster, wie immer gleich der erste Wurf ein Treffer, »éh, Tséne, komm runter, éla káto!«, nicht lange nachgedacht.
»Dann sehen wir uns. Freut mich.«
Und herumgefragt. »Wann geht ein Schiff nach Napoli?«
»Es wird eines gehen. Es wird.«
Ich hatte mich hingesetzt und einen Kaffee bestellt.
Und war drei Tage später an den Ägypter geraten, der mit seinem Frachter erst Pireas, dann Napoli anlaufen sollte. Und weil Jorgos, der Wirt des Kafenions Majestic, mit dem Ägypter befreundet war und mich nun auch schon gute vier Jahre lang als Nachbar hatte, waren wir uns schnell handelseins geworden.
»Kein Problem. Sei einfach morgen um sechs Uhr da. Wir trinken noch unseren Metrio, und dann geht’s los.«
Ich hatte am selben Nachmittag noch meinen Seesack gepackt.
Als wir in Saloniki ausliefen, schneite es noch immer. Über Athina lag ein dunkelgrauer Schneesturm, in der Meerenge von Messina brodelte es. Dieser Januar des Jahres 2002 meinte es gar nicht gut mit dem Mittelmeer. Trotzdem hatte ich die Reise für eine vernünftige Idee gehalten.
Inzwischen bin ich drauf und dran, mir das wieder anders zu überlegen. Die Arme sind mir längst taub geworden und liegen wie Fesseln am Rumpf, immer noch marschieren Stiefel an mir vorbei aufs Schiff, dann drei Hunde. Der letzte, eine schwarzgraue Mischung mit ansehnlichen Riesenschnauzer-Anteilen, hält kurz an, schaut neugierig in meine Richtung, kommt langsam näher, schnüffelt an meinem Gesicht.
Ich schließe die Augen und warte. Liege starr. Als ich endlich wieder alleine bin, bis auf dem Fuß in meinem Rücken, ein kurzer Pfiff hatte mich erlöst, hole ich so tief Luft, wie es mein längst schon flachgedrückter Brustkorb eben erlaubt und versuche, laut zu werden.
»Ma porca miseria.«
Jetzt soll man sein eigenes Unglück nicht auch noch verfluchen, zuviel hängt an ihm, wenn nicht gar unser ganzes Leben, und ein Unglück kommt selten allein, und also schreit mich jemand aus dem Nichts an.
»Tschenett!«
Das, denke ich, kann jetzt eigentlich nicht sein. Wer kennt mich schon. Und hier schon gar.
»Fatelo alzare. È un mio confidente.«
Nein, denke ich, und schüttle stumm den Kopf, so gut das in meiner Lage eben geht, das nicht. So nicht, mein Freund. Von dir lasse ich mich nicht einen Polizeispitzel nennen. Von dir nicht.
Da zerrt es an mir, ein schnauzbärtiger Carabiniere, ebenso massiv wie teigig breit, stellt mich auf die Beine, ich ächze und versuche, meine Hände so zu drehen, daß die Handschellen mir nicht vollends die Gelenke zerschneiden, schaue zu Boden und sage: »Mindestens Größe 47.«
Jetzt weiß ich wenigstens, was da auf mir lastete.
»Zitto«, sagt der Carabiniere.
Und ich schweig still. Blick zu Boden.
Wir sind jetzt mitten im Spiel, und ich will kein Spielverderber sein. Oder ist man zu gutmütig, nur weil man alt geworden ist?
Vielleicht, denke ich, hat es aber auch nur aufgehört zu schneien. In meinem Blickfeld wenigstens. Vielleicht gibt es noch eine Welt, hinter diesen Schuhen, hinter diesem Hafen.
Und dann höre ich, wie der Neue dem Carabiniere seinen Ausweis zeigt, »Polizia di Stato, ecco qua«, Dienstgrad und Namen nennt, und wie er ihn bittet, mit leisem Befehlston, so nebenbei, mir die Handschellen abzunehmen. Weil er mich jetzt mitnehmen will, mich, seinen Spitzel.
Ich drehe mich so, daß der Carabiniere nicht an die Handschellen herankommt, er will linksrum, ich dreh mich wieder rechtsrum, er rechts, ich links.
»Nein«, sage ich, »ich bin nicht sein Spitzel. Ich kenne den da gar nicht, Signor Carabiniere. Haben Sie sich seinen Ausweis genau angesehen? Con tutti i farabutti, che ci sono in giro? Bei all den Gaunern, die frei herumlaufen?«
So einfach bekommst du mich nicht. Nicht, wenn ich dein confidente sein soll.
Der Carabiniere ist jetzt doch etwas verwirrt, schaut den Polizisten fragend an, flucht leise und dreht den Handschellenschlüssel unschlüssig in der Hand.
»Andiamo«, sagt der Polizist mit einer Stimme, die keinen Raum mehr läßt, »los jetzt«, greift sich den Schlüssel, hakt sich bei mir unter und schleift mich und meinen Seesack hinter sich her.
3
Dünner, weicher Teig, knuspriger Rand, golden mit Brandflecken, Mozzarella, Tomaten, ein Schuß Olivenöl, fruchtig, und schließlich Basilikumblätter; nichts als eine ganze Welt auf einem Teller, dampfend, und ausnahmsweise in runder Harmonie.
»Ich denke«, sage ich, »die Fröste der letzten Wochen und die Trockenheit der letzten Monate haben den italienischen Gemüsemarkt leergefegt oder ihn zumindest so unerschwinglich gemacht für unsereinen wie es sonst nur die Amsterdamer Diamantenbörsen sind.«
»Deswegen sind wir hier«, sagt Totò, »Luccio weiß, wie’s geht.«
»Nicht daß mir die Tomaten aus diesen Nährlösungstöpfen der freudlosen holländischen Zuchtanstalten kommen …«
»Tschenett, mach dich nicht unglücklich und laß das den Patron nicht hören: Er würde dich direkt zur Hölle schicken. Eigenhändig. Du kämst nicht einmal in den Genuß eines Auftragskillers. Und was das heißt, weißt du: Sauerei.«
»Allora«, sagt Ciro und hebt sein Glas, »auf uns. Tutt’ ’o lassato è perduto. Was man liegen läßt, ist verloren.«
»Schönes Sprichwort«, sage ich.
»Man kann«, sagt Ciro, »sein Leben mit diesen Sprichwörtern verbringen. Man kann es sich manchmal sogar erklären damit. In Napoletanisch, in der Sprache dieser Stadt, läßt sich die Welt beschreiben, wenn überhaupt. Napule, wie wir sagen, Napule ist unsere Stadt. Das andere, dieses andere Napoli, ist eine entschlackte Leichtausgabe für den Reisenden.«
Dann prosten wir uns zu. Ein Aglianico aus dem Umland. Dunkel, erdig, würzig.
Länger als fünf Minuten hatte unsere Fahrt in dem Alfa Romeo nicht gedauert, hinter dessen Steuer ein älterer Mann saß, für napoletanische Verhältnisse völlig gelassen, den mir Totò als Ciro vorstellte. Ciro nickte kurz und nicht unfreundlich in meine Richtung.
»Und …«, sagte ich, »ein Kollege?«
»Deiner sicher nicht, Tschenett. Kein gestrandeter Seemann, kein lahmgelegter LKWler. Ein kaum gescheiterter Mensch.«
»Bulle?«
»Naja. So einer wie ich. Mich haben sie in die sibirischen Weiten des Brenners verbannt …«
»Und ich weiß auch, wieso. Vollkommen unzuverlässiger Ermittler mit unkontrollierbarem Hang zu Cannabis. Außerdem rechthaberisch, aufsässig und stur …«
»… und Freund Ciro hat vom Polizeichef mitten in Napoli ein Büro zugeteilt bekommen, in dem er außer Ratten keine Gesellschaft und außer Bleistiftspitzen kaum eine Beschäftigung hat.«
»Und wohin geht’s jetzt?« sagte ich. »Zum Verhör dritten Grades?«
»Ja«, sagte Totò, »höchste Zeit für Luccio.«
»E facimmo ’e pizze!«
Ciro schien Hunger zu haben. Und die Fähigkeit, sich fürs Essen zu begeistern.
Begeistert bin ich auch. Luccios margherita ist ein Wunderwerk in ihrer ruhigen Einfachheit aus nichts als Mehl, Wasser, Hefe, Öl, Salz und den flüchtigen Aromen: Schon bin ich zuhause. So einfach ist das. Überall. Aber nicht immer. Habe schon festgestellt, daß bestimmte Wasser sich nun gar nicht zur Pizzateigherstellung eignen, wieso weiß ich nicht, keiner konnte es mir je auch nur im Ansatz erklären, Hypothesen, Hypothesen ja. Aber aus Hypothesen macht man keinen Pizzateig. Mit den Hefen ist es einfacher. Hefen funktionieren oder sie funktionieren nicht. Natürlich sieht man ihnen das nicht an. (Ich nicht.) Und trotzdem ist es so. Wir reden vom Fünften Hauptsatz der Thermodynamik. Hefen und ihre Hierarchien. Hefen und Hufeisen als Glückssymbol. Heftige Hefen höherer Ordnung. Das ganze System eben. Das wäre alles noch zu erforschen. In diesem Leben. Und als nächstes.
»Bene«, sagt Totò und wischt sich den Wein von den Lippen, erst mit der Linken, dann mit der Rechten, langsam mit breitem Handrücken, auf der Linken ein kleiner lila Streifen, die Rechte wischt längst ins Leere, und wie ich ihm dabei zusehe, denke ich: Er ist alt geworden in diesen Jahren, und ich noch älter. Ob das getrennt schneller geht als gemeinsam?
»Allora, also …«, sagt Totò
»Versuche ja nicht, dich zu entschuldigen«, sage ich. »Ciro, er hat mich öffentlich als seinen confidente ausgegeben. Mehr als öffentlich: einem Carabiniere gegenüber.«
Ciro versteht sofort.
»Das tut man wirklich nicht. Accide cchiù ‘a lengua ca ‘a spata. Die Zunge ist tödlicher als das Schwert.«
»Was wollt ihr?« sagt Totò. »Ihr wart ja dabei. Die Herren vom anderen Ministerium haben eine Razzia veranstaltet. Und entweder finden sie auf diesem Frachter zwanzig halbverhungerte Chinesen, drei Kanister Koks oder Bin Ladens Zwillingsbruder: Irgendeinen Ärger wird es geben. So wie die aufmarschiert sind, waren sie sich ihrer Sache sicher. Und der Tschenett, dieses Unglück, wieder mittendrin.«
»Ist mir doch egal.«
»Dir vielleicht, Freund, ich weiß. Aber ich stehe in der Gerichts-Bar vor meinem caffè, überlege, daß ich noch den Hafenmeister anrufen muß, um zu erfahren, wann du mit deinem Frachter einzulaufen gedenkst, Herr der Weltmeere du, da hör ich Hefaistos und Razzia und sehe die zwei Carabinieri und denke mir: Jetzt hast du den Tschenett fünf Jahre lang nicht gesehen und alles war ruhig und alles war bestens, er sitzt in Griechenland und was passiert? Die Erde bebt, die Wälder brennen, die Städte ersticken im Schnee, aber was soll’s, Griechenland ist weitab und irgendwie werden die schon mit ihm fertig werden, so wie ich es mußte all die Jahre, das denke ich mir und das höre ich, und da denke ich, und sag du mir, Ciro, wieso ich immer wieder so blöd bin und warum meine Mutter mich nicht gleich ertränkt hat, als in der Nacht meiner Geburt drohend feuerflammend das Wort Tschenett stand überm Tyrrhenischen Meer und die alten Weiber des Dorfes auf dem Platz zusammenliefen heulend und zähneknirschend, während die Männer nach ihren Gewehren griffen, warum bin ich so blöd und denke mir wieder: Hol ihn da raus, rette ihn vor sich selbst, wieder einmal und wohl wieder umsonst, entreiß ihn seinem wohlverdienten Schicksal, zwei Wochen Untersuchungshaft und ein schwerhöriger Richter, der es längst schon aufgegeben hat, den Pflichtverteidiger aus seinem Schlaf zu reißen, es kompliziert die Dinge nur, und die sind draußen in der Welt schon nicht einfach, wie sollen sie es dann bei Gericht sein, wo alles seinen Gang zu gehen hat in den schweren Roben, und dem Tschenett sein Gang ist der in die ewige Verdammnis der tenebrae aeternae, wieso also rufst du Ciro eigentlich an und bittest ihn, mit dir zusammen einen Freund am Hafen abzuholen unter Mitnahme eines zivilen Dienstfahrzeuges und also: Formular Nummero 204StrichB, Formular 3Strich21A und was sonst noch, läßt dir von der Capitaneria di porto sagen, wo dieses Unglücksschiff anlegen soll, steigst kaum aus dem Auto und wirst schon von der wildgewordenen Horde aus dem Verteidigungsministerium überrannt, nicht das erste Mal, daß ein Polizist von einem Carabiniere totgetreten würde, so gut wie folgenlos, siehst einen da liegen flach wie Flunder trotz der Leibesfülle, die sich im Lauf der Jahre um ihn gesammelt hat, bleich im Gesicht, weiß im grauen Schnee, verschnürt und verpackt und verloren, gut, denkst du und siehst den Carabiniere, der auf ihm steht und siehst dessen fraglosen Blick und den stummoffenen Mund, gut, da muß jetzt Trick siebzehn klappen und das im ersten Anlauf, und also raus mit dem Ausweis, der zu nichts anderem berechtigt als zu einem ermäßigten Essen in der Kongresskantine und vorwärts forsch, und noch bevor der Carabiniere zum Nachdenken kommt und der nodo al pettine, der Knoten an den Kamm, zückst du das Zauberwort. Confidente. Und jetzt sag mir: Was sonst? Das sag mir.«
»Du hast ja flüssig reden gelernt, Totò.«
»Dich habe ich nicht gefragt, Tschenett. Ciro?«
»Insomma … Naja.«
Ciro scheint sich nicht sicher zu sein. Er schaut zweifelnd zwischen Totò und mir hin und her.
»Liebe Freunde«, sagt Totò und sinniert ins Weinglas, er, der sonst eher ein großzügiger Trinker ist, einer, der sich der Herausforderung stellt, besser gesagt, »liebe Freunde, jetzt, wo wir hier glücklich vereint sind …«
Ich greife mir an den Kopf. Ciro rührt keine Miene. Totò schiebt lärmend seinen Stuhl zurück, stemmt sich hoch, als hätte er’s am Rücken, hebt weit ausholend sein Glas.
»Amici …«
Und dann lacht es aus ihm heraus, er umarmt mich und sagt: »Gut, daß du da bist.«
»Erzähl mir, was du in Napoli machst, Totò. Von mir weiß ich das. Ich bin mit dir verabredet.«
»Durchaus ehrenwert«, sagt Totò.
»Schon gut.«
»8th International Conference of the European Polices undsoweiter …«
»Wie bitte?«
»8. Internationales Symposion der Europäischen Sicherheitsbehörden zur Grenzüberschreitenden Kriminalität. Entwicklungen und Zukunftsfragen im Lichte jüngster Erkenntnisse.«
»Und da bist du …«
»… als Fachkraft geladen. Sozusagen«, sagt Totò.
»Nicht dein Ernst.«
»Mein Ernst schon. Aber nicht meine Idee. Befehl von ganz oben. Amtliches Schreiben des Polizeikommandos Distretto NordEst, Abteilung Relazioni esterne e ricerche scientifiche.«
»Und da denkst du dir nichts dabei?«
»Manchmal denke ich, man sollte sich wirklich nichts mehr denken, in Zeiten wie diesen.«
»È vero«, sagt Ciro und lächelt in sich hinein. »Ist wahr.«
»Du auch?«
Ciro nickt nur. Ein stiller Mensch mit Humor. Keine schlechte Kombination.
»Wie hat man sich so etwas vorzustellen?«
Jetzt will ich es genauer wissen. Jetzt will ich mehr von Totòs kometenhaften Aufstieg in die dünne Luft polizeiwissenschaftlicher Symposien hören.
»Das ist einfach«, sagt Totò.
»Ganz einfach«, sagt Ciro.
Die beiden spielen Pingpong. Bei Gelegenheit nachfragen, wo und wann sie das geübt haben. Ich notiere es mir.
»Dieses Ding da«, sagt Totò, »nenne es Symposion, Konferenz, Kongress, Kabbalistentreffen, Kaffeekränzchen, egal, wie auch immer, bringt an die fünfzig Leute an einen Tisch.«
»Scheißspiel an so einem Tisch« sagt Ciro vor sich hin.
Die Sache scheint ihm nahe zu gehen.
»Also sitzen wir da«, sagt Totò, »und schauen dem Gegenüber ins Auge. Polizeibeamte, Gesetzeshüter, Soziologen der Polizeischulen, Finanzfachleute, ein vollkommen zottliger, vollkommen bravgewordener Hacker, der eine oder andere Geheimdienstler, schlecht getarnt. Was die sogenannten Europäischen Sicherheitssysteme eben so zu bieten haben.«
»Und was kommt dabei heraus?« sage ich.
»Niente«, sagt Ciro. »Nichts außer der Stimme des Dolmetschers aus den Ohrhörern. Glaub es mir, ich bin schon seit ewig bei dem Verein und ich kenne mich aus. Es ist die pure Alibiveranstaltung, ein gespenstisches Ding. Kein Wunder bei einem Ministerpräsidenten als Dienstherren, gegen den in mindestens drei der kongressbeteiligten Länder ermittelt oder prozessiert wird. Da schickt man vorsichtshalber nur die Totòs und die Ciros. Unsere Polizei wird konsequent in den Ruin getrieben. So ist das. Aber: A chiagnere ‘nu morto so’ lacreme perze. Wer über einen Toten weint, weint verlorene Tränen.«
Ich schaue zu Totò hinüber, der immer noch in seinem caffè rührt.
»Was herauskommt, Tschenett? Herauskommt eine Woche Napoli für den Polizisten, der von der Grenze kam. Elegante Tagungsräume, Blick aufs Meer, in einem Schloß, das in normalen Zeiten als Museum für Ethnoprähistorie dient. So gesehen eigentlich passend.«
Sonderlich glücklich sieht Totò nicht aus.
»Das Museum ist für zwei Wochen geschlossen worden«, sagt Ciro, »fünf Tage auf Wanzen abgesucht. Drei Einheiten der napoletanischen Kollegen sind für die Abschirmung zuständig.«
»Dann kann euch ja nichts passieren«, sage ich.
»Mach du nur deine Scherze, Tschenett«, sagt Totò. »Es ist gespenstisch. Der ganze Aufwand, für nichts. Und wir beide mittendrin.«
»Bisogna capire la logica«, sagt Ciro, »man muß die Logik begreifen, die dahintersteckt.«
»Komm einfach mit und schau’s dir an«, sagt Totò.
»Wer, ich?«
Die Idee, mich in diese seltsame Veranstaltung zu begeben, mitten ins Prähistorische, gefällt mir gar nicht.
»Wie soll ich da rein kommen?«
»Als mein confidente.«
»Nie.«
»Dann als mein persönlicher Berater.«
Ciro steht auf.
»Also los. Ich muß noch kurz ins Büro. Wir treffen uns vor dem Castel dell’Ovo.«
Totò nickt. Und dann sitze ich allein am Tisch.
»Was ist? Che fai?«
»Komm ja schon«, sage ich.
4
Nun è ca dico: ’O mare fa pauraMa dico: ‘O mare sta facenno ’o mare
Hier schlägt das Meer den Tuffstein und die Zeit tot. Hier ist immer gestern und hier ist immer morgen. Und irgendwo in den Kellergewölben dieser Festung, irgendwo in den Verließen dieses Schlosses liegt ein goldenes Ei verborgen. Und hinter jeder Ecke ein Skelett, unter jedem Türbogen ein Knochen, auf jeder Stufe ein Schädel. Es sind viele gestorben, alle sind sie gestorben auf der Suche nach dem goldenen Ei, verlassen, verdorben, gestorben. Davon ahnt ihr, wenn ihr in euren Sonntagsschuhen durch das Schloß geht, davon ahnt ihr, wenn ihr mit eurer Verlobten an der Brüstung steht und auf die Brandung seht, davon ahnt ihr, wenn ihr an seinem Fuße sitzt, davon ahnt ihr, wenn ihr von seinen Zinnen blickt, davon ahnt ihr nichts. Dieses Schloß ist so weit weg von euch wie ihr ihm nahe kommt. Dieses Schloß steht gar nicht hier, dieses Meer schlägt gar nicht hier, dieses Schloß liegt in einem verwunschenen Land, das ihr nicht kennt, dieses Schloß liegt in einem Paradies, das ihr euch nicht wünscht, dieses Schloß gibt es nicht und dieses Schloß war immer schon da. Und ich bin nur ein armer, alter Mann, ich bin nur einer, der das Leben längst hinter sich hat, mehr als das Leben sogar, den Tod habe ich auch schon hinter mir und Liebe und Leiden und Leidenschaft, vor mir liegt nur noch dieses Schloß und der Tuff und das Meer. Ich kann jeden eurer Schritte hören, ich kann jedes eurer Worte hören, ich kann jeden eurer Blicke hören, ihr schreit bei Tag und ihr schreit bei Nacht, ihr schreit, wenn ihr lacht und ihr schreit, wenn ihr singt, ihr schreit, wenn ihr weint und ihr schreit, wenn ihr euch küßt. Ihr habt Angst vor diesem Schloß und ihr habt Angst vor diesen Steinen und ihr habt Angst vor diesem Meer. Ich bin der Wächter des Castel dell’Ovo.
5
»Woher kennst du diesen Ciro?«
»Alte Geschichte«, sagt Totò. »War unser jüngster Lehrer an der Polizeischule, runde Dreißig, damals. Wir nannten ihn ’o prufessore. Er tauchte irgendwann einmal auf, als Aushilfskraft für einen jahrelang krankgeschriebenen ispettore, der an dencarciofi in seinem Garten offensichtlich mehr Freude hatte als an uns. Wir standen im Klassenzimmer stramm, die Tür ging auf, herein kam dieser eigenartige Napoletaner, und vorbei war’s mit der Ruhe. Ab da standen nur mehr die Idioten stramm.«
»Angenehmer Mensch. Unaufgeregt.«
»Und guter Esser. Ihr werdet euch verstehen.«
Als ob es nie geschneit hätte. Die Sonne scheint auf den Golfo di Napoli, liegt an den Hängen, der Asphalt staubt längst schon wieder. Wenn da nicht der Vesuvio wäre und seine Schneehaube, die bis zu den ersten Dörfern reicht, die längst Stadt sind, weiße Zungen, die ins Land lecken, wenn draußen überm Meer nicht die Wolken dunkel hingen wie eine Mauer: Nie würde ich glauben, noch vor ein paar Stunden naß gelegen zu haben. Als ob die Welt eine andere wäre.
»Und sonst, Totò?«
»Ordinaria amministrazione. Alles wie gehabt.«
»Und das heißt?«
»Ich habe den Job am Brenner längst satt, weiß lang schon nicht mehr, wieso ich Polizist geworden bin. Und ich warte nur auf die Gelegenheit zur Kündigung.«
»Gelegenheit? Seit wie vielen Jahren jetzt? Das meinst du nicht ernst.«
»Anlaß. Anstoß. Irgendwas. Wenn ich freilich wüßte, was danach kommt, hätten wir’s schon hinter uns. Ich kann mich nicht so wie du in irgendeinem Hafen verstecken.«
Irgendwo in unserem Rücken rumort beschwörerisch eine Stimme. Ich drehe mich um: Ein alter Mann, der in die Luft redet.
»Totò, du hast eine fundamentale Charakterschwäche. Du hältst das Nichtstun nicht aus.«
»Schlecht. Zu lange im Norden gelebt.«
»Man kann es wieder lernen.«
»Vielleicht, wenn man ins dritte Alter gekommen ist, so wie du.«
»Wegen der acht Jahre …«
»Trotzdem, Tschenett. Du verkriechst dich irgendwohin, läßt nichts von dir hören und sehen, bis auf die eine oder andere Postkarte. Und keiner weiß, womit du lebst, und wovon.«
»Ich habe nichts zu tun und damit genug zu tun.«
Wir sitzen auf einer Mauer, hinter uns das Castel dell’Ovo, vor uns der Golfo di Napoli, lassen jugendlich die Füße baumeln und schauen aufs Meer, als ob da sonst nichts wäre. Der alte Mann ist murmelnd hinter einer Mauer verschwunden.
»Und wenn ich wieder ein paar Drachmen brauche, tue ich das, was ich sonst auch tue: Wandere zwischen den Sprachen, und also übersetze ich manchmal in den Händeln, die sich am Hafen ergeben, als italiano vom Dienst, und so ganz klar ist mir noch immer nicht geworden, was eigentlich von mir dabei erwartet wird, dieses zwischen den Worten Vermitteln oder das zwischen den Menschen, das man uns anscheinend eher zutraut als anderen. (Ob das nicht falsch ist, frage ich mich, ein Großirrtum, der sich aus dem Blick auf Bellaitalia speist?) Oder ich stehe an der Pfanne in einer kleinen Ouzerie. Nachdem ich jahrelang da gegessen habe, klaglos, mehr noch: Manchmal laut begeistert, traut man mir die kleineren Gerichte durchaus zu, und so kann der Koch zur Bouzouki greifen und die Gäste verhungern trotzdem nicht. Es ergibt sich also, wie von alleine. Ein machbares Leben.«
Es hat sich eine Wolke verfangen am Vesuvio, der Wind zerrt an ihr und zieht sie lang zur Fahne. Kleiner Betrug: Noch raucht der Berg nicht wieder.
»Du erinnerst dich an den alten Mann von Brindisi? Der mit den vielen Namen? Krassimir, Bashkim, Khaled, Jorgos, Cosmo, Demetrio, Agesilao, Francis, Michail Petrowitsch, Nilo. Wir haben nie erfahren, wie er wirklich heißt, ich kenne bis heute seinen richtigen Namen nicht. Weiß nicht genau, wovon und wofür er lebte. Ich weiß nicht einmal genau, ob er überhaupt noch lebt, in seinem Hotelzimmer am Hafen von Brindisi. Aber ich weiß, daß ich immer noch in seiner kleinen Wohnung in Saloniki sitze, unterm Dach, direkt am Hafen, zwei Handvoll Quadratmeter und ein stupender Blick, Beobachterhorst zwischen Tauben und Katzen wie zwischen Himmel und Erde, und bei Gott, keine dieser fetten Katzen des Nordens, nicht diese runden, häßlichen Biester, sondern räudig raubtierhaft schmale Kletterwesen, die in ihrer eigenen Stadt zu leben scheinen.«
»Napoli ist voll von solchen Katzen.«
»Deswegen bin ich hier, Totò.«
»Danke, Tschenett. Schönes Kompliment.«
»Da kommt Ciro.«
Und hat es eilig. Rudert etwas mit den Armen an seinem Körper entlang, als ob er gegen Wind ankämpfte, wo keiner ist; den Oberkörper leicht nach vorne gebeugt kommt er auf uns zu, kein Wort, kein Zeichen, während wir beide ihn auf seinem Weg am Wasser entlang beobachten.
»Es gibt Ärger«, sagt Totò. »Ich erinnere mich an einen Tag, an dem Ciro mit genau diesem Gang in die Klasse kam. Er war etwas schmaler, damals, aber die Haltung war dieselbe. Es war der Tag des Massakers von Piazza Fontana, der Tag, an dem eine Bombe in der Banca Nazionale dell’Agricoltura sechzehn Menschen zerfetzte, an die achtzig verletzte. Polizeioffiziell sollten es die Anarchisten gewesen sein. Ciro stellte sich vor uns hin, holte einmal tief Luft, und sagte dann, still, fast unhörbar: ›Ich sage euch: Es waren die Faschisten. Und wir decken sie.‹ Dann setzte er sich und sprach, ohne Punkt und Komma und Unterlagen, eine Stunde lang von Observierungstechniken. Trockener, unspektakulärer Stoff, der einem für die Zukunft nichts Gutes verhieß, nichts außer Müdigkeit, Langeweile, geschwollene Füße und frostrote Ohren. Ganz anders, als wir das aus Filmen kannten. Aber Piazza Fontana war da und Piazza Fontana blieb da.«
»Da war doch was, vor ein paar Monaten …«
»Ja. Ein Schwurgerichtshof hat, endlich, dreißig Jahre später, beschlossen, daß es doch die Faschisten waren. Und daß sie all die Jahre lang von unseren Polizeien, den diversen immer wieder neu gesäuberten Geheimdiensten und den Freunden aus Übersee gedeckt worden sind. Wer ihnen zu nahe kam, wurde in die andere Richtung gejagt. Falsche Fährten, verschwundene Beweisstücke, unversehens Verstorbene.«
»Und Ciro?«
»Wenn du mich fragst, ist das der Tag gewesen, an dem sein Polizistenherz einen Sprung bekommen hat. Und in den letzten dreißig Jahren ist genug passiert, um die Kluft zwischen ihm und seiner Polizei noch weiter zu vergrößern. Piazza Fontana ist seine offene Wunde. Aber er spricht selten darüber. Und hat längst schon arthritische Knie.«
»Ciao, Ciro. Was gibt’s Neues?«
»Addò vaje truove guaje.«
Wohin du auch kommst: Nichts als Ärger. Ciro scheint randvoll zu sein mit diesen napoletanischen Sprichwörtern. Mindestens eines für jede Lebenslage. Und die jetzige scheint ihm nicht besonders zu behagen.
Er steht vor uns, gräbt in den Tiefen seiner Hosentaschen und sieht aufs Meer hinaus, als gäbe es da für ihn etwas zu sehen, wo für unsereinen nur stilles Wasser ist, beschaulicher Wellengang, im besten Falle der Gedanke ans Verreisen. (Und für Altmatrosen wie unsereinen die schaudernde Erinnerung an das eisige Nordmeer; das ist lange her und weit weg, in diesem Augenblick. Dazu wärmt zu sehr die Wintersonne.)
»Addò vaje truove guaje.«
Er wiederholt es, leise, beinahe singend.
Totò wird nervös, was sich bei ihm, wie vor zehn Jahren schon, dadurch äußert, daß er mit offenem Mund nach einem ersten Wort sucht.
»Ist …«
Ciro schüttelt sofort den Kopf.
Totò sieht mich an, ich sehe ihn an und wir denken: was ist? Bleiben stumm und starren jetzt auch aufs Meer. Aber da ist nichts. Nichts, was uns auf den Sprung helfen würde.
Also warten wir.
Und dann nimmt Ciro die Hände aus den Hosen, spitzt an der zu Boden gehaltenen Rechten Zeigefinger und Kleinfinger (Mittel-, Ringfinger und Daumen in der Handinnenfläche aufeinandergekreuzt) und stößt mit diesen Hörnern einmal stechend zu, fa le corna, das Uraltzaubermittel, um Bösen Blick, jettatura, Unglück und Mißgeschick von sich zu wenden; dreht sich, Ciro, halb erleichtert schon, und lehnt dann neben uns an der Mauer. Zupft sich am Ohrläppchen und beginnt zu reden. Vor sich hin.
»Ich bin in mein Büro, du kennst es«, sagt er. »Hatte da kurz was zu tun. Nichts Besonderes.«
Ohrläppchen.
»M’ hanno messo ’o gallo.«
Ohrläppchen.
Sie haben ihm einen Hahn ins Büro gelegt. Geköpft.
»Er war beinahe noch warm. So, wie es da aussieht, haben sie ihn lebendig mitgebracht.«
Langsam ahne ich, was Ciro da draußen im Golf sieht.
»Wer war’s?« sagt Totò.
Ciro hebt nur kurz die Schultern. Zupft, außer am Ohrläppchen, jetzt auch an seiner Nasenspitze. Als säße ihm immer noch jemand auf.
»Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden müssen. Und schnell.«
»Und du erzählst, du bist an keinem Fall dran …«
»Bin ich auch nicht, Totò. Eigentlich nicht. Aber wer weiß. In dieser Stadt hat man immer mit irgendwas zu tun. Ob man will oder nicht. Es ist, wie durch unterirdische Gänge, jedes mit allem verbunden, hier stößt du an einen losen Pflasterstein und dort stürzt ein Palazzo ein. Napule eben.«
Ich sehe mir die beiden an. Auch bei ihnen scheint es so etwas wie geheime Kommunikationsröhren zu geben: zwei ins Dienstalter gekommene italienische Polizisten. Auch wenn Totò um runde fünfzehn Jahre jünger ist.
»Und jetzt …«, sagt Totò.
Das ist der Systematiker in ihm.
»… melde ich zuerst mein Dienstfahrzeug als gestohlen.«
»Wie bitte?«
»Naja. Ich komme aus meinem Büro zurück auf die Straße … und weg ist es. Jetzt versuche ich, uns ein neues aufzutreiben. In meinem Alter will ich nicht noch zum Fußgänger werden müssen.«
Der hat Sorgen. Immerhin ist mein Seesack weg.
Nimmt sein telefonino, wählt eine Nummer und marschiert vor uns auf und ab, während er spricht.
»Wie geht’s dir?« sagt Totò.
Er kennt mein Problem, was Federvieh betrifft.
»Gut«, sage ich. »Bis auf den Seesack. Man hat ja sonst nichts, im Leben.«
»Du hast ja mich«, sagt Totò.
Und ich nicke, schicksalsergeben.
»Va bene«, sagt Ciro und scheint schon wieder tatendurstig, »also gut: Wir gehen jetzt zuerst einmal zu diesem Kongress. Ganz so als ob nichts wäre. Drei nutzlose Männer an einem nutzlosen Tisch.«
Und im Gehen, auf das Castel dell’Ovo zu, sagt er noch: »Richtig bedacht: Vielleicht war’s ja auch der Polizeichef, der möchte, daß ich mit meinen achtundfünfzig Jahren endlich in Pension gehe. Fuori dai coglioni, rompicoglioni, und aus den Augen, aus dem Sinn.«
6
Langsam den steinigen Weg das Schloß hoch, sekundenlang kurzatmig geworden, und man weiß nicht: war es der kurze Weg oder der lange Blick.
Und vorbei an den Carabinieri in Uniform, kommentarlos, was mich jedesmal neu eine halbe Vergewaltigung meiner selbst kostet, zu abwegig ist diese arma, wie Liebhaber sie nennen, in Kleid und Kopf. Und an den Carabinieri in Zivil vorbei, denen man ihre Uniform auch noch in Badehose ansehen würde.
Die Vorstellung, daß es in diesem Castel dell’Ovo ein Museum für Ethnoprähistorie und in diesem Museum zurzeitig ein Internationales Symposion zu Grenzüberschreitendem Irgendwas geben solle, läßt mich kurz ins Stolpern kommen.
»Avanti, amico«, sagt Totò und blinzelt mir aufmunternd zu in seiner genießerischen Verschlagenheit, »vorwärts, Freund, verlaß mich nicht.«
Und vorbei an Polizisten in Uniform, kommentarlos. Und an den Polizisten in Zivil vorbei, Totò nickt grüßend, und also nicke ich auch.
Dann der Empfangstisch, drei Jungpolizistinnen und ein Jungmannexemplar, errötend aufgereiht und frischgefönt hinter Stapeln von Unterlagen und seitenlangen Listen, in denen sie eifrig wühlen, rückenbeschirmt von Breitschultern mit Knopf im Ohr, Hände vorm Geschlecht verschränkt; wo bleiben die Sonnenbrillen, denke ich, wo? und bin schon fast entsetzt, als ich endlich die Vier am Saaleingang sehe: Die ja, bebrillt, und schon ist unsereins wieder friedlich und verkneift sich die Nachfrage und Totò zwickt mich am Unterarm und zieht mich hinter sich her, bis direkt vor die Tischkante.
»Buon giorno. Den Ausweis und die Tagungsunterlagen für den Kollegen bitte. Er ist endlich angekommen.«
Und sieht mich strafend an.
»Immer, wenn diese Mailänder zu spät kommen, behaupten sie, der Nebel sei schuld. Immer wieder die alte Leier: Kein Zug, kein Flug, kein Automobil. Als ob dieser Mailänder Nebel aus Atombunkerbeton sei. Dabei ist es nur ihre Nordistenarroganz.«