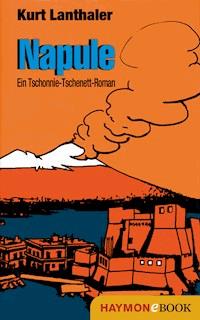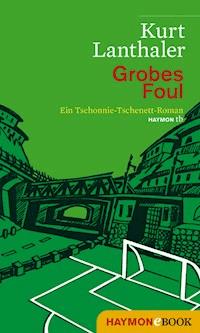
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tschonnie-Tschenett-Roman
- Sprache: Deutsch
SIE WISSEN ALLES. DER STARFUSSBALLER WIRD ERPRESST. MIT EINER GESCHICHTE, DIE KEINESFALLS AN DIE ÖFFENTLICHKEIT GELANGEN DARF … Der Stürmerstar Paolo Canaccia hat die teuersten Beine seiner Mannschaft und eine Frau, um die ihn ganz Italien beneidet. Währenddessen ist der Aushilfs-LKW-Fahrer Tschonnie Tschenett hauptsächlich damit beschäftigt, unter der Sommerhitze zu leiden. Als er nachts an einem auf der Notspur der Autobahn geparkten Ferrari vorbeikommt, hält er an. Stunden später hat er in Canaccia einen Freund gewonnen. Der ein Problem hat: Der Starfußballer wird erpresst. Mit einer Geschichte, die keinesfalls an die Öffentlichkeit gelangen darf … WEITERE KRIMIS AUS DER TSCHONNIE-TSCHENETT-REIHE: - Der Tote im Fels - Grobes Foul - Herzsprung - Azzurro - Napule LESERSTIMMEN: "Der Antiheld Tschonnie Tschenett tritt mal wieder von einem Fettnäpfchen ins nächste. Dabei will er doch nur einem Fußballstar helfen. Verplant, chaotisch und schräg, ein Krimistar der besonderen Sorte." "Der Krimi gewährt Einblicke hinter die Fassade Südtirols abseits der aufgehübschten Touristenstories. Ein Buch mit starkem Realitätsbezug, Italienische Redewendungen runden das Ganze ab. Ein Buch zum Abtauchen, einlassen, schmunzeln!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HAYMON
Personen und Handlung dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen, tatsächlichen Zuständen und Vorkommnissen waren nicht zu vermeiden.
© 1993HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7682-1
Umschlag und Buchgestaltung: Kurt Höretzeder, Büro für Grafische Gestaltung,Scheffau/Tirol Mitarbeit: Ines GrausUmschlagillustration: Peter KaserAutorenfoto: Haymon Verlag
Kurt Lanthaler
GrobesFoul
Ein Tschonnie-Tschenett-Roman
Mit einem aktualisierten Glossar
Kurt Lanthaler
Grobes Foul
Für Kurt F.
1
Dreißig Kilometer hatte ich noch vor mir. Richtung Norden. Um da anzukommen, wo ich gar nicht hin wollte.
Im 300-Liter-Tank meiner Zugmaschine konnte sich maximal noch ein halbes Schnapsglas Diesel herumtreiben. Zu wenig, um anzukommen, und zu wenig, um umzukehren.
Wenn ich weiterfuhr, verreckte mir der Karren. Mitten auf der Autobahn. Mitten in einem verreckt engen Tal. Mitten in der Nacht.
Ich nahm einen Schluck.
Oder ich stellte die Mühle einfach auf dem Pannenstreifen ab. Mitten in einem verreckt engen Tal. Mitten in der Nacht.
Ich fuhr weiter.
Und dann war es soweit.
Ich stieg voll in die Bremse. Mitten in der Spur stand einer und fuchtelte mit den Armen. Es dauerte, bis die Zugmaschine zum Stehen kam. Die Schnapsflasche hatte sich selbständig gemacht. Ihr Inhalt war mir über die Hose gelaufen. Ich war auf und auf naß. Und der Verrückte war verschwunden.
„Sauber“, sagte ich.
Sehr viel schlimmer konnte es eigentlich nicht mehr kommen. Nichts im Sack, was wie Geld aussah. Nichts in der Flasche. Ein dicker Kopf. Und ein leerer Tank. Ein Uhr morgens. Pannenstreifen Autobahn.
Ich sprang von der Zugmaschine. Und schlug mit dem Knie auf. Schmerzen. Genau das, was ich brauchte. Ich ließ mich zurückfallen. So liegen bleiben. Bis ans Ende der Zeiten. Bis immer. Bis dann.
Ich wollte nicht mehr. Wollte nicht mehr auf den Bock. Nicht mehr über die Autobahnen fahren. Nicht mehr die Hänger quer durch die Lande ziehen. Nicht mehr brauchbar sein. Nicht mehr nichts mehr.
Gebt mir eine Kugel, und ich geb sie mir.
Das hier war der richtige Ort dazu. Der Arsch der Welt. Ein Stück Autobahn, verkommen und verdreckt, das über eine baufällige Militäranlage führte. Genauso verkommen und verdreckt. Ich war angekommen. Endlich.
„Ciao. Salve. Tachjen.“
Ich sah erst gar nicht auf. Das mußte der Verrückte sein. Das kranke Hirn, das sich vor meine Zugmaschine geschmissen hatte.
„Tachjen is juut“, sagte ich.
So einer hatte mir gerade noch gefehlt.
„Willste?“ sagte er.
Ich sah nach links. Der Typ war eben dabei, sich neben mich hinzusetzen. Mit einem Joint in der Hand.
„Paolo“, sagte er und grinste. Von links ganz hinten bis rechts ganz hinten. „Paolo heeß ick.“
„Ach nee“, sagte ich.
„Willste?“
Ich nahm den Joint, zündete ihn an und sah mir den Menschen genauer an. Da saß er, grinste mich an, blondhaarig bis auf die Schultern, braungebräunt, höchstens Mitte Zwanzig und damit zehn Jahre jünger als ich, dunkles Jackett, feines Tuch, die Füße nackt in Lederschuhen. Keine Ahnung, was so einen um diese Uhrzeit an diesen Ort verschlagen hatte.
„Und wie kommste auf Paolo?“ sagte ich.
„Is so“, sagte er.
„Auch gut.“
Ich tat ein paar Züge, schloß die Lungenklappen und gab ihm den Joint zurück. Während mir der Rauch durch die Bronchien wanderte, stand ich auf, ging an die Leitplanke und knöpfte meine Hose auf. Dann ließ ich Luft und Wasser ab. Oben rauchte es, unten auch. So kühl war die Nacht geworden, mitten in diesem August des Jahres 1989.
Direkt neben mir stand ein Ferrari mit eingeschalteter Warnblinkanlage.
„Sieht juut aus, wa?“ sagte der Typ.
Stand hinter mir. Und inhalierte.
„Die Farbe ist nicht so besonders“, sagte ich.
„Ich rede nicht von der Karre“, sagte der Typ und zeigte in meine Richtung.
Ich knöpfte mir die Hose zu. Stieg über die Leitplanke, suchte mir ein nettes Plätzchen und setzte mich.
„Gibt’s was zu trinken auch?“ sagte ich.
„Hier“, sagte er, nachdem er sich neben mich gesetzt hatte, und hielt mir eine Whiskyflasche vors Gesicht.
Whisky. Warum nicht. War zwar nicht unbedingt das Gesöff, das ringsum in den Bergen von fleißigen Landarbeitern gekellert wurde. Nichts Bodenständiges. Ich riß den Verschluß auf, nahm einen ordentlichen Schluck und griff mir den Joint.
„Hätte gut sein können, daß ich dich totfahre“, sagte ich.
Er zog sich seine Nobeljacke aus, faltete sie und schmiß sie hinter sich. Dann ließ er sich zurückfallen und starrte in den Himmel.
„Ick weeß“, sagte er.
„Paß auf“, sagte ich. „Wenn du mit diesem komischen Berlinern aufhörst und endlich wie ein Mensch redest, könnte das eventuell noch ein gemütlicher Abend werden.“
„E perché no“, sagte er, „wieso nicht.“
Wenn er gedacht hatte, mich mit seinem plötzlichen italienischen Umschwung zu verwirren, hatte er sich getäuscht. Mir war es scheißegal, was er von sich gab. Solange er genug Whisky und Shit im Kofferraum seines Ferraris gelagert hatte. Und mich ansonsten in Ruhe ließ. Plötzlich war das Leben ziemlich erträglich geworden. Ich saß da, kratzte mich am Sack, hielt mich an die Whiskyflasche und ließ mich durch die Kollegen, die in meinem Rücken die Kilometer runterrissen, nicht drausbringen. Für mich war Feierabend. Hier und jetzt. Und wenn es sich machen ließ, für immer.
„La pace dei sensi“, sagte ich, weil mir das eingefallen war, während ich an dem Joint nuckelte.
La pace dei sensi. Der Frieden der Sinne und Gelüste. Den Begriff hatten die Italiener für ihre alten Männer erfunden. Jenseits von Gut und Böse. Über den Dingen stehend.
Während ich den Rauch auf eine zweite Runde durch die Lunge schickte, geisterte mir noch ein anderer Satz durchs Hirn. Zuerst ein Wort, dann ein anderes, bis sich die beiden gefunden hatten und zu einem Satz geworden waren. Den Anfechtungen der Welt entrückt. Was auch immer der Erfinder damit gemeint haben konnte: es klang ganz so, als wäre er eines Nachts mit wackligen Knien und nassen Hosenbeinen über die Leitplanken der Autobahn gestiegen, hätte sich ins feuchte Gras gelegt und alle viere von sich gestreckt.
Es mußten Stunden vergangen sein, in denen ich auf das orange Licht gestarrt hatte, das sich vor und unter mir breitmachte, als ich plötzlich eine Stimme hörte.
„Ich kauf das Ding da. Ich kaufe es.“
Ich drehte mich so lange um mich selbst, bis ich festgestellt hatte, woher das Gerede kam. Es war der Typ, der rechts von mir saß. Dann erinnerte ich mich: das war der, auf dessen Kosten ich zur Zeit lebte. Er hatte sich in der Zwischenzeit wieder aufrecht hingesetzt und bastelte an einem neuen Joint. Noch größer, noch bunter.
„Muß ja ganz etwas Geheimes sein, daß die das so anleuchten“, sagte er.
„Ist Militär“, sagte ich, „und Militär ist immer geheim. Die haben sonst nichts zu tun.“
„Bello però“, sagte er. „Hat was.“
Ich mußte ihm recht geben. Die Burschen besaßen Geschmack. Da hatten sie diese Festung ins Tal geklemmt. Stein auf Stein, Mauern über Mauern, Schießscharten und Türmchen. Türkisches Mittelalter. Und jetzt waren sie so nett und hatten die Weihnachtsbeleuchtung angemacht. Ein erbauliches Spektakel.
„Es gibt noch Idealisten in dieser Welt“, sagte ich.
„Du meinst die da?“
Da war er wieder.
„Wenn ich jetzt noch wüßte, wie du heißt“, sagte ich und sah meinen Nachbarn an.
Irgendwo habe ich den schon gesehen, dachte ich mir.
„Paolo“, sagte er. „Schon wieder vergessen?“
Ich ließ mir mit meiner Antwort Zeit.
„Schon mal gehört?“ sagte ich dann.
„Was?“
„Ist egal.“
Ich war längst wieder ganz woanders. Nach einer Weile zwickte mich etwas am Arm.
„Komm mal zurück, Kollege“, sagte Paolo. „Nur ganz kurz.“
„Wozu?“
„Weil hier gleich die grünen Männchen auftauchen werden, rote Ohren kriegen und uns ins Raumschiff verladen.“
Ich setzte mich auf.
„Sag mal, hältst du mich für beklopft, oder was? Nur weil ich dir deinen Whisky wegtrinke und meine Ruhe haben will?“
„Ma dai“, sagte er und haute mir auf die Schulter, „ganz ruhig, Kollege, dai.“
Und hielt mir den neuen Joint vors Gesicht. Wie war das noch gewesen? Wie war ich hier gelandet? Ich kramte in meinem Hirn herum, bis so etwas wie eine Erinnerung auftauchte. Richtig. Der Ferrari. Und der Selbstmordkandidat auf der Autobahn. Meine Zugmaschine. Und der leere Tank. Scheiße. Schon hatte sie mich wieder, die Welt. Und ich hatte sie.
„Mein Lieber“, sagte ich und versuchte angestrengt, auf die Beine zu kommen, „das war’s dann.“
Wenn ich mich auf die Seite drehte, ging es vielleicht leichter.
„Was machst du?“ sagte Paolo.
„Aufstehen“, sagte ich. „Früher einmal habe ich gewußt, wie das geht.“ Ich holte Luft. „Ich erinnere mich schon noch.“
„Ti sei incazzato?“
„Inca … was?“
„Erzürnt. Beleidigt. Verärgert.“
Ich wußte nicht, wovon der Mensch sprach.
„Dai“, sagte Paolo, „Bleib sitzen.“
„Wer bist du?“
„Paolo“, sagte er und grinste.
„Aha.“
Der Mann, der aus der Dunkelheit aufgetaucht war.
„O.k.“, sagte ich. „Du bist Paolo. Ich bin Tschenett.“
„Und was ist das?“
Er zeigte auf die orange leuchtende Festung.
„Wenn ich’s noch richtig im Kopf habe“, sagte ich, „dann haben sich früher hier die Österreicher gegen die Italiener verteidigt. Und heute verteidigt sich der Italiener gegen den Russen. Heißt Franzensfeste. Auf italienisch ganz einfach Fortezza, die Festung.“
„Der Italiener verteidigt sich gegen den Russen? Mit so etwas?“
„Ja“, sagte ich. „Was dagegen? Der Russe überrollt Österreich und will dann nach Italien.“
„Cesenatico, Rimini, Caorle.“
„Genau“, sagte ich. „Der Russ’ in Rimini. Stell dir das vor. Vergewaltigt deutsches Frau, läßt sich von kleines schwarzes Italiener die Stiefel putzen und brunzt ins Meer.“
„Und deswegen haben die hier die Lichter angeworfen?“
Ich sah mir die Festung an. Richtig nett sah sie aus, wie sie sich im Tal breitgemacht hatte, von einem Berghang zum anderen. Sie hatten reihenweis Stacheldraht gesetzt auf das Ding und alle paar hundert Meter einen dieser altertümlichen Riesenscheinwerfer. Sicherheitszone. Bis an die Zähne bewaffnet. Achtung, Schußwaffengebrauch. Pericolo di morte. Todesgefahr. Und dann reichte es, einen Schritt über die Leitplanke der Autobahn zu tun und man stand ihnen sozusagen auf dem Dach. Das mit Gras bewachsen war.
Ein schönes Plätzchen hatten wir uns ausgesucht. Mein Nachbar wurde mir langsam sympathisch.
„Ja“, sagte ich. „Damit der Russ’ sieht, daß er keine Chance hat.“
„Wenn der angreift, sind wir mittendrin“, sagte Paolo. „Dann kommen von da oben ein paar Raketen und jagen das ganze Zeug hier in die Luft. E basta. Chiuso lì. Feierabend. Aus.“
Er langte mir den Joint herüber.
„Dem Russen sind wir scheißegal“, sagte ich. „Und er mir auch.“
„Druschba“, sagte Paolo.
„Hunger“, sagte Paolo.
„Wie bitte?“
„Hunger. Hammhamm. Panini caldi. Pizzette. Apfelstrudel. Tramezzini.“
„Du hast Hunger?“ sagte ich.
„Richtig.“
„Dann müssen wir uns etwas zu essen suchen.“
„Sissignore. Zu Béffel.“
Wir halfen uns gegenseitig auf die Füße. Die Leitplanke war zwar ein Hindernis, aber irgendwann hatten wir auch das geschafft.
„Welchen nehmen wir?“ sagte ich.
Wir standen vor unseren zwei Fahrzeugen, die auf dem Pannenstreifen immer noch brav vor sich hin blinkten. Paolo gab seinem Ferrari einen Tritt.
„Den kannst du vergessen“, sagte er. „Der tut es nicht mehr. Feierabend.“
„Dumm, dumm“, sagte ich. „Oder hast du einen Kanister Diesel im Kofferraum?“
Paolo sah mich schräg an.
„Dann eben nicht“, sagte ich. „Fahren wir halt trotzdem mit meinem. Aber weiter als ein paar Kilometer werden wir nicht kommen, bevor er uns verreckt. Ich bin total auf dem trockenen.“
„E beh“, sagte Paolo und zuckte mit den Achseln.
„Richtig“, sagte ich. „Ein Dosenfisch stürzt sich locker ins offene Meer. Steig auf.“
2
„Hertha BSC“, sagte Paolo, als er von der Zugmaschine stieg. „Drei Jahre Hertha.“
Das Wunder war eingetreten. Irgendein Schutzengel hatte mir in den Tank gespuckt und uns auf die Autobahnraststätte geleitet. Paolo hatte mir erzählt, daß er als Sohn eines italienischen pizzaiolos in Berlin-Neukölln groß geworden war. Halb als Berliner, halb als Pugliese. Und deswegen in beiden Sprachen gleich zuhause war. Und Anfang der 80er Jahre bei Hertha BSC Profifußball gespielt hatte.
„Bei dem Schlappverein?“ sagte ich, als wir uns durch das Drehkreuz in das Innere des Lokals zwängten.
„So schlecht war der Verein gar nicht“, sagte Paolo, während wir uns einen Espresso bestellten und er sich nach etwas Eßbarem umsah. „Okay, der Vorstand war ziemlich korrupt. Aber das gehört dazu.“
„Wenn du das sagst.“
Schien ein unkomplizierter Bursche zu sein, dieser Pizzabäcker Paolo. Genau richtig für so einen wie mich, der alles versuchte, um eine Nacht wie diese möglichst schmerzlos über die Runden zu bringen.
Wir hatten es uns vor ein paar warmgemachten Broten und Bieren bequem gemacht.
„Und bei Hertha verdient man so viel, daß man sich einen Ferrari leisten kann?“ sagte ich. „Und einen Mechaniker, falls das Teil auf der Autobahn liegenbleibt?“
Paolo grinste mich an.
„Da mach dir nur keine Sorgen“, sagte er. „Man braucht einfach nur einen kleinen Nebenjob. Dann geht das. Und für die Hertha spiele ich schon lang nicht mehr.“
„Nebenjob“, sagte ich, „pfui. Mir ist eigentlich schon einer viel zuviel. Und, was ist das für ein Nebenjob?“
Paolo nahm das vierte Brot in Angriff. Er schien einen gesegneten Appetit zu haben.
„Lassen wir das“, sagte Paolo, „ich habe keine Lust, darüber zu reden. Außerdem bin ich in Urlaub. Zwei Whisky.“
Der Kellner reagierte prompt. Allzuviel zu tun hatte er im Augenblick nicht. Neben uns am Tresen standen eine Handvoll Männer. Einige kannte ich vom Sehen. Waren Abspüler, Kellner und ähnliches Fußpersonal der hier in den Bergen so florierenden Fremdenverkehrsindustrie. Sie traten nach Feierabend den Fußweg über die Felder an, schlichen sich von hinten her an die Raststätte und überstiegen, streng verboten, den Zaun zum Autobahnareal, um sich, endlich, ihren Lohn hinter die Binde zu kippen. Was um diese Uhrzeit, nach vier Uhr morgens, nur mehr hier möglich war. Falls einen die Polizei, die in regelmäßigen Abständen die Raststätten anfuhr, um sich ebenfalls einen hinter die Binde zu kippen, nicht nach der Autobahnmautkarte fragte. Ohne die man kein Recht darauf hatte, sich hier zu verpflegen. Wer ohne erwischt wurde, durfte hunderttausend Lire auf den Tisch legen. Gegen ordentliches Strafmandat. Oder dreißigtausend ohne. Aber was tut man nicht alles für ein Bierchen oder zwei Schnäpse nach Feierabend. Sogar einen dieser Ordnungshengste nett anlächeln.
Wie ich jetzt.
„Buona sera, signori“, sagte einer der zwei Männer, die eben ins Lokal gekommen waren.
Polizei in Zivil, hundertfünfzigprozentig. Hatte also mein Lächeln nichts genützt.
„Paolo“, sagte ich, „was hast du angestellt?“
„Ich?“ sagte Paolo, grinste und hob die Arme, „ich bin unschuldig wie ein Kleinkind, das sich in die Hose gemacht hat.“
Der Polizist lächelte zurück. Mir war nicht ganz klar, was das zu bedeuten hatte.
„Sie“, sagte er und drehte sich zu Paolo, „Sie haben schon genug am Hals. Stia buono. Ganz brav bleiben.“
„Am Hals? Was hast du am Hals?“ sagte ich.
Paolo machte ein Zeichen. Es sah ganz nach einem Strick mit Henkersknoten aus. Ich griff mir mein Whiskyglas und prostete ihm zu.
Der Polizist beobachtete uns in aller Ruhe. Sein Kollege graste inzwischen die restlichen Trinker ab.
„Evvabbene“, sagte der Polizist, zog einen Ausweis, hielt ihn uns für den Bruchteil einer Sekunde unter die Nase, als würde er sich selber dafür schämen und ließ das Ding dann ebenso schnell wieder verschwinden. „Favoriscano i documenti, per favore. Ausweise, bitte.“
„Cazzo“, sagte ich.
Unserem Besuch war’s egal.
„Documenti …“, sagte ich und suchte in meinen Taschen herum, „documenti. Der hat Nerven. Wo soll ich die denn hernehmen?“
Paolo war schneller.
„Ecco quà“, sagte er und hielt der Obrigkeit sein Portemonnaie hin.
„Die Ausweispapiere“, sagte die nur.
Und sah auf das Ding, als hätte es die Pest. So lange, bis Paolo seinen Ausweis herausgefischt hatte.
„Bene“, sagte der Polizist, nahm den Ausweis in die eine Hand und hielt die andere erwartungsvoll vor mich hin.
Ich war noch am Suchen.
„Find ich nicht“, sagte ich.
„Schlecht“, sagte der Polizist.
„Der LKW“, sagte Paolo.
„Danke“, sagte der Polizist, als er meine Papiere in der Hand hatte. „Die können Sie morgen bei uns abholen. Heute wird nicht mehr gefahren.“
„Das ist nicht wahr“, sagte ich.
„E come. Und wie das wahr ist. Oder wollen wir Promille messen?“
„Scheiße.“
„Dann rufen Sie uns ein Taxi“, sagte Paolo. „Oder ihr nehmt uns mit. Wir können ja schlecht zu Fuß nach Hause laufen.“
„Perché no?“ sagte der Polizist, „warum denn nicht?“
„Bis zu meinem Hotel ist es mindestens eine Stunde, zu Fuß“, sagte Paolo, „ich muß bis in die Stadt rein.“
Da hatte ich ja noch Glück. Für mich war’s nur halb so weit.
„Schönen Abend noch, die Herren“, sagte der Polizist und ging.
Hinter den Bergspitzen wurde es langsam hell. Die feuchte Luft, die über dem Talkessel lag, leuchtete orange von den Scheinwerfern, die entlang der Auf- und Abfahrten, Parkplätze und Laderampen standen. Über die Autobahn zogen Kolonnen von LKWs Richtung Norden. Auf dem Zollabfertigungsareal schüttelten sich die Fahrer den Schlaf aus den Knochen und füllten ihre Espressomaschinen mit Kaffeepulver. Es würde ein langer Tag werden.
„Das war’s dann“, sagte ich zu Paolo, als sich der Feldweg gabelte. „Ich muß hier nach rechts. Du brauchst nur immer geradeaus weiterzugehen.“
„Bene“, sagte er. „Ci vediamo.“
Tapfer setzte ich einen Fuß vor den anderen. Dabei brachte mich jeder Schritt nur einen Schritt der sogenannten Wirklichkeit näher. Es war jetzt sechs Uhr morgens. Ich hatte noch genau fünf Stunden, um ein wenig zu schlafen und meinen dicken Kopf loszuwerden. Dann mußte ich mir Geld besorgen und meine Papiere und die Zugmaschine zurückholen. Schließlich hatte ich eine Fuhr nach Rotterdam übernommen. Und die sollte spätestens um vier Uhr vom Hof rollen. Es hatte alles nichts genützt. Sie hatte mich wieder, die Welt.
Haus Waldfrieden stand da wie der Prinz im Märchen: verzaubert und verschlafen. Blümchen auf dem Balkon. Eine millimetergenau zurechtgestutzte Hecke, an der meine Nachbarn ihre ganze Liebe ausgelassen hatten. Ein akkurat gefegter Parkplatz. Und das alles mitten in einem kleinen Dorf südlich von Sterzing, das den lieblichen Namen Maria Trens trug. Womit hatte ich das verdient? Gottseidank wohnte ich direkt unterm Dach. Falls ich einmal aus dem Fenster springen würde.
3
„Hast du was dagegen, Berta, wenn ich mich hinters Haus lege und in Ruhe sterbe?“
Berta sah mich an, drehte sich um und verschwand in die Küche. Als sie zurückkam, hatte sie eine überdimensionale Schale in der Hand. Normalerweise braute sie sich darin ihren Milchkaffee. Berta legte ihre schwere Hand auf meine Schulter, schob mich vom Pudel weg zu dem kleinen Tisch, drückte mich in den Stuhl und setzte mir die Schale vor die Nase.
„Das wird jetzt getrunken“, sagte sie, „vorher red ich nicht mit dir. Punktum.“
Das Ding war randvoll mit dampfender Fleischsuppe. Und mittendrin schwammen zwei Eier, halbroh.
„Berta …“
„Nix da. Austrinken“, sagte Berta und setzte sich.
Mir genau gegenüber. Und ließ mich nicht aus den Augen. Ich versuchte zaghaft, die Tasse anzuheben, ohne alles zu verschütten. Nach den ersten Millimetern war schon klar, daß ich keine Chance hatte.
„Los. Auf geht’s“, sagte Berta.
Ich sah sie kurz an. Sie schaute gnadenlos zurück. Dann gab ich auf. Beugte mich über die Fleischsuppe und schlürfte.
„Vielleicht wirst so wieder ein Mensch“, sagte Berta.
Was sollte ich tun? Ich war Berta auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Nirgendwo sonst hatte ich noch auch nur einen Rest von Kredit. Und Berta ließ Widerspruch prinzipiell nicht gelten. Vor allem, wenn sie sich in den Kopf gesetzt hatte, so einen wie mich auf den Rechten Weg zurückzubringen. Und wenn es mit Hilfe eines dreiviertel Liters kochendheißer Suppe war.
„Mein Bruder hat einmal zwei Tage lang nicht mehr gewußt, wie er heißt“, sagte Berta. „So viel gesoffen hat er gehabt. Heumachen hab ich ihn geschickt, mitten in die größte Hitze. Und zu trinken hat er nur Fleischsupp bekommen. Und rohe Eier. Aber geholfen hat’s.“
Bertas Bruder war seit fünfzehn Jahren tot. So gut war ich noch nicht dran.
Dann war da noch Bertas Verlobter: vor vierzig Jahren gestorben. Als dann auch der Bruder tot war, hatte sie sich allein geholfen. Und eine Bar aufgemacht. Hier hinten in Pflersch, diesem kleinen Seitental abseits der Welt, führte sie ein kleines Lokal, das für die Bauern der Umgebung so etwas wie ein Sanatorium war. Hier konnte man sich für ein paar Lire die Mühen einer ganzen Woche langsam und in Ruhe von der Seele trinken und reden. Für gescheiterte Figuren wie mich hatte die Berta auch immer einen Platz frei. Und ein paar Lire übrig. Deswegen war ich hier.
„Ich glaube nicht, daß mir noch etwas helfen kann“, sagte ich.
„Hör auf, dir ewig leid zu tun.“
„Und dann?“
„Gar nichts. Trink aus und geh arbeiten.“
Genau so hatte ich sie vor Jahren kennengelernt. Ein Weibermensch mit Haaren auf den Zähnen, sagten die Einheimischen. Und verwiesen auf Bertas ebenso unvollendete wie frühe Witwenschaft und die nachfolgenden ledigen Jahrzehnte. Zuerst wollte sie nicht und dann hat sich keiner mehr getraut, sagten sie. Berta sah das anders.
„Junger hab ich noch geglaubt, es nützt etwas, sich mit einem Mandermensch zusammenzutun“, hatte sie mir erklärt, als wir wieder einmal über einem halben Roten ins Philosophieren gekommen waren. „Jetzt weiß ich’s besser. Es wird nichts leichter dadurch. Also hab ich’s bleibenlassen“, hatte sie gesagt. Und mir dringend ähnliches empfohlen. „Dann wirst ruhiger. Zum Heiraten bringst du’s eh nie. Und alles andere macht dich nur konfuser. Schau dich an.“
Viel zum Schauen gab’s da nicht. Ich war inzwischen, ohne es zu merken, sechsunddreißig Jahre alt geworden, machte, wenn’s gar nicht anders ging, zwischendurch ein paar Fuhren als Aushilfs-LKW-Fahrer und versuchte ansonsten, mir vom Leben möglichst wenig anhaben zu lassen. Was nicht immer leicht war. Denn was sich da um mich herum abspielte an Geschäftigkeit, Tüchtigkeit, Fleiß und Pünktlichkeit und wie diese Kardinaltugenden einer verrottenden Welt alle hießen, konnte einem die Pickel bis ins letzte Glied schießen lassen.
Und für heute hatte ich noch diese LKW-Fuhre am Hals. Mit dem letzten Schluck war mir das halbrohe Eiweiß durch die Kehle geschlurft. Es schüttelte mich.
„Komm, komm“, sagte Berta, „das ist mehr als gesund. Es hilft dir wieder auf die Beine.“
Und genau dahin wollte ich nicht. Eigentlich.
„Berta, ich habe in ein paar Stunden eine Fuhre. Rotterdam. Aber die Zugmaschine steht noch auf der Raststätte. Tank leer. Ich brauch ein paar Lire.“
Berta sah mich an, stand langsam auf, verschwand kurz in der Küche und legte dann zwei Hunderttausender vor mich hin.
„Kriegst es vom nächsten Gehalt.“
Wobei Gehalt für das, was ich von meinen Arbeitgebern zu erwarten hatte, ein maßlos übertriebenes Wort war.
„Was?“ sagte Berta. „Das hier, oder die anderen Schulden?“
Ich hob langsam den Kopf und sah Berta an. In diesem Augenblick kam ein Gast in die Bar.
„Vergiß es“, sagte Berta, „es hat keine Eile. Zum Leben hab ich genug. Und zu was anderem brauch ich’s nicht.“
Ich steckte das Geld ein. Berta stand inzwischen hinter dem Pudel und schenkte ihrem Gast einen Treber ein. Ich stand auf, möglichst langsam, um die Fleischsuppe nicht durcheinanderzubringen, und stellte mich dazu.
Der Mensch, der gerade versuchte, sich den Schnaps einzuverleiben, war mindestens so schlimm dran wie ich. Er zitterte so stark, daß er das Glas mit beiden Händen halten mußte. Und trotzdem kam er nicht recht weit damit. Nach ein paar Zentimetern verschüttete er die ersten Tropfen. Sofort stellte er das Glas wieder hin. War ja auch schade um das gute Zeug. Berta schaute zwischen ihm und mir hin und her. Und schien zu überlegen, wem von uns beiden sie als nächstes die Ohren langziehen sollte. Inzwischen hatte der Kollege die Lösung gefunden, sich über das Glas gebeugt und schlürfte den Schnaps direkt in sich hinein.
„Gib mir einen Weißgespritzten“, sagte ich zu Berta.
„Den zahlst aber“, sagte sie, „wenn schon unbedingt trinken mußt. Die Supp ist gratis.“
„Ins Rutschen gekommen“, sagte der Mensch neben mir, mehr zu sich als zu sonst jemandem. „Der Bagger ist ins Rutschen gekommen. Auf einmal. Grad daß ich noch Zeit gehabt hab. Grad noch.“
„Was ist los, Franz?“ sagte Berta.
Kannte sie also auch den.
„Feierabend hab ich für heut. Der Bagger ist mir abgestürzt. Tot könnt ich sein. Hin wie der Bagger. Feierabend. Und noch ein’ Treber.“
Den letzten Schluck hatte er schon mit beinahe ruhiger Hand in sich hineingeworfen.
„Wenn’s sein muß“, sagte Berta. „Was war denn?“
Darauf hatte er nur gewartet.
„Am Morerberg oben bauen wir einen Forstweg. Soll bis ganz oben aufs Eck raus gehen. Weißt eh. Seit einer knappen Woche sind wir in dem Hang drin. Dreihundert Meter hab ich schon hinübergebaut, steh vorn mit dem Bagger, leg noch einen von den Felsbrocken hin, dreh mich, hol mir mit der Schaufel noch einen, da kommt der sauteuflige Bagger ins Rutschen.“
Den zweiten Schnaps trank er in einem Schluck aus. Er war merklich ruhiger geworden. Und ich begann langsam, den Mann zu verstehen.
Die neue Forststraße, die sie oben am Morerberg quer durch das steile Gelände zogen, damit sie sich jeden Baum, der dort gefällt werden sollte, direkt auf den LKW fallen lassen konnten, war ein ziemlich gewagtes Unterfangen. Ein paar Bürokraten in der Hauptstadt hatten einen Strich quer über eine Karte gezogen, unter Zuhilfenahme eines Lineals. Und jetzt wurde da oben die Straße gebaut. Das sah dann so aus, daß einer wie Franz mit seinem Bagger vorne überm Abgrund stand und einen nach dem anderen Felsbrocken, die kaum in die Schaufel paßten, an den Hang legte. So lange, bis eine Hangmauer und darauf eine Art Straße entstanden war. Auf der er selbst als erster fuhr. Sozusagen probeweise. Und hinter ihm der LKW, der die Felsen antransportierte. Zyklopenmauern hießen die Dinger unter Fachleuten. Für den, der sie da mit seinem Schaufelbagger in die steilen Hänge legen mußte, war das eine nervenaufreibende Angelegenheit. Da waren einiges Fingerspitzengefühl, Geschicklichkeit, gute Nerven und vor allem jede Menge Glück gefragt. Wenn es mein Nachbar, nachdem ihm sein Bagger abgestürzt war, noch bis in Bertas Bar geschafft hatte, hatte er sogar ziemlich viel Glück gehabt. Meist blieben die Baggerfahrer, wenn sie erst einmal ins Rollen gekommen waren, zusammen mit ihren Maschinen ein paar hundert Meter weiter unten liegen. Und nichts bewegte sich mehr.
„Jetzt bin ich für zwei Tage krankgeschrieben“, sagte Franz, der Baggerfahrer, als er sich den dritten Schnaps bestellte.
„Ist ja auch etwas“, sagte Berta.
„Zwei Tage? Das vergeht dir ein Leben lang nicht mehr. Ich weiß es. Ist das zweite Mal, daß es mich putzt. Das wirst nicht mehr los.“
„Die Schnäpse gehen auf meine Rechnung, Berta“, sagte ich. „Und gib ihm noch einen.“
Mir war plötzlich alles zuviel geworden.
„Ist schon gut“, sagte Berta. „Geh.“
Mein Nachbar drückte mir die Hand.
„Bist ein guter Mensch“, sagte er. „Höchstwahrscheinlich.“
4
Sie hatten mir zweiundvierzig Original Tiroler Bauernstuben auf den Hänger geladen, die nun via Rotterdam nach Übersee gehen sollten. Stilmöbel stand in den Frachtpapieren. Mir war’s ziemlich egal, welchen Dreck die sich da drüben überm Großen Teich von der Alten Welt wieder hatten aufschwatzen lassen. Für mich bedeutete das Ganze an die achtzehn Stunden Fahrt. Und ein paar Lire, grad genug, um einen Teil der Schulden zurückzuzahlen, die sich im Lauf der Zeit angesammelt hatten. Und achtzehn Stunden Gelegenheit, über meine Zukunft nachzudenken. Falls das überhaupt etwas brachte.
Der Bulle vom Dienst, bei dem ich mir meine Papiere wieder geholt hatte, hatte mich ziemlich unverschämt angegrinst. „Alla prossima volta, bis zum nächsten Mal“, hatte er gesagt. „No di sicuro“, hatte er zur Antwort bekommen, „hundertprozentig nicht.“
Als ich mich den Brenner Richtung Innsbruck hinunterbremste, erfuhr ich über das Radio, daß man vor ein paar Stunden eine Leiche gefunden hatte. Ziemlich genau an der Stelle, wo ich letzte Nacht mein Wasser gelassen hatte.
Auf dem Gelände der früheren k. u. k. Befestigungsanlage Franzensfeste, auf dem heute ein Lager des italienischen Militärs stationiert ist, wurde vom wachhabenden Posten bei einem Kontrollgang in der Nähe der Autobahn die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Ersten Informationen zufolge soll der noch unbekannte Mann in der letzten Nacht an einer Überdosis Rauschgift verstorben sein.
Nicht schlecht. Da hatten wir gelegen, dieser Fußballer und ich. Hatten dagelegen und uns unter Zuhilfenahme von Whisky und Haschisch einen Rausch verpaßt, bis wir kaum mehr gehen konnten. Und wenn von der Meldung auch nur die Hälfte stimmte, hatte ganz in der Nähe noch ein anderer Giftler gelegen. Tot.
Ich haute den Blinker rein und überholte ein paar Kollegen, die ein bißchen mehr als ich geladen hatten. Bis Rotterdam war’s noch weit. Und ich mußte mich beeilen, um dem österreichischen Nachtfahrverbot zuvorzukommen.
Neunundzwanzig Stunden später hatte ich Rotterdam, Amsterdam und Bremerhaven angefahren. Tomaten geladen, um sie nach Brescia zu bringen. Weiß der Teufel, was sie dort damit vorhatten.
Mir reichte es, daß ich mir ein paar Stunden abzwakken hatte können, um den Abstecher nach Amsterdam zu machen. Und dann hatte ich auch noch das Glück gehabt, den französischen Kollegen aufzutreiben, der bei mir Schulden hatte. Noch besser: der Kollege war flüssig gewesen. Ich hatte das Geld sofort umgesetzt und den Gegenwert in meiner Zugmaschine verstaut. Die zwei kleinen Päckchen nahmen nicht viel Platz weg.
Als ich von Brescia kommend und nach Norden fahrend an der Franzensfeste vorbeikam, war es bereits dunkel. Wieder hatten sie das Lichterspektakel inszeniert. Langsam, wie aus der hintersten Galaxie, tauchten einige Erinnerungen auf. Die Joints, der Ferrari, der fußballernde pizzaiolo. Und der Tote.
Mir war das alles jetzt ziemlich egal. Ich wollte nur den Hänger abstellen und dann in Ruhe ein ordentliches Bier trinken. Als erstes und gegen den Durst. Und dann etwas Schönes zum Essen und eine Flasche Wein. Soviel mußte noch drin sein. Und wenn’s wieder auf Kredit war. Dafür war morgen Zahltag. Zweieinhalb Tage hatte ich auf dem Bock gesessen, mir die Nächte um die Ohren geschlagen, sämtliche gesetzlichen Regelungen über Ruhe- und Schlafenszeiten eines LKW-Fahrers und die Höchstgeschwindigkeit seines Gefährts mißachtet: ich hatte mir einen möglichst angenehmen Feierabend redlich und unangenehm genug verdient.
5
Als ich das Bierglas abgesetzt hatte, fühlte ich mich langsam besser. Angekommen. Als zuhause konnte man die Gegend hier zwar nicht unbedingt bezeichnen. Dazu war sie zu ungemütlich, diese italienische Provinz mitten in den Bergen, in der sie drei Sprachen redeten, aber immer nur von einer die Rede ging. Von der eigenen.
Ich hatte mich noch immer nicht daran gewöhnt, daß es mich hierher verschlagen hatte. Nach den vielen Jahren im Hohen Norden. Bis es mir dort zu kalt geworden war. Und ich Richtung Süden gezogen war. Und dort auch keine richtige Wärme gefunden hatte. Weiter südlich war es mir zu heiß, und hier, mittendrin, hielt ich es nicht aus. Und trotzdem war ich heute froh, angekommen zu sein.
Ich war nicht mehr auf Fahrt, saß nicht mehr auf dem Bock. Sondern auf einem Kneipenhocker. Einem ziemlich unbequemen, mit einem Kuhfellimitat überzogenen auch noch. Aber immerhin. Keine Autobahn vor mir, keine hinter mir. Keine Stilmöbel, keine Strumpfgürtel, keine Tomaten, Äpfel, Kirschen, Kürbiskerne, Goldfischlaiche, keine sinnlosen Ersatzteile für noch sinnlosere Maschinen, die noch viel Sinnloseres produzierten.
Ich stieg gerne auf den Bock, aber ich saß ungern drauf. So einfach war das.
Mit dem Bier hatte ich den ärgsten Staub hinuntergespült. Jetzt wurde es Zeit, sich mit etwas Ordentlichem zu versorgen.
Ich setzte mich an meinen Stammplatz. Bestellte spaghetti aglio, olio e peperoncino und eine Flasche Lagrein, Villa Karneid. Den Wein hatten sie im Angebot, seit ich dem Chef einmal eine Flasche zum Verkosten mitgebracht hatte. Direkt aus der Kellerei Castelfeder. Recht viel wurden sie hier allerdings nicht los von dem Wein. War verständlich, bei einem Lokal, das sich Försterkeller nannte und als Diskothek für Volksmusikfanatiker der übelsten Sorte galt. Für die reichte ein Löwentrunk oder Meraner Gold Auslese.
Dafür war bei der Ausstattung an nichts gespart worden. Rundherum Holz, so weit das Auge trug. Höchst schlampig auf alt gemachte Baumstämme, die an die Betondecke gedübelt worden waren. Eine Sitzecke, die so tat, als sei sie eine Almhütte. Rotweißkarierte Vorhänge. Hörner und Felle diverser alpiner Gattungen an der Wand. Und die abscheulichsten Blech-, Messing- und Eisengerätschaften, die man sich nur vorstellen konnte. Eine Folterkammer.
Der Försterkeller war normalerweise der Austragungsort von Stellungskriegen und Grabenkämpfen zwischen den Rekruten des italienischen Heeres und den mindestens ebenso tapferen und wackeren Burschen der umliegenden Seitentäler.
Die Jungsoldaten, von sadistischen Oberbefehlshabern aus dem tiefsten Süden des Landes hierher in diese unwirtliche Berggegend verschickt, hielten sich, und das nicht immer zu Unrecht, für die schöneren Exemplare der männlichen Spezies. Die Burschen, die nächtens von den Berghöfen in die Diskothek einfielen, waren sich ihrerseits ziemlich sicher, hier ältere und verbrieftere Rechte zu haben. Vor allem auf die vereinzelten Exemplare holder Weiblichkeit, die sich manchmal hierher verirrten. Die eine oder andere Abspülerin und nördliche Touristinnen auf der Suche nach dem Echten, Wahren, Unverfälschten.
Worauf dann, sobald sie leergetrunken waren, die Bierkrüge flogen. Und was sonst noch in Reichweite stand. Sie verhauten sich gegenseitig mit solcher Regelmäßigkeit und Inbrunst, daß man nur mehr von Liebe sprechen konnte.
Der Lagrein war gekommen. Ich gönnte mir einen ersten Schluck. Gut so.
Es schien ein ruhiger Abend zu werden heute. Mitternacht war grad vorbei, die tapferen Soldaten längst schon auf ihren schmalen Matratzen. Der silenzio hatte sie wieder. Und die Seitentalbewohner hatten schon so viel intus, daß sie sich, den Kopf schwer auf beide Hände gestützt, kaum mehr rührten. Sogar die zwei Abspülerinnen auf der Tanzfläche ließen sie kalt. Jetzt, wo weit und breit keine Konkurrenz mehr zu sehen war. An der Decke hing ein Fernseher, in dem stumm ein Fußballspiel lief.
Dann ging die Tür auf. Zusammen mit einem übermäßig hoch aufgeschossenen jungen Mann betrat ein kleines Ding das Lokal.
Im selben Augenblick brachte Charlie, der Chef des Hauses, meine spaghetti aglio, olio e peperoncino.
Einige Sekunden lang war ich hin und her gerissen. Und kam mir dann selbst blöd dabei vor. Sie war kaum älter als fünfzehn. Also standen zwanzig Jahre, der Lagrein und die Spaghetti zwischen ihr und mir. Zuviel.
„Mahlzeit“, sagte Charlie. „Scheinst ja einen ziemlichen Appetit zu haben.“
Er hatte mich dabei ertappt, wie ich, Gabel in der Hand, quer durchs Lokal gestarrt hatte.
„Laß die alten Leut in Ruh“, sagte ich zu ihm.
„Und du die jungen.“
„Verschwind“, sagte ich, „sonst vergeht mir noch das Essen.“
Kaum zu glauben, aber der Försterkeller hatte einen erstaunlich guten Koch auf seiner Gehaltsliste stehen. Mehr als eine Handvoll Gerichte gab es zwar nicht zur Auswahl, und recht viel mehr als sieben, acht Essen schickte er pro Abend nicht ins Lokal, aber der Mann war gut. Wodurch oder womit er sich bezahlt machte, war wieder eine andere Frage.
Die aglio, olio e peperoncino waren wie immer richtig auf dem Punkt. Zwischen einer Gabel Spaghetti und der anderen mußte ich feststellen, daß die beiden Neuankömmlinge schon wieder verschwunden waren.
Ich war gerade dabei, mir Wein nachzuschenken, als die Kleine wieder auftauchte. Vom Klo her. Sie stellte sich an den Tresen und bestellte. Ich wickelte langsam meine Nudeln um die Gabel und schaute ihr zu. Sie war verdammt jung. Leicht hinüber. Und suchte nach Zigaretten. Ich schob meine in ihre Richtung. Sie kam herüber und setzte sich, übers Eck, an den Tresen.
„Zwei brauch ich“, sagte sie.
„Für den Typ?“
„Welcher Typ?“
„Der von vorhin.“
Sie schien kurz nachzudenken. Senkte ihren Kopf, hob ihn dann ruckartig wieder hoch und sah mir direkt ins Gesicht.
„Ciccio? Nein.“
Stand abwartend da, und wie nebenbei.
„Nimm, wieviel du brauchst“, sagte ich.
„Ist gut.“
Sehr gesprächig war sie nicht.
„Trinkst ein Glas mit?“
„Ich krieg schon eine Cola.“
„Stimmt“, sagte ich, „Cola. Was denn sonst.“
Ich schob den Teller weg. Hatte genug gegessen. Und dann sah ich sie mir an. Sie saß da, trank sich langsam in ihre Cola hinein und rührte sich ansonsten nicht.
„Brauchst du Feuer auch?“
Ich kam mir zwar ein bißchen blöd vor, aber es mußte sein.
„Nein. Ich rauch sie später.“
Und während sie das sagte, sah sie mich an. Und ließ mich nicht mehr aus den Augen. Ich schaute zurück. Es dauerte. Ich hätte nicht sagen können, was ich sah.
„Kann das weg?“
Das war Charlie. Mischte sich wieder ein. Ich schaute gar nicht erst hin.
„Nimm sie mit. Und sag dem Koch, heut haben sie nicht geschmeckt.“
„Wird wohl kaum seine Schuld sein.“
„Hau ab.“
Den vorlauten Mensch konnte ich im Augenblick nicht brauchen. Andererseits hatte er recht. Was ich da gerade am Aufführen war, war ziemlich albern. Charlie grinste sich einen und langte nach dem Teller.
„Ich hab Hunger, wenn’s gleich ist.“
Die Kleine hatte sich, mit ziemlicher Geschwindigkeit, die Spaghetti geschnappt.
„Oui, Madame“, sagte Charlie.
„Cretin“, sagte ich.
„Was?“
„Eben“, sagte ich. „Fang gar nicht erst damit an, wenn du eh nur die zwei Worte kannst.“
Jetzt war er beleidigt. Und ich hatte ihm noch gar nicht gesagt, daß ich heute auf Kredit essen und trinken wollte. Er verzog sich in seine Schmollecke gleich neben der Espressomaschine.
Die Kleine war näher herangerückt, drehte die Gabel in die Nudeln und sah ihnen dabei zu.
„Eigentlich hab ich gar keinen Hunger“, sagte sie.
„Dann laß es stehen.“
Sie drehte weiter.