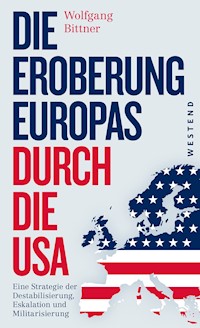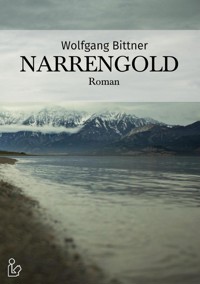
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Der Romankiosk
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Steve, ein junger Deutscher, kommt in den Norden Kanadas, wo er Arbeit in einer Goldmine findet. Als es zu Auseinandersetzungen mit dem Minenbesitzer kommt, flieht er und findet freundliche Aufnahme bei einem Indianerstamm. Hier lernt er ein Leben kennen, das so ganz anders ist als alles bisher Erlebte. Er hört die Geschichten der Indianer und lernt ihre Tradition kennen, lernt jagen und fischen, findet Freunde und Anerkennung. Doch bleiben ihm auch die existentiellen Sorgen, die die Indianer in einer von weißen dominierten Welt haben, nicht verborgen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
WOLFGANG BITTNER
Narrengold
Roman
Der Romankiosk
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
NARRENGOLD
Auf der Suche
In der Mine
Goldwäsche
Bärenbesuch und eine Beobachtung
Ein Wochenendausflug
Donessys Kompagnon
Dunkle Geheimnisse
Geschäfte und Geschichten
Erdrutsch
In der Geisterstadt
Eine Unterbrechung
Auseinandersetzungen
Entlassen
An den warmen Quellen
Sommertage
In der Reservation
Waldleben
Midas Geburtstag
In Gefahr
Überraschungen
Worterklärungen
Impressum
Copyright © by Wolfgang Bittner/Der Romankiosk.
Mit freundlicher Genehmigung der Edition Bärenklau
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg
Umschlag: Copyright © by Christian Dörge.
Verlag:
Der Romankiosk
Winthirstraße 11
80639 München
www.apex-verlag.de
Das Buch
Steve, eine junger Deutscher, kommt in den Norden Kanadas, wo er Arbeit in einer Goldmine findet. Als es zu Auseinandersetzungen mit dem Minenbesitzer kommt, flieht er und findet freundliche Aufnahme bei einem Indianerstamm. Hier lernt er ein Leben kennen, das so ganz anders ist als alles bisher Erlebte. Er hört die Geschichten der Indianer und lernt ihre Tradition kennen, lernt jagen und fischen, findet Freunde und Anerkennung. Doch bleiben ihm auch die existentiellen Sorgen, die die Indianer in einer von weißen dominierten Welt haben, nicht verborgen...
NARRENGOLD
Auf der Suche
Einige Augenblicke blieb er noch regungslos liegen, bis er sich erinnerte, wo er war. Dann schlüpfte er aus seinem Schlafsack und öffnete das Zelt. Die plötzliche Helligkeit stach in die Augen. Obwohl der Morgen nicht mehr ganz jung war, lag immer noch Raureif auf den Gräsern der kleinen Lichtung, die wie mit Zuckerguss überzogen in der Sonne glitzerte. In den Weidenbüschen lärmten die Häher. Es war kalt.
»Also doch zu früh aufgestanden«, murmelte Steve vor sich hin und reckte sich, dass die Gelenke knackten. Er nahm den Beutel mit seinen Waschutensilien, schlang sich das Handtuch um den Hals und ging die wenigen Schritte zum Bach hinüber, der vernehmbar am Rande der Lichtung vorbeifloss. Am Ufer hatte sich während der Nacht eine Eisschicht gebildet, die sich jedoch leicht wegtreten ließ.
Das Wasser rötete die Haut und vertrieb den Rest von Schläfrigkeit. Waschen, Zähneputzen, Kämmen. Er kleidete sich rasch an. Ein paar im Kreis gelegte Steine bildeten den Feuerplatz und unter den Fichten fand sich genügend trockenes Holz. Als das Feuer brannte und die Kaffeekanne aufgestellt war, ließ er seinen Proviantbeutel herunter, den er am Abend zuvor in einen Baum hochgezogen hatte. Inzwischen drang die Sonne schon durch die Zweige, der Raureif verdampfte innerhalb weniger Minuten.
Das Wasser brodelte. Er schüttete Kaffee hinein, ließ ihn kurz aufkochen und zog die Kanne beiseite. Damit sich das Kaffeemehl absetzte, gab er etwas kaltes Wasser hinzu. Auf der als Unterlage benutzten Regenplane waren die Lebensmittel ausgebreitet, die er am Vortag in Jakes Corner eingekauft hatte: Brot, Butter, Dauerwurst, Käse. Behaglich lehnte er sich gegen seinen Rucksack und schlürfte den heißen Kaffee.
Die Häher hüpften ihm auf der Suche nach Futter bis vor die Füße. Er brach etwas Brot ab und warf es ihnen zu. Auch zwei Streifenhörnchen stellten sich ein. Wie kleine Gnome äugten sie vom Rand der Lichtung herüber auf den Eindringling, der sich offenbar direkt vor ihrer Haustür niedergelassen hatte.
Die Mücken machten sich unangenehm bemerkbar. Sobald es wärmer wurde, waren sie da, binnen kurzem eine ganze Wolke. Steve zog ein Fläschchen Insektenöl aus der Tasche und rieb sich Handrücken, Gesicht und Nacken damit ein. Das half die Quälgeister fernzuhalten.
Nach dem Frühstück baute er das Zelt ab und packte zusammen. Noch während er dabei war, ließ sich von der Landstraße das Geräusch eines vorbeifahrenden Autos vernehmen. Er lauschte kurz, schulterte dann seinen Rucksack, nahm das Gewehr und machte sich auf den Weg. Längs des Baches erreichte er nach fünf Minuten die Straße. Er stieg die Böschung hinauf. Die Fahrbahn bestand nur aus Schotter und führte mehrere Kilometer schnurgerade von Norden nach Süden. Er setzte den schweren Rucksack ab, um zu verschnaufen. In südöstlicher Richtung sah man über den Bergen den schneebedeckten Kegel eines hohen Berges emporragen. Hoch oben in dem hellen unbestimmten Blau des Himmels, in dem noch ein Hauch eisiger Winterkälte enthalten war, zogen Wildgänse in zwei langen Flugkeilen nach Norden.
Von dort näherte sich jetzt das Brummen eines Automotors, und wenig später wurde an der Spitze einer Staubfahne ein Lastwagen sichtbar, der trotz der holperigen Straße rasch herankam. Als Steve winkte, hielt das Fahrzeug an. »Nach Atlin?«, rief er.
»Wohin sonst?«, gab der Fahrer zurück. »Steig ein!«
Steve warf seinen Rucksack auf die Ladefläche und kletterte ins Führerhaus. Sein Gewehr, das er in ein Leinwandfutteral gesteckt hatte, legte er neben sich. »Ich heiße Steve«, sagte er.
»Mein Name ist George«, erwiderte der Fahrer, ein schon etwas älterer Mann. »Komme gerade aus Whitehorse.« Und mit einem kurzen Seitenblick setzte er hinzu. »Du bist wohl fremd hier?«
»Ich war noch nie in dieser Gegend«, bestätigte Steve, »habe vor, mich nach Arbeit umzusehen.«
»Das wird nicht einfach sein«, meinte George. Er musste sich auf die Straße konzentrieren, die jetzt in vielen Kurven durch hügeliges Gelände führte und voller Schlaglöcher war; manchmal ratterten die Stoßdämpfer wie wild und der ganze Wagen vibrierte, wenn eine längere waschbrettartige Strecke kam. Dann ging es wieder durch dichten Fichtenwald.
»Die Straße endet in Atlin«, führte George das Gespräch weiter. »Einen anderen Ort gibt es in dieser Gegend nicht. Nur noch eine Siedlung der Tlingit im Indianerreservat, einige Goldminen und hier und da ein paar Häuser, die über Nebenstraßen erreichbar sind.«
Er packte, ohne mit der Geschwindigkeit herunterzugehen, einige Sandwiches aus, von denen er Steve anbot. Sie aßen. Von Zeit zu Zeit krachte es, als müsse die Achse brechen, wenn das Fahrzeug über eine Querrinne holperte oder eines der Räder in ein tiefes Schlagloch geriet. Doch der Fahrer schien sich gut auszukennen, denn er verringerte jeweils zeitig genug die Geschwindigkeit, um anschließend sofort wieder Gas zu geben.
»Frostaufbrüche«, brummte er. »Es ist jedes Jahr dasselbe. Der Highway muss dringend repariert werden.«
»Highway ist gut«, sagte Steve lachend.
»Besser als gar nichts«, gab George ein wenig brüsk zurück. »Ein richtiger Highway ist es natürlich nicht, da hast du Recht. Aber bis vor wenigen Jahrzehnten gab es nur einen Indianerpfad. Diese Strecke vom Alaska Highway wurde erst 1949 fertig gestellt; vorher war der Wasserweg über die Seen nach Skagway am Pazifik die einzige Verbindung zur Außenwelt.«
»Wohnst du schon länger in Atlin?«, fragte Steve.
»Seit fünfzehn Jahren. Ich bin bei der Straßenbauverwaltung, das ist ein recht guter Job. Man hat zu tun, auch im Winter, wenn hier die meisten arbeitslos sind. Im Sommer müssen die Straßen ausgebessert, im Winter geräumt werden.«
Sie fuhren an einem Schild vorbei, das die Grenze zwischen dem Yukon-Territorium und Britisch-Kolumbien markierte. Auf der rechten Seite kam zwischen den Bäumen die Wasserfläche eines sich weit nach Süden erstreckenden Sees zum Vorschein, der von hohen, zum Teil noch schneebedeckten Bergen überragt wurde.
»Der Atlin Lake«, erläuterte George. »Er ist über hundert Kilometer lang. Bis Atlin sind es noch ungefähr fünfzig Kilometer.« Kurz darauf ging er mit der Geschwindigkeit herunter, denn vorn war eine rote Fahne zu sehen, und nach einer Kurve kamen eine Planierraupe und ein Lastwagen in Sicht. Mehrere Männer waren damit beschäftigt, die Fahrbahn in Stand zu setzen. George hielt an und stieg aus. »Ich komme gleich wieder«, sagte er, »muss mich nur mal um meine Leute kümmern.«
Als sie nach zehn Minuten weiterfuhren, war es sehr warm geworden. Die Straße führte immer noch am See entlang und bot einen herrlichen Ausblick bis zu den fernen Gletschern des Küstengebirges. Steve kurbelte die Scheibe herunter. Überall blühte es, die Weidenbüsche waren voller Kätzchen und die Laubbäume entfalteten bereits ihre Blätter. Am Straßenrand saßen manchmal Hasen oder Fichtenhühner, hin und wieder auch Murmeltiere aufrecht wie kleine Wächter. Einmal überquerte ein Elch gemächlich die Fahrbahn.
Nach einer weiteren halben Stunde ging es erneut durch dunklen Fichtenwald. Dann fuhren sie über einen Hügel und sahen unten am Seeufer die Ortschaft liegen: ein paar schachbrettartig verlaufende ungepflasterte Straßen mit Holzhäusern und einer Kirche. Ein idyllisches Bild. Als sie in den Ort hineinkamen, merkte Steve jedoch, dass viele der Häuser sehr heruntergekommen oder dem Verfall preisgegeben waren; andere hatten allerdings einen neuen Anstrich erhalten und glänzten farbenfroh in der Sonne. Gleich rechter Hand befand sich eine Tankstelle sowie ein Laden mit der Aufschrift Atlin Trading Post.
»Ich setze dich am besten vor dem Hotel ab«, sagte George. »Du kannst dich ja mal in der Bar umhören, da verkehren die Minenarbeiter, und vielleicht weiß einer von ihnen Arbeit für dich. Meistens kommen sie gegen Abend noch auf ein Bier in die Stadt.«
Steve bedankte sich vielmals, nahm seinen Rucksack von der Ladefläche und sah sich erst einmal um.
Das Hotel - Atlin Inn stand über dem Eingang - war ein großes kastenförmiges Holzgebäude an der Uferstraße; es schien ziemlich neu zu sein und hatte zwei Stockwerke, aber der erste Stock war noch unbewohnt. Schräg gegenüber lag auf dem Ufer ein imposantes weißes Schiff, das offenbar in früheren Jahren den See befahren und dem Güter- und Passagierverkehr gedient hatte. In großen Lettern stand der Name Tarahne daran. Man hatte es aufgebockt und war dabei, es zu restaurieren, vielleicht als eine Attraktion für die sich auch in diese Gegend gelegentlich verirrenden Touristen. Dahinter glänzte der weite Spiegel des Wassers.
Inzwischen war es Mittag geworden. Keine Menschenseele ließ sich blicken. Vor dem Hotel standen mehrere Autos, ein paar Hunde strichen herum. Steve schulterte seinen Rucksack und ging entlang dem Ufer auf einige Bretterschuppen zu, die dort zwischen dem Weidengebüsch standen. Ein mit Steinbrocken verstärkter hölzerner Anleger, an dem Motorboote, Kanus und ein Wasserflugzeug verankert waren, führte in den See hinein. Hinter den Schuppen war das Ufer grasbewachsen und schon nach etwa fünfzig Metern fand sich eine zum Zelten geeignete Stelle. Hier warf Steve den Rucksack ab, um sein Zelt aufzubauen. Als es stand, sammelte er etwas von dem umherliegenden Treibholz, zündete ein Feuer an und setzte Wasser auf.
Nicht weit entfernt gründelten in der flachen Bucht zwei Enten. Einen Moment lang war er versucht, sie zu schießen, denn sein Magen meldete sich bereits wieder. Aber so nahe der Ortschaft, die sich oberhalb des Ufers noch weiter hinzog, mochte er nicht auf Jagd gehen. Deshalb holte er Mehl, Backpulver und Salz aus dem Rucksack, rührte in seinem Topf einen Teig an und tat ihn in die Bratpfanne, die er an den Rand des Feuers stellte. Danach brühte er sich Tee auf.
In Gedanken versunken, saß er neben dem Feuer, blickte auf den See hinaus und schlürfte seinen Tee. Wie sollte es weitergehen? Er musste zusehen, dass er Arbeit bekam, denn die wenigen Dollars, die er noch besaß, würden nicht mehr lange reichen. Wahrscheinlich war es falsch gewesen, gerade in diesen abgelegenen Landstrich zu gehen, aber in Vancouver hatte ihn nichts mehr gehalten. Die Großstadt war ihm so zuwider gewesen, dass er einfach zusammengepackt und ihr den Rücken gekehrt hatte, nur raus aus dem Trubel. Dabei war er davon ausgegangen, dass er trotz der hohen Arbeitslosigkeit bald einen Gelegenheitsjob finden würde. Im Norden Kanadas womöglich noch eher als in den Metropolen oder in den dichter besiedelten Gebieten. Hoffentlich hatte er sich nicht getäuscht.
Das Fladenbrot brauchte noch eine gute halbe Stunde. Er drehte es um, dann zog er seine Angel aus, befestigte einen Blinker daran und ging auf den Anleger. Von dort warf er den Blinker so weit es ging in den See hinaus. Nachdem er fast eine Viertelstunde ergebnislos geangelt hatte, spürte er schließlich Widerstand. Vorsichtig holte er die Schnur ein und zog den Fisch an Land. Ein Grayling hatte gebissen, den er gleich schuppte und ausnahm.
Als er zu seinem Lagerplatz zurückkehrte, war das Brot gut durchgebacken. Er legte es zum Abkühlen auf einen flachen Stein, rieb den Fisch mit Salz und etwas Pfeffer ein und briet ihn. Fisch und frisches Brot, ein köstliches Essen. Zum Nachtisch gab es noch eine Schnitte mit Marmelade; dann legte er sich in das Zelt, um auszuruhen. Denn er fühlte sich von der langen Reise in den Norden noch immer ein wenig erschöpft.
Am späten Nachmittag erwachte er und ging in den Ort. Das Gelände stieg vom See her leicht an, im Hintergrund waren in einer Entfernung von mehreren Kilometern bewaldete Berge zu sehen. Atlin schien nicht viele Einwohner zu haben und wirkte verträumt. In der Straße hinter dem Hotel befanden sich mehrere kleine Andenkenläden, die um diese Jahreszeit noch geschlossen waren, denn die Touristen würden frühestens im Juni kommen. Die meisten der Häuser waren alt und hatten nach vorn hohe Scheinfassaden, hinter denen sich - schaute man genauer hin - nur kleine Häuschen verbargen; manche waren baufällig und unbewohnt, die Dächer notdürftig mit Blechplatten abgedeckt. Dazwischen gab es mit Gras und niedrigem Buschwerk überwucherte Grundstücke, Bretterschuppen und Garagen. Als Bürgersteige dienten hier und da hölzerne Stege.
Weiter oben fiel ihm in einer Querstraße ein größeres Gebäude mit einer repräsentativen Freitreppe und einem Turm auf dem Dach auf; eine Tafel kennzeichnete es als ehemaliges Gericht. Atlin musste also schon bessere Zeiten erlebt haben. Darauf deuteten auch die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften hin, die sich im Garten eines ebenfalls recht stattlichen Hauses befanden, das als Museum eingerichtet war: alte Dampfmaschinen, Bagger, Bulldozer und Schleusenkästen aus Holz, wie sie früher in den Goldminen verwendet wurden. Die Geschichte des Ortes begann Steve zu interessieren und er beschloss das Museum zu besichtigen. Doch es war geschlossen. Langsam schlenderte er zum Atlin Inn zurück und ging hinein.
Die Bar befand sich gleich neben dem Eingang in einem lang gestreckten Raum von erheblichen Ausmaßen, dessen Fenster zur Uferstraße hinausgingen. Die linke Seite nahmen eine imposante Theke mit einer langen Reihe von Barhockern und ein Billardtisch ein, auf der rechten Seite standen ein paar Sessel, ein Plüschsofa sowie einzelne Tische mit Stühlen. An den Holzwänden hingen alte Werkzeuge und riesige bräunliche Fotos aus der Goldgräberzeit. Eine Musicbox plärrte: »Last night I went to sleep in Detroit City...«
Er ging an die Theke, setzte sich und bestellte einen Kaffee, der lediglich sechzig Cents kostete. Nur wenige Gäste waren anwesend, aber nach und nach kamen immer mehr. Die meisten trugen karierte Flanellhemden, Jeans und derbe Schuhe, ihre Schirmmützen behielten sie auch im Raum auf dem Kopf. Einige der Männer schienen tatsächlich aus den umliegenden Minen zu kommen und Steve überlegte, wie er ein Gespräch mit ihnen beginnen konnte.
Sie saßen zusammen und unterhielten sich, sodass es schwierig war, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Auch das Mädchen hinter der Theke war an einem Gespräch mit ihm nicht interessiert, denn es hatte mittlerweile alle Hände voll zu tun.
Da gingen ein paar Männer an den Billardtisch, um ein Spiel zu machen. Kurz entschlossen stand er ebenfalls auf und gesellte sich zu ihnen. Nachdem er eine Weile zugeschaut hatte, sprach er einen der Spieler an, einen noch jüngeren Mann mit offenem Gesicht: »Hör mal, ich bin hier fremd und suche Arbeit in einer Mine. Kennst du vielleicht jemanden, der mir einen Tipp geben kann?«
Der Mann wandte sich um und stellte sein Billardqueue beiseite. »Sicher«, erwiderte er ganz unerwartet freundlich. »Ich arbeite selber in der Mine, bei Al Donessy. Bin aber erst seit zwei Wochen hier und kenne mich auch noch nicht richtig aus.« Er überlegte. »Frag doch mal Alex«, meinte er dann, »der sitzt dort drüben am Tisch bei den anderen Jungs.«
Steve bemerkte, dass der Minenarbeiter mit einem leichten ausländischen Akzent sprach. »Schönen Dank«, sagte er und gab ihm die Hand, »ich heiße übrigens Steve.«
»Okay«, erwiderte der andere, »mein Name ist Karel.« Und indem er seine Hände als Trichter benutzte, rief er quer durch den Raum: »He, Alex, kannst du mal kommen?«
Drüben erhob sich eine hagere Gestalt, ein Mann in mittleren Jahren mit schütterem Haar und einer auffallenden Hakennase.
»Was gibt es denn so Dringendes?«, fragte er im Näherkommen. »Willst du etwa ein Bier ausgeben?«
»Das hier ist Steve«, stellte Karel vor, »er sucht Arbeit in der Mine. Weißt du, ob Al noch jemanden braucht?«
»Also, wie ist das nun mit einem Bier?«, gab Alex zurück und musterte den Fremden abschätzend.
»Ich lade euch ein«, sagte Steve. Sie gingen an die Theke, wo er drei Biere bestellte. Als sie kamen, prostete er den beiden zu.
»Du suchst also Arbeit in einer Goldmine?«, fragte Alex und bot Steve eine Zigarette an.
»Ja, ich bin erst heute angekommen und dachte, ich hör mich mal um.«
»Gute Idee«, sagte Alex grinsend. »Aber das ist gar nicht so einfach. Die Wolframmine in Tungsten hat gerade geschlossen und die Asbestmine in Cassiar hat auch einen Haufen Leute entlassen, von denen jetzt viele hier in der Gegend herumlungern und die Löhne verderben.« Er trank sein Bier aus und Steve wollte neues bestellen, doch Karel kam ihm zuvor. »Die nächste Runde geht an mich«, erklärte er und rief der Bedienung seine Bestellung zu. »Hat Al nicht gestern den Indianer gefeuert, als der wieder zu spät kam?«, fragte er. »Da wär doch eine Stelle frei.«
»Hm«, meinte Alex, »ich kann ihn ja morgen darauf ansprechen. Wenn er noch nichts abgemacht hat, könnte es vielleicht klappen.« Und zu Steve gewandt fuhr er fort: »Am besten, du kommst morgen gegen Mittag vorbei und erkundigst dich. Al Donessy hat seine Mine am Spruce Creek, das ist zehn Kilometer entfernt, am Flugplatz vorbei und dann rechts über die Brücke. Hast du ein Auto?«
»Nein«, erwiderte Steve, »aber ich werde schon irgendwie hinkommen.«
»Gut«, sagte Alex und bestellte drei weitere Biere. »Dann lass uns darauf anstoßen, dass du die Stelle bekommst.« Sie nickten sich zu und tranken.
»Kennst du dich mit der Arbeit in so einer Mine aus?«, wollte Karel wissen.
Steve schüttelte den Kopf. »Nicht besonders. Ich habe allerdings schon Lastwagen und Bulldozer gefahren und vor zwei Jahren weiter oben im Norden mit der Pfanne nach Gold gesucht.«
»Das ist immerhin etwas«, meinte Alex beifällig. »Waren denn deine Bemühungen erfolgreich? Hast du Gold gefunden?«
»Es lohnte kaum die Arbeit. Und wenn ich länger dabeigeblieben wäre, hätte ich bestimmt sehr bald einen Bandscheibenschaden und Rheumatismus bekommen.«
»Jaja«, nickte Alex, »das kenne ich. Vor ein paar Jahren war ich in der Gegend von Dawson City, da habe ich es auch versucht. Ich fand damals eine Stelle, ein Rinnsal in den Ogilvie-Bergen, wo es sich zuerst sogar rentierte. Ob ihr es glaubt oder nicht: Ich wusch in wenigen Wochen mehr als zwanzig Unzen allein an Nuggets heraus, das gab seinerzeit etwa zehntausend Dollar; hinzu kamen noch ein paar Unzen Staub und Blättchen. Da hab ich mir eine Blockhütte gebaut und mich in der Wildnis häuslich eingerichtet. Fast zwei Jahre habe ich dort zugebracht. Bis ich es nicht mehr aushielt.«
»Warum bist du nicht ein paar Jahre länger geblieben?«, fragte Karel ein wenig misstrauisch. »Vielleicht wärst du dann heute Millionär und könntest in einer Villa im Süden leben.«
Alex zündete sich eine Zigarette an und nahm einen Schluck Bier. Sein hageres Gesicht, in das sich tiefe Furchen eingegraben hatten, wirkte auf einmal müde. Ohne auf die Frage gleich einzugehen, erzählte er weiter: »Zu Anfang gefiel es mir recht gut: grüner Wald, frische Luft, kein Chef, keine Vorschriften, ein völlig ungebundenes Leben. Aber der Platz befand sich ziemlich weit entfernt von der nächsten Ortschaft, sodass ich jeweils vier Tage brauchte, um neuen Proviant zu holen. Ein Leben wie in der Steinzeit, sage ich euch. Im Oktober fiel bereits der erste Schnee und es wurde so kalt, dass ich die Arbeit erst einmal aufgeben musste. Es ging einfach nicht mehr, obwohl ich versuchte die gefrorene Erde mit Feuer aufzutauen, wie sie es früher gemacht haben; Holz gab es ja genug. Es war zu mühsam und die Temperaturen sanken manchmal auf minus vierzig Grad Celsius, einmal sogar auf unter fünfzig Grad. Den ganzen Winter über saß ich in meiner Hütte wie in einem Gefängnis - von Romantik keine Spur. Eine Woche lang habe ich hungern müssen, weil zu hoher Schnee lag und ich nicht aus den Bergen herauskam. Mit der Jagd hatte ich auch kein Glück, ich sah weder Karibus noch einen Elch. Ich bin fast wahnsinnig geworden, führte Selbstgespräche und glaubte andauernd, ich hätte eine Blinddarmentzündung. Scheußlich, unmenschlich. Und wenn ich nach Dawson City kam, rann mir das Geld nur so durch die Finger. Allein der Arzt kostete mich über zweitausend Dollar, denn ich hatte mir durch die schlechte Ernährung Skorbut geholt. Im Frühjahr machte ich dann weiter. Aber die Ausbeute ließ von Tag zu Tag nach, und obwohl ich wie besessen arbeitete, wie im Fieber - und ich glaube, ich hatte tatsächlich einen Goldrausch -, verdiente ich kaum noch meinen Unterhalt. Es war zum Schluss eine sinnlose Plackerei.«
In der Erinnerung schüttelte er sich und nahm einen weiteren gehörigen Schluck Bier. »Da bin ich in die Mine gegangen«, setzte er noch hinzu, »das war mir lieber. Man hat sein festes Einkommen, ein richtiges Dach über dem Kopf, braucht sich um nichts zu kümmern und erhält im Winter Arbeitslosenunterstützung...«
»Ich wäre euch dankbar«, unterbrach ihn Steve, »wenn ihr mir erzählen würdet, was zu tun ist. Sonst stehe ich morgen womöglich wie ein Trottel da, wenn Al Donessy mich etwas fragt.« Er gab noch eine Runde Bier aus und Alex und Karel berichteten von ihrer Arbeit. Gegen zehn Uhr brachen die beiden auf, um zur Mine am Spruce Creek zurückzukehren, denn morgens um sechs war für sie die Nacht schon wieder zu Ende.
»Übernachtest du nicht im Hotel?«, fragte Karel erstaunt, als Steve mit hinausging.
»Nein«, erwiderte er, »ich schlafe in meinem Zelt. Es steht dort drüben am Seeufer.«
»Wie praktisch«, amüsierte sich Alex. »Das kostet nichts und ist sehr gesund.«
Sie verabschiedeten sich. Während Steve am Ufer entlangging, hörte er noch, wie das Auto gestartet wurde und abfuhr. Der Himmel war klar und voller Sterne, es würde wieder kalt werden. Rasch schlüpfte er in seinen Schlafsack und war bald darauf eingeschlafen.
In der Mine
Es war noch dämmrig, als er davon erwachte, dass jemand seinen Namen rief. »Was gibt es denn?«, meldete er sich, auf einmal hellwach.
»Ich bin's, Karel!«, kam die Antwort von draußen. »Wir haben vorhin mit Al Donessy gesprochen und er will dich eventuell einstellen. Ich soll dich abholen.«
Rasch zog sich Steve an und öffnete das Zelt. »Eine gute Nachricht«, freute er sich, kroch hinaus und begrüßte Karel. »Hab ich denn noch Zeit, mir einen Kaffee zu kochen?«
»Pack lieber gleich zusammen«, erwiderte Karel. »Frühstücken können wir gemeinsam im Hotel, ich lade dich ein.«
In wenigen Minuten war das Zelt abgebaut und alles im Rucksack verstaut. Sie gingen zum Hotel, wo Karel das Auto geparkt hatte, und frühstückten gemütlich und in Ruhe. Dann machten sie sich auf den Weg zur Mine. Auf der Discovery Avenue, deren Name auf die Goldrauschzeiten schließen ließ, fuhren sie aus dem Ort hinaus, vorbei an einem alten Friedhof und am Flugplatz, der nur aus einer Baracke, einigen Schuppen und der Schotterpiste bestand. Nach wenigen Kilometern führte eine Abzweigung nach rechts über eine Holzbrücke in die Berge hinein. Der Weg war ausgefahren und wand sich durch lichten Kiefernwald.
Überall sah man Geröllhalden, im Hintergrund felsige Höhen. Bald befanden sie sich oberhalb einer tiefen Schlucht, auf deren Grund ein Bach floss. Auch hier sah es aus wie auf dem Mond: Die Erde war kilometerweit aufgerissen, der Bach offenbar schon mehrmals umgeleitet worden. An manchen Stellen wurde mit schwerem Gerät gearbeitet.
»Das sind mehrere kleine Minenunternehmen«, erläuterte Karel. »Ich habe gehört, dass hier schon seit 1898 nach Gold gesucht und offenbar auch eine Menge gefunden wird. Unsere Mine liegt weiter bachaufwärts.«
Sie kamen auf eine Anhöhe, wo zwischen den Bäumen eine blaue Wohnbaracke aus Fertigbauteilen und mehrere Autos standen.