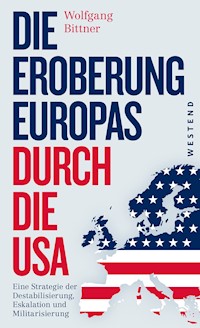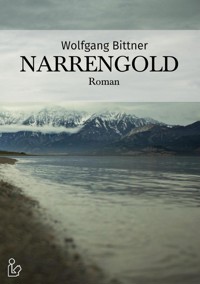5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Stefan (Steve), ein junger Mann, ist auf der Flucht vor der Zivilisation und sucht die Weite und Ruhe der kanadischen Wildnis. In der alten Goldgräberstadt Dawson City am Yukon River trifft er eine Gruppe von Lachsfischern, die ein noch relativ unabhängiges, naturverbundenes Leben führen, aber mit ihrer schweren Arbeit im Vergleich zu den hohen Preisen, für die Lachs verkauft wird, nur sehr wenig verdienen. Die Fischer entschließen sich zu einem Streik, um bessere Bedingungen auszuhandeln.
Es beginnen turbulente Wochen im Norden Kanadas, zumal einer der Fischer verdächtigt wird, einen Drogendealer beraubt und ermordet zu haben. Hinzu kommt der Ärger mit einem Touristenschiff, dessen Kapitän durch rücksichtslose Fahrweise immer wieder die Netze und Fischräder beschädigt.
»Der Roman ist sachkundig und mit einem guten Gefühl für Sprache und Stil geschrieben, unaufdringlich humorvoll, dabei nicht belehrend.«
- Bulletin Jugend + Literatur
»Ein Abenteuerroman, der in gekonnter und unaufdringlicher Weise soziale Konflikte am Rande der Zivilisation thematisiert.«
- Der evangelische Buchberater
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
WOLFGANG BITTNER
Die Lachsfischer vom Yukon
Roman
Der Romankiosk
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DIE LACHSFISCHER VOM YUKON
Der Fremde
Auf dem Yukon
Das Blockhaus am Fluss
Kahinjik, der Weidenmann
Versammlung
Ein Ort namens Fortymile
Fischer, Jäger, Trapper
In Dawson City
Die Lachse kommen
Beunruhigende Ereignisse
Eine Verhaftung
Zivilisation
Der alte Jack Harry erzählt
Eine gute Saison
Gefährliche Begegnungen
Bärenjagd
Ein Notfall
Schlechte Nachrichten
Am Tod vorbei
Indianersommer
Das Buch
Stefan (Steve), ein junger Mann, ist auf der Flucht vor der Zivilisation und sucht die Weite und Ruhe der kanadischen Wildnis. In der alten Goldgräberstadt Dawson City am Yukon River trifft er eine Gruppe von Lachsfischern, die ein noch relativ unabhängiges, naturverbundenes Leben führen, aber mit ihrer schweren Arbeit im Vergleich zu den hohen Preisen, für die Lachs verkauft wird, nur sehr wenig verdienen. Die Fischer entschließen sich zu einem Streik, um bessere Bedingungen auszuhandeln.
Es beginnen turbulente Wochen im Norden Kanadas, zumal einer der Fischer verdächtigt wird, einen Drogendealer beraubt und ermordet zu haben. Hinzu kommt der Ärger mit einem Touristenschiff, dessen Kapitän durch rücksichtslose Fahrweise immer wieder die Netze und Fischräder beschädigt.
»Der Roman ist sachkundig und mit einem guten Gefühl für Sprache und Stil geschrieben, unaufdringlich humorvoll, dabei nicht belehrend.«
- Bulletin Jugend + Literatur
»Ein Abenteuerroman, der in gekonnter und unaufdringlicher Weise soziale Konflikte am Rande der Zivilisation thematisiert.«
- Der evangelische Buchberater
DIE LACHSFISCHER VOM YUKON
Der Fremde
Ein ungewöhnlich warmer Frühling hatte die Berghänge zu beiden Seiten des Yukonstromes sehr zeitig in diesem Jahr vom Schnee befreit und innerhalb weniger Tage war die Natur machtvoll aus ihrer winterlichen Erstarrung erwacht. An den Ufern blühten sogar schon die Weidenbüsche, die Laubbäume hatten sich hellgrün gefärbt und die schmalen nordischen Fichten setzten erste Triebe an, sodass der sonst so düstere Wald in diesen Tagen freundlich, fast anheimelnd wirkte. Obwohl es auf den Abend zuging, stand die Sonne noch hoch am Himmel - in wenigen Wochen würde sie ein paar Tage lang überhaupt nicht mehr untergehen.
Das Kanu, das mit der schnell fließenden Strömung von Süden her den breiten Fluss herabkam, trug nur einen einzelnen Mann, der an der Einmündung des Klondike auf das rechte Ufer zuhielt. Dort tauchten die Häuser der alten Goldgräberstadt Dawson City auf. Ein Damm, der erst vor kurzem aus Felsbrocken und Kies neu aufgeschüttet worden war, schützte sie vor Hochwasser. Mit wenigen kräftigen Paddelschlägen lenkte der Mann sein Boot auf die Anlegestelle zu, wo mehrere Motorboote und ein für den Touristenverkehr gedachter kleiner Raddampfer vertäut lagen. Einen der riesig großen richtigen Dampfer, die in früherer Zeit zum Transport von Gütern und Passagieren benutzt worden waren, hatte man, wohl als weitere Touristenattraktion, hoch auf das Ufer befördert und dort aufgebockt.
Der Ankömmling zog sein Kanu an Land, schob das darin liegende Gewehr in ein Futteral und verstaute es zwischen dem Gepäck, das aus einem Rucksack von erheblichen Ausmaßen und einem weniger gut gefüllten Proviantbeutel bestand. Dann warf er eine Plane darüber und befestigte sie mit einem Stück Schnur.
Er machte einen abgerissenen, etwas verwilderten Eindruck. Sein dunkelblondes Haar und der wuchernde Vollbart sahen ungepflegt aus, die derben halbhohen Schnürstiefel waren lehmverkrustet, die schmutzigen Jeans und das grün karierte Flanellhemd an manchen Stellen eingerissen. An dem gebräunten Gesicht und den Händen war zu erkennen, dass er schon längere Zeit unterwegs sein musste.
Die Ortschaft lag auf einer flachen Uferbank und erstreckte sich nach Osten hin einen knappen Kilometer bis an einen bewaldeten Abhang. Linker Hand überragte ein Bergkegel die Stadt, die während des großen Goldrausches Ende des neunzehnten, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts mit etwa 40.000 Bewohnern ihre Blüte erlebt hatte und jetzt vielleicht anderthalbtausend Menschen beherbergte. Sie wirkte altertümlich mit ihren Holzhäusern, ungepflasterten Straßen und den Trottoirs aus Brettern, malerisch. Manche der Gebäude hatten hohe Scheinfassaden, wie früher im amerikanischen Westen. Hier und da sah man verfallene oder vom Verfall bedrohte Häuser; die meisten Fassaden waren jedoch wieder hergerichtet und mit einem neuen Farbanstrich versehen worden.
Die Läden an der Frontstreet hatten bereits geschlossen. Lediglich eine Imbissbude war noch geöffnet. Der Mann kaufte sich ein paar Sandwiches und ging dann kauend in eine der Querstraßen hinein. Eine Gruppe amerikanischer Touristen mit Namensschildchen auf der Brust kam ihm entgegen, zumeist ältere Leute. Ihrem Gespräch nach zu urteilen, waren sie in einem Spielkasino gewesen. Die Männer trugen papageienbunte Hemden und breitkrempige Stetsonhüte; die Frauen waren mit goldenen Armbändern, Ohrringen und Halsketten behängt, an ihren Fingern glitzerten dicke Brillantringe. Vor dem Downtown- Hotel, einem kastenförmigen großen Holzgebäude, saßen auf der Kante des erhöhten hölzernen Bürgersteigs mehrere Indianer in der üblichen Kleidung: Jeans, karierte Hemden, Plastikschirmmützen. Eine in Packpapier eingewickelte Schnapsflasche machte unauffällig die Runde. Einer der Indianer stand auf und trat schwankend näher.
»Bist du hier fremd?«, fragte er mit schwerer Zunge.
»Ja, ich bin eben erst angekommen. Was gibt es?«
Der Indianer streckte ihm die Hand hin: »Ich heiße Frank. Und wie heißt du?«
»Mein Name ist Stefan.«
»Ste... Stef...«
»Du kannst mich Steve nennen.«
»Okay, Steve! Sag mal, hast du vielleicht einen Dollar für mich?«
Der Mann namens Steve kramte eine Dollarmünze aus seiner Hosentasche. »Wo kann man denn hier ein Bier trinken?«, fragte er.
»Nun, am besten gehst du ins Westminster, gleich dort um die Ecke. Da ist es um diese Zeit am gemütlichsten.«
Das Westminster war eine Kneipe, die aus einem großen wartesaalähnlichen Raum bestand, dessen eine Längsseite von der Theke eingenommen wurde. Davor saßen und standen ein paar Männer, andere saßen an den Tischen; dem Aussehen nach waren es Einheimische, darunter auch Indianer. Einige trugen Arbeitskleidung, manche sogar Gummistiefel, fast alle hatten Schirmmützen oder Hüte auf dem Kopf und wuchtige Messer am Gürtel. Steve setzte sich auf einen gerade frei gewordenen Barhocker und bestellte ein Bier. Er blickte sich im Raum um.
Die Musikbox in der Ecke spielte »Take me home«. An der gegenüberliegenden Wand hing ein gewaltiges Elchgeweih, an der hinteren Querwand, gegenüber der Eingangstür, das Fell eines Vielfraßes. Der Gast links neben ihm, ein großer dunkelbärtiger Bursche, war bereits angetrunken. Er schien Streit mit seinem Nachbarn gehabt zu haben und drehte sich jetzt herum.
»He!«, rief er, »wen haben wir denn da?«
Steve nahm sein Bier in Empfang und zahlte. Er trank einen tiefen Schluck. »Bleib ja ruhig, Hank«, sagte die Frau hinter der Theke, während sie das Geld einstrich.
»Keine Sorge, Sally«, entgegnete der Dunkelbärtige, »du kennst mich doch.«
»Gerade deswegen«, sagte sie kurz angebunden. »Wenn du Ärger machst, fliegst du raus.«
»Was hältst du davon, wenn wir einen Fünfliterkrug ausdrücken?«, fragte der Dunkelbärtige und stützte seinen linken Arm mit dem Ellenbogen auf die Theke. Die Hand hielt er Steve zum Drücken hin. »Du siehst, ich nehme den linken Arm. Deine Chance, den Vorteil lass ich dir.«
Die anderen Gäste an der Theke waren aufmerksam geworden und schauten herüber. Einer meinte lachend: »Mensch, Hank, erzähl ihm doch keine Märchen! Du bist doch sowieso Linkshänder.«
Steve stieg vorsichtshalber von seinem Hocker. »Ich habe einen harten Tag hinter mir«, sagte er, »und möchte in Ruhe mein Bier trinken, weiter nichts.« Er wandte sich ab, behielt den anderen aber von der Seite her im Auge.
»Du bist noch nicht lange hier?«, fragte ihn sein Nachbar zur Rechten.
»Nein, heute Abend erst angekommen.«
»Wohl auf der Durchreise?«
»Mal sehen. Vielleicht bleib ich ein paar Monate, falls ich irgendwo einen Job finde. Ich müsste meine Kasse wieder etwas aufbessern.«
Der andere nickte. »Suchst du eine bestimmte Arbeit?«, fragte er nach einer Weile.
Steve schüttelte den Kopf: »Nichts Bestimmtes.«
»Dann hätte ich eventuell etwas für dich. Ich heiße übrigens Norman.«
»Und ich heiße Steve.«
Sie gaben sich die Hand. Aber ehe sie ihr Gespräch fortsetzen konnten, schob sich der Dunkelbärtige wieder heran.
»Warum willst du nicht gegen mich antreten?«, rief er. »Du bist wohl feige! Du hast wohl Angst zu verlieren?« Er packte Steve am Arm und versuchte ihn zu sich herumzuziehen.
Steve schüttelte die Hand mit einem Ruck ab und trat einen Schritt zurück.
»Jetzt reicht es«, sagte Norman ruhig, doch mit deutlich vernehmbarer Stimme. »Du siehst doch, Hank, dass wir uns unterhalten.«
Dieser Norman schien einen gewissen Respekt zu genießen. Er war eher untersetzt, aber breitschultrig und drahtig; außerdem schien er sehr behände zu sein. Steve fiel erst jetzt auf, dass er indianisches Blut haben musste, jedenfalls zu einem Teil. Seine Haut war etwas dunkler, das Haar tiefschwarz, die Gesichtsform leicht mongolid.
Hank zog sich, in den Bart knurrend, auf seinen Platz zurück.
»Lass uns lieber an einen Tisch gehen«, schlug Norman vor. »Da können wir uns besser unterhalten.«
Sie nahmen ihre Gläser und setzten sich in eine Ecke. »Also, eventuell hätte ich einen Job für dich«, begann Norman von neuem. »Macht es dir was aus, wenn du ein paar Wochen nicht in die Stadt kommst?«
»Absolut nicht. Worum geht es denn?«
»Ich will ein neues Boot bauen. Und ein Fischrad. Bevor die Lachse kommen. Dazu brauche ich Hilfe, vielleicht auch später zum Fischen.«
»Du bist Lachsfischer?«
»Ein paar Wochen im Sommer. Im Winter stelle ich Fallen.«
»Und davon kann man leben?«
Norman bestellte einen Fünfliterkrug Bier. »Es geht«, erwiderte er. »Als Fischer komme ich durch den Sommer und als Trapper durch den Winter.« Er schenkte aus dem Krug ihre Gläser voll und trank seines zur Hälfte gleich wieder aus. »Ich habe stromabwärts eine Hütte«, berichtete er weiter. »Eigentlich wollte ich morgen schon hinfahren.«
»Was würdest du denn zahlen?«, fragte Steve.
»Sagen wir einmal tausendzweihundert Dollar im Monat«, erwiderte Norman.
Steve wiegte den Kopf. »Das ist nicht gerade viel«, meinte er.
»Du kriegst es bar auf die Hand«, sagte Norman. »Und du kannst es sparen, bis du wieder nach Dawson kommst, weil du vorher gar keine Gelegenheit haben wirst, es auszugeben. Natürlich stelle ich die Unterkunft und die Verpflegung.«
»Gut«, erwiderte Steve, »einverstanden. Wenn es einem von uns nicht passt, können wir uns leicht wieder trennen.« Sie prosteten einander zu und tranken ihre Gläser aus.
Plötzlich krachte es an der Theke und sie sahen, wie einer der Gäste der Länge nach auf dem Fußboden landete. Vor ihm stand mit geballten Fäusten der Dunkelbärtige und wollte ihm gerade in die Rippen treten. Da wurde er, bevor irgendein anderer noch ein- greifen konnte, von hinten von Sally mit einer Hand bei den Haaren, mit der anderen beim Hosenboden gepackt. Sie stieß ihn, ehe er sich versah, zur Tür und warf ihn hinaus; trotz ihrer erheblichen Körperfülle bewegte sie sich mit einer erstaunlichen Leichtigkeit. »Komm mir bloß nicht wieder herein!«, schrie sie ihm mit schriller Stimme hinterher. »Du hast ab heute hier Hausverbot!«
Der Gast hatte sich mittlerweile ächzend vom Boden erhoben. »So ein verdammter Mistkerl«, fluchte er und betastete sein Auge, das anzuschwellen begann. »So ein heimtückischer Hund. Wenn ich dem allein begegne, leg ich ihn um.«
»Nimm es nicht so tragisch, Tobias«, versuchte die Wirtin ihn zu beruhigen. Sie schenkte ihm ein neues
Bier ein und gab ihm einen nassen Lappen, den er auf sein Auge legte.
»Ich habe es kommen sehen«, brummte Norman. »Dieser Hank hat schon den ganzen Abend herumgestänkert. Wenn er nüchtern ist, lässt sich gut mit ihm umgehen. Er sucht, mit mehr oder weniger Erfolg, auf eigene Rechnung nach Gold. Aber sobald er betrunken ist, wird er ein Ekel. Tobias ist nun wirklich eine Seele von einem Menschen.«
Sie tranken den Krug leer und besprachen noch weitere Einzelheiten ihrer Unternehmung. Als die Wirtschaft kurz nach Mitternacht geschlossen wurde, verabredeten sie sich für den nächsten Morgen um acht Uhr zum Frühstück, und zwar bei Nancy's, einem Café an der Frontstreet.
Steve trottete zurück zu seinem Boot. Er breitete die Plane über den Kies, rollte seinen Schlafsack darauf aus und kippte das Kanu schräg darüber, um die nächtliche Feuchtigkeit abzuhalten und für den Fall, dass es wider Erwarten regnen sollte. Dann zog er Hose und Hemd aus, kroch in den Schlafsack und war nach wenigen Minuten eingeschlafen.
Auf dem Yukon
Norman bestrich einen Pfannkuchen dick mit Marmelade, rollte ihn zusammen und biss herzhaft hinein. »Du bist bei mir natürlich nicht versichert«, sagte er mit vollem Mund, »sodass ich auch keine Papiere von dir brauche.«
»Das ist mir recht«, erwiderte Steve. »Ich habe diesen Job auch nicht als Lebensstellung angesehen.«
»Wo hast du eigentlich übernachtet?«, fragte Norman.
»Am Anleger unter meinem Kanu.«
»Wie dumm von mir, du hättest auch auf dem Sofa in meinem Wohnwagen schlafen können. Ich hab gestern Nacht nicht mehr daran gedacht, hatte wohl zu viel getrunken.«
»Das macht nichts«, sagte Steve. »Ich habe nicht zum ersten Mal unterm Kanu genächtigt. Übrigens würde ich es gern mitnehmen.«
Norman nickte. »Das lässt sich einrichten.«
Sie aßen, tranken ihren Kaffee aus und fuhren dann mit Normans Auto, einem Pick-up, zum Baumarkt, wo sie Bretter und Sperrholzplatten aufluden, die dort schon bereitstanden. Anschließend kaufte Norman noch im Supermarkt ein. Sie schleppten zwei große Kartons voller Lebensmittel hinaus.
»Mehl und Reis habe ich noch genug«, schnaufte Norman. »Ich war in der vergangenen Woche schon in der Hütte und habe ein paar Sachen dorthin geschafft.«
Das Boot war ziemlich alt und zog Wasser, wie Norman erklärte. Aber es sah recht originell aus, denn auf den schwarzen Anstrich war am Bug mit weißer Farbe ein großes zähnestarrendes Haifischmaul gemalt. Nachdem sie alles aufgeladen und zum Schluss noch das Kanu oben auf dem Bretterstapel festgebunden hatten, fuhr Norman sein Auto zum Parkplatz. Dann, gegen elf Uhr, konnten sie endlich ablegen. Sie hatten nur wenig Freibord, aber das Wetter war gut und es ging stromabwärts.
Gemächlich trieben sie an der Fischfabrik, dem Touristenzentrum und der alten Sägemühle vorbei, deren Gebäude über den Uferdamm herausragten. »An diesen Deich kann ich mich nicht gewöhnen«, brummte Norman. »Als es ihn noch nicht gab, konnte man von hier aus die ganze Stadt sehen.« Er hantierte am Außenbordmotor, der knatternd ansprang. Gerade hatte das Fährschiff abgelegt, das an dieser Stelle Autos und Fußgänger über den Yukon beförderte. Auf der anderen Seite befanden sich noch einige Häuser, ein Campingplatz und die Straße nach Alaska.
Sie durchschnitten die Wellen der Fähre in Ufernähe und hielten dann auf die Mitte des Stromes zu, der sich hier zu weiten begann und einige Inseln umfloss. Auf der linken Seite lag das Wrack eines alten Raddampfers am Ufer, der dort vor Jahrzehnten gestrandet sein mochte, als Dawson City über den Wasserweg des Yukon noch mit Whitehorse im Süden und dem Pazifischen Ozean im Nordwesten in Verbindung stand; rechts tauchten nach wenigen Minuten die Häuser einer kleinen Ortschaft auf. Norman deutete hinüber. »Moosehide!«, überschrie er den Lärm des Motors. »Dort wohnt Louis, ein Freund von mir! Er ist Maler und mit einer Indianerin verheiratet! Du wirst ihn vielleicht kennen lernen!« Er schloss seine Jacke vor dem kalten Fahrtwind und drückte sich die Schirmmütze in die Stirn. An einer bewaldeten Insel zeigte er auf ein am Ufer liegendes Boot und brüllte: »Das gehört Charlie! Er ist ebenfalls Lachsfischer!« Im Wald war für einen Augenblick ein Zeltdach zu sehen. Ein Indianer trat aus dem Gebüsch und grüßte kurz mit erhobenem Arm. Dann waren sie schon vorbei.
Steve schob sich den Rucksack in den Rücken und streckte sich zwischen den Brettern und Kartons aus. Zu beiden Seiten zog die Uferlandschaft vorüber: bewaldete Hänge und Täler, manchmal Klippen und steile Felsen. Der Yukon wälzte seine aschfarbenen Wassermassen in zahlreichen Windungen mit wahrnehmbarer Geschwindigkeit nach Norden, begleitet von den Höhenzügen und Felsbarrieren der Ogilvie-Mountains. Ein majestätischer Strom. An manchen Stellen war er breit wie ein See, von Inseln durchsetzt und äußerst unübersichtlich; dann wieder verengte er sich auf ein paar hundert Meter. Aber immer war er gewaltig und erhaben. Hier und da hatte er sein Bett erweitert und die Uferböschung fortgerissen. Ganze Bäume führte er mit sich und das Treibholz staute sich vor den Inseln und Sandbänken.
Norman musste die Wasserfläche vor dem Boot ständig im Auge behalten, damit er keinen treibenden Baumstamm rammte und kein Holz in die Schraube bekam. Von Zeit zu Zeit schöpfte er, ohne den Blick zu senken, mit einer Konservendose Wasser, das sich zu seinen Füßen sammelte. Als sie zwischen zwei Inseln hindurchfuhren, deutete er nach vorn zu einem Sandstreifen: »Enten!« Rasch zog Steve sein Gewehr aus dem Futteral und entsicherte es. Das Boot beschrieb einen Halbkreis, zwei Schüsse krachten und drei Enten blieben auf der Strecke; kurz darauf schossen sie zwei weitere. Dann begann auf einmal der Motor zu stottern und verstummte schließlich völlig. Sie mussten ans Ufer paddeln.
»Dort drüben hatte Percy de Wolfe einmal seine Farm«, sagte Norman und zeigte auf ein von Buschwerk und niedrigen Bäumen überwuchertes flaches Gelände zwischen den Hügeln. Er hielt das Boot darauf zu und sie sprangen an Land. Sofort waren sie inmitten einer Wolke aus Mücken. Während der Fahrt auf dem kühlen Fluss waren sie von diesen Quälgeistern verschont geblieben, die hier an Land zu einer unerträglichen Plage wurden. Die beiden Männer rieben sich erst einmal das Gesicht, den Nacken und die Handrücken mit Mückenöl ein.
»Weißt du, wer Percy de Wolfe war?«, fragte Norman.
Steve verneinte.
»Man nannte ihn den ‘Eisernen Mann des Nordens’. Er starb 1951 im Alter von 73 Jahren und liegt in Dawson City begraben. Einer seiner Söhne, Willy de Wolfe, lebt noch dort; er muss inzwischen 80 Jahre alt sein - ziemlich ungewöhnlich in dieser rauen Gegend.«
Während sich Norman mit dem Motor beschäftigte, berichtete er von Percy, dem eisernen Mann, der jahrzehntelang selbst im tiefsten Winter bei Minustemperaturen von 30 bis 40 Grad Celsius die Post von Dawson City nach Eagle in Alaska brachte, dreimal im Monat. 210 Meilen war er hin und zurück mit dem Hundeschlitten über den zugefrorenen Yukon gefahren, manchmal auch mit dem Pferdeschlitten; im Sommer benutzte er natürlich das Boot. Dafür hatte er von Georg V. von England einen Orden erhalten. Als er starb, ging eine Epoche zu Ende. Die Zeit der Motorschlitten, Wasserflugzeuge, Hubschrauber, Kettensägen, Transistorradios und Fernseher begann.
Percy de Wolfe hatte noch ganz andere Zeiten erlebt. 1877 in Neuschottland geboren, war er bereits 1898 während des großen Goldrausches an den Klondike gezogen. Da er beim Goldsuchen kein Glück hatte, verdiente er sich in den folgenden Jahren seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsarbeiten. Er fällte Bäume, hackte Holz, fischte, jagte, beförderte Frachten. Aber sobald im Jahre 1903 die Nachricht von weiteren großen Goldfunden in Alaska die Runde machte, ging er kurz entschlossen nach Fairbanks. Als er abermals - wie viele andere, die dorthin geströmt waren - ohne Erfolg blieb, zog es ihn zurück an den Yukon. Er trat für kurze Zeit in den Dienst der North-West Mounted Police. 1915 erhielt er dann den Vertrag zur Beförderung der Post zwischen Dawson und Eagle.
»Er war einer der wirklichen Pioniere, einer dieser Oldtimer, die sich in der Wildnis noch auskannten«, sagte Norman und ein Unterton von Achtung schwang in seiner Stimme mit. »Heute gibt es das kaum noch, die Leute sind zu bequem geworden. Und ein paar Spinner, die zu viel Geld haben, machen aus Langeweile kostspieliges Überlebenstraining.« Er lachte. »Damals war die ganze Existenz dieser Menschen ein Überlebenstraining. Für mich und manch anderen in dieser Gegend ist es das manchmal auch heute noch, obwohl sich die Voraussetzungen ein wenig verbessert haben.«
Steve schaute sich in der näheren Umgebung um. Die Wildnis hatte die Rodung wieder völlig überwuchert und er fand lediglich ein paar morsche Balken. Der Ort sah nicht besonders einladend aus. Als er zum Boot zurückkam, war Norman gerade fertig geworden. »In diesen Breiten lohnen sich Ackerbau oder Viehzucht nicht«, sagte er und packte sein Werkzeug zusammen. »Der Boden ist zu schlecht und außerdem ist der Sommer zu kurz und das Klima überhaupt viel zu rau.« Nach einer Weile fügte er noch hinzu: »Wäre es anders, würden hier im Norden sicherlich erheblich mehr Menschen leben.«
»Gibt es eigentlich eine Ortschaft in der Nähe?«, fragte Steve.
»Dawson City«, erwiderte Norman. »Und stromabwärts ist Eagle in Alaska der nächste ständig bewohnte Ort. Dazwischen leben nur ein paar Lachsfischer während der Sommermonate und ein paar Trapper im Winter. Mag sein, dass es hier und da auch noch einen verrückten Prospektor gibt, der mit der Pfanne nach Gold sucht. Aber alle zusammen kannst du an zwei mal zwei Händen abzählen.«
Sie fuhren weiter. Hoch in der Luft zogen Kraniche keilförmig nach Norden. Einmal sahen sie eine Elchkuh quer über den Fluss schwimmen, der an dieser Stelle gut 800 Meter breit war. Dann, am frühen Nachmittag, bemerkte Steve am linken Ufer einen Rauchfaden, auf den Norman zuhielt. Am Strand lag ein Motorboot vertäut. Als sie landeten, kamen zwei Männer die Böschung herunter - sie sahen aus wie Buschräuber.
»Hallo, Norman«, grüßten sie. »Schön, dass du mal vorbeischaust.«
»Ihr könnt die Lachssaison wohl gar nicht erwarten?«, rief Norman und zu Steve gewandt fuhr er fort: »Der Dürre mit dem grauen Bart ist Robert, genannt Stick, und der Dicke mit den roten Locken ist Larry.«
»Was heißt dick?«, protestierte Larry und zog den Hosengurt hoch, der unter seinen auffällig vorgewölbten Bauch gerutscht war. »Meinst du etwa meine Muskeln?«
»Das hier ist Steve«, sagte Norman, »er hilft mir beim Bau eines neuen Bootes.«
Sie gaben sich die Hand. Dann stiegen sie die Böschung hinauf ins Camp. Das bestand lediglich aus einem Leinwandzelt und einer als Schutzdach zwischen vier Bäumen aufgespannten Plane, vor der ein Lagerfeuer brannte. Im Wald verstreut lagen allerlei Gerätschaften, Teile von Außenbordmotoren, alte Eimer, Töpfe und sogar ein verrosteter Kühlschrank.
»Wie wär's mit einem Schluck Kaffee?«, fragte Stick.
»Dazu sagen wir nicht nein«, war Normans Antwort.
Larry nahm zwei Blechnäpfe, die an Nägeln an einem Baum hingen, tauchte sie kurz in einen Wassereimer und goss aus dem Kaffeekessel ein, der am Rande des Feuers stand. Der Kaffee war bitter, aber sehr heiß und nach der Fahrt auf dem Fluss eine Wohltat. Steve merkte erst jetzt, wie durchgefroren er war.
»Wir sind etwas früher herausgekommen«, berichtete Stick, »weil wir noch das Boot streichen und die Netze flicken müssen. Außerdem konnten wir es bei diesem herrlichen Wetter nicht mehr in der Stadt aus- halten.«
»Außerdem lebt es sich hier ein bisschen billiger als in der Stadt«, ergänzte Larry grinsend und fügte wie nebenbei noch hinzu: »Ihr habt wohl nicht zufällig ein paar Flaschen Bier in eurem Boot?«
»Verdammt«, entfuhr es Norman, »wir haben doch tatsächlich das Bier vergessen.«
»Na, dann dreht euch erst mal eine Zigarette«, meinte Stick und ließ seinen Tabaksbeutel herumgehen. Sie setzten sich neben dem Feuer auf die Erde, rauchten und tranken Kaffee.
»Im Boot hegen ein paar Enten«, sagte Norman. »Wenn ihr wollt, könnten wir sie uns braten.«
»Eine gute Idee«, freute sich Larry. Er sprang auf, nahm die Axt und begann einige Holzkloben zu spalten, die in der Nähe des Zelts lagen.
Steve ging hinunter zum Boot. Er zog eine der Enten ab, nahm sie aus und spießte sie auf einen Weidenstock. Die Haut mit den Federn und die Innereien warf er ins Wasser.
Stick kam ihm nach, um zu helfen. »Du bist wohl neu in dieser Gegend?«, fragte er. »Ich habe dich in Dawson noch nie gesehen.«
»Gestern erst angekommen«, antwortete Steve. »Ich bin mit dem Kanu von Whitehorse den Yukon heruntergefahren.« Mehr schien er nicht über sich erzählen zu wollen und Stick fragte auch nicht nach. Dass der andere kein Greenhorn war, merkte man schon daran, wie er die Enten abzog.
Kurz darauf saßen sie zu viert um das Feuer herum, unterhielten sich und warteten, dass die Braten über der Glut gar wurden.
Das Blockhaus am Fluss
Steil in das Wasser abfallende Felswände wechselten mit bewaldeten Hängen, Höhenzügen und Tälern. Seit sie das Camp von Stick und Larry verlassen hatten, war erst eine Viertelstunde vergangen. Da wurde die Wasseroberfläche unruhiger. Vor sich sahen sie die meterhohen Wellen und Schaumkämme von Stromschnellen. Norman lenkte das Boot zur Mitte des Flusses, der hier von einer Sandbank geteilt wurde. Er schien sich genau auszukennen, denn entlang dieses Sandstreifens blieben sie in ruhigem Wasser. Und wenige Minuten später, hinter einer lang gestreckten Biegung, tauchte auf der linken Seite ein Blockhaus auf. Es lag am Fuß eines Bergrückens auf dem hohen Ufer des Yukon und war schon von fern zu sehen. Etwa 50 Meter weiter mündete ein Bach.