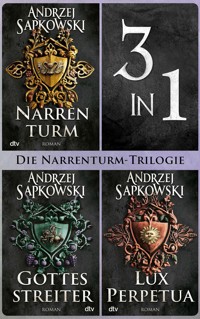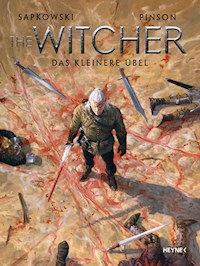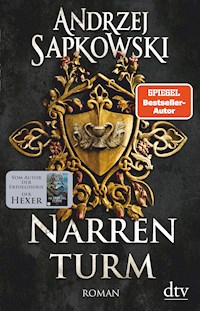
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Narrentum-Trilogie
- Sprache: Deutsch
»Als hätten sich Tolkien und Eco zusammengetan.« Generalanzeiger Bonn Schlesien, 1422. Reynevan von Bielau ist auf der Flucht. Weil man ihn in flagranti erwischt hat, mit der schönen Adele von Sterz. Doch nicht nur die Brüder des sich auf dem Hussiten-Kreuzzug befindenden Gatten sind hinter ihm her. Auch die Inquisition interessiert sich für ihn: Die Schergen haben bei ihm so manches gefunden, das den Verdacht auf Hexerei aufkommen lässt – oder ist er gar ein Hussit? Quer durch das damalige Mitteleuropa jagen sie den liebenswert-einfältigen Medicus, der, kaum einem Abenteuer entronnen, gleich ins nächste gerät. Selbst der Narrenturm der Inquisition bleibt Reynevan nicht erspart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1022
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Über das Buch
Schlesien, im Jahr des Herrn 1422. Reinmar von Bielau, von seinen Freunden Reynevan genannt, ist auf der Flucht. Der Liebe wegen, genauer gesagt, weil er in flagranti mit der schönen Adele von Sterz ertappt wurde, der Ehefrau des sich auf dem Kreuzzug gegen die Hussiten befindenden Gelfrad von Sterz. Aber auch die Schergen der Inquisition interessieren sich auf einmal für den jungen Medicus, denn was man nach seinem stürmischen Abgang bei ihm findet, ist neben medizinischen Schriften so manches, was den Verdacht auf Hexerei aufkommen lässt. Und wer weiß, vielleicht ist er ja gar ein Hussit? Der sündige Möchtegern-Lancelot hat also ernsthafte Probleme. Und das ist erst der Beginn seiner Abenteuer. Auf der Flucht quer durch das damalige Mitteleuropa gerät er in ein turbulentes Ränkespiel …
Von Andrzej Sapkowski sind bei dtv erschienen:
Die Abenteuer des jungen Witchers
Der letzte Wunsch
Zeit des Sturms
Das Schwert der Vorsehung
Die Witcher-Saga
Das Erbe der Elfen
Zeit der Verachtung
Feuertaufe
Der Schwalbenturm
Die Dame vom See
Kreuzweg der Raben
Geschichten aus der Welt des Witchers
Etwas endet, etwas beginnt
Das Universum des Andrzej Sapkowski
Alain T. Puysségur: The Witcher. Der Codex
Die Narrenturm-Trilogie
Narrenturm
Gottesstreiter
Lux perpetua
Andrzej Sapkowski
Narrenturm
Roman
Aus dem Polnischen von Barbara Samborska
Prolog
Das Ende der Welt brach Anno Domini 1420 doch nicht herein. Obwohl vieles darauf hindeutete, dass es käme.
Die düsteren Prophezeiungen der Chiliasten, die den Weltuntergang ziemlich präzise – nämlich für das Jahr 1420, den Monat Februar und den Montag, der auf den Festtag der heiligen Scholastica folgte – angekündigt hatten, erfüllten sich nicht. Die Tage der Strafe und der Rache, die dem Herannahen des Königreiches Gottes vorangehen sollten, kamen nicht. Obwohl sich die tausend Jahre erfüllt hatten, wurde Satan nicht aus seinem Kerker befreit, und er trat auch nicht hervor, um die Völker an allen vier Enden der Welt zu betören. Weder gingen sämtliche Sünder dieser Welt und alle Feinde Gottes durch Feuer und Schwert, Hunger und Hagel, die Hauer der Bestie, den Stachel des Skorpions zugrunde, noch durch das Gift der Schlange. Vergeblich harrten die Gläubigen der Ankunft des Messias auf dem Tábor, dem Schafberg, auf dem Oreb, Sion und dem Ölberg, vergeblich harrten die quinque civitates, die fünf auserwählten Städte, als die Pilsen, Klattau, Laun, Schlan und Saaz galten, auf die Wiederkunft Christi, wie sie die Prophezeiung Jesajas verkündet hatte. Das Ende der Welt brach nicht herein. Die Welt ging nicht unter und brannte nicht. Zumindest nicht die ganze.
Trotzdem ging es recht kurzweilig zu.
Köstlich, diese Biersuppe, in der Tat. Dick, würzig und reichlich geschmalzt. So eine habe ich lange nicht mehr gegessen. Ich danke Euch, werte Herren, für die Bewirtung, ich danke auch dir, Schankwirtin. Ihr fragt, ob ich ein Bier verachten würde? Nein, gewiss nicht. Wenn Ihr erlaubt, dann mit Vergnügen. Comedamus tandem, et bibamus, cras enim moriemur.
Der Weltuntergang kam also 1420 nicht, auch nicht ein Jahr später, nicht zwei, nicht drei, und auch nicht vier Jahre später. Die Dinge nahmen, wenn ich so sagen darf, ihren gewohnten Verlauf. Die Kriege dauerten an. Die Seuchen mehrten sich, die mors nigra wütete, Hunger breitete sich aus. Der Nächste erschlug und beraubte seinen Nächsten, begehrte dessen Weib und war überhaupt des Menschen Wolf. Den Juden bescherte man von Zeit zu Zeit ein kleines Pogrom und den Ketzern ein Scheiterhäufchen. An Neuheiten hingegen war dieses zu vermelden: Skelette hüpften mit lustigen Sprüngen über die Friedhöfe, der Tod schritt mit seiner Sense über die Erde, der Inkubus stahl sich des Nachts zwischen die zitternden Schenkel der Jungfrauen, und dem einsamen Reiter sprang in der Einöde eine Striege in den Nacken. Der Teufel mischte sich sichtbar in die Alltagsangelegenheiten ein und strich unter den Leuten umher, tamquam leo rugiens, brüllend wie ein Löwe, und Ausschau haltend, wen er verschlingen könnte.
Viele berühmte Leute starben in jener Zeit. Ja gewiss, es wurden auch viele geboren, aber es ist wohl so, dass man die Geburtsdaten in den Chroniken nicht verzeichnet und sich dann auch ums Verrecken keiner daran erinnert, außer den Müttern vielleicht, und Ausnahmen machten wohl nur Neugeborene mit zwei Köpfen oder wenigstens mit zwei Pimmeln. Aber was den Tod anlangt, ja, das ist ein sicheres Datum, wie in Stein gehauen.
Im Jahre 1421, am Montag nach dem Mittfastensonntag Oculi, verstarb in Oppeln nach sechsundsechzig verdienstvollen Jahren Johann, appellatus der Weihwedel, ein Herzog aus dem Geschlecht der Piasten und episcopus Wloclaviensis. Vor seinem Tode hatte er der Stadt Oppeln eine Schenkung von sechshundert Mark gemacht. Es heißt, ein Teil dieser Summe sei, dem letzten Willen des Sterbenden gemäß, an das berühmte Oppelner Hurenhaus »Zur Roten Gundel« gegangen. Die Dienste dieses Liebestempels, der sich hinter dem Kloster der Minderbrüder befand, hatte der Bischof, der ein Lebemann war, bis zu seinem Tode in Anspruch genommen – wenn auch gegen Ende seines Lebens nur mehr als Beobachter.
Im Sommer des Jahres 1422 hingegen – das genaue Datum ist mir entfallen – starb in Vincennes der englische König Heinrich V., der Sieger von Azincourt. Ihn nur knapp zwei Monate überlebend, starb der König von Frankreich, Karl VI., der schon seit fünf Jahren vollkommen verrückt war. Die Krone forderte der Dauphin, Karl, ein, der Sohn jenes Irren. Aber die Engländer erkannten seine Rechte nicht an. Denn seine eigene Mutter, die Königin Isabella, hatte schon längst erklärt, er sei ein Bankert, der außerhalb des Ehebettes mit einem Manne von gesundem Menschenverstand gezeugt worden sei. Da ein Bankert den Thron nicht erben kann, wurde ein Engländer zum rechtmäßigen Herrscher und Monarchen Frankreichs, der Sohn Heinrichs V., der kleine Heinrich, der gerade mal neun Monate alt war. Regent in Frankreich wurde der Oheim des kleinen Heinrich, John Lancaster, der Herzog von Bedford. Dieser hielt gemeinsam mit den Burgundern Nordfrankreich – mit Paris –, den Süden beherrschte der Dauphin zusammen mit den Armagnacs. Zwischen den beiden Reichen heulten die Hunde neben den Leichen auf den Schlachtfeldern.
Im Jahre 1423 aber verstarb am Pfingsttage im Schlosse Peñíscola unweit von Valencia Pedro de Luna, der avignonesische Papst, ein verdammter Schismatiker, der sich bis zu seinem Tode und entgegen den Beschlüssen zweier Konzilien Benedikt XIII. nannte.
Von den anderen, die in jener Zeit starben und an die ich mich noch erinnere, verschied Ernst der Eiserne von Habsburg, Fürst der Steiermark, Kärntens, der Krain, Istriens und Triests. Es starb Johann von Ratibor, Herzog aus Piasten- und Přzemysliden-Geschlecht gleichermaßen. Jung verstarb Wenzeslaus, der dux Lubiniensis, es starb Herzog Heinrich, der gemeinsam mit seinem Bruder Johann Herr von Münsterberg war. In der Fremde verschied Heinrich, dictus Rumpoldus, Herzog von Glogau und Landvogt der Oberlausitz. Nikolai Trąba verstarb, Erzbischof von Gnesen, ein ehrenwerter und fähiger Mann. In der Marienburg starb Michael Küchmeister, der Hochmeister des Ordens der Allerheiligsten Jungfrau Maria. Auch Jakob Pęczak, genannt Fisch, der Müller von Beuthen, starb. Ha, ich muss zugeben, der ist etwas weniger bekannt und berühmt als die oben Genannten, aber er hat ihnen gegenüber den Vorteil, dass ich ihn persönlich kannte und manchmal mit ihm gebechert habe. Mit den früher Erwähnten ist das irgendwie nie zustande gekommen.
Auch in der Kultur nahmen wichtige Ereignisse ihren Lauf. Es predigte der beseelte Bernhardin von Siena, es predigten Jan Kanty und Johannes von Capestrano, es lehrten Johannes Carlerius de Gerson und Pawel Włodkowic, Christine de Pisan und Thomas Hemerken a Kempis schrieben gelehrte Werke. Vavřinec von Břzezová verfasste seine wunderschöne Chronik. Andrej Rubljow malte seine Ikonen, es malte Masaccio, es malte Robert Campin. Jan van Eyck, der Hofmaler Johanns von Bayern, schuf für die St.-Bavo-Kathedrale von Gent seinen »Altar des Mystischen Lammes«, ein überaus schönes Polyptychon, das die Kapelle des Jodocus Vyd ziert. In Florenz beendete Meister Pippo Brunelleschi die Errichtung der Kuppel über den vier Schiffen der Kirche Santa Maria dei Fiori. Wir in Schlesien waren auch nicht schlechter – bei uns hat Herr Peter von Frankenstein in der Stadt Neisse den Bau der sehr stattlichen St.-Jakobs-Kirche vollendet. Gar nicht weit von hier, von Militsch, entfernt, wer noch nicht da war und sie noch nicht gesehen hat, dem böte sich jetzt Gelegenheit dazu.
In jenem Jahr 1422 beging der alte Litauer, der polnische König Jagiełło, mitten im Karneval in der Burg Lida mit großem Pomp seine Hochzeit – er heiratete Sonka Holszańska, ein blühendes, blutjunges Mädchen von siebzehn Jahren, das demnach mehr als ein halbes Jahrhundert jünger war als er. Wie es hieß, war jenes Mädchen wohl eher ihrer Schönheit, denn ihrer Sitten wegen berühmt. Ja, und es sollte auch später noch viel Ärgernis daraus erwachsen. Jogaila aber, als hätte er völlig vergessen, wie man sich eines jungen Weibes erfreut, zog schon im Frühsommer gegen die preußischen Herren, will heißen, gegen die Ritter mit dem Kreuz. So kam es auch, dass der neue Hochmeister des Deutschen Ordens, Herr Paul von Rusdorf, Küchmeisters Nachfolger, gleich nach der Amtseinführung Bekanntschaft mit den polnischen Waffen schließen musste – und zwar eine recht stürmische Bekanntschaft. Wie es da auf dem Ehelager mit Sonka bestellt war, wird man vergeblich zu erfahren suchen, um den Deutschordensrittern den Hintern zu versohlen, war Jogaila aber immer noch Manns genug.
Eine Menge wichtiger Dinge ereigneten sich in jener Zeit auch im Königreich Böhmen. Eine große Erschütterung gab es da, viel Blutvergießen und unaufhörlich Krieg. Wovon rede ich da … Wollet einem alten Mann vergeben, Ihr edlen Herren, aber Furcht ist ein menschlich Ding, und ist schon so mancher für ein unbedachtes Wort am Hals gepackt worden. Auf Euren Wämsern, Ihr Herren, sehe ich wohl die polnischen Wappen der Nałęcz und der Habdank, und auf den Euren, edle Böhmen, die Hähne der Herren von Dobrá Voda, und die Ritterpfeile von Strakonice … Und Ihr, Marsjünger, seid ein Zettritz, ich erkenn’s am Bisonkopf im Wappen. Das Eurige, Herr Ritter, das schräge Schachbrett und die Greifen, kann ich nirgendwo zuordnen. Es lässt sich nicht ausschließen, dass du, Frater aus dem Orden des heiligen Franziskus, nicht alles dem Heiligen Officium zuträgst, dass Ihr es tut, Brüder von St. Dominik, ist wohl gewiss. So seht Ihr selbst, dass es mir nicht leicht wird, in einer so internationalen und auch so unterschiedlichen Gesellschaft von den böhmischen Dingen zu berichten, weil ich nicht weiß, wer hier für Albrecht und wer für den polnischen König und den Prinzen ist. Wer hier für Menhart von Hradec und Oldřich von Rožmberk ist, und wer für Hynek Ptąček von Pirkstajn und Jan Kolda von Žampach. Wer auf des Comes Spytko von Melsztyńskis Seite steht und wer ein Anhänger des Bischofs von Oels ist. Ich habe gewiss keine Sehnsucht nach Schlägen, aber ich weiß wohl, dass ich welche einstecken werde, weil ich schon mehrmals welche einstecken musste. Wie das, fragt Ihr? Das ist so: Wenn ich sage, dass in den Zeiten, von denen ich erzähle, die tapferen Hussiten den Deutschen heftig das Wams durchgewalkt und sie in drei Kreuzzügen hintereinander zu Pulver und Staub zermahlen haben, dann währt es nicht lang, bis mich die einen aufs Haupt schlagen. Sage ich aber, dass in den Schlachten bei Vítkov, Vyšehrad, Saaz und Deutsch-Brod die Häretiker die Kreuzfahrer nur mit teuflischer Hilfe besiegt haben, ergreifen mich die anderen und prügeln mich durch. Daher wär’s mir lieber zu schweigen, aber wenn ich schon reden muss, dann mit der Neutralität eines Berichterstatters – berichten, wie man sagt, sine ira et studio, knapp, kühl, sachlich, und ohne einen Kommentar von meiner Seite hinzuzufügen
So sage ich denn auch nur kurz: Im Herbst des Jahres 1420 lehnte der polnische König Jogaila die böhmische Krone ab, die die Hussiten ihm angetragen hatten. In Krakau wähnte man, dass der litauische dux Witold, der schon immer gekrönt werden wollte, die Krone nehmen würde. Um aber weder den römischen König Sigismund noch den Papst über Gebühr zu ärgern, wurde Zygmunt, der Neffe Witolds und Sohn Korybuts, nach Böhmen gesandt. Er stand am Tage des heiligen Stanislaus im Jahre 1422 im goldenen Prag an der Spitze von fünftausend polnischen Rittern. Aber schon am Dreikönigstag des darauf folgenden Jahres musste das Prinzchen nach Litauen zurückkehren, so wütend waren der Luxemburger und Oddo Colonna, seinerzeit der Heilige Vater Martin V., über die böhmische Thronfolge. Aber schon 1424, am Vorabend von Mariä Heimsuchung, war der Sohn des Korybut zurück in Prag. Diesmal gegen den Willen Jogailas und Witolds, gegen den Willen des Papstes, gegen den Willen des römischen Königs. Das heißt als Aufrührer und Geächteter. An der Spitze ebensolcher Aufrührer und Geächteter. Und nicht nur Tausender, wie vorher, sondern Hunderttausender.
In Prag hingegen fraß der Umsturz, wie Saturn, seine eigenen Kinder, und eine Seite maß sich mit der anderen. Jan von Želiva, den man am Montag nach dem Sonntag Reminiscere des Jahres 1422 geköpft hatte, wurde schon im Mai desselben Jahres in allen Kirchen als Märtyrer beweint. Kühn stellte sich das goldene Prag auch Tabor entgegen, aber hier hatte die Sense auf den Stein getroffen. Nämlich auf Jan Žižka, den großen Kämpen. Anno Domini 1424, am zweiten Tage nach den Nonen des Juni, erteilte Žižka den Pragern bei Malschau am Flüsschen Bohynka eine schreckliche Lehre. Viele, o gar viele Witwen und Waisen gab es nach dieser Schlacht in Prag.
Wer weiß, vielleicht bewirkten die Tränen jener Waisen, dass kurz darauf, am Mittwoch vor dem Festtage des St. Gallus in Přybyslav nahe der mährischen Grenze Jan Žižka von Trocnov, oder wie es später hieß, vom Kelch, verstarb. Begraben hat man ihn in Hradec Králové, und dort liegt er. Und so wie vorher die einen seinetwegen geweint hatten, weinten jetzt die anderen um ihn. Dass er sie als Waisen zurückgelassen hatte. Deswegen nannten sie sich »die Waisen« …
Aber daran erinnert Ihr Euch wohl alle noch. Weil das vor noch gar nicht so langer Zeit gewesen ist. Und jetzt sind das schon … historisch gewordene Zeiten.
Ihr wisst doch, werte Herren, woran man erkennt, ob eine Zeit historisch ist? Daran, dass vieles schnell geschieht.
Damals ereignete sich sehr vieles sehr schnell. Der Weltuntergang war, wie gesagt, nicht gekommen. Obwohl vieles darauf hindeutete, dass er kommen würde. Denn es gab – genauso, wie die Prophezeiungen es wollten – große Kriege und große Plagen für das Christenvolk, und viele Männer starben. Es schien, als wolle Gott selbst, dass der Entstehung einer neuen Ordnung der Niedergang der alten vorausginge. Es schien, als nahte die Apokalypse. Als käme die Bestie mit zehn Hörnern aus der Hölle. Als sähe man die vier Reiter im Rauch der Brände und der blutgetränkten Felder. Als ertönten jeden Augenblick die Trompeten und die Siegel würden zerbrochen. Als würde Feuer vom Himmel fallen. Als würde der Stern Wermut auf den dritten Teil der Ströme und auf die Quellen der Wasser fallen. Als würde der irre gewordene Mensch, der die Fußspuren eines anderen auf der Brandstätte erblickte, unter Tränen jene Spuren küssen.
Manchmal war es so schlimm, dass einem, ich bitte um Vergebung, edle Herren, der Arsch auf Grundeis ging.
Das war eine bedrohliche Zeit. Eine böse. Und wenn es Euer Wille ist, so werde ich davon erzählen. Um die Langeweile zu vertreiben, solange der Regen, der uns hier in der Schenke festhält, nicht aufhört.
Ich erzähle, wenn Ihr wollt, von jenen Zeiten. Von den Menschen, die damals lebten, wie auch von jenen, die damals lebten, aber keine Menschen waren. Ich erzähle davon, wie die einen, wie die anderen sich mit dem maßen, was die Zeit ihnen brachte. Mit ihrem Schicksal. Und mit sich selbst.
Diese Geschichte beginnt freundlich und ergötzlich, undurchsichtig und zärtlich – mit einer angenehmen, innigen Liebe. Aber das soll Euch, liebwerte Herren, nicht täuschen.
Lasst Euch dadurch nicht täuschen.
Erstes Kapitel
in dem es dem Leser vergönnt ist, Reinmar von Bielau kennen
zu lernen, genannt Reynevan, und dies sogleich von
seiner besten Seite, wozu eine geläufige Kenntnis der
ars amandi, der Geheimnisse der Reitkunst und des Alten
Testaments zu zählen sind, wenn auch nicht unbedingt in
dieser Reihenfolge. In diesem Kapitel ist auch von Burgund
die Rede, im weiteren, wie auch im engeren Sinne.
Durch das offene Kammerfenster erblickte man vor dem dunklen Hintergrund des Himmels, über den eben noch ein Gewitter gezogen war, drei Türme – den Rathausturm, der am nächsten stand, etwas weiter entfernt den schlanken, mit seinen neuen roten Dachziegeln in der Sonne funkelnden Turm der St.-Johannis-Kirche und dahinter den rundlichen des Fürstenschlosses. Um den Kirchturm jagten die Schwalben, aufgescheucht vom eben verklungenen Geläut der Glocken. Die Glocken waren schon vor einer guten Weile verstummt, aber die ozongeschwängerte Luft schien immer noch von ihrem Klang zu vibrieren.
Vor wenigen Augenblicken hatte es auch von den Türmen der Liebfrauenkirche und der Fronleichnamskirche geläutet. Diese aber waren von dem Kammerfenster im Dachgeschoss des hölzernen Anbaus, der wie ein Schwalbennest am Gebäudekomplex des Hospitals und Klosters der Augustiner klebte, nicht auszumachen.
Es war die Zeit der Sexta. Die Mönche hatten ihr Deus in adjutorium begonnen. Reinmar von Bielau, den seine Freunde Reynevan nannten, drückte einen Kuss auf das schweißnasse Schlüsselbein der Adele von Sterz, befreite sich aus ihrer Umarmung und lag schwer atmend neben ihr auf dem von der Liebe dampfenden Laken.
Von jenseits der Mauer, von der Klostergasse her, drang Geschrei, Wagenrollen, das dumpfe Gepolter leerer Fässer und der helle Klang von Zinn- und Kupfergeschirr herauf. Es war Mittwoch, Markttag also, der wie immer zahlreiche Händler und Kauflustige nach Oels brachte.
Memento, salutis auctor,
quod nostri quondam corporis,
ex illibata virgine
nascendo, formam sumpseris.
Maria mater gratiae,
mater misericordiae,
tu nos ab hoste protege,
et hora mortis suscipe …
Sie singen schon die Hymne, dachte Reynevan und umfasste mit einer trägen Bewegung die aus dem fernen Burgund stammende Adele, das Eheweib des Ritters Gelfrad von Sterz.
Schon die Hymne. Unglaublich, wie schnell Momente des Glücks die Zeit verstreichen lassen. Man wünschte, dass sie ewig währten, und sie entschwinden einem flüchtigen Traume gleich …
»Reynevan … Mon amour … Mein göttlicher Jüngling …«, unterbrach Adele wild und verlangend seine Halbschlafträumereien. Auch sie war sich der verrinnenden Zeit bewusst, dachte aber keineswegs daran, sie an philosophische Überlegungen zu verschwenden.
Adele war nackt, völlig und gänzlich nackt.
Andere Länder, andere Sitten, dachte Reynevan, wie interessant ist es doch, Länder und Leute kennen zu lernen. Die Schlesierinnen und die Deutschen zum Beispiel erlauben einem nie, wenn es zur Sache geht, das Hemd höher als bis zum Bauchnabel zu lüpfen. Die Polinnen und die Böhminnen ziehen es sich selbst, und sogar gern, bis über die Brust hinauf, würden sich aber um nichts auf der Welt ganz ausziehen. Die Burgunderinnen hingegen – oh! werfen sofort alles ab, ihr heißes Blut duldet anscheinend beim Liebestaumel kein Fetzchen Stoff auf der Haut. Ach, welch ein Glück ist es doch, die Welt kennen zu lernen. Burgund muss gewiss sehr schön sein. Herrliche Landschaften muss es dort geben. Aufstrebende Berge … Steile Hügel … Täler …
»Ach, aaach, mon amour«, stöhnte Adele von Sterz, sich mit ihrer ganzen burgundischen Landschaft nach Reynevans Händen sehnend.
Reynevan, unter uns gesagt, zählte erst dreiundzwanzig Lenze und hatte noch nicht eben viel von der Welt erfahren. Er kannte einige wenige Böhminnen, noch weniger Schlesierinnen und Deutsche, eine Polin, eine Zigeunerin, und was andere Völkerschaften anlangte, so hatte er nur einmal von einer Ungarin einen Korb bekommen. Seine erotischen Erfahrungen, wenngleich von vielversprechendem Anfang, konnten wohl mit keinerlei Maß gemessen werden und waren, ehrlich gesagt, sowohl nach Anzahl wie auch nach Qualität ziemlich dürftig. Aber auch so erfüllten sie ihn mit Stolz und Genugtuung. Reynevan hielt sich – wie jeder heißblütige Jüngling – für einen großen Verführer und Experten in Sachen Liebe, für den das weibliche Geschlecht keine Geheimnisse birgt. In Wahrheit verhielt es sich so, dass die bisherigen elf Begegnungen mit Adele von Sterz Reynevan mehr über die ars amandi gelehrt hatten als sein dreijähriges Studium in Prag. Reynevan bekam nicht einmal mit, dass Adele ihn etwas lehrte – so sicher war er sich, dass sein angeborenes Talent hier eine große Rolle spielte.
Ad te levavi oculos meos
qui habitas in caelis.
Ecce sicut oculi servorum
ad manum dominorum suorum
sicut oculi ancillae in manibus dominae suae
ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum,
donec misereatur nostri.
Miserere nostri Domine …
Adele packte Reynevan am Nacken und zog ihn zu sich herunter. Reynevan griff sich, was sich gehörte und liebte sie. Er liebte sie heftig und eindringlich – und, als wäre damit noch nicht genug getan – flüsterte ihr seine Liebesbekundungen ins Ohr. Er war glücklich. Sehr glücklich.
Das Glück, das er in vollen Zügen genoss, verdankte Reynevan – mittelbar, versteht sich – einem Heiligen des Herrn. Das hatte sich so zugetragen:
Reue für seine Sünden verspürend, die nur sein Beichtvater kannte, hatte sich der schlesische Ritter Gelfrad von Sterz auf Pilgerfahrt zum Grabe des heiligen Jakob begeben. Aber unterwegs änderte er seinen Plan. Er gelangte zu der Ansicht, dass es nach Santiago de Compostela entschieden zu weit sei, und da der heilige Ägidius auch nicht von schlechten Eltern war, würde eine Wallfahrt nach St. Gilles vollauf genügen. Aber Gelfrad war es auch nicht gegeben, bis nach St. Gilles zu gelangen. Er kam gerade bis nach Dijon, wo er durch Zufall eine sechzehnjährige Burgunderin, die reizende Adele de Beauvoisin, kennen lernte. Adele, die Gelfrad ganz und gar bezauberte, war eine Waise, die zwei leichtfertige und sittenlose Brüder hatte, die ohne viel Federlesens ihre Schwester dem schlesischen Ritter zur Ehe gaben. Obwohl Schlesien der Vorstellung der Brüder zufolge irgendwo zwischen Euphrat und Tigris lag, war Sterz in ihren Augen der ideale Schwager, der denn auch nicht sonderlich hartnäckig um die Mitgift stritt. Auf diese Weise war die Burgunderin nach Heinrichsdorf gelangt, einem Dorf bei Münsterberg, das Gelfrad als Erblehen erhalten hatte. In Münsterberg wiederum war sie, nun schon Adele von Sterz, Reynevan von Bielau ins Auge gestochen. Was auf Gegenseitigkeit beruhte.
»Aaaach!«, schrie Adele von Sterz und umklammerte mit ihren Beinen Reynevans Rücken. »Aaaa-aaach!«
Nie im Leben wäre es zu diesen Achs gekommen, und alles wäre bei verstohlenen Blicken und heimlichen Gesten geblieben, wäre da nicht ein dritter Heiliger gewesen, nämlich der heilige Georg. Auf ihn nämlich hatte Gelfrad von Sterz einen heiligen Eid geleistet, ähnlich wie die übrigen Kreuzfahrer, als er sich im September 1422 einem der Kreuzzüge gegen die Hussiten anschloss, die der Kurfürst von Brandenburg und der Markgraf von Meißen organisierten. Große Erfolge konnten die Kreuzfahrer auf ihrem Konto nicht verbuchen, sie drangen in Böhmen ein und verließen es alsbald wieder, ohne den Kampf mit den Hussiten riskiert zu haben. Aber obwohl es keine Kämpfe gegeben hatte, gab es doch Opfer – eines davon war eben Gelfrad, der sich bei einem Sturz vom Pferd das Bein gebrochen hatte und sich jetzt, wie aus Briefen an die Familie hervorging, immer noch irgendwo im Land an der Pleiße kurierte. Adele, die zu der Zeit als Strohwitwe bei der Familie ihres Gatten in Bernstadt wohnte, konnte sich ohne jedes Aufheben mit Reynevan in der Kammer des Augustinerklosters von Oels treffen, unweit des Spitals, in dem Reynevan sein Kabinett hatte.
Die Mönche in der Fronleichnamskirche begannen mit dem Gesang des zweiten der drei zur Sexta üblichen Psalmen. Wir müssen uns beeilen, dachte Reynevan. Beim capitulum, spätestens aber beim Kyrie muss Adele aus dem Hospital verschwinden. Niemand darf sie hier sehen.
Benedictus Dominus
qui non dedit nos
in captionem dentibus eorum.
Anima nostra sicut passer erepta est
de laqueo venantium …
Reynevan küsste Adeles Hüfte, dann aber, angeregt von dem Gesang der Mönche, tauchte er hinab in die Blume aus Henna und Nardenöl, aus Zuckerrohr und Zimt, aus Myrrhe und Aloe, aus allen duftenden Harzen. Adele wölbte sich ihm entgegen, streckte ihre Arme aus, vergrub ihre Finger in seinem Haar und unterstützte mit sanften Hüftbewegungen seine biblische Initiative.
»Oh, oooooh … Mon amour … Mon magicien … Du göttlicher Jüngling … Du Zauberer …«
Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion
non commovebitur in aeternum,
qui habitat in Hierusalem …
Schon der dritte Psalm, dachte Reynevan. Wie flüchtig sind doch die Momente des Glücks …
»Revertere«, brummte er kniend. »Dreh dich um, dreh dich um, kleine Sulamith.«
Adele wandte sich um, kniete, beugte sich vor, umfasste kraftvoll das Kopfende aus Lindenholz und präsentierte auf diese Weise Reynevan die ganze berückende Schönheit ihrer Rückansicht. Aphrodite Kallipygos, dachte er, während er sich ihr näherte. Die Anspielung auf die Antike und der erotische Anblick bewirkten, dass er sich, wie weiland Sankt Georg auf den Drachen von Silena, mit gezückter Lanze auf sie warf. Er kniete hinter Adele wie König Salomon hinter dem Thron aus Libanonzedern, mit beiden Händen umfasste er den Weinberg Engadda.
»Einer Stute im Gespanne des Pharaos gleichst du, meine Freundin«, flüsterte er an ihrem Hals, der ihm wohlgestaltet wie Davids Turm erschien. Und er setzte seinen Vergleich in die Tat um.
Adele stöhnte zwischen den zusammengebissenen Zähnen hindurch. Reynevan schob langsam seine Hände an ihren schweißnassen Seiten nach oben, erstieg die Palme und erhaschte die Zweiglein ihrer schwellenden Früchte. Die Burgunderin warf den Kopf nach hinten wie eine Stute vor dem Sprung über ein Hindernis.
Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum,
super sortem iustorum
ut non extendant iusti
ad iniquitatem manus suas …
Adeles Brüste hüpften unter Reynevans Händen wie ein Zwillingspärchen junger Gazellen.
Er versenkte eine Hand in ihren Granatenhain.
»Duo … ubera tua …«, stöhnte er, »sicut duo … hinnuli capreae gemelli … qui pascuntur … in liliis … Umbilicus tuus crater … tornatilis numquam … indigens poculis … Venter tuus … sicut acervus … tritici vallatus liliis …«
»Ach … aaaach … aaach …«, kontrapunktierte die des Lateinischen nicht mächtige Burgunderin.
Gloria Patri, et Filio et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper
et in saecula saeculorum, amen.
Alleluia
Die Mönche sangen. Und Reynevan, der Adele von Sterz’ Hals küsste, außer sich, berauscht, über Berge rennend, über Hügel hüpfend, saliens in montibus, transiliens colles, war für seine Geliebte wie ein junger Hirsch in den Balsambergen. Super montes aromatum.
Die Tür wurde mit lautem Knall und solcher Wucht aufgestoßen, dass der Türzapfen aus dem Futter sprang und wie ein Meteor durch das Fenster flog. Adele schrie schrill und erschrocken auf. Die Brüder von Sterz stürmten in die Kammer. Klar war, dass dies kein freundschaftlicher Besuch war. Reynevan rollte sich aus dem Bett, das ihn von den Eindringlingen trennte, haschte nach seinen Kleidern und begann sich in Windeseile anzuziehen. Es gelang ihm auch einigermaßen, aber nur deshalb, weil sich der Frontalangriff der Brüder Sterz gegen ihre Schwägerin richtete.
»Du Hure!«, brüllte Morold von Sterz und riss die nackte Adele aus dem Bett. »Du abscheuliche Hure!«
»Du sittenlose Buhle!«, fiel Wittich, sein älterer Bruder, ein. Wolfher hingegen, der älteste nach Gelfrad, brachte kein Wort hervor; bleich vor Wut, hatte es ihm die Sprache verschlagen. Mit voller Wucht schlug er Adele ins Gesicht. Die Burgunderin stieß einen lauten Schrei aus. Wolfher setzte nach, diesmal von der anderen Seite.
»Wage es nicht, sie zu schlagen, Sterz!«, schrie Reynevan, aber seine Stimme brach und zitterte vor Schreck und lähmender Hilflosigkeit wegen seiner erst halb heraufgezogenen Hosen. »Wage es nicht, hörst du!«
Der Schrei blieb nicht ohne Folgen, wenn diese auch nicht ganz der ursprünglichen Absicht entsprachen. Wolfher und Wittich ließen von ihrer ungetreuen Schwägerin ab und stürzten sich auf Reynevan. Ein Hagel von Schlägen und Tritten prasselte auf den Jungen nieder.
Er duckte sich unter den Stößen, aber anstatt sich zu verteidigen oder zu schützen, zog er krampfhaft seine Hosen hoch, als wären sie keine gewöhnlichen Beinkleider, sondern eine magische Rüstung, die unverwundbar machte, der Zauberpanzer eines Astolph oder Amadis von Wales. Aus den Augenwinkeln heraus sah er, dass Wittich ein Messer hervorzog.
Adele schrie auf.
»Lass das!«, knurrte Wolfher seinen Bruder zornig an. »Nicht hier!«
Reynevan hatte sich inzwischen auf die Knie erhoben.
Wittich, wutschnaubend und mit zornesbleichem Gesicht, sprang auf ihn zu und versetzte ihm einen Fausthieb, der ihn wieder zu Boden warf. Adele kreischte laut, aber der Schrei brach ab, als Morold ihr ins Gesicht schlug und sie an den Haaren zerrte.
»Wagt es nicht …«, wimmerte Reynevan, »… sie zu schlagen, ihr Schurken!«
»Du Hundesohn!«, brüllte Wittich. »Warte nur!«
Er sprang wieder auf ihn zu, schlug und trat zu, einmal, ein zweites Mal. Beim dritten Schlag hielt Wolfher ihn auf.
»Nicht hier«, sagte er ruhig, aber es war eine grausige Ruhe. »In den Hof mit ihm. Wir nehmen ihn mit nach Bernstadt. Die Hure auch.«
»Ich bin unschuldig!«, wimmerte Adele von Sterz. »Er hat einen Zauber über mich geworfen. Er hat mich behext. Das ist ein Hexenmeister! Le sorcier! Le diab …«
Morold schnitt ihr das Wort ab und brachte sie mit einem Hieb zum Schweigen.
»Still, du verdammtes Luder! Du wirst schon noch genug Gelegenheit zum Schreien bekommen. Warte nur noch ein Weilchen!«
»Wagt es nicht, sie zu schlagen!«, brüllte Reynevan.
»Du kriegst auch Gelegenheit zum Schreien, du Hähnchen! Los, in den Hof mit ihm.«
Der Weg vom Dachgeschoss hinab führte über eine ziemlich steile Stiege. Die Brüder von Sterz stießen Reynevan hinunter, der Junge fiel auf das Podest, nicht ohne einen Teil der hölzernen Balustrade mit sich zu reißen. Bevor er wieder auf die Füße kam, packten sie ihn erneut und warfen ihn direkt auf den Hof, in den Sand, den dampfende Pferdeäpfel zierten.
»Na bitte, na bitte!«, sagte Niklas von Sterz, der die Pferde hielt, der jüngste der Brüder und ein rechter Grünschnabel. »Wer ist uns denn hier vor die Füße gefallen? Wenn das nicht Reinmar von Bielau ist!«
»Der belesene Klugscheißer Bielau!«, prustete Jens von Knobelsdorf, genannt der Uhu, ein Gevatter und Verwandter der Sterz’, er beugte sich über den mühsam im Sand herumkriechenden Reynevan. »Der redegewandte Klugscheißer Bielau!«
»Der beschissene Poet!«, versetzte Dieter Haxt, ein weiterer Freund der Familie. »So ein gottverdammter Abaelard!«
»Und damit wir ihm beweisen, dass wir auch belesen sind«, sagte Wolfher, der die Stiege herunterkam, »machen wir mit ihm das Gleiche, was sie mit Abaelard getan haben, als sie ihn mit Héloïse erwischten. Punkt für Punkt das Gleiche. Na, Bielau? Wie gefällt dir das, ein Kapaun zu werden?«
»Fick doch einen Sterz!«
»Was? Was?« Obwohl es schier unmöglich schien, wurde Wolfher Sterz noch eine Spur blasser. »Das Hähnchen wagt es noch, den Schnabel aufzureißen? Es wagt zu krähen? Gib mir den Ochsenziemer, Jens!«
»Wage es nicht, ihn zu schlagen!«, ließ sich völlig unerwartet Adele vernehmen, die man schon, wenn auch nicht ganz bekleidet, die Stiege hinabführte. »Wage es ja nicht! Sonst werde ich allen kundtun, was du für einer bist! Dass du selbst dich an mich herangemacht, mich begrabscht hast und mich zur Unzucht verleiten wolltest. Hinter dem Rücken deines Bruders! Dass du Rache geschworen, als ich dich davongejagt habe! Deshalb bist du jetzt so ein … so ein …« Hier fehlte ihr das passende deutsche Wort, so dass die ganze Tirade verpuffte. Wolfher lachte nur.
»Dir werd ich’s zeigen!«, spottete er. »Auf dich wird grad einer hören, Französin, wollüstige Hure! Den Ochsenziemer, Uhu!«
Der Hof füllte sich plötzlich mit den dunklen Habiten der Augustinermönche.
»Was geschieht hier?«, rief der greise Prior Erasmus Steinkeller, ein magerer, gelbsüchtig aussehender Alter. »Was tut ihr, Christenbrüder?«
»Packt euch fort!«, brüllte Wolfher und knallte mit dem Ochsenziemer. »Packt euch fort, ihr geschorenen Narren, ab zum Brevier und zum Gebet! Mischt euch nicht in Ritterfehden, sonst geht es euch schlecht, elende Schwarzkittel!«
»Herr!« Der Prior faltete seine mit Altersflecken übersäten Hände. »Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In nomine Patris, et Filii …«
»Morold, Wittich! Her mit dem Wüstling! Jens, Dieter, fesselt den Kerl!«
»Vielleicht«, Stefan Rotkirch, ein weiterer Freund des Hauses, der bisher geschwiegen hatte, verzog das Gesicht zu einer Grimasse, »vielleicht sollten wir ihn ein bisschen hinter dem Pferd herziehen?«
»Von mir aus. Aber zuerst nehme ich ihn mir ein bisschen vor!«
Er holte mit der Peitsche gegen den immer noch am Boden liegenden Reynevan aus, aber der Hieb blieb aus, weil Frater Innocent seinen Arm ergriffen hatte. Frater Innocent war von stattlichem Wuchs und ebensolcher Statur, was trotz seiner Demutshaltung unschwer zu erkennen war. Sein Griff umschloss Wolfhers Arm wie eine Eisenzwinge.
Sterz fluchte lästerlich, riss sich los und versetzte dem Mönch einen Stoß. Aber genauso gut hätte er versuchen können, den Schlossturm von Oels umzustoßen. Frater Innocent, den die Confratres nur Bruder Insolent nannten, wankte nicht einmal, sondern revanchierte sich mit einem Stoß, der Wolfher in hohem Bogen über den halben Hof hinweg schließlich auf einen Misthaufen beförderte.
Einen Moment lang herrschte Stille. Dann stürzten sich alle auf den riesigen Mönch. Dem Uhu, der ihn als Erster ansprang, wurden die Zähne eingeschlagen, und er rollte durch den Sand. Morold Sterz hatte eins aufs Ohr bekommen und tappte mit wirrem Blick zur Seite.
Der Rest belagerte den Augustiner wie Ameisen. Die hohe Gestalt im schwarzen Habit verschwand förmlich unter ihren Püffen und Stößen. Obwohl Frater Insolent tüchtig etwas abbekam, bedankte er sich ebenso tüchtig und keinesfalls christlich dafür, damit in keinster Weise der Demutsregel des heiligen Augustinus entsprechend.
Bei diesem Anblick verlor der greise Prior die Nerven. Mit kirschrotem Gesicht und brüllend wie ein Löwe warf er sich ins Kampfgetümmel, indem er nach rechts und links schwere Hiebe mit seinem Kruzifix aus Palisanderholz austeilte.
»Pax!«, schrie er beim Zuschlagen. »Pax! Vobiscum! Liebedeinen Nächsten! Proximum tuum! Sicut te ipsum! Ihr Hurensöhne!«
Dieter Haxt traf ihn mit der Faust. Der Alte stürzte kopfüber nach hinten, seine Sandalen fuhren durch die Luft und beschrieben dort malerische Kurven. Die Augustiner erhoben ein fürchterliches Geschrei, einige von ihnen hielt es nicht länger, und sie stürzten sich in den Kampf. Auf dem Hof tobte ein regelrechter Aufruhr.
Wolfher Sterz, der aus dem Getümmel verdrängt worden war, zog sein Kurzschwert und schwang es – ein Blutvergießen drohte. Aber Reynevan, dem es inzwischen gelungen war, auf die Beine zu kommen, zog ihm den Knauf des Ochsenziemers über den Hinterkopf. Sterz griff sich an den Kopf und wandte sich um, da schlug ihm Reynevan mit aller Kraft die Peitsche ins Gesicht. Wolfher stürzte zu Boden. Reynevan rannte zu den Pferden.
»Adele! Hierher! Zu mir!«
Adele stand reglos da, ihr gleichgültiger Gesichtsausdruck erstaunte ihn. Reynevan sprang in den Sattel. Das Pferd wieherte und begann zu tänzeln.
»Adeeeleee!«
Morold, Wittich, Haxt und der Uhu rannten auf ihn zu. Reynevan wendete das Pferd, ließ einen gellenden Pfiff ertönen und sprengte im Galopp geradewegs auf die Pforte zu.
»Hinterher!«, kreischte Wolfher Sterz. »Aufs Ross und hinter ihm her!«
Reynevans erster Gedanke war, Richtung Marientor zu fliehen und sich hinter der Stadt in die Spahlitzer Wälder zu schlagen. Die Kuhgasse war jedoch zum Tor hin hoffnungslos von Fuhrwerken verstopft, und das durch das Geschrei erregte und verschreckte fremde Ross ergriff nun selbst die Initiative, was dazu führte, dass Reynevan, noch bevor er dessen recht gewahr wurde, im Galopp in Richtung Markt sprengte, wobei der Schlamm nach allen Seiten spritzte und das Fußvolk geschwind auseinander fuhr. Er musste sich nicht umwenden, um zu wissen, dass die Verfolger ihm dicht auf den Fersen waren. Er hörte das Hufgetrappel, das Wiehern der Pferde, die wilden Schreie der Sterz-Brüder und das wütende Gebrüll zu Boden fallender Menschen.
Er drückte dem Ross die Fersen in die Flanken, streifte dahingaloppierend einen Bäcker, der einen Brotkorb trug, und riss ihn um, so dass Brote, Brötchen und Hörnchen wie ein Hagelschlag in den Schlamm fielen, wo sie gleich darauf von den Hufen der Sterz’schen Pferde zertreten wurden. Reynevan sah sich nicht um, mehr als alles, was hinter ihm geschah, interessierte ihn, was vorne los war, und vor ihm erhob sich ein im Näherkommen immer größer werdendes Fuhrwerk, hoch beladen mit Reisig. Es nahm fast die ganze Gasse ein, und an der einzigen passierbaren Stelle hockte eine kleine Schar halb nackter Kinder, die eifrig damit beschäftigt waren, etwas ungemein Interessantes aus dem Mist zu buddeln.
»Jetzt haben wir dich, Bielau!«, brüllte von hinten Wolfher Sterz, der ebenfalls bemerkt hatte, was sich da vorne abspielte.
Das Ross raste in scharfem Galopp dahin, so dass keine Rede davon sein konnte, es anzuhalten. Reynevan beugte sich zur Mähne hinunter und schloss die Augen. Daher sah er auch nicht, dass die halb nackten Kinder flink und behende wie Ratten auseinander stoben. Er blickte auch nicht nach hinten, nahm also auch nicht wahr, wie sich das Bäuerlein in seinem Schafsfellumhang, das den Wagen lenkte, bass erstaunt umwandte, Deichsel und Wagen dabei mit sich drehend. Er sah auch nicht, wie die Sterz-Brüder gegen den Wagen prallten. Auch nicht, wie Jens Knobelsdorf aus dem Sattel flog und dabei die Hälfte der Reisigladung mit sich riss.
Reynevan jagte die Johannisgasse zwischen dem Rathaus und dem Haus des Bürgermeisters entlang und preschte in gestrecktem Galopp auf den großen Marktplatz von Oels. Er hielt auf die südliche Straßenfront und den dicken viereckigen Turm über dem Ohlauer Tor zu. Reynevan jagte mitten durch Leute, Pferde, Ochsen, Schweine, Wagen und Marktstände und ließ ein wahres Schlachtfeld hinter sich. Menschen kreischten, wimmerten und fluchten, Hornvieh brüllte, Schweine quiekten, Kramläden und Marktstände stürzten übereinander, und ein Hagel von unterschiedlichsten Gegenständen ging hernieder – Töpfe, Schüsseln, Zuber, Hacken, Schüreisen, Fischreusen, Schaffelle, Filzkappen, Lindenholzlöffel, Talgkerzen, Bastschlappen und tönerne Hähnchen mit Trillerpfeifen. Wie ein Regenschauer ergossen sich die verschiedensten Nahrungsmittel ringsumher – Eier, Käse, Backwaren, Erbsen, Grütze, Möhren; Rübchen, Zwiebeln, ja sogar lebendige Krebse. Federwolken flogen durch die Luft, begleitet vom Höllengeschrei des Federviehs. Die Brüder Sterz, immer noch auf Reynevans Fersen, vollendeten das Werk der Verwüstung. Als eine Gans dicht vor seiner Nase aufflatterte, scheute Reynevans Pferd und geriet mit den Vorderhufen in einen Fischstand, von dem es Kisten und Fässer herunterriss. Der erboste Fischhändler holte mit dem Käscher zu einem heftigen Schlag aus, verfehlte den Reiter, traf aber das Pferd mit voller Wucht auf die Hinterbacken. Es wieherte und warf sich zur Seite, riss dabei einen Kramladen mit Garn und Bändern um, tänzelte einige Sekunden auf der Stelle, stampfte dabei in einer silbrigen, stinkenden Masse von Plötzen, Brassen und Karauschen herum, in die sich wie von Feenhand bunte Spulen woben. Nur mit einigem Glück konnte sich Reynevan im Sattel halten. Aus den Augenwinkeln sah er, wie die Garnhändlerin mit einem riesigen Beil hinter ihm hersprang, das, Gott weiß wie, in den Garnhandel geraten war. Er spuckte die Gänsedaunen aus, die ihm an den Lippen klebten, zügelte das Pferd und galoppierte dann die Fleischergasse hinunter, von wo aus es, wie er wusste, nur noch ein paar Schritte zum Ohlauer Tor waren.
»Ich reiß’ dir die Eier ab, Bielau!«, schrie Wolfher Sterz hinter ihm her. »Ich reiß’ sie dir ab und stopf’ sie dir in den Schlund!«
»Küss mir den Steiß!«
Es waren nur noch vier Verfolger. Rotkirch hatten die erbosten Händler vom Pferd gerissen und schlugen nun auf ihn ein.
Wie ein Pfeil schoss Reynevan durch das Spalier der an den Beinen aufgehängten Schweinehälften. Die Metzger sprangen vor Schreck zur Seite, trotzdem riss er einen um, der einen halben Ochsen auf seinen Schultern balancierte. Der Umgeworfene rollte mit seiner Last bis dicht vor die Hufe von Wittichs Ross, dieses scheute und stieg, von hinten prallte Wolfhers Pferd dagegen. Wittich fiel vom Sattel direkt auf die Metzgerlade, mit der Nase hinein in Leber, Lunge und Nieren. Wolfher stürzte auf ihn drauf, mit einem Bein im Steigbügel hängen bleibend, und bevor er sich noch befreien konnte, begrub er einen großen Teil der Fleischbank unter sich und beschmierte sich bis über die Ohren mit Schlamm und Tierblut.
Reynevan beugte sich rasch und in letzter Minute über den Pferdehals und tauchte so unter dem Holzschild hindurch, das ein gemalter Schweinekopf zierte. Dieter Haxt, ihm dicht auf den Fersen, schaffte es nicht mehr, sich zu bücken. Das Brett mit dem Konterfei eines lächelnden Schweines schlug ihm gegen die Stirn, dass es krachte. Dieter fiel aus dem Sattel in einen Haufen Abfälle, von denen er die Katzen vertrieb. Reynevan wandte sich um. Nur noch Niklas verfolgte ihn.
In vollem Galopp bog er aus der Fleischergasse auf einen kleinen Platz, auf dem die Gerber arbeiteten. Als direkt vor ihm ein mit nassen Fellen behängtes Trockengerüst seinen Weg versperrte, hielt er das Pferd an und zwang es zum Sprung. Das Ross sprang. Und Reynevan stürzte nicht. Wieder wie durch ein Wunder.
Niklas hatte nicht so viel Glück. Sein Pferd verweigerte den Sprung, warf das Gerüst um und geriet zwischen Schlamm, Fleischfetzen und Fettresten ins Rutschen. Der jüngste Sterz schlug einen Purzelbaum nach vorne über den Pferdekopf. Fiel sehr, aber wirklich sehr unglücklich. Mit Unterleib und Bauch genau in eine Sense, die den Gerbern zum Entfernen der Fleischreste diente.
Anfangs begriff Niklas gar nicht, was ihm widerfahren war. Er stand auf, stürzte zu seinem Pferd, und erst als dieses schnaubte und zurückwich, gaben die Knie unter ihm nach. Immer noch ohne zu begreifen, was geschehen war, rutschte der jüngste Sterz durch den Schlamm, seinem rückwärts gehenden und voller Panik laut schnaufenden Tier hinterher. Schließlich ließ er die Zügel los und versuchte aufzustehen. Da merkte er, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte, blickte auf seinen Bauch. Und schrie.
Er kniete in einer rasch größer werdenden Blutlache.
Dieter Haxt kam herangeritten, hielt sein Pferd an und sprang aus dem Sattel. Ebenso nach einer Weile Wolfher und Wittich Sterz.
Niklas setzte sich stöhnend. Er blickte wieder auf seinen Bauch. Er schrie erneut, dann brach er in Tränen aus. Seine Augen begannen sich zu vernebeln. Sein hervorquellendes Blut vermischte sich mit dem der am Morgen hier geschlachteten Rinder und Schweine.
»Niklaaaas!«
Niklas Sterz hustete, verschluckte sich und starb.
»Du bist des Todes, Reynevan Bielau!«, brüllte Wolfher Sterz Richtung Stadttor, weiß vor Wut. »Ich kriege dich, zerstöre dich, zermalme dich, vernichte dich, zusammen mit deinem ganzen Natterngezücht von Familie! Mit deinem ganzen Natterngezücht, hörst du?«
Reynevan hörte nichts. Unter dem Hufgeklapper auf den Bohlen der Brücke verließ er eben Oels und stürmte nach Süden, geradewegs auf die Straße nach Breslau.
Zweites Kapitel
in dem der Leser noch mehr über Reynevan erfährt,
und zwar aus Gesprächen, welche Leute
über ihn führen, die ihm wohlgesinnt sind, wie auch solche,
die gegenteilig empfinden. Währenddessen irrt Reynevan
durch die Wälder von Oels. Eine Beschreibung dieser
Irrfahrt erspart der Autor dem Leser, so dass dieser,
nolens volens, gezwungen ist, sich dieselbe auszumalen.
Setzt Euch, an den Tisch, Ihr Herren.« Bartholomäus Sachs, der Bürgermeister von Oels, lud die Ratsherren ein. »Was soll kredenzt werden? An Weinen habe ich, ehrlich gesagt, nichts, womit ich imponieren könnte. An Bier aber, oho! ist mir heute just aus Schweidnitz ein köstliches Lagerbier erster Güte aus einem tiefen, kalten Kellerchen geliefert worden.«
»Bier sodann, Bier!« Johann Hofrichter, einer der reichsten Kaufherren der Stadt, rieb sich die Hände. »Das ist unser Trunk, sollen sich der Adel und andere Herrlein den Verstand mit Wein vernebeln … Mit Verlaub, Hochwürden …« »Nichts da«, lachte Pfarrer Jakob von Gall, der Propst der Johanniskirche, »ich bin kein Edelmann mehr, ich bin Geistlicher und als solcher, wie es dem Stande geziemt, dem Volke verbunden, und daher schickt es sich auch nicht, das Bier zu verachten. Und trinken darf ich wohl, denn die Vesperandacht habe ich gehalten.«
Sie nahmen an dem Tisch im großen, niedrigen, lediglich getünchten Ratssaal Platz, wo für gewöhnlich der Magistrat zu tagen pflegte. Der Bürgermeister auf seinem angestammten Platz, mit dem Rücken zum Kamin, Pfarrer Gall neben ihm, das Gesicht zum Fenster gewandt. Gegenüber saß Hofrichter, neben ihm Lukas Frydman, ein gefragter und wohlhabender Goldschmied, der in seinem modisch wattierten Wams und mit dem Samtkäppchen wie ein echter Edelmann aussah. Der Bürgermeister räusperte sich, und ohne auf die Dienerschaft mit dem Bier zu warten, begann er zu sprechen:
»Und was haben wir?«, sagte er, seine Hände über der Wölbung seines Bauches verschränkend. »Was haben die wohlgeborenen Herrn Ritter unserer Stadt so edelmütig beschert? Eine Schlägerei bei den Augustinern. Eine Hatz zu Pferde durch die Straßen und Gassen der Stadt. Tumult auf dem Markt, ein paar Verletzte, ein Kind schwer verletzt. Beschädigte Habe, verdorbene Waren. Bedeutende Verluste materieller Natur, bis in den späten Nachmittag hinein kamen die mercatores und institores mit ihren Schadenersatzforderungen zu mir gelaufen. Wahrlich, ich hätte sie mit ihren Beschwerden zu den Herren Sterz nach Bernstadt, Ledna und Sterzendorf schicken sollen.«
»Besser nicht!«, versetzte Johann Hofrichter trocken. »Obwohl auch ich der Ansicht bin, dass die Herrn Ritter in letzter Zeit zu übermütig geworden sind, so dürfen wir dabei weder den Anlass noch die Folgen außer Acht lassen. Die Konsequenz, die tragische Konsequenz ist wohl der Tod des jungen Niklas von Sterz. Und die Ursache: Unzucht und Ausschweifung. Die Sterz’ haben die Ehre ihres Bruders verteidigt, sie haben den Schandbuben gejagt, der ihre Schwägerin verführt und das Ehelager beschmutzt hat. Es stimmt wohl, in der Aufregung hat sie der Hafer gestochen …«
Der Kaufherr verstummte, ein bedeutsamer Blick von Pfarrer Jakob hatte ihn getroffen.
Denn wenn Pfarrer Jakob durch einen Blick signalisierte, dass er zu sprechen wünschte, schwieg sogar der Bürgermeister. Jakob Gall war nicht nur der Propst der städtischen Pfarre, sondern auch der Sekretär des Herzogs Konrad von Oels und Kanonikus im Domkapitel von Breslau.
»Ehebruch ist eine Sünde«, sagte der Pfarrer und reckte hinter dem Tisch seine dürre Gestalt. »Ehebruch ist auch ein Verbrechen. Aber die Sünden straft Gott und die Verbrechen das Gesetz. Selbstjustiz und Mord sind durch nichts zu rechtfertigen.«
»Wohl, wohl!«, fiel ihm der Bürgermeister ins Credo, verstummte aber sofort und widmete sich dem Bier, das eben kredenzt wurde.
»Niklas Sterz ist auf tragische Weise ums Leben gekommen, was uns sehr schmerzt«, fuhr der Pfarrer fort, »aber infolge eines schlimmen Unfalls. Wenn Wolfher und seine Kumpanen Reinmar von Bielau erwischt hätten, hätten wir es in unserer Jurisdiktion mit einem Mord zu tun. Nicht ausgeschlossen, dass wir es noch damit zu tun bekommen. Ich möchte daran erinnern, dass der Prior Steinkeller, der von den Sterz’ schlimm verprügelt worden ist, ein gottesfürchtiger Greis, noch immer bewusstlos bei den Augustinern liegt. Wenn er an den Schlägen stirbt, gibt es ein Problem. Für die Sterz’ nämlich!«
»Was das Verbrechen des Ehebruches anlangt«, der Goldschmied Lukas Frydman betrachtete die Ringe an seinen gepflegten Fingern, »so bedenkt, ehrenwerte Herren, dass dies keineswegs in unsere Jurisdiktion fällt. Obwohl die Unzucht in Oels stattgefunden hat, unterstehen die Delinquenten nicht uns. Gelfrad Sterz, der betrogene Ehemann, ist ein Vasall des Herzogs von Münsterberg. Wie auch der Verführer, der junge Medicus Reinmar von Bielau …«
»Hier bei uns ist die Unzucht geschehen, hier bei uns hat das Verbrechen stattgefunden«, gab Hofrichter schroff zurück. »Und es ist keine Bagatelle, wenn man dem Glauben schenkt, was das Eheweib des Sterz bei den Augustinern bekannt hat. Dass der Medicus sie durch einen Zauber betört und durch schwarze Kunst zur Sünde verführt hat. Eine Unwillige gezwungen hat.«
»Das sagen sie alle«, brummte der Bürgermeister in seinen Humpen.
»Besonders, wenn ihnen einer wie Wolfher von Sterz das Messer an die Gurgel hält«, fügte der Goldschmied trocken hinzu. »Der ehrwürdige Vater Jakob hat wohl gesprochen, Ehebruch ist ein Verbrechen, ein crimen, und als solches verlangt es nach Untersuchung und Gericht. Wir wollen hier keine Familienfehden und Straßenschlachten, wir lassen nicht zu, dass wild gewordene Herrensöhne ihre Hand gegen Geistliche erheben, mit Messern herumfuchteln und Leute auf öffentlichen Plätzen niedertrampeln. In Schweidnitz ist, weil er einen Waffenschmied geschlagen und mit dem Schwert bedroht hat, einer von den Pannewitzern ins Gefängnis gekommen. Und so soll es sein. Die Zeiten ritterlicher Selbstherrlichkeit sind vorbei. Die Angelegenheit muss vor den Herzog gebracht werden.«
»Umso mehr«, bestätigte der Bürgermeister nickend, »als Reinmar von Bielau ein Adeliger und Adele von Sterz eine Adelige ist. Ihn können wir nicht auspeitschen, und sie nicht wie eine gewöhnliche Hure aus der Stadt vertreiben. Die Sache muss vor den Fürsten.«
»Damit hat es keine Eile«, meinte Jakob von Gall, die Lage einschätzend, »Herzog Konrad begibt sich nach Breslau, und vor seiner Reise hat er tausenderlei zu tun. Das Gerücht – wie Gerüchte es so an sich haben – ist gewiss schon zu ihm gedrungen, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür, solche Gerüchte offiziell zu bestätigen. Es reicht aus, wenn die Angelegenheit dem Herzog nach seiner Rückkehr vorgebracht wird. Bis dahin wird sich vieles von selbst erledigen.«
»Das denke ich auch.« Bartholomäus Sachs nickte erneut.
»Ich ebenfalls!«, fügte der Goldschmied hinzu.
Johann Hofrichter rückte seine Marderkappe zurecht und blies den Bierschaum vom Humpen. »Den Herzog jetzt zu informieren«, sprach er, »steht uns nicht an, warten wir, bis er zurückkehrt, darin stimme ich mit Euch überein, werte Herren. Aber das Heilige Officium informieren müssen wir. Und das schleunigst. Darüber, was wir im Arbeitszimmer des Medicus gefunden haben. Schüttelt nicht den Kopf, Herr Bartholomäus, verzieht nicht das Gesicht, werter Herr Lukas. Und Ihr, Hochwürden, seufzet nicht und zählt nicht die Fliegen am Sturzbalken. Mir ist genauso wenig nach Eile zumute wie Euch, ich möchte die Inquisition genauso wenig wie Ihr vor Ort haben. Aber bei der Öffnung des Arbeitszimmers waren viele Leute anwesend. Und wo viele Leute sind, damit sage ich nicht Neues, wird sich wohl auch immer einer finden, der es der Inquisition zuträgt. Und wenn der Visitator in Oels erscheint, wird er als Erste uns befragen, warum wir gezögert haben.«
»Ich hingegen«, Propst Gall löste seinen Blick vom Deckenbalken, »ich werde die Verzögerung erklären. Ich höchstpersönlich. Denn das ist meine Pfarrei, und mir obliegt die Pflicht, den Bischof und den päpstlichen Inquisitor zu informieren. Mir obliegt die Beurteilung, ob die gegebenen Umstände eine Anrufung und das Bemühen der Kurie und des Officiums erfordern.«
»Ist die Hexerei, von der Adele Sterz bei den Augustinern herumgeschrien hat, etwa kein gegebener Umstand? Das Arbeitszimmer auch nicht? Der alchimistische Destillierapparat und das Pentagramm auf dem Fußboden? Die Mandragora? Die Totenschädel und die skelettierten Hände? Die Kristalle und Spiegel? Die Flaschen und Flakons mit weiß der Teufel was für Scheußlichkeiten und Giften? Frösche und Ratten in Glasbehältern? Sind das keine gegebenen Umstände?«
»Eben nicht. Die Inquisitoren sind ernsthafte Leute. Ihr Werk ist die inquisitio de articulis fidei, und nicht Weibergewäsch, Aberglauben und Frösche. Ich denke nicht daran, sie damit zu behelligen.«
»Und die Bücher? Die hier vor uns liegen?«
»Die Bücher«, erwiderte Jakob Gall ruhig, »muss man zuerst studieren, genau und ohne Eile. Das Heilige Officium verbietet das Lesen nicht. Und auch nicht den Besitz von Büchern.«
»In Breslau«, sagte Hofrichter düster, »sind erst kürzlich zwei auf dem Scheiterhaufen gelandet. Und es geht das Gerücht, eben des Besitzes von Büchern wegen.«
»Keinesfalls der Bücher wegen«, entgegnete der Propst trocken, »sondern wegen der Kontumaz, wegen der hartnäckigen Weigerung, den darin befindlichen Inhalten abzuschwören. Unter diesen Büchern befanden sich Schriften von Wyclif und Hus, der lollardische Floretus, die Prager Artikel und zahlreiche hussitische libelli und Manifeste. Etwas Ähnliches sehe ich hier nicht unter den requirierten Büchern aus dem Arbeitszimmer des Reinmar von Bielau. Ich sehe hier fast nur medizinische Werke. Die übrigens in der Mehrzahl, wenn nicht in Gänze Eigentum des scriptorium des Augustinerklosters sind.«
»Ich wiederhole«, Hofrichter stand auf und trat zu den auf dem Tisch ausgebreiteten Büchern, »ich wiederhole, ich habe es nicht eilig, weder zum Bischof noch zur päpstlichen Inquisition, ich will niemanden anschwärzen und auch niemanden auf dem Scheiterhaufen rösten sehen. Aber hier geht es um unsere eigenen Hintern. Damit wir nicht dieser Bücher wegen angeklagt werden. Was haben wir denn hier? Außer Galen, Plinius und Strabo? Saladin Ferro von Asculi, Compendium aromaticorum, Scribonius Largus, Compositiones medicinae, Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum, Albertus Magnus, De vegetabilibus … Magnus, ha! ein Beiname, wahrhaft eines Zauberers würdig! Und hier, bitte, Sabur ben Sahl … Abū Bakr ar-Rāzi … Heiden! Sarazenen!«
»Diese Sarazenen«, erläuterte Lukas Frydman in aller Ruhe, indem er seine Ringe betrachtete, »werden an christlichen Universitäten gelehrt. Als medizinische Autoritäten. Und Euer Zauberer ist Albert der Große, der Bischof von Regensburg, ein überaus gelehrter Theologe.«
»So sagt Ihr? Hmmm … Schauen wir weiter … Oh! Causae et curae, verfasst von Hildegard von Bingen. Gewiss eine Hexe, diese Hildegard!«
»Nicht wirklich«, lächelte Pfarrer Gall, »Hildegard von Bingen, Prophetin, genannt die rheinische Sibylle. Sie verschied in einer Aura von Heiligkeit.«
»Ha! Wenn Ihr das sagt … Aber was ist das? John Gerard, Generall … Historie … of Plantes … Möchte wissen, in welcher Sprache das verfasst ist, muss wohl jüdisch sein. Bestimmt wohl auch wieder so ein Heiliger. Hier haben wir hingegen Herbarius von Thomas de Bohemia …«
»Wie sagtet Ihr?« Pfarrer Jakob hob den Kopf. »Thomas Böhm?«
»So steht es hier.«
»Zeigt einmal her. Hmmm … Interessant, interessant … Wie es scheint, bleibt alles in der Familie. Und alles dreht sich um die Familie.«
»Welche Familie?«
»So sehr in der Familie«, Lukas Frydman schien weiterhin ausschließlich Interesse für seine Ringe zu haben, »dass es enger gar nicht geht. Thomas Böhm oder Behem, der Autor dieses Herbarius, war der Großvater unseres Reinmar, ein Liebhaber von Ehefrauen anderer, der uns ziemlich viel Aufsehen und Kopfzerbrechen bereitet hat.«
»Thomas Behem, Thomas Behem.« Der Bürgermeister runzelte die Stirn. »Genannt auch Thomas der Medicus. Ich habe von ihm gehört. Er war der Gefährte eines der Herzöge … Ich kann mich nicht recht erinnern …«
»Herzog Heinrich VI. von Breslau«, fügte der Goldschmied Frydman seine beruhigende Erklärung rasch hinzu. »Tatsächlich war jener Thomas sein Freund. Ein hervorragender Gelehrter und fähiger Arzt. Er hat in Padua, Salerno und Montpellier studiert …«
»Es hieß aber auch«, warf Hofrichter ein, der schon seit einiger Zeit durch Kopfnicken erkennen ließ, dass er sich gleichfalls erinnerte, »dass er ein Zauberer und ein Ketzer war.«
»Ihr habt Euch an dieser Zauberei wie ein Blutegel festgesogen, Herr Johann.« Der Bürgermeister verzog das Gesicht. »Erspart es Euch.«
»Thomas Behem«, dozierte der Propst mit einiger Strenge, »war ein Geistlicher. Kanonikus in Breslau, dann dort sogar Suffragan, und auch Titularbischof von Sarepta. Er hat Papst Benedikt XII. persönlich gekannt.«
»Über diesen Papst wird auch unterschiedlich geurteilt.« Hofrichter dachte nicht daran aufzugeben. »Es soll auch unter den Infulaten zu Hexerei gekommen sein. Inquisitor Schwenckefeld hat zu seiner Zeit …«
»Lasst das jetzt!« Pfarrer Jakob schnitt ihm das Wort ab. »Wir haben hier über anderes zu befinden.«
»In der Tat«, bekräftigte der Goldschmied. »Ich weiß genau, worum es geht. Herzog Heinrich hatte keine männlichen Nachkommen, er hatte nur drei Töchter. Mit der jüngsten, Margarethe, hatte unser Pfarrer Thomas eine Romanze.«
»Und das hat der Herzog zugelassen? So eine Freundschaft war das also?«
»Der Herzog war seinerzeit schon nicht mehr am Leben«, erklärte der Goldschmied. »Herzogin Anna wusste entweder nicht, was da im Busch war, oder sie wollte es nicht wissen. Thomas Behem war damals noch kein Bischof, aber er hatte ausgezeichnete Verbindungen zu den übrigen Schlesiern: zu Heinrich dem Getreuen von Glogau, zu Kasimir von Teschen und Freistadt, zu Bolek dem Kleinen von Schweidnitz-Jauer, Wladislaw von Beuthen und Cosel, zu Ludwig von Brieg. Denn stellt Euch vor, Ihr Herren, jemand, der nicht nur in Avignon beim Heiligen Vater weilt, sondern auch Harnsteine so geschickt entfernen kann, dass der Patient nach der Operation nicht nur seinen Schwanz behält, sondern dass der ihm auch noch steht. Wenngleich nicht jeden Tag, so doch immerhin. Und wenn das auch wie eine Schnurre klingt, ich scherze keineswegs. Allgemein heißt es, es sei Thomas zu verdanken, dass es heute noch Piasten in Schlesien gibt. Er half nämlich mit gleicher Geschicklichkeit sowohl Männern als auch Frauen. Und auch Paaren, wenn Ihr versteht, was ich meine.«
»Ich fürchte, nein«, sagte der Bürgermeister.
»Er verstand es, Eheleuten zu helfen, bei denen es im Bett nicht klappte. Versteht Ihr jetzt?«
»Jetzt schon«. Johann Hofrichter nickte. »Das bedeutet, dass er die Breslauer Prinzessin wohl sicher auch nach allen Regeln der medizinischen Kunst behandelt hat. Und natürlich ging daraus ein Kind hervor …«
»Natürlich«, bestätigte Pfarrer Jakob. »Die Angelegenheit wurde wie üblich erledigt. Margarethe kam zu den Klarissen ins Kloster, das Kind nach Oels zu Herzog Konrad. Konrad erzog es wie einen eigenen Sohn. Thomas Behem wurde zu einer immer wichtigeren Figur, überall. In Schlesien, in Prag bei Kaiser Karl IV., in Avignon, deshalb war die Karriere des Knaben schon seit der Kindheit gesichert. Seine Karriere als Geistlicher, versteht sich. Abhängig von seinen Geistesgaben. Wäre er einfältig gewesen, hätte er eine ländliche Pfarrei erhalten. Wäre er mittelmäßig begabt gewesen, hätte man ihn zum Zisterzienserabt gemacht. Wäre er klug gewesen, würde eines der Kollegiatkapitel auf ihn gewartet haben.«
»Und als was hat er sich erwiesen?«
»Als klug. Ansehnlich wie der Vater. Und ritterlich. Bevor noch jemand etwas unternehmen konnte, kämpfte der zukünftige Geistliche schon an der Seite des jungen Prinzen, des späteren Konrad des Alten, gegen die Großpolen. Er kämpfte so geschickt, dass es keinen anderen Weg gab, er wurde zum Ritter geschlagen. Und erhielt ein Lehen. Und damit war es aus mit dem Pfarrer Tymo, hoch lebte der Ritter Tymo Behem von Bielau. Ritter Tymo, der sich kurz darauf angemessen vermählte, er heiratete die jüngste Tochter des Heidenreich Nostitz.«
»Nostitz hat seine Tochter dem Bankert eines Pfaffen zur Frau gegeben?«
»Dieser Pfaffe, der Vater des Bankerts, war inzwischen zum Weihbischof von Breslau und Bischof von Sarepta aufgestiegen, er kannte den Heiligen Vater, beriet König Wenzel IV. und war mit allen Fürsten Schlesiens auf Du und Du. Der alte Heidenreich hat ihm sicher selbst und gern die Tochter zugeführt.«
»Das ist wohl möglich.«
»Aus der Ehe der Nostitz-Tochter mit Tymo von Bielau gingen Heinrich und Thomas hervor. Bei Heinrich regte sich anscheinend das Blut des Großvaters, denn er wurde Kleriker, studierte in Prag, und bis zu seinem Tode, vor kurzem erst, war er Scholasticus am Heiligen Kreuz in Breslau. Thomas hingegen heiratete Boguśka, die Tochter des Miksza von Parchwitz und hatte mit ihr zwei Kinder. Peter, genannt Peterlin, und Reinmar, genannt Reynevan. Peterlin, also Petersilie, und Reynevan, also Rainfarn, solche vegetativen Beinamen, ich habe keine Ahnung, ob sie selbst sich die ausgedacht haben, oder ob sie der Phantasie des Vaters entsprungen sind. Dieser, wo wir schon dabei sind, fiel bei Tannenberg.«
»Auf wessen Seite?«
»Auf der unsrigen, der christlichen.«
Johann Hofrichter nickte und nahm einen Schluck aus dem Humpen.
»Aber jener Reinmar-Reynevan, der sich an Frauen anderer heranmacht … Was ist er bei den Augustinern? Laienbruder? Konversus? Novize?«
»Reinmar Bielau«, Pfarrer Jakob lächelte, »ist ein Medicus, ausgebildet in Prag an der Karls-Universität. Vor seinem Studium hat er die Domschule zu Breslau besucht, dann hat er die Geheimnisse der Kräuterkunde bei einem Apotheker in Schweidnitz und bei den frommen Brüdern vom Hospital in Brieg studiert. Jene frommen Brüder und sein Oheim Heinrich haben ihn bei unseren Augustinern untergebracht, die sich auf Kräuterheilkunde spezialisieren. Der Junge hat ehrlich und mit ganzem Herzen, wie es seine Berufung war, für das Spital und die Leprakranken gearbeitet. Dann, wie gesagt, hat er in Prag Medizin studiert, ebenfalls dank der Protektion seines Oheims und auf dessen Kosten, von den Einkünften, die der Oheim aus seiner Würde als Kanonikus bezog. Bei den Studien hat er sich, scheint’s, befleißigt, denn schon nach zwei Jahren war er artium baccalaureus. Prag hat er gleich nach … hmmm …«
»Gleich nach dem Fenstersturz verlassen.« Der Bürgermeister hatte keine Angst, den Satz zu vollenden. »Was klar beweist, dass ihn nichts mit dieser – wie sagt man – hussitischen Häresie verbindet.«
»Nein, nichts verbindet ihn damit«, bekräftigte der Goldschmied Frydman gelassen. »Ich weiß es wohl von meinem Sohn, der zur selben Zeit in Prag studierte.«
»Sehr gut hat es sich auch gefügt«, setzte Bürgermeister Sachs hinzu, »dass Reynevan nach Schlesien zurückgekehrt ist, und gut, dass er zu uns nach Oels gekommen ist und nicht ins Herzogtum Münsterberg, wo sein Bruder bei Herzog Johann in Ritterdiensten steht. Das ist ein guter und verständiger Junge, und obwohl noch jung an Jahren, in der Kräuterheilkunde doch so bewandert, dass man selten seinesgleichen findet. Mein Weib hat er von Furunkeln geheilt, die sich auf, wie sagt man gleich, auf ihrem Leib befanden, die Tochter hat er von ihrem ständigen Husten befreit. Mir hat er für die eitrigen Augen einen Aufguss gegeben, der hat so schnell geholfen, als hätte eine Hand den Eiter weggewischt …«
Der Bürgermeister verstummte, räusperte sich und schob die Hand in seinen pelzverbrämten Rock. Johann Hofrichter betrachtete ihn aufmerksam.
»Jetzt«, erklärte er, »ist mir endlich einiges klar geworden. Über diesen Reynevan. Jetzt weiß ich alles. Obwohl er ein Bankert ist, fließt in ihm doch Piastenblut. Der Sohn eines Bischofs. Ein Freund der Fürsten. Ein Verwandter der Nostitz. Der Brudersohn eines Scholasticus des Breslauer Kollegiats. Den Söhnen der Reichen ein Studienfreund. Dazu, als reiche das alles nicht aus, ein gefragter Medicus, ein Wundertäter fast, der sich die Dankbarkeit der Höhergestellten verdient hat. Wovon hat er Euch denn geheilt, hochwürdiger Vater Jakob? Von was für einem Gebrechen, wenn man fragen darf?«
»Gebrechen stehen hier nicht zur Debatte«, erwiderte der Propst kühl. »Sagen wir einfach, er hat geheilt, ohne dabei Einzelheiten zu erwähnen.«
»Jemanden wie ihn dürfen wir nicht verlieren«, fügte der Bürgermeister hinzu, »es wäre schade, wenn einer wie er in einer Familienfehde umkommen sollte, nur weil er sich, wie sagt man gleich, wegen eines Paares schöner Augen vergessen hat. Er soll der Gemeinschaft dienen. Er soll heilen, da er es kann …«
»Selbst wenn er dabei ein Pentagramm auf dem Fußboden verwendet?«, spottete Hofrichter.