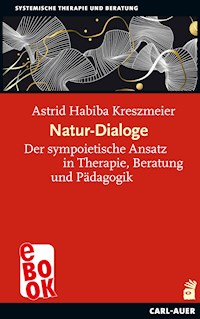
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Systemische Therapie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Psychologische Vorgänge sind keine rein "inneren" Angelegenheiten von Individuen. Sie wollen systemisch gesehen werden, d. h. mit Bezug auf das kommunikative, soziale und körperlich-sinnliche Geschehen. Einer der zentralen Begriffe dafür ist Kontext: Systeme und deren Umwelten bilden die Einheiten, auf die es ankommt. Astrid Habiba Kreszmeier führt in diesen erlebensbezogenen Ansatz behutsam ein und zeigt dessen bedeutende Folgen für Therapie, Beratung und Pädagogik anhand vieler praktischer Erfahrungen und eindrücklicher Beispiele. Ausgehend von Konzepten aus der Biologie des Erkennens nach Humberto Maturana und Francisco Varela – Stichwort: Autopoiesis – beschreibt sie genauso feinfühlig wie theoretisch klar Erlebenswege, die die eigene ökologische Verwobenheit nachhaltig erfahren lassen. Daraus erwächst ein umfassenderes Verstehen dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein: mit anderen Menschen, mit vielen anderen Lebewesen und in komplexer Verbundenheit – auf einer Erde. Der Leitbegriff Sympoiese trägt der Tatsache Rechnung, dass sich Lebenswelten dauernd miteinander erschaffen, erhalten und entwickeln. Natur-Dialoge in der beraterischen und therapeutischen Praxis schaffen Erlebensräume, in denen wir uns neu begreifen und uns untereinander und mit unserer Welt gut verbinden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Systemische Therapie und Beratung
In den Büchern der Reihe zur systemischen Therapie und Beratung präsentiert der Carl-Auer Verlag grundlegende Texte, die seit seiner Gründung einen zentralen Stellenwert im Verlag einnehmen. Im breiten Spektrum dieser Reihe finden sich Bücher über neuere Entwicklungen der systemischen Arbeit mit Einzelnen, Paaren, Familien und Kindern ebenso wie Klassiker der Familien- und Paartherapie aus dem In- und Ausland, umfassende Lehr- und Handbücher ebenso wie aktuelle Forschungsergebnisse. Mit den roten Bänden steht eine Bibliothek des systemischen Wissens der letzten Jahrzehnte zur Verfügung, die theoretische Reflexion mit praktischer Relevanz verbindet und als Basis für zukünftige nachhaltige Entwicklungen unverzichtbar ist. Nahezu alle bedeutenden Autoren aus dem Feld der systemischen Therapie und Beratung sind hier vertreten, nicht zu vergessen viele Pioniere der familientherapeutischen Bewegung. Neue Akzente werden von jungen und kreativen Autoren gesetzt. Wer systemische Therapie und Beratung in ihrer Vielfalt und ihren transdisziplinären und multiprofessionellen Zusammenhängen verstehen will, kommt um diese Reihe nicht herum.
Tom Levold
Herausgeber der Reihe Systemische Therapie und Beratung
Astrid Habiba Kreszmeier
Natur-Dialoge
Der sympoietische Ansatz in Therapie, Beratung und Pädagogik
2021
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe »Systemische Therapie und Beratung«
hrsg. von Tom Levold
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: Heinrich Eiermann
Umschlagfoto: © vectortwins – stock.adobe.com
Abbildungen: © Carolina Vidal
Fotos: © nature & healing gmbh
Redaktion: Dr. Eva Dempewolf
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2021
ISBN 978-3-8497-0391-2 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8340-2 (ePUB)
© 2021 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten haben, können Sie dort auch den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Vorwege
Zehn erste Annäherungen an Natur
1In Zeiten fortschreitender Erddemenz
Wo sind wir gelandet?
Regnet es?
Wo bist du?
Was spricht dich an?
Was will sich erinnern?
Wie antwortest du?
Ist die Welt noch von Belang?
Bist du bei Sinnen?
Unentwegt mittendrin
2Praxis des Streunens
Zwischen häuslichem Schutz und wildem Raum
Ohne Ziel, jedoch nicht ohne Halt
Gesunde Verstörungen
Wechselseitige Begegnungen
Zirkularität erfahren
Chancen auf Rückkoppelung
Eigenlebendig, miteinander und spontan
Unglückliche Verwechslungen
Wege zur Mit-Sprache
Sympoietische Annäherungen
3Weiter weben
Grüne Grenzen
Moderne Trennungen
Unzulässige Verbindungen
Kulturelle Situationen
Zeichen der Zeit
Fachliche Netze
Rückblicke
Öko-Gewebe heute
4Der sympoietische Ansatz
Welten bilden sich wechselseitig
Leben heißt Mit-Werden
Reziproke Wahrnehmung gehört zur irdischen Grundausstattung
Lebendig zusammen mit einer lebendigen Welt
Menschen sind erdverbundene Wesen
Kooperative und fürsorgliche Gemeinschaften
In Sprache lebend, mit Symbolen Welten schaffend
Über Erinnerung mit größeren Gedächtnisräumen verbunden
Archaische Archive sind Erinnerungsräume der Zuversicht
Sympoietische Kommunikationskultur
Erdverbindung, Erinnerungspraxis und Resonanzkultur – die drei Lernfelder
Handeln formt die Welt – sechs Leitlinien
Partizipativ
Forschend
Wechselseitig
Topologisch
Leiblich
Phänomenal
Sympoietische Praxis nimmt viele Wege
Sympoietische Grundlagen im Überblick
5Zeit für Geschichten
Ernesto: What a life!
Frische Luft
Oh, mein Papa
My comfort is killing me softly
I landed already
What a life
Renata: Wild beatmet
Salto Mortale
Wellenritt
Waldschule
Zwischenschlichtungen
Gebirgsgänge
Bannbrüche
Neuland
Antonia: Entnebelungen
Einladungen ans Feuer
Flussaufwärts
Marc: Bis in die Fingerspitzen
Magic Mushrooms
Durstgeschichten
Fuck – what now?
Ein elementarer Krimi
Ganz in den Körper kommen
6Unterwegs
Nahe der Erde
In frischer Luft
Archaische Schlichtheit
Mimesis und Selbstvertrautheit
Feuer und Dialog
Dialog im sympoietischen Raum – Poly-Kultur
Unsere Nische – ein sicherer Raum
Horizonte und Landschaften
Unterwegs Zeichen lesen
In Erinnerung
In Sprache handeln
Beständiges Werden
Wohin reichen unsere Erinnerungshorizonte?
Gedächtnisräume – The Big Five
Die Entdeckung mythischer Resonanzen
Das mythische Archiv
Mytho-mimetische Praxis
Zwischen den Dingen
In den Gefügen des täglichen Lebens
Kommunikative, besondere und verzehrbare Dinge
Schöne Aktanten
Atmosphärische Kompetenz
Zufälle und Fügungen
Materielle Semiotik
Einander anvertraut
7Kollegiale Gespräche
Sozialpädagogik: »Der Platz hält mich aus, und die Bäume laufen nicht davon«
Psychotherapie: »Ich höre das Herz der Erde pochen«
Organisationsberatung: »Ganz logisch: topologisch, mythologisch, phänomenologisch«
Bildungsmanagement: »Zeitwende im Zeitraffer«
Visuelle Kommunikation und Gestaltung: »Wider Palimpseste aus Neon«
Im Nachgang
Ökologien der Aufmerksamkeit
Mein Dank gilt
Literatur
Über die Autorin
Vorwege
»Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde.«
Jean Paul
Zehn erste Annäherungen an Natur
Dieses Zitat von Jean Paul stand auf einem Lesezeichen, das mich und einige Bücher längere Zeit begleitete. Wohin es irgendwann verschwunden ist, das weiß ich nicht, aber während der Arbeit an diesem Text war es nah und hat mich dazu ermutigt, mehr zu beschreiben denn zu erklären, mehr zu umkreisen denn zu begraden, aber auch immer wieder zu betonen, was mein Standpunkt ist und mit welchen Fäden er verknüpft sein kann.
Einen gebührlichen Abstand zu den Lesenden zu wahren, war mir dennoch wichtig. Nicht zuletzt deshalb, weil es selbst bei guten Freund:innen ratsam ist, abzuklären, ob der Gebrauch und die Verständnisräume von zentralen Wörtern sinnvolle Überschneidungen schaffen und befruchtende Dialoge ermöglichen.
Ein solch zentrales Wort findet sich hier sogar im Titel, und ich gestehe, es ist ein kompliziertes Wort: die Natur. Selbst wenn es auf den folgenden Seiten selten vorkommt, so klingt es doch durch den gesamten Ansatz. Daher will ich vorweg ein wenig zusammentragen, was mit dem Begriff Natur alles gemeint sein kann.
Natur ist für viele alles, was nicht menschengemacht ist und sein eigenes Leben, seine eigene Rhythmik hat.
Andere sagen möglicherweise: »Ja, aber Moment, auch der Mensch ist Natur, folglich ist alles, was er tut und macht, auch natürlich.«
Andere gehen noch weiter und finden, dass diese Natur-Mensch-Einheit einem größeren geistigen Plan folgt, an dessen Spitze der Mensch eingesetzt ist.
»Weit gefehlt!«, denken die nächsten. Die Natur sei so etwas wie die natürliche Feindin des Menschen, gegen die er sich durch ihre Beherrschung zur Wehr setzen muss.
Für wieder andere hat sich das menschliche Gebaren von der Natur abgelöst und sie zum messbaren Ding und zur marktbaren Ware gemacht. Aus dieser Perspektive stehen die Menschen jetzt vor dem Problem, dieses komplexe Ding Natur so bei Laune zu halten, dass es weiter fortfährt mit seinem schönen atmosphärischen Gleichgewicht, auf das auch die Menschen angewiesen sind. Hier schließen sich alle Bestrebungen nach einer ökologischen Ökonomie oder einer ökonomischen Ökologie an.
Dann gibt es jedoch solche, für die ist Natur einfach heilig, vielleicht von vielen Gött:innen oder von einem Gott bewohnt. Sie finden, diese Heiligkeit muss geehrt, allenfalls geschützt oder gefeiert werden.
Unglaublich, aber wahr ist, dass es auch (noch) solche gibt, die das Wort Natur gar nicht kennen! Es gibt tatsächlich Völker, in deren Sprache Natur nicht vorkommt. Sie kennen Berge, Bäume, Flüsse, Pflanzen per Namen; sie wissen, wo sie sind, was sie tun, wer ihre Nachbarn sind und allenfalls sogar, wie man mit ihnen in Kontakt kommen kann oder umgeht. Aber Natur als Ganzes kennen sie nicht, wozu auch all das in einen Begriff packen? Sie wollen sich das alles ja nicht vom Leibe halten oder es gar vergessen, was bei Überbegriffen oder Großwörtern, wie ich sie nenne, oft geschieht.
Daneben gibt es auch jene Stimmen, für die Natur zu einem Unwort geworden ist. Politisch zutiefst unkorrekt, weil es in sich die Geschichte der naturalistischen, kolonialistischen Unterdrückung enthält und festhält, wie sie meinen.
Ich kenne auch solche, für die ist Natur einfach eine unter mehreren relevanten Um-Welten menschlicher Gesellschaften. Es ist jener Teil, der zu den Naturwissenschaften zählt und sich vom Geist der Geisteswissenschaften unterscheidet. Uff.
Und viele wissen von all dem nichts oder zumindest nicht so und finden Natur einfach schön. Sie freuen sich, wenn sie ins Grüne schauen oder sich draußen aufhalten können, darüber, wenn sie einem Schmetterling oder einer Blume begegnen, wilde Brombeeren vom Strauch essen oder Mangos – je nachdem, wo sie sich aufhalten.
Mhm.
Wir sehen: Natur ist ein komplexes Wort.
Ich würde mich wohl gerne zu den Zuletztgenannten zählen, aber so unschuldig kann ich mich nach vielen Jahren psychologischer Arbeit in und mit der Natur nicht präsentieren und schon gar nicht, wenn ich trotz aller Bedenken dieses Wort in den Titel nehme und in Umlauf bringe.
Bekanntlich können wir niemandem vorschreiben, wie er oder sie etwas versteht – glücklicherweise, möchte ich hinzufügen.
Was ich jedoch hoffe: dass mit dem, was auf den kommenden Seiten geschrieben ist, auch der Begriff Natur sich dreht und wendet, dass er sich verschiedentlich erhitzt und mit Sinn und Geschichten befüllt, dass er sich verwurzelt, verflüssigt, belüftet und dass er im Leben und in den Praxisfeldern aller, die ihn für wichtig halten, einen guten Platz einnehmen kann.
Astrid Habiba Kreszmeier
Altstätten, im Frühjahr 2021
1In Zeiten fortschreitender Erddemenz1
»Es könnte immerhin sein, dass es für erdgebundene Wesen,die handeln als seien sie im Weltall beheimatet, auf immer unmöglich ist,die Dinge, die sie solcherweise tun, auch zu verstehen.«
Hannah Arendt, Vita Activa, S. 10
Wo sind wir gelandet?
Regnet es?
Nach vielen sonnigen Tagen regnet es.
Das mag ein etwas seltsamer Beginn für eine Art Fachbuch sein, dennoch ist er genau richtig. Weil es eben von großer Bedeutung ist, dass es regnet. Früher kamen mir eher abfällige Gedanken, wenn andere übers Wetter redeten. Sie sollten doch mit dem Small Talk aufhören und über etwas Wichtigeres sprechen. Über das, was sie wirklich beschäftigt, was ihnen wirklich wichtig ist. Und bestimmt habe ich mich auch über mich geärgert, wenn mir nichts Besseres eingefallen ist, als zu sagen: Regnet es bei euch auch? Sich über das, was uns umgibt, also unter anderem und ganz wesentlich das Wetter, auszutauschen, war nahezu ein intellektuelles Armutszeichen.
Das sehe ich heute nicht mehr so. Im Gegenteil, ich halte es für außerordentlich wichtig, dass wir wieder mehr wahrnehmen, ernst nehmen und mitteilen, was für Witterungen wir gerade erleben. Welche ganz sinnlich wahrnehmbaren Atmosphären, welche elementaren Qualitäten mit uns sind. Es scheint mir für unsere körperliche, psychische und soziale Gesundheit – oder anders, für unser gedeihliches Zusammenleben hier auf Erden – wesentlich, dass wir nicht nur über unsere smarte Wetter-App, sondern auch hautnah bemerken, dass es draußen heiß, nass, trocken, windig, nebelig, sonnig ist. Wetter ist wesentlich, nicht nur, aber auch für Menschen.
Wo bist du?
Nach vielen sonnigen Tagen regnet es. Ich sitze im Dachzimmer eines Hauses in den Südhängen des ostschweizerischen Rheintales. Der bräunlich-graue Wolkenhimmel und ziehende Nebel lassen mich zwar die Ebene sehen, die der Rhein dereinst mäandernd mitgestaltet hat, jedoch die prächtigen Bergketten auf der anderen Seite bleiben gerade verhüllt. Das macht gar nichts. Weil ich weiß, dass es sie gibt. So oft haben sie sich mir gezeigt (und ich mich ihnen), dass ihre Gegenwart in meinem räumlichen Empfinden lebendig ist. Sie halten den Raum und mich in ihm, so scheint es mir, so fühle ich es. Und ich bin ihnen so dankbar. Dankbar bin ich auch diesen Hügeln und Hängen, den Nasen und Kuppen, ganz besonders den sieben Birken, dem Holunder und der großen, alten Linde am Hang vor unserem Fenster. Ich will es jetzt zu Beginn nicht übertreiben mit meinen Liebesbekundungen an diese Landschaft, mit der ich lebe, das würde kein Ende nehmen. Ich würde dann ja auch von den menschlichen Nachbarn erzählen müssen, den Bauern und Bäuerinnen, den Handwerkern und Kassiererinnen, den Physiotherapeuten und Versicherungsmaklern. Aber auch damit wäre es nicht getan, ich müsste nämlich auch den Straßen, die hier im Hang angelegt sind, danken, und unserem Auto und dem Fahrrad und dem schicken Airbook und meinem schier unverwüstlichen Telefon und den vielen Dingen, die mit mir leben. Keine Sorge, soweit wird es nicht kommen, und dennoch ist mir wichtig hier einzubringen, dass ich mich als Schreibende an einem Ort befinde. An einem ganz wirklichen Ort, in einer geografischen, biologischen und freilich auch kulturellen Situation. Dieser Ort mitsamt seinen wilden Welten und menschengemachten Dingen spricht mit, schreibt mit. Nichts geschieht ohne den Ort, an dem wir gerade sind.
Alle folgenden Überlegungen und Geschichten möchten unter anderem daran erinnern, dass wir Menschen Teil einer Welt sind, die lebt und pulsiert. Dass es einen Unterschied macht, ob wir und unsere menschlichen Mit-Lebenden nicht nur wahrnehmen, dass es uns gibt, sondern auch wo es uns gibt. Vor allem auch wie wir mit diesem Wo in Beziehung sind und mit ihm kommunizieren. Der Regen trommelt kräftig auf die Dachfenster, schön.
Was spricht dich an?
Ich sitze im Dachzimmer eines Hauses in den Südhängen des ostschweizerischen Rheintales. Dort unten in der Ebene, wo heute Rietflächen, Wiesen und fruchtbares Ackerland, kleine städtische Siedlungen und Dörfer einander abwechseln und die der Rhein in begradigter Linie durchzieht, dort war vor langer Zeit ein Gletscher, dann ein großer See, dann ein mäandernder Fluss.
Funde in den Halbhöhlen an den Hängen deuten auf prähistorische Besiedelung hin und sollen gar bis zu 10.000 Jahre alt sein. Als geologische oder archäologische Information sagt mir das noch nicht viel. Allerdings geschieht es, dass mich aus der langen Zeitgeschichte des Raumes etwas anhaucht und zum Eintauchen einlädt. Es sind dann nicht Gefühle im eigentlichen Sinn, sondern eher Ahnungen, organismische Wahrnehmungen, ja körperliche Empfindungen, die mich an dieses Feuer in der Halbhöhle rufen. Gemeinsam mit den anderen sitze ich dann dort, den Älteren und Jüngeren, eingebettet in diese ungeheure Vielfalt der Wildnis rund um uns, ja vielleicht mit einem Blick auf den mäandernden Fluss, der uns so viel Nahrung beschert. Unsere Körper wissen sich zu bewegen, kräftig und sanft in diesen Felsen, Moosen, Wäldern, mit den Tieren und Pflanzen und unter uns. Hand in Hand bei der Jagd, am Feuer, bei den Gängen durchs Land, beim Sammeln und Graben. Hier werden Kinder geboren, hier sterben andere, manche jung, manche alt. Wir erzählen die Geschichten des Tages und wohl auch schon die Geschichten der Ahnen. Wir singen und tanzen.
Solche Bilder kann mir diese Landschaft zurufen. Andere Landschaften erzählen andere Geschichten. Alle laden ein, zu erinnern.
Was will sich erinnern?
Jetzt regnet es nicht mehr. Das Zirpen der Grillen, Vogelstimmen, blökende Schafe und der rauschende Grundton des Windes in den Bäumen des angrenzenden Waldes füllen mein Dachzimmer. Wie alle Töne füllen sie auch mich auf ihre eigentümliche Weise. Es klingt friedlich miteinander. Das ist es oft auch, aber gewiss haben diese Hügel und Hänge nicht nur Frieden erlebt. In unmittelbarer Nähe ziehen Kantonsgrenzen, aber auch Staatsgrenzen durch das Gebiet. Hier wurde gerungen, gekämpft und gehandelt. Die Geschichte dieses Grenzraumes kann sich jederzeit auffalten, über irgendein zufälliges Zeichen. Gerade höre ich einen Schuss. Jagd? Schießübungen? Noch einen. Vielleicht wegen der Wildschweine, die hier durch die Wälder ziehen.
Dort unten der Alpenrhein, dessen Mäandern vor gut 100 Jahren reguliert wurde. Er ist nicht nur Fluss, sondern auch fließende, politische Grenze zwischen der Schweiz und Österreich. Wie schnell jene offene, mehr verbindende als trennende Zone zu einer bedrohlichen, von Militär aktiv bewachten Mauer werden kann, haben die Corona-Maßnahmen im Frühjahr 2020 gezeigt. Bewegungen, die über Jahrzehnte selbstverständliche Gewohnheit waren, Freundschaften, soziales Leben, Familien, Liebesbeziehungen und alles, was nicht gerade notwendiger oder als solches angesehener Wirtschaftsverkehr war, wurden von einem Tag auf den anderen getrennt, unterbunden und verboten. An dieser Grenze war »Krieg«, der unsichtbare Feind allgegenwärtig und mit ihm die Erinnerungen und Geschichten der letzten Kriege. Ob in ihnen die Chancen der Befriedung genutzt werden können, oder ob der Schreck, die Angst und die Panik sich noch etwas tiefer eingraben werden?
Wie antwortest du?
All diese Ausflüge rund um meinen aktuellen Schreibort unternehme ich nicht aus erzählfreudiger Laune heraus, sondern weil alles zu systemisch-ökologischen Perspektiven gehört: genau genommen ja zum Leben an sich, zumindest zu einem situiert-leiblichen, sinnlich-wirklichen Leben. Das Wetter, die Geografie, die Landschaft, ihre Steine, Pflanzen und Tiere, die Luft und ihr Lied. Und natürlich die Menschen, ihre Geschichten und Kulturen und ihre Räume der Erinnerung.
Das alles gehört dazu.
Dieses Nachdenken und Erzählen lädt dazu ein, unseren irdischen Lebenskontext samt seinen biologischen und kulturellen Historien in unsere professionellen Begegnungen, Gespräche, Hypothesen, Reflexionen und Interaktionen aufzunehmen. Es geht darum, menschliche Angelegenheiten in ihrer systemischen Verortung als Erd-Mitbewohner:innen mitzudenken, mitzufühlen und in unsere Kommunikation einfließen zu lassen. Es geht darum, der fortschreitenden »Erddemenz«, die leider schon vor ein paar Jahrtausenden langsam ihren Anfang genommen hat und seit gut 200 Jahren exponentiell gestiegen ist, auch im Bereich von Bildung und Beratung ein paar Körper-Denkübungen oder auch Kopf-Herz-Hand-Wege entgegenzuhalten.
Bekanntlich wird nichts von einem objektiven Niemand im relativen Nirgendwo geschrieben, auch wenn viele ganz geschickt sind darin, so zu tun als ob, oder vermutlich tatsächlich an solch objektive Standpunkte und ihre Wahrhaftigkeit glauben. Ich schreibe also nicht nur in einem spezifischen Orts-Raum, sondern auch in einer spezifischen kulturellen Zeit, und ich bin als in Sprache lebendes weibliches menschliches Wesen mit all dem im wechselseitigen Austausch und in bedingender Verwobenheit.
Der kulturelle Moment, in dem dieser Text entstanden sein wird, ist geprägt von der oben kurz erwähnten Covid-19-Pandemie, deren Wellen, Nach- oder Nebenwellen hier im mitteleuropäischen Raum und in allen anderen Teilen der Welt gerade Wirklichkeiten gestalten. Corona »erschien« in einer Zeit, in der Klimaerwärmung, System-Change, from Ego to Eco, Kreislaufwirtschaftsmodelle aber auch konservative Nationalismen, Fremdenfeindlichkeit und potenziell totalitäre Populismen den gesellschaftlichen Diskurs prägten. Diese Gegenwärtigkeiten werden da und dort in den Fluss der Gedanken hineinschwappen. Auch wenn natur-dialogische Blickwinkel weder von der Pandemie noch von ihren Auswirkungen sonderlich überrascht sind, so gewinnen sie inmitten dessen doch an Dringlichkeit.
Ist die Welt noch von Belang?
Bist du bei Sinnen?
Bislang war ich der Meinung, dass es primär wichtig sei, die verschüttete Beziehung zu den uns umgebenden Naturräumen und den Dingen im Allgemeinen zu thematisieren. Nach den letzten Monaten der digitalen Aufrüstung in Bildung und Psychotherapie scheint jedoch neben der Erddemenz eine weitere Krankheit um sich zu greifen: nämlich eine gehörige Ent-Körperung unseres sozialen menschlichen Daseins. Wir gewöhnen uns gerade daran, dass wirklich körperliche Begegnungen nicht nur potenziell gefährlich, sondern auch mehrheitlich unnötig sind. Zumindest in den wohlhabenden Ländern, die körperliche Notwendigkeiten an billige ausländische Arbeitskräfte delegieren und darüber hinaus über so viel Raum verfügen, dass Distanzgeschäfte funktionieren.
So werden gerade Beratungs- und Therapie-Apps im großen Stil entwickelt. Viele Kollegen halten Online-Beratung für mindestens so wirkungsvoll wie Präsenz-Beratung, und selbst körperorientierte Verfahren wie die Aufstellungsarbeit scheinen mittels Splitscreen und Face-Tracing so gut zu funktionieren, dass nicht einmal Klienten und Stellvertreter im selben Raum sein müssen.2
Es bahnt sich an: In Zukunft wird es mehr und mehr digitale Beratungen geben. Der selbstbestimmte Kunde oder Klient wird frei wählen, was für ihn gut ist. Das ist auch angemessen. Er (oder sie) wird sich vermutlich für eine Therapie-App entscheiden, die er sich zunächst gratis downloaden kann. Ab einer gewissen Bedarfskomplexität kann er ja jederzeit auf Standard Pro, Premium light oder gar Goldmaster aufstocken. Von seiner individualisierten, automatisierten Therapie-App wird er in klug berechneter Taktung Nachrichten erhalten. Sie werden ihn glücklicher machen, auf andere Ideen bringen, und sie werden Möglichkeiten erweitern! Mit jeder Interaktion wird der Computer mehr lernen, und da er ohnedies »mitschaut«, wo sich der Klient den ganzen Tag virtuell und analog bewegt, können die Nachrichten immer gezielter, gewitzter und klüger werden. Und ich bin überzeugt, dass mit dieser Technik auch viel Schlimmes verhindert werden kann. Kein Witz.
Nun, andere werden sich für eine analoge Beratung entscheiden, weil ihnen eine wirklich gute Freundin das im wirklich guten Moment empfiehlt. Nehmen wir an, diesmal sei es eine Klientin: Sie wird sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Weg machen, vermutlich im Verkehr steckenbleiben. Sie wird schon vor dem eigentlichen Ereignis einiges riechen, schmecken und fühlen; es wird, je nachdem, von wo nach wo sie unterwegs ist, mehr oder weniger anstrengend sein. Ich erspare uns jegliche Details. Sie wird aber irgendwann den vereinbarten Treffpunkt erreichen, vermutlich ein Haus. Die Atmosphäre der Tür, die Gerüche im Gang, der Ton der Glocke, der Empfang und dann die Begegnung mit diesem Menschen, der ihre Therapeutin, ihr Berater ist. Ein Blick, ein kurzes Lächeln, eine kleine Unsicherheit, vielleicht sogar Scham oder aber Freude, spontane Geneigtheit, gewisse ritualisierte Handlungen, Händewaschen, ein Glas Wasser.
Selbst wenn alles schon bekannt ist: Dieser Moment der Begegnung wird immer etwas Aufregendes sein, weil er eine in Echtzeit stattfindende Erfahrung ist. Wir treten miteinander in einen gemeinsamen Handlungsraum, und bei allem Bemühen, eine solche Begegnung abzusichern, bleibt sie, was Leben derweilen noch ist: ein unvorhersehbares, unberechenbares Aufeinanderbezogensein, das jederzeit spontan Stimmungen, Gefühle, Ideen und Bewegungen hervorbringen kann. Dieser Unverfügbarkeit des lebendigen Raumes ist nicht gänzlich beizukommen. Wir bleiben ewige Schüler:innen in Sachen Vertrauen und Kompetenz, wenn es ums Lebendige geht. Jede leiblich-situierte Begegnung ist bei genauer Betrachtung ein Lernraum für den Umgang mit lebendigen Dingen.
Unentwegt mittendrin
So unfassbar es klingt: Der Umgang mit lebendigen Dingen, ja überhaupt die Erinnerung daran, dass Leben mit Lebendigkeit zu tun hat, macht konsequent allerlei Risikoberechnungen und Produktivitätssteigerungsmodellen Platz, deren Ergebnisse nur dann treffend sind, wenn spontane Erscheinungen durch Absicherung unwahrscheinlich gemacht werden.
Eine langjährige Freundin ist Großmutter geworden. Während der Schwangerschaft war sie irritiert darüber, dass ihre Tochter von einem digitalen Schwangerschaftsprogramm regelrecht unter Kontrolle gehalten wurde. Ihre »Mama-Werden«-App wurde zur Autorität und Orientierung Nummer eins. Auch wenn wir die »großmütterliche Übertreibung« abziehen und auch die mögliche Kränkung, als Mutter weniger Stimme zu haben als ein programmierter Ratgeber, so teile ich dennoch ihre Besorgnis: »Meine Tochter verliert ihr natürliches Gefühl zu sich selbst, das Vertrauen in ihre Wahrnehmungen und den Dialog mit dem Kind, den Menschen und der Welt rundum.«
Es ist ein Weltverlust, ein Verlust des vertieften, sinnlichen, leiblichen und direkten Handelns in einer mehrdimensionalen wirklichen Welt, den wir vorantreiben, der uns vorantreibt. Das wirkt unmittelbar in alle beruflichen Felder hinein.
Umso überraschender ist, dass die menschlichen Beziehungen zur Welt in Psychotherapie und Beratung kaum Aufmerksamkeit erhalten, während sie in der Soziologie, der politischen Philosophie und alternativen Bewegungen intensiv diskutiert werden. Selbst in systemischen Schulen, die für eine kontextbewusste Schau von Kommunikationsnetzwerken stehen, ist die Frage nach den Beziehungen mit der äußeren Welt – sei sie selbst-lebendig oder von Menschen gemacht – aktuell kaum im Bewusstsein. Die ökologische Verwobenheit hat mitunter dem rein mensch-orientierten oder ganz abstrakten Systemdenken Platz gemacht. Fast könnte man meinen, dem systemischen Netzwerk seien einige Welten-Fäden entglitten, die in seinem Entstehen noch durchaus prominent mitgedacht wurden.3
Hier mache ich mich daran, einige dieser ökologischen Fäden wieder aufzugreifen, ihre Textur in meinen weiblichen Händen zu fühlen, sie mit anderen Fäden aus älterer und jüngerer Zeit zu verknüpfen und neu ins Spiel zu bringen. Wie schön, dass ich dabei nicht alleine war und bin. Durch die kollegialen Gespräche, die Begegnungen mit Klienten und Klientinnen und die Gegenwart meiner menschlichen und anders-als-menschlichen Freunde und Freundinnen ist herzhaftes, lebendiges Miteinander entstanden. All das webt in wiederkehrenden Erzählsträngen mit.
So geht es um Beiträge zum Weltlichen, zur Erinnerung an das sagenhaft Selbstverständliche, nämlich daran, dass sich das Leben ganz leiblich auf der Erde abspielt. Auch wenn darin viel vom Lebendigen, ja mitunter vom Beseelten oder gar Wunderbaren die Rede sein wird: All diese Gedanken sind tief »gottlos«, ganz und gar an Immanenz orientiert. Das Erdlingsdasein ist ausreichend unberechenbar und einfallsreich. So voller Wunder und Kraft, dass es eine Freude ist und es sich lohnt, mit offenen Augen durch Land und Leben zu ziehen.
1 Mit dem Begriff der Erddemenz will ich jene »Welt- und Erd-Entfremdung« ansprechen, die seit der Entwicklung der Schriftkulturen und ihrer dokumentierten Geistesgeschichte die Mehrzahl der menschlichen Kulturen prägt. Mit diesem Phänomen setzen sich viele Menschen in Theorie und Praxis auseinander. Meine Gedanken stützen sich unter anderem auf die theoretischen Analysen von Hannah Arendt sowie auf die Auseinandersetzungen des französischen Soziologen Bruno Latour und auf die Gedankenwelt der Ökofeministin Donna Haraway.
2 Eine schweizerische Fachzeitschrift für Beratungspersonen, das BSO Journal, widmet ihre Ausgabe 2/2020 der boomenden Frage der Online-Beratungen und ist sich sicher: Die neue Zeit ist digital. Matthias Varga von Kibéd erklärt darin im Gespräch mit Sandra Küng »Wie systemische Strukturaufstellung online geht« und stellt fest: »Systemische Strukturaufstellungen lassen sich sogar dann online durchführen, wenn der Klient und die Repräsentanten alle an verschiedenen Orten sind.« Split-Screen und Facetracking sind hier seine technischen Helfer.
3 Hier beziehe ich mich vor allem auf drei bekannte Namen: Gregory Bateson, der als wesentlicher Wegbereiter des systemischen Denkens gilt, hat in seinen gesellschaftskritischen und erkenntnistheoretischen Überlegungen, die Natur, also die nicht-menschliche Welt, noch an Bord. Zwar ist auch er, wie viele Männer seiner und schon geraumer Zeit, auf der Suche nach dem »einenden Muster«, das die Verschränkung von Materie und Geist zu erklären vermag, und tendiert letztlich dazu, dem Geist den Vorrang zu geben, aber immerhin ist er in fürsorglicher Hinwendung zur Frage: Welches Muster wirkt zwischen dem Einzelnen? In Geist und Natur schreibt er auf Seite 22: »In Wahrheit ist die richtige Weise anzufangen, über das Muster, das verbindet, nachzudenken, es primär (was immer das bedeuten mag) als einen Tanz ineinandergreifender Teile aufzufassen, und erst sekundär als festgelegt durch verschiedenartige physikalische Grenzen …«
Ilya Prigogine, der als Physiker, Chemiker und Philosoph rund um seine Thesen der Selbstorganisation und dissipativer Strukturen die Systemtheorie stark inspirierte, hatte gemeinsam mit der Philosophin Isabelle Stengers unter dem Titel Im Dialog mit der Natur eine wissenschaftskritische und philosophiekritische Auseinandersetzung der »alten« Trennung von Natur und Kultur angeregt. Isabelle Stengers ist als Wissenschaftsphilosophin bis zum heutigen Tag in ihrem Werk daran, eine kritische Auseinandersetzung von Wissenschaft, Politik, Ökologie und Kosmologie zu wagen (vgl. Stengers 2008).
Humberto Maturana, der gemeinsam mit Franzisco Varela die Idee der Autopoiese als Muss in den systemischen Diskurs einbrachte, lehrte bis zu seinem Tod im Frühjahr 2021 noch gemeinsam mit Ximena Dávila im Institut Matriztica in Chile ihren Ansatz der »Cultural Biology«, »Biologia Cultural«. Seine unermüdliche Forschung rund um das, wie Leben und menschliches Leben beschrieben und gestaltet werden kann, wird im Laufe dieser Arbeit immer wieder einfließen.
2Praxis des Streunens
»Lebende Systeme sind wunderbar spontan.«
Humberto Maturana
»Nichts ist mit allem verbunden. Alles ist mit etwas verbunden.«
Donna Haraway, Unruhig bleiben, S. 48
Seit dreißig Jahren arbeite ich mit Menschen in beratender und psychotherapeutischer Praxis. Gemeinsam mit meinem Partner und Kollegen und Kolleginnen erfinden wir Ausbildungen, zetteln wir Netzwerke an, halten da und dort Vorträge und schreiben. Es grenzt an viele Wunder, dass das, was wir am Rande einer scheinbar völlig anders tickenden Lebensumwelt tun, nicht nur funktioniert, sondern uns ernährt und erfüllt und in all den Jahren nie langweilig geworden ist. Seit zwanzig Jahren ist der Rosenhof unser Seminarhaus und Praxisraum in einem ländlichen Gebiet, am Rande eines appenzellischen Dorfes. Der Westhang hinter dem Haus lässt zwar die Sonne früher untergehen, aber er schützt uns vor kalten Winden. So gedeihen hier allerlei prächtige Blumen, Sträucher, Kräuter und Bäume, ehe sich ein wildes Wald-Tobel hinunter zu einem kleinen, aber frei fließenden Fluss namens Sitter neigt. Scherzhaft sagen wir manchmal, unser Esalen4 liegt eben nicht an der Klippe zum Pazifik, sondern an einer Klippe zum Fluss.
Die Menschen, die uns aufsuchen, sind so vielfältig wie der Garten. Jünger, älter, männlich, weiblich, arm und reich und aus allerlei beruflichen und sozialen Umfeldern. Sie kommen aus den Nachbardörfern und aus den Städten, von nah und fern. Sie kommen mit Krankheiten, Anliegen, mit Interesse oder einfach aus Freude.
Und auch wenn sich unsere Arbeitsweisen verschiedentlich beschreiben lassen, so sind sie doch alle von einer markanten Qualität geprägt: von der Praxis des Streunens. Ja, es ist fast ein bisschen simpel und doch offensichtlich: Das Streunen wurde zum Herzstück unseres Wirkens. Es gibt kaum eine andere Art von Weltenbezug, dem wir so viel an Geschenken und Einsichten, Möglichkeiten und Dialogen verdanken. Man darf annehmen, dass es sich mittlerweile herumgesprochen hat: Bei uns kann man das Streunen lernen.
Zwischen häuslichem Schutz und wildem Raum5
Streunen ist eine sehr eigenwillige Weise, in der Welt zu sein. Für gewöhnlich wird das Streunen Tieren zugesprochen. Katzen sind hierzulande vermutlich die bekanntesten »Streunerwesen«. Sie bewegen sich – sofern sie nicht absolute Wohnungs- oder Hauskatzen sind – sozusagen nach Lust und Laune nach draußen, sie streifen durch das Gebiet, ohne ersichtliches Ziel; halten inne, setzen sich, laufen weiter. Sie erkunden den Raum, nahezu belanglos, ohne von ihm etwas zu wollen, nur um sich in ihm zu bewegen. Eine Katze am Streungang ist nicht auf der Jagd, zumindest so lange nicht, bis ihr etwas ganz interessant Erscheinendes über den Weg läuft, das sie daran erinnert, dass sie auch eine Jägerin ist. Und selbst dann ist nicht sicher, ob unsere Katze das genüssliche Streunen zugunsten des erregenden Jagens aufgibt.
Ich verstehe nichts von Katzen, bin ihnen weder besonders zunoch abgeneigt, aber in Sachen Streunen können wir von ihnen lernen. Ihre Mischung aus häuslicher Anhänglichkeit und wildnisorientiertem Bewegungsverhalten ermöglicht, dass wir sie relativ häufig und gefahrenfrei wahrnehmen, ja sogar beobachten können. Ich vermute, dass auch Wildschweine, Feuersalamander, Rehe und Dachse, ja vielleicht sogar alle Vierbeiner streunen, und wahrscheinlich streunen auch Vögel. Milane zum Beispiel sind sehr elegante Luftstreuner. Der Unterschied liegt wohl nur darin, dass all diese »Wildtiere« entweder sagenhaft schnell verschwinden oder uns gar als Beute oder Feind ausmachen, wenn wir ihnen im Nahbereich begegnen. Dann ist es mit ihrem Streunen vorbei – und damit auch mit unserem Zuschauen.
Hier noch eine wichtige Unterscheidung, ehe wir weiterziehen: Eine Katze, die ihre Streunschlaufen zieht, ist nicht mit einer ständig streunenden Katze zu verwechseln. Eine ständig streunende Katze hat – weshalb auch immer – kein »Haus«, in das sie durch ein Katzenklapptürchen gelangt, wann immer es ihr beliebt. Die ständig streunende Katze beginnt einen Verwilderungsprozess, der durch die viele Jahrtausende währende Koexistenz von menschlicher und kätzlicher Spezies gar nicht so einfach ist und meist doch dadurch unterbrochen wird, dass die betroffene Katze sich eine neue Wohnung samt deren Bewohner:in sucht. Wer kennt nicht jemanden, der von einer zugelaufenen Katze regelrecht erobert wurde? Das funktioniert freilich nur bei einem ausgewogenen Verhältnis von Häusern und Katzen. Andernfalls kann es schon zu hauslosen Katzenhorden kommen, die mit Vorliebe Restaurant-Viertel überfallen. Übrigens oft zeitgleich mit den Touristenhorden, aber das ist ein anderes Thema.
Nun aber zurück zu jenem Streunen, das sich im speziellen Zusammenspiel aus häuslichem Schutzort und offenem Wildraum entwickeln kann. Es ist auch für uns Menschen möglich, zumindest für jene, die einen häuslichen Schutzort und einen offenen Wildraum einigermaßen in Reichweite haben. Leider ist das jedoch nicht selbstverständlich, und so ist auch die Kunst des Streunens – so wie viele Erbschaften aus frühen Zeiten der Menschgeschichte – vom Aussterben bedroht.
Streunen ist jene Bewegung im Raum, die keinem Ziel folgt und vor nichts flüchten muss. Die nichts wollen muss und ganz bestimmt nichts vermessen, erkennen, vergleichen. Sie muss nichts nehmen und nichts geben, auch wenn wir, solange wir atmen, gar nicht anders können als fortwährend zu nehmen und zu geben. Wir können beim Streunen den Raum und seine Dinge ganz einfach in ihrem Zusammenwirken belassen und müssen nichts (können aber, wenn es sich einstellt) aus ihm herauszoomen, herausextrahieren oder gar isolieren. Wir können das Zusammenleben sinnlich wahrnehmen, uns in und mit diesem Gewebe erkunden und ein wenig vom ständigen Werden überrascht werden. Das ist herrlich!
Ohne Ziel, jedoch nicht ohne Halt
Das Streunen erlaubt also jenen Modus, in der unsere Aufmerksamkeit, die ja immer auch eine leibliche Aufmerksamkeit ist, nicht von Werbesignalen raffiniert eingefangen, von Rechenmaschinen gelenkt oder von Marktinteressen bespielt wird. In ihm darf unsere Aufmerksamkeit einfach da sein, inmitten einer Umgebung, die auch einfach da sein darf. Wir bewegen uns in einer Aufmerksamkeitsallmende, einem Raum, in dem alle das Recht auf ihre Aufmerksamkeit haben.6
Wir müssen hier nichts voneinander wollen, nur atmend den Sinnen folgen, so wie wir eben biologisch ausgestattet sind. Nur atmend den Spuren folgen, die uns unsere Geschichten zuspielen, so wie wir Menschen das eben tun. Nur atmend uns im Raum bewegen und allein dadurch in ihm handeln, gemeinsam mit allen anderen Handelnden im Raum.
Beim Streunen lenken wir unsere Aufmerksamkeit dorthin, wohin wir sie lenken (wollen), und zugleich wird sie dorthin gelenkt, wohin sie gelenkt werden will. Hier sitzt weder ein innerer Chauffeur am Lenkrad, der weiß wohin es gehen muss, noch regelt ein Polizist unsere Bewegung. Außer wir behandeln uns selbst so, als gäbe es Chauffeur und Polizist, was leider kulturell bedingt oft der Fall ist.
Wenn das »reine Streunen« gelingt, dann folgen wir den sinnlichen Impulsen und richten uns nach ihnen aus. Hier greifen der uns umgebende Raum und wir als Individuen fortwährend ineinander, aufeinander bezugnehmend bilden wir uns miteinander aus. So sind wir zwar ohne vorbestimmtes Ziel auf dem Weg, jedoch nicht ohne Halt. Im Gegenteil: In diesem Aufmerksamkeitsdreh, der hier geschieht, fühlen sich Menschen in hohem Maß gesammelt, führend und geführt und zugleich gesehen und gemeint.
»Das ist doch wirklich verrückt«, erzählt Irina nach einer Zeit des Streunens und schüttelt noch immer den Kopf. »Ich war froh, ein bisschen Zeit für mich zu haben, und ich wollte an den Fluss, ganz im Dorthin-gehe-ich-dorthin-will-ich-Modus. Und nach ein paar Schritten bin ich ausgerutscht und sanft auf dem Hinterteil gelandet. Dort blieb ich, weil es einfach der beste Ort war zum Sein und ich ja auch nicht wirklich zum Fluss musste. Irgendwann hat mich ein Rascheln aufgeschreckt, dem bin ich gefolgt. Es war gar nichts Besonderes, einfach ein Folgen, das mich zu einem großen bemoosten Stein geführt hat. So, als würde er sagen: Sei willkommen! Kaum hatte ich mich auf ihm niedergelassen, sah ich erst, dass er so einen schönen Ausblick auf den Fluss bot, der dort unten silbern glitzerte. All das war so unmittelbar und so schön. Ich begann zu weinen, es begann mich zu weinen, der Fluss, der Stein, das Licht, meine Güte, ich wusste nicht mehr, wer wen anschaute, wer zu wem sprach – das war eine höchst lebendige Begegnung. Wenn das Streunen ist, dann habe ich jetzt eine Ahnung, wovon ich in Zukunft mehr machen werde!«
Gesunde Verstörungen
Irinas Erfahrung erzählt beispielhaft, was Streunen alles kann. Es kann uns, sofern wir uns auf einen Weg oder ein Vorhaben ausrichten, davon abbringen. Streunen ist einfach nicht im klassischen Sinn effizient, sondern eher eine Verstörung. Genauer gesagt, es macht die im Leben ständig stattfindenden Verstörungen sichtbar und erlaubt, ihnen zu folgen. Wäre Irina auf dem Weg zu einem Termin gewesen, hätte dieser »Ausrutscher« nicht zu einer innigen Begegnung mit der Welt geführt, hier in Form eines Steines, eines Blicks, eines Flusses und wer oder was sonst noch immer beteiligt war. Vermutlich hätte sie sich geärgert, wäre aufgestanden und hätte den Weg mit erhöhter Vorsicht weiter beschritten. So geschieht es leider meist: Unser geplantes Leben, das uns durch eine mehr oder minder kontrollierte Welt führt, kann sich »Ausrutscher« nicht leisten. Sie sind nicht vorgesehen. Weil sie trotzdem geschehen, müssen wir die Kontrolle erhöhen.
Das macht viel Druck und ist zudem eine einseitige und anstrengende Geschichte, weil alle dafür sorgen müssen, dass ihnen nichts Außerplanmäßiges geschieht bzw. dass sich die lebendige Interaktion, die allenfalls mit dem Raum stattfinden könnte, auf ein unbedingt nötiges Minimum reduziert. Der Raum wird kaltgestellt, seine Eigenlebendigkeit verneint bzw. in dafür vorgesehenen Zeitfenstern kultiviert. Am Feierabend, am Wochenende oder in den Ferien wäre es schön, würde die Welt wieder lebendig sein. Nur leider bleibt sie dann oft stumm, weil sie eben nur zu uns spricht, wenn sie will. Ihr Wollen, also ihre unberechenbare, nicht steuerbare und unkontrollierbare Bereitschaft, sich zu zeigen, ist unmittelbar an unsere Wahrnehmung, unser Handeln geknüpft. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Wir Menschen bewegen uns gemeinsam mit allen anderen abgegrenzten Organismen in einer fortwährenden wechselseitigen, ja sogar zirkulären Bedingtheit in und mit dem Raum, der uns umgibt. Humberto Maturana und Ximena Dávila sprechen hier von einer »organism-niche-unity«, einer Organismus-Nische-Einheit:
»Wir sehen also: Wenn ein lebendes Wesen auftaucht, bildet sich eine ökologische Organismus-Nische-Einheit. Was also wann auch immer auf der Erde erscheint, ist kein einzelnes Lebewesen, nicht ein isolierter Organismus. Vielmehr entsteht zeitgleich mit dem Organismus die Umwelt, die ihn möglich macht. Sie erscheinen miteinander in einer dynamischen Organismus-Nischen Einheit. Die ökologische Nische ist nicht statisch. Sie wandelt sich.«7
Wechselseitige Begegnungen
Diese ständig stattfindende Wechselseitigkeit können wir mehr oder weniger bewusst wahrnehmen, reflektieren und im Umlauf halten.
In den »modernen« Denkkulturen und ihrer mittlerweile nahezu globalen Verbreitung sind jedoch der Fokus und die Erfahrung der Wechselseitigkeit einer zunehmend trennenden Einseitigkeit gewichen. Das heißt, wir sind daran gewöhnt, uns von einem belebten Innen heraus in einem objektiven Draußen zu bewegen. Wir sind daran gewöhnt, sowohl dem Innen als auch dem Außen als getrennte Einheiten Aufmerksamkeit zu schenken. Mit systemischen Perspektiven, welche selbst ja noch lange nicht in unsere soziale, politische, institutionelle oder ökonomische Wirklichkeiten Einzug gehalten haben, ist unsere Aufmerksamkeit zwar mehr auf die kommunikativen Dynamiken und Muster zwischen den einzelnen Einheiten gelenkt, aber für ko-kreative eigenlebendige Wechselseitigkeit, die Maturana u. Dávila als unsere biologische Verfasstheit annehmen, gibt es in der psychologischen, bildenden, pädagogischen Sprache und Praxis nach wie vor wenig Platz.
Wir sind nicht geübt darin, auf dieses Dazwischen zu schauen und ihm Ausdruck zu verleihen. Unmessbare, unkontrollierbare, unberechenbare, unsteuerbare Kräfte, die Beziehungen wechselseitiger Lebendigkeit ausmachen, werden in der breiten Öffentlichkeit wenig zur Sprache gebracht. Gut beobachtbar wurde das bei der Auseinandersetzung mit sowie der Information rund um Covid-19. Hier prägten Zahlen, Kurven, Tabellen die tägliche Berichterstattung. Das natürliche Zusammenspiel von Milieu und Viren kam darin marginal zu Wort.
Wer sich in Psychotherapie und Beratung dem Lebendigen zuwenden will, wird sich Erfahrungen, Denkweisen und vor allem Praktiken aus anderen gesellschaftlichen Bereichen zuwenden müssen. Als besonders anschlussfähig, vermutlich nicht zuletzt aufgrund ihrer Transzendenzorientierung, die auch unsere Denkkultur durchdringt, erweisen sich Anleihen aus östlichen Kulturräumen. Unterschiedliche Formen von Achtsamkeitspraxis, der allgemeine Yoga-Boom, das beachtliche Netzwerk der Theorie-U-Bewegung oder der Integralen Schulen erzählen davon. Ihnen allen liegt eine Verwurzelung in oder Verbindung mit buddhistischen oder hinduistischen Traditionen zugrunde.8
Zirkularität erfahren
Das Streunen, von dem ich hier gerade erzähle, ist jedenfalls kein Streunen im Geiste, sondern ein Streunen auf der Erde. Es ist kein Streunen im Licht, sondern ein Streunen an der frischen Luft. Es ist ein ganz und gar materielles, körperliches, konkretes Streunen. Nichts geringeres. Wenn Irina ausrutscht, könnte sie sich auch verletzen oder zumindest ihre Hose schmutzig machen. Und selbst wenn sie so sanft landet, garantiert nichts, dass ihr Streifzug zu irgendwelchen besonders nährenden, stärkenden, ermutigenden Begegnungen führt. Streunen verspricht keinerlei Ergebnisse, das macht es heutzutage schon sehr besonders. Wer kann es sich denn schon leisten, keine Ergebnisse zu erzielen?
Hartmut Rosa, der das Prinzip oder die Fähigkeit der Resonanz ins Zentrum seiner soziologischen Thesen stellt, erläutert ausführlich, dass Ergebnisoffenheit in unserer gegenwärtigen Weltbeziehung, die auf Verfügbarkeit und Reichweitenerweiterung ausgerichtet ist, keinen Platz haben kann. Zugleich betont er mehrfach, dass Ergebnisoffenheit zu jenen zentralen Kriterien gehört, welche eine resonante – also in meinen Worten eine wechselseitig eigenlebendige, eine schöne und gelingende – Weltenerfahrung ausmachen.9 Streunen ist also resonanzkompatibel.
Aber freilich, ich höre es schon, und es stimmt: Wir leben nicht vom Streunen allein. Nicht einmal unsere Katze. Nein, wir müssen auch jagen, sammeln, essen und schlafen. Wir müssen auch träumen, tanzen, singen, lieben und Geschichten austauschen. Wir müssen vielleicht sogar irgendwohin fahren, ganz bestimmt auch putzen und uns selbst und unsere Wäsche waschen. Wir müssen spielen, dann wieder Musik machen und Feste feiern. Wir müssen Rat halten, Entscheidungen treffen, vielleicht Freunden oder Angehörigen beistehen, sie vielleicht sogar begraben und verabschieden. Wir müssen Werkzeuge bauen oder töpfern oder nähen. Manchmal müssen wir auch krank sein oder im Haus etwas erneuern oder am Dorfplatz. Ach ja, wir müssen unbedingt zum Wasser: es trinken und der Welt, den Bäumen, den Tieren, den Blitzen und Winden begegnen, ihnen lauschen und sie schauen, wir müssen ihre Zeichen lesen oder eben auch Bücher, oder das Kunstvolle tun, das uns gegeben ist. All das und viel mehr, was wir wirklich zu tun haben, ist nicht streunen. Aber, und das ist unsere These: Wer immer wieder mal streunt, der lernt viel für all das andere.
Chancen auf Rückkoppelung
Die Magie des Streunens, das haben wir schon gesehen, kann uns von vorgespurten Wegen abbringen. Als eine Art potenzielle Pertubation oder Verstörung lässt sie uns Erfahrungen von Spontaneität im wechselseitigen Zusammenspiel mit unserer ökologischen Nische machen. Unerwartet folgen wir darin Bewegungs- oder Handlungsimpulsen in und mit einem Raum, der auf uns ebenso unerwartet und spontan einwirkt wie wir auf ihn. Um es etwas pathetischer zu formulieren: Wir oder Elemente oder Perspektiven von uns erscheinen dem Raum so wie Elemente oder Perspektiven des Raumes vor uns erscheinen. Sie erscheinen uns als Du, so wie wir als Du erscheinen. Es kann sein, dass diese Dus einander etwas zurufen und gar einander antworten. Es kann sein, dass diese spontan entstehende Bezogenheit diese Dus verwandelt und zum nächsten führt. Es kann aber auch einfach still sein. Es kann sein, dass wir einem plötzlichen Antrieb folgen, schnell zu laufen, Steine zu sammeln oder in den See zu springen. Es kann aber auch sein, dass wir uns niederlassen, alle Viere von uns strecken, oder langsam, ganz langsam von einem Baum zum nächsten gehen und unsere Hände an ihren Stämmen entlanggleiten lassen, und wir spüren die Struktur der Rinde und spüren die Rinde unsere Handflächen spüren. Streunen erlaubt einen Wechsel von Geschwindigkeit, von Bewegung und Ruhe im Raum. Der Aufmerksamkeitsmodus, der mit dem Streunen einhergeht, führt nie und nimmer zu einer in nur eine Richtung weisenden Linie, dazu ist er zu biologisch, zu wirklich, zu lebendig, anders gesprochen: Er ist schlicht und ergreifend zirkulär.
»In der Biologie gibt es keine monotonen Werte«, schreibt Bateson und führt weiter aus:
»Ein monotoner Wert ist ein solcher, der entweder nur zu- oder nur abnimmt … Begehrte Substanzen, Dinge, Muster oder Erfahrungssequenzen, die in gewissem Sinne gut für den Organismus sind – Nahrungsmittel, Lebensbedingungen, Temperatur, Unterhaltung, Sex und so fort –, sind niemals so beschaffen, dass mehr von der Sache stets besser ist als weniger davon. Vielmehr gibt es für alle Objekte und Erfahrungen eine Quantität, die einen optimalen Wert hat. Jenseits dieser Quantität wird die Variable toxisch. Unter diesen Wert zu fallen bedeutet Entbehrung« (Bateson 1987, S. 72).
Inspiriert von Batesons Perspektive wage ich zu behaupten, dass Streunen in einer kulturellen Umwelt, die mit linearem Denken und einem ebensolchen Handeln seit ein paar Jahrtausenden in toxischer Liaison zusammenlebt, nicht nur antitoxisch ist, sondern auch eine enorme Bildungschance für zirkuläres Denken, Empfinden und Handeln. Es enthält die Chance zur Rückkoppelung unserer biologischen und kulturellen Verfasstheiten. Wir können nicht wissen, was dabei herauskommt. Aber ich vermute, dass ein Mehr an zirkulären Erfahrungen mit unserer Nische zumindest Unterschiede im mehrheitlich linearen Selbst- und Weltempfinden generieren würde. Das Wagnis ist es allemal wert.
Jetzt aber wieder zurück zur Katze, unserer Mentorin. Das Streunen der Katze ist ja eben auch nicht monoton, sondern rhythmisch, zyklisch, zirkulär. Vom Haus aus betrachtet, kommt und geht sie, im Territorium selbst wird sie vermutlich als begnadete Streunerin immer wieder neue Wege und Bereiche erkunden. Auf diese Weise lernt die Katze den Raum kennen und der Raum die Katze. Selbst wenn unsere Katze keine große Abenteurerin ist und – angenommen – oft auf denselben Strecken streunt, wird sie doch jedes Mal einem anderen Raum begegnen, weil das Wetter, die Ameisen, die Büsche, die Gräser, die Autos, die Menschen, die anderen Katzen, die Vögel nie und nimmer zwei Mal in der genau selben Konstellation erscheinen. Hier ist alles einmalig gegenwärtig, unwiederholbar, ganz und gar nicht verallgemeinerbar. Man könnte sagen eine einmalige besondere Erfahrung, die eine spezielle Beziehungsqualität zwischen der Katze und ihrer Nische bildet. Streunen ist so gesehen für naturwissenschaftliche Erkenntnisse ziemlich ungeeignet, weil sich aus diesem speziellen Beziehungsgeflecht nichts isoliert untersuchen und schon gar nicht beliebig wiederholen und überprüfen lässt. Es ist daher auch höchst unwahrscheinlich, dass sich in nächster Zukunft Streunen als wirksame Methode per Krankenkasse abrechnen lassen wird, worüber ich – ehrlich gesagt – auch sehr froh bin.
Eigenlebendig, miteinander und spontan
Bleiben aber dennoch die vielen Erfahrungsgeschichten von Streunenden, die wir im Laufe der Jahre immer wieder hören können. So unterschiedlich sie auch sein mögen, es wiederholen sich folgende Wahrnehmungsstränge: Hier ist zum einen die sinnlich, leibliche Erfahrung von Eigenlebendigkeit. Wir atmen und werden geatmet, wir tun und werden getan, wir richten uns aus und werden ausgerichtet. Diese eigentümliche Doppelwahrnehmung von aktiv und passiv, von geben und nehmen, erleben viele Menschen als Erfahrung von Eingebundensein. Sie ist – so meine Annahme – die reflektierte Erfahrung unserer biologischen Verfasstheit, um in Maturanas Bildern zu sprechen: Wir erfahren uns in unserer Existenz als molekulare autopoietische Lebewesen. Fortwährend fließen uns Moleküle zu und andere ab, und unsere gegebene Struktur sorgt dafür, dass wir uns in all dieser Bewegung als Lebewesen am Leben erhalten. Nicht weil eine äußere Kraft, ein Geist, ein Gott uns lenkt, sondern weil das, was wir als Leben erkennen, so funktioniert, so in der Welt ist, in ihr so handelt. Streunend erleben wir uns eigenlebendig, erfahren unsere zirkuläre Verfasstheit als existenziellen Halt, und viele beschreiben diese Erfahrung als entlastend, berührend, nährend und bewegend.
Als eigenlebendige Lebewesen erschaffen wir Menschen uns gemeinsam mit unserer Mitwelt, unserer Nische, in einer zyklischen, selbst erneuernden und reflektierenden Art und Weise. Wir sind nicht, wie bislang noch unsere Maschinen, auf Wartung von außen angewiesen. Die strukturimmanente Kooperation und die Koexistenz mit der Umgebung erhalten uns so frisch und so lange am Leben, wie es eben geht. Wenn in dieser kooperativen Koexistenz etwas maßgeblich gestört wird, dann stellen sich Unfälle oder Krankheiten ein. Wenn es nicht gelingt, ein gutes Zusammenleben wiederherzustellen, löst sich diese Organismus-Nischen-Einheit früher oder später auf. Dasselbe gilt, wenn im Laufe unseres natürlichen Alterns unser Austausch mit dem Raum bis hin zum letzten Atemzug zurückgeht und wir sterben und mit uns unsere Nischen. Gut, derweilen leben wir noch, das freut mich sehr!
Diese eigenlebendige Grundausstattung ist in sich schon eine fantastische Angelegenheit. Dazu gesellen sich andere Großartigkeiten, ohne die das Leben und das Streunen gar nicht funktionieren würden: zum Beispiel die Spontaneität. Spontan, plötzlich, ungeplant, zufällig – das sind Wörter, die in den Berichten der Streunenden praktisch immer vorkommen. Viele berichten so, also wären sie in diversen Situationen von sich selbst überrascht worden, aber eben auch von der Umgebung, die ihnen ebenso spontan, plötzlich, ungeplant und zufällig entgegenkommt. Spontan heißt weder klug noch instinktiv, es garantiert auch keine angenehme Erfahrung. Dennoch trägt das Ausbleiben von spontaner Welt- und Selbsterfahrung ganz bestimmt zu einer traurigen, stereotypen, geschmacklosen oder aggressiven Stimmung bei. Vermutlich ahnen die Menschen, dass das Lebendige bis zu einem Grad unvorhersehbar ist, jederzeit spontan sein kann, ja spontan sein muss oder will. So, wie wir den Verlust des Spontanen betrauern oder uns gar darum betrogen fühlen können, so sehr inspiriert, ja animiert es Menschen, wenn sie der Spontaneität (wieder) begegnen: bei sich, in ihrer Nische und vor allem immer im fließenden Austausch von beidem.
Zur Erinnerung: Wir sprechen hier von einer Erfahrung spontaner Eigenlebendigkeit in Wildräumen, die ihrerseits auch voller Lebewesen mit spontaner Eigenlebendigkeit sind. Im Kapitel »Zwischen den Dingen« (S. 200 ff.) werde ich mich auch besonders der Welt der menschengemachten Dinge und ihren Möglichkeiten resonanter Kooperation zuwenden. Hier schenken wir zuerst dem Streunen in »natürlichen Räumen« Aufmerksamkeit. Zum einen, weil die Eigenlebendigkeit dieser Räume uns darin unterstützt, dieses Phänomen des Lebendigen zu erkennen. Aber noch aus einem weiteren triftigen Grund: Solange wir Luft atmen müssen, solange wir Wasser trinken





























