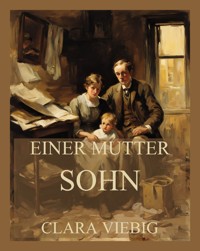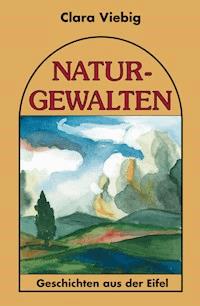
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neun frühe Novellen (1898-1904) Clara Viebigs enthält der Band 'Naturgewalten'. Schauplätze sind Eifeldörfer und Landschaften von der Mosel bis zum Hohen Venn. In diesen Eifelgeschichten geht es der Autorin nicht nur um die Gewalten der Natur, sondern vor allem um deren Auswirkungen auf die Menschen der Eifellandschaft und um die Naturgewalten, die in jedem einzelnen stecken. Landschaftsbild und Menschenbild werden so miteinander verwoben. Clara Viebig gelingt es in meisterhafter Weise, uns die 'Eifelaner' und ihr Leben in den Dörfern um Manderscheid oder in der Ein- samkeit des Hohen Venn vor gut einhundert Jahren zu schildern, oft in hartem Realismus, aber immer geprägt von der Liebe zur Landschaft und ihren Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Naturgewalten
Geschichten aus der Eifel
Rhein-Mosel-Verlag
Inhalt:Der Lebensbaum
Maria und Josef
Brennende Liebe
Der Fuhrmann
Die Liste
Ein Kriegsandenken
Der Wolf
Die letzte Nummer
Das Kind und das Venn
Der Lebensbaum
Die mächtigen Kehren der Bergstraße, die in kunstvoll angelegten Windungen vom Eifelplateau zu Tal führt, kam ein Mädchen herab.
Die Welt war in Mondschein getaucht. Unruhig zitternde, züngelnde Schatten warfen die im herbstlichen Nachtwind bebenden Ebereschenbäume am Straßenrand auf das bläulichweiße, hart wie Metall schimmernde Band der Chaussee. Zur Rechten, tief unten, in den am Tag noch grünen, jetzt seltsam fahl gefärbten, kulissenartig ineinander geschobenen Schluchten, blitzte wie blankes Silber der sich siebenmal windende Wildbach. Man hörte ihn bis zur Höhe der Chaussee herauf rauschen und gegen die Steine schlagen, die, vom ewigen Anprall rund gewaschen, sein Bett füllten.
Von links her, von der mächtigen Ley, deren uralte Kraterwände, dem erhellenden Himmelslicht zum Trotz, schwarz blieben wie in finstrer Nacht und von ihrer erstarrten Lava das Mondsilber abschüttelten, jammerten Vögel. Das Raubgeschrei der Falken und Bussarde war verstummt, aber Eulen und Käuzchen mit langgezogenem ›Huhuh –‹ mischten ihre Stimmen unter das Pfeifen der Fledermäuse.
Aus beengter Brust zittrigen Atem schöpfend, blieb Anna Maria Katzvey stehen. Jesus, war der Weg weit! So weit war der ihr sonst nie erschienen. Wäre sie doch nur schon unten im Tal, wo die niedlichen Häuser des Bädchens wie Spielzeug um die Heilquelle stehen! Dort unten – ach ja – bei der letzten, der weißen Villa – dort, wo der Garten am Hang hinauf grünt – wäre sie nur schon dort!
Mit unruhiger Hand fuhr sich die Junge über die gebräunte, niedrige Stirn. Nässe perlte darauf, aber es war nicht Tau der Nacht, es war kalter Schweiß. In einem plötzlichen Bedenken zogen sich ihre Augenbrauen zusammen: wenn’s der Herr Pfarrer wüßte! O je, der käme gleich mit Strafe und Fegfeuer für die arme Seele – – ach was, keine Sorge, dafür betete man fleißig den Rosenkranz! Eine Abhilfe mußte geschafft werden, sonst – –
Als verwirre ihm Angst den Blick, so schaute das Mädchen verstört um sich. Wenn’s nun nicht mehr zu verbergen ging! Wenn die Tant’ sie bei den Haaren riß und ausschimpfte, wenn die Leute im Dorf nach ihr guckten – o, schon alle Nacht sah sie die neugierig-hämischen Gesichter – wenn die Kameradinnen sie auslachten?! Nein, nein! Eine Abhilfe mußte geschafft werden,sonst lieber ins Wasser! Aber das Wasser ist so kalt – huh – und so naß, das Sich-Ertränken so schwer, wenn man erst zwanzig Jahre alt ist! Da war’s doch besser, man suchte sich eine andere Abhilfe. Ei, und wem schadete die denn? Niemandem geschah ein Unrecht, niemandem ein Leides –
»O Jeß!« Mit einem erschrockenen Aufkreischen fuhr das Mädchen zusammen. Was war denn das für ein Wimmern?!
Am ganzen Leib zitternd, den Hals vorgestreckt, lauschte Ammei. Horch, wieder das jammernde Rufen! Wer tat das?! Aber dann besann sie sich: je, das war ja nur ein Käuzchen! Oben um die Ley flatterte das oder hockte in einer Felsspalte.
»Haal’ dei Maul!« Sie drohte hinauf und versuchte dabei zu lachen; aber das Lachen gelang ihr nicht, sie war doch zu erschrocken. Ihre Knie zitterten, schwer lehnte sie sich an den nächsten Baum, der, von einer Last korallenroter Beeren überschüttet, müde seine Äste senkte.
Ah – Ammei guckt zu der Eberesche hinauf – die wäre auch froh, wenn sie ihre Last los würde! Und sie rüttelte hilfsbereit.
Aber kein Schauer ging nieder, fest blieben die Beeren droben haften, obgleich der Baum ihrer müde war.
Ein Zorn überkam sie darob, eine wahre Wut. Mit geballten Fäusten stieß sie sich gegen die Brust:
»O du dumm Mensch!«
Und dann fing sie plötzlich an, jämmerlich zu weinen.
Ach, was war sie doch für eine unglückliche Person, daß sie nun hier rennen mußte in der toteinsamen, bitterkalten Herbstnacht, statt daheim im warmen Bett zu schlafen! Ach, ihren guten festen Mädchenschlaf hatte sie nun nie mehr! Mitten in der Nacht schreckte sie nun etwas auf; sie wußte nicht, was das war, aber sie mußte auffahren, sich steil hinsetzen und die nackten Arme um die kalten Knie schlingen. So mußte sie oft sitzen, Stunde um Stunde – die in Falten gezogene Stirn tief gesenkt – so lange, bis die Hähne krähten und das Morgenlicht durchs Fensterchen dämmerte. Ach, und dann war sie am Tage so müde, das Kreuz war ihr steif, die Lenden waren lahm; das Rübenhacken im Taglohn, das Kartoffelausbuddeln und das Futterschneiden fürs Vieh waren ihr so blutsauer!
Und wie sollte das noch weiter werden?! Wenn Martini ins Land ritt, wurde gedroschen beim Bauer; wie sollte sie wohl dann den schweren Flegel regieren?! Wie ihn niedersausen lassen mit steifem Arm, – der Rücken kriegt einen Ruck und der ganze übrige Körper mit – daß unterm kräftigen Schlag die gelben Körner aus den Ähren springen und die Erbsen aus ihren Schoten, daß ein Tanzen anhebt von Staub und Frucht und Spreu auf der Tenne bei Dreschmusik, immer im Takt?! Und wenn sie das auch wirklich noch vor sich brächte – mit zusammengebissenen Zähnen, unter heimlichen Stoßseufzern – wie sollte es dann werden?! Später – ja später?!
Ei, dann war’s erst recht schlimm! Dann wurde nichts aus dem schönen Plan, sich zu verdingen hinunter ins Bädchen, um den Fremden, die im Sommer zur Quelle kommen und reiches Trinkgeld zahlen, aufzuwarten, um sich endlich ein neues Kleid kaufen zu können, einen Hut mit Rosen und eine Brosche für den Sonntag, die aussieht wie Gold. Wenn sie sich nun vermietete für die Saison, mußte sie doppelt und dreifach um die Gäste herumschwänzeln, mußte ihren derben Tritt dämpfen, daß er sich anhörte wie auf Sammetpantoffeln, mußte in einem fort ›Was gefällig‹ und ›Wie beliebt‹ stammeln, mußte knixen und freundlich den Mund ziehen, wenn sie lieber geweint hätte – denn sie mußte viel, sehr viel Trinkgeld verdienen. So ein Wurm kostet Geld, niemand nimmt das umsonst in Pflege; die Tant’ erst recht nicht, die wollte sich doch dran bereichern. Alt und steifknochig war die, konnte selbst nichts mehr erwerben, nun würde die immerfort die Hand ausstrecken: ›Geld! Schnaps! Wecken!‹ Da ging denn der ganze Verdienst drauf, da blieb ihr selbst nichts, kaum das Hemd auf dem Leibe!
Schauernd hüllte sich Ammei fester in ihr Tuch. Das Körbchen, das sie am Arme trug, als ginge sie wie sonst wohl an den Feiertagen zu Einkäufen hinunter ins Bad, entglitt ihr und kollerte ins Gras. Die Hände vors Gesicht schlagend, sank sie nieder am feuchten Rain und lehnte in ohnmächtigem Schmerz den Kopf hintenüber an den Meilenstein.
Ach, daß man auch eine vergnügte Stunde so bitter büßen muß! Wär’ nur der Sonntag nicht gewesen, jener warme Sonntag auf Peter und Paul, an dem im Nachbardorf Tanzmusik fiedelte und aus der ganzen Gegend, von weit her, die Mädchen zuströmten, um die Urlauber daselbst tanzen zu sehen.
Auch sie war mit einer Kameradin hingegangen durch die Felder, über deren junge Ähren der Frühsommerwind strich, durch die blühenden Lupinenbreiten, deren goldne Farbe die goldne Sonne noch goldner machte. Durch all den starken Duft der befruchteten Erde waren sie gelaufen, lachend und spaßtreibend, voller Erwartung aufs kommende Pläsier.
Wenn man die ganze Woche Werkeltag hat, genießt man den Sonntag doppelt, kostet ihn ganz aus mit allen Sinnen.
Sie hatten sich untergefaßt und zu singen angefangen, aber die Lust auf den Tanz, das Schäkern und Lachen hatte ihnen den Atem genommen, sie konnten nur noch kurze, helle Juchzer ausstoßen. Und dann waren sie hingerannt mit flatternden Röcken, gerannt, gerannt, daß nur keine zu spät kam.
Ammei hatte auch einen Tänzer gefunden. ›Wilhelm‹ hieß er und ›lieb‹ war er; das genügte ihr, nach weiter fragte sie nichts. Sie tanzten den ganzen Nachmittag miteinander, und er bestellte ihr Kuchen und Bier und Schnaps, sogar ein Viertel Wein. Sie war berauscht – nicht vom Getränk, vom Glück.
Als es Abend ward und in der dunstigen Wirtsstube zum Ersticken heiß, waren sie, gleich den anderen Paaren, draußen umherspaziert. Die Luft war schmeichlerisch, die Grillen zirpten, lockend-vertraulich.
Durch die weichdunkle Sommernacht schlichen die Paare; mancher Bursche wankte, sein Mädchen mußte ihn stützen. Auch Ammeis Wilhelm war nicht mehr nüchtern – oder war es die Liebe zu ihr, die sie aus seinen Blicken glänzen sah, und die sie aus seiner Rede hörte?
›Mädche, wat bis du lief!‹
Sie hatte noch nie so viel zärtliche Worte zu hören gekriegt. Den heißen Kopf dicht an ihren heißen geschmiegt, den Arm verliebt um ihre Hüfte gelegt, schlenderte er mit ihr abseitige Wege – – –
– – – »Jesses, Jesses, wat waoren ech esu dumm!« stöhnte jetzt die am feuchtkalten Rain Zusammengekauerte und stützte den bleischweren Kopf mit beiden Händen. Aber wer hätte denn auch gedacht, daß es so ein böses Ende nehmen würde?! Wo der Wilhelm jetzt wohl war? Bei den Soldaten! Das wußte sie, mehr aber auch nicht. Von hier herum war er nicht zu Haus, nicht einmal seinen Vatersnamen hatte sie im Nachbardorf erfahren können; und weiter zu forschen getraute sie sich nicht. Da müßte der König ja alle seine Soldaten vor ihr aufmarschieren lassen, bis sie den einen, den richtigen, herausfand. Nein, auf den Vater durfte sie keine Hoffnung setzen, sie, sie ganz allein hatte die Last am Hals!
Ihr jämmerliches Weinen ging in ein lautes Heulen über. Das Nachtgetier an der Ley verstummte, selbst das Rauschen des Wildbachs und das Wehen des Windes war nicht mehr hörbar. Einzig allein dies laute Geheul erfüllte die Natur.
»Ech will net! Ech will net!«
Ammei stieß mit den Füßen. Und dann raffte sie sich auf: schnell gemacht, nicht länger gezögert, schnell hinunter ins Bad, schnell! Hin durch den schlafenden Ort, hin zu der letzten, der weißen Villa, wo der Garten den Hang hinauf grünt, wo hinter dem Gitter, auf dem Rasenplatz – – – – ah, wenn’s auch nur wirklich wahr war, was das Bäbbchen ihr gesagt hatte?! Wart, wenn die gelogen hätte, die sollte fühlen, was Prügel sind!
Aber die hatte ja nicht gelogen, zugeschworen hatte die es ihr, anvertraut nach hochheiligem Schwur und Handschlag, daß sie selber schon einmal dort gewesen sei. Gott sei gelobt und die Gebenedeite auf dem höchsten Thron! Was sollten denn auch sonst wohl die armen Mädchen anfangen? Ihr ganzes Leben hat sonst so eine verspielt; und kriegt sie trotzdem doch noch einen Mann, und ist der auch noch so umgänglich, vorgeworfen kriegt sie’s am Ende doch, nicht nur im Streit, auch schon, wenn er nicht guter Laune ist!
Sie faltete krampfhaft die Hände und bewegte murmelnd die Lippen: »Gegrüßet seist du, Maria, Gebenedeite unter den Weibern« – –
Beten, nur beten; fleißig beten dabei! Ammei fühlte das Bedürfnis, sich des Beistands der gesegneten Jungfrau zu versichern. Und sie betete. Aber ruhiger wurde sie nicht dadurch. Sie ärgerte sich über ihre Schreckhaftigkeit; der eigene trappsende Schritt auf der steinernen Härte der Chaussee flößte ihr Furcht ein. Immer wieder blickte sie scheu zurück: folgte ihr nicht jemand? Aber nur die mächtige Ley dräute ihr finster im Rücken. Warum ihr das Herz nur so pochte? So wild hatte es ja nicht einmal gepocht, als die erste, die schreckliche Ahnung in ihr aufgedämmert war. Und jetzt stand es gar still in eisigem Schreck.
»Huhuh!«
So hatte es ja nicht einmal stillgestanden, als sie – nach durchwachter Nacht – beim Morgengrauen im Bett aufgesessen und mit verweinten Augen sich ihres Unglücks wirklich und wahrhaftig bewußt geworden war.
»Huhuh – huhuh!«
Schon wieder?! »Jessesmaria!«
Das immer rascher dahinschreitende Mädchen schlug zitternd ein Kreuz. Wie graulich die Käuzchen schrien! Nicht bloß eines, nein, ihrer drei, vier; rechts, links, vorn und hinten.
Sie waren von der Ley herabgeflattert und wischten nun mit lautlosem Flug durch die Bäume der Straße.
Was wollten die Unglücksvögel? So jammern sie doch sonst nur, wenn sie den Tod ansagen! Sollte, mußte einer sterben? Und wer denn, wer?!
»Huhuh – huhuh – huhuh!«
Nein, das war nicht mehr anzuhören! Ammei glaubte den unhörbaren Flügelschlag schon gespenstisch an ihrem Gesicht zu fühlen; unerträglich wimmerte der unheimliche Ruf. Eisige Schauer liefen ihr über den Leib. Sie vergaß das Kreuzschlagen. Sich die Ohren zuhaltend, rannte sie davon, wie auf der Flucht, im Trab hinunter zu Tal.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Das Bädchen lag in tiefer Ruhe. Die schönen Villen an seinem Eingang hatten die Läden fest vorgelegt; auch aus den Dorfhäuschen, die sich in einer gestreckten Linie durchs schmale Tal ziehen, schimmerte kein Licht. Sie alle, die darin wohnten, hatten sich während der Saison weidlich plagen müssen; nun waren die letzten Fremden des Herbstes entflohen, und sie dämmerten allmählich in den Winterschlaf hinüber. Zudem war’s jetzt Nacht.
Das verstörte, scheu um sich blickende Mädchen, das jetzt durch die Gasse huschte, brauchte kein neugieriges Auge zu befürchten. Wie ausgestorben, wie verzaubert lag der kleine Ort im Mondenschein. Auf dem spitzen Dach der Kirche, die, stattlich, ein wenig erhöht, den Flecken beherrscht, glitzerte jeder Schiefer gleich einem Riesendiamant. Auch das Wasser des Wildbachs glitzerte; aus den Kaskaden, in denen er dahinrollte, sprühten tausend Brillanten. Schwer lag der versilbernde Reif der Herbstnacht auf den braunen Blättern der Bäume, und der Bergwald, der zwischen Häusern und Kirche hereinlugte, zeigte um seine runden Buchenkronen eine schimmernde Aureole.
Das einzig Dunkle im silberbeschütteten Nest war die Gestalt, die, ins Tuch vermummt, als schwarzer Schatten flüchtig dahineilte.
Gelobt sei die heilige Schutzpatronin! Aufatmend drückt Ammei die Faust gegen das heftig pochende Herz. Jetzt war’s bald geschafft, die Straße zu Ende, deren gedrängte Häuser zu passieren, ihr das schwerste gedeucht hatte. Nun links herum!
›Linksom,‹ hatte das Bäbb gesagt, ›on dann ebbes dän Berg eruf, on dann bei der grußen Kerch rechtsom. On lao stieht die Filla, dau kanns net fehlen. On dann giehste bei’t Gitter, on kuckst, ob dat Dührche offe stieht, on wann et eweil net offe stieht, dann steigste öwer dat Gitter. Noren Kurasch, dau wills ja net stehlen!‹ So hatte das Bäbb gesprochen; aber mitkommen hatte sie nicht gewollt, obgleich die Kameradin sie vielmals gebeten hatte.
Nun, soweit war ja alles nach Vorschrift gegangen – linksum – rechtsum – da war die Villa! Aber die Courage fehlte.
Da war das Gitter – da war der Garten, der den Hang hinauf grünt – da war der Rasenplatz – und da, ganz nah, mitten im vollsten Mondesglanz, er, um deswillen sie hierhergeeilt war in Bangen und Hoffen, in Fürchten und Glauben – er, der Baum, der lebendig bleibt im Winter wie im Sommer, er, der ins Eifelland gekommen war von Gott weiß woher!
Dort stand er, ein wenig erhöht auf silberhellem Rasen – kein Busch, kein anderer Baum rundum – und reckte seine nach oben gerichteten Äste, die nicht Blätter, nicht Nadeln tragen, deren tiefes Dunkel das Licht nicht erhellte, schwarz und unbeweglich gegen die blanke Mondscheibe.
Heftig atmend, die Brust gegen das trennende Gitter gepreßt, stand Ammei und stierte und starrte.
Ah, der Baum! Wer davon trank, von seinen Zweigen einen Tee kochte – schwärzlich sollte der aussehen und bitterer schmecken als Galle und langsam durch die Kehle rinnen, klebrig wie Tannenharz – wer davon trank, wacker den bitteren Trank nicht scheute, der wurde der Last ledig.
›Fürwaohr on enklich, bei meiner ewigen Säligkaat, esu es et,‹ hatte das Bäbb geschworen.
Der Last ledig – – –!
Ammei streckte begehrlich die Hände aus und maß mit prüfendem Blick das den Garten abschließende Eisenstaket. Das Pförtchen war geschlossen, aber hoch war das Gitter ja nicht, da traute sie sich leicht hinüberzukommen. Und doch hob sie noch nicht den Fuß, um einen Stützpunkt zu suchen zum Hinüberklettern, – vor ihren Ohren wimmerte wieder der Käuzchenschrei, jener klagende Ruf des Totenvogels. Horch – wer sollte sterben, wer?!
Die Zähne schlugen der Einsamen aufeinander. Durch die Nacht, von irgendwoher – kam es vom Himmel, aus der Erde hervor, mit dem Nachtwind vom Bergwald, empor aus dem Wildbach? – drang ein Weinen, ganz leise.
Dem abergläubischen Mädchen sträubten sich die Haare. Huh, wer weinte da?! Alle Spukgeschichten, die es jemals gehört hatte, fielen ihm ein. Jesus, da drüben im Bergwald, da, wo die Leyen wie Fratzen über die Buchenkronen ragen, da, wo der große Suterwald anfängt, da hauste der Sutermichel! Da ging er um. Der konnte die Stimme verstellen, weinen wie ein hilfloses Kind – nur nicht auf den hören!
Wie vorhin beim Käuzchenschrei, so hielt sich Ammei die Ohren zu und kniff auch die Augen zu in einer großen Angst. Sie fühlte, wie aus ihren Wangen alles Blut entwich. Sie wollte wieder beten und konnte nicht, wollte wenigstens ein Kreuz schlagen, aber auch das konnte sie nicht; nur so viel Kraft hatte sie übrig, um mit ihren eiskalten Händen das Gitter zu umklammern. Sie hielt sich daran fest, denn ihr schwindelte.
Durch die dumpfe Leere ihres armen Kopfes schossen schauerliche Vorstellungen in überwältigendem Gedränge: wenn der Sutermichel nun kam, wenn er sie packte?! Horch, das Wehen! Vom Bergwald herunter pustete wer! Die Blätter zitterten vor Angst. Jesus Maria, nur fortlaufen, rasch! Aber nein, nein, sie mußte ja bleiben – vom Baum pflücken, vom Baume!
Mit aller Willenskraft die Augen aufreißend, suchte Ammei dessen tröstenden Anblick. Und wie sie ihn so recht ins Auge faßte, schwand plötzlich der Spuk und auch ihre Angst. Jetzt hätte sie lachen mögen: so einfältig war’s, sich zu fürchten! Vor was denn? Nun war sie ja hier am ersehnten Ort, hier stand ja der Baum, der nicht seinesgleichen hatte im Eifelland – gepriesen sei er! Schnell hin und gepflückt, von den Zweigen ins Körbchen gesammelt, und dann geschwind heimgelaufen, den Tee gekocht und – hei – getrunken!
In einem plötzlichen Entschluß, wie angefeuert zu Mut und Tatkraft, packte Anna Maria Katzvey das Gitter fester, gab sich einen Ruck, einen Schwung – plumps – da lag sie, schwer wie ein Mehlsack jenseits auf dem Gartengrund. Aber sie hatte sich nicht wehgetan; wohlgemut stand sie auf und ging rasch, mit federnden Schritten, auf den Baum los.
Sie zitterte vor Freude: jetzt, jetzt hatte sie ihn!
Nah, schon ganz nah war ihr der schlanke Stamm, der sich tannengerade ins Mondlicht reckte, nur die Hände brauchte sie auszustrecken – so! Zu greifen – o weh! Ihr Arm war nicht lang genug. Ein gut Stück über ihrem Kopf fingen erst die untersten Äste an. Die hatten ursprünglich viel weiter hinabgereicht, aber – abgeschnitten, abgeknickt, abgerissen fehlten sie jetzt alle, alle! Nur dürr herausstehende Stümpfchen zeigten an, wo sie einst gewesen waren.
Mit offenem Mund starrte das enttäuschte Mädchen. Und dann machte es einen Sprung, tölpisch in Hast und Ungestüm, und dann noch einen und noch einen höheren. Ein derbes Schimpfwort drängte sich durch die zusammengebissenen Zähne, ein verzweifeltes ›Jessmarijusep‹ folgte.
Aber unerreicht blieben die untersten Äste des Lebensbaumes; in seltener Höhe hob sich die Zypresse und ließ um ihren zugespitzten Wipfel das Mondlicht zittern.
Sprünge folgten auf Sprünge. Die haltenden Nadeln, der Pfeil flogen aus Ammeis Haar, die Zöpfe fielen lang über den Rücken und hüpften mit bei jeglichem Sprung. Bald lösten sich Strähnen. Die Röcke flatterten.
Das war ein Keuchen und Jappen, ein Recken und auf die Zehen heben, ein Langen und Haschen und Greifen und doch in die leere Luft Fassen. Aus der Sehnsucht war die Gier geworden: sie mußte vom Baume haben, sie mußte!
Wild sah sich Ammei um. Aber ihr Blick galt nicht der weißen Villa, von der aus der Wächter, der Haus und Garten behütete, nun die Herrschaft wieder in der Stadt war, sie gut hätte sehen können; er galt auch nicht dem Weg, den, das Gitter entlang, ein spät aus dem Wirtshaus Heimgehender leicht passieren konnte. Sie horchte nicht wie vordem ängstlich auf jedes Geräusch, hörte weder das Rufen der Käuzchen, noch das leise Weinen, noch das mahnende Wehen vom Bergwald – sie sah, hörte, fühlte, begehrte nur: vom Baume.
Schweiß und Tränen liefen über das erhitzte Mädchengesicht.
»Hilf, Maria, Benedeite, hilf! Verflixter Baum, vermaledeiter Baum, ech ruppen dech kurz on klein, ech schlaon dech kapores!«
Wütend packte sie den Stamm und rüttelte ihn, aber kein einziges Zweiglein starren Grüns fiel herab, und die zähen Wurzeln hafteten wie mit Eisen festgeklammert im Erdreich.
Da gab sie das Rütteln auf und das Hämmern mit den Fäusten gegen seine Rinde. Auf die Knie sinkend hob sie flehend die Hände:
»O du heilige Jungfrau, Gebenedeite unter den Weibern und gebenedeit die Frucht deines Leibes – laoß e Blättche nidderfaalen! Noren eins, noren ein einzig Blättche, ech bitten dech!«
Aber kein Blättchen fiel. Wohl aber fiel Tau – gleich Tränen – schwer und hörbar niedertropfend, auf die Kreatur.
Langsam rutschte der Mond tiefer auf seiner Bahn; dumpfe Schläge der Kirchenuhr dröhnten durch die Mitternacht. Da ließ sich plötzlich ein behutsamer Tritt vernehmen. Und nun noch einer! Trippelnde leichte Mädchenschritte waren es.
Die am Stamm der Zypresse in tiefer Niedergeschlagenheit Kauernde hörte sie nicht, sah nicht, daß jemand nahte. Auch sie ward nicht gesehen; über ihre Gestalt hinweg hefteten sich wiederum begehrliche Blicke auf den hilfreichen Baum.
Zwei Mädchen standen jetzt am Gitter: eine hübsche Schlanke und eine, deren noch nicht bis zu den Knöcheln reichendes Röckchen und das vom runden Kamm zurückgehaltene, kurzverschnittene Haar die kaum Halbwüchsige verrieten.
Die Augen in dem runden Kindergesicht funkelten. Das war ein Spaß! Gestern schon war sie hergeschlichen, um für die große Schwester vom Baume zu holen, aber wenn sie, die Luzia, auch gut klettern konnte, bis ans Grün war sie doch nicht hinauf ge- kommen. Immer wieder war sie den Stamm hinuntergerutscht. Aber heut würde es glücken – hurra – heut hatten sie ja eine Leiter!
»Helf mer doch, helf mer doch,« wisperte die Große ungeduldig und lud sich die Leiter auf den Rücken. Sie lupften beide. Und die Kleine überlegte dabei: warum eigentlich die Lisa nur durchaus und durchum von dem Lebensbaum haben mußte?! Wollte sie einen Kranz davon winden, vielleicht für ein Grab? O je, darum brauchten sie doch nicht so heimlich zu schleichen!
»Lisa, saog ehs, en Tee willste dervon kochen, es’t waohr? Für wat dann? Lisa, saog!«
Aber die große Schwester fuhr sie an: »Biste still!«
Und dann mühten sie sich. Geschwind genug rutschte die Leiter übers Gitter, aber trotz aller Vorsicht rumpelten die Holzsprossen auf den Eisenstäben.
Ammei unterm Baum horchte auf: wer, wer war da?! Und jetzt merkte sie’s: ei, da waren ihrer zwei mit einer Leiter! Die wollten wohl auch vom Baume?!
»Hä!« Sie richtete sich schnell auf.
Mit einem unterdrückten Kreischen wichen die Schwestern zurück und ließen ihre Leiter fallen; aber nur im ersten Schreck, denn als die große Lisa die so störend Aufgetauchte näher ins Auge gefaßt hatte, huschte ein pfiffiges Lächeln um ihren Mund: aha, auch eine! Ei, vor der brauchte man keine Angst zu haben!
Ungeniert machte sie sich daran, ihre Leiter zu richten. Die Kleine kroch behend hinauf, während sie die auf abschüssigem Sand rutschende Leiter hielt.
Ammei stand dabei mit gierenden Blicken. Nun streckte sie die Hände aus – ah, ein Zweiglein fiel, und noch eins, und noch eins! Die Kleine oben verstand wacker zu rupfen. Jetzt – hei! – jetzt fiel ein ganzer Strauß nieder.
Wie die Wilden stürzten beide Mädchen drüber her.
Lisa vergaß die rutschende Leiter, Ammei ihre Scheu. Beide rafften und rafften. Heiß vom vielen Bücken und mit hochwogender Brust standen sie sich dann gegenüber.
»Haste eweil genug?« fragte Lisa.
Und Ammei antwortete, nach einem befriedigten Blick auf ihr bis zum Rande gefülltes Körbchen: »Jesses, dat waor äwer gescheid, ihr Mädercher, dat ihr en Leiter gehaot hatt!«
Und dann von einem lebhaften Dankgefühl bewegt – was hätte sie machen sollen, wären die nicht gekommen?! – streckte sie die Hand hin: »Seid aach villmals bedankt!«
»Kein Ursach!« Und dann pfiff die große der kleinen Schwester: »Komm eweil erunner, Zeih! Mir haon des eweil genug! Laosse mir dän annern aach noch ebbes üwrig!«
»Dän annern?!« Ammei riß die Augen auf, sie war erstaunt: begehrten denn noch viele andere vom Baume?!
»Olau!« Die hübsche Lisa lachte. »Duh sein derer mieh, als mer denkt! Net bloß hei zu Land – wat zweifelste? – nä, üwerall! Ech haon als des Grün nach der Stadt geschickt an en Bekannte, on widder an en Bekannte von der – ech saon der: dat hei gedrunk, es dausendmaol besser, als all die annren Middelcher, die gebraucht gänn!«
»Maanste, maanste wirklich?«
»Ech schwören druf!«
Da fing Ammei, angesteckt von der heiteren Zuversicht der anderen, sich an zu freuen. Vergnügt wurde sie und zutraulich.
Flüsternd kamen sie beide ins Schwatzen, und die Halbwüchsige, die derweil vom Baum herabgeklettert war, stand dabei und hörte zu mit neugierig gespitzten Ohren. Sie hätte wohl noch länger geschwatzt, aber ein Geräusch störte sie. Es kam nicht aus der Villa, auch war es nicht das Knurren eines Hundes. Ein unterdrücktes Schluchzen war’s, und ein Seufzen, in der Stille der Nacht schon von weitem vernehmlich. Und dann ein mahnendes ›S–st–‹ und ein ungeduldig flüsterndes Zureden.
Noch war niemand zu erspähen – aber jetzt!
Um die Ecke des Gäßchens bog ein Paar: ein Bursche und eine Frauensperson. Er zog sie, und sie widerstrebte und schluchzte dabei aus tiefster Seele. Aber sie ließ sich doch ziehen. Stracks kamen sie auf den Garten zu.
»Hau,« wisperte Lisa und drückte sich hinter den Baum, »die kommen heihin. Ech kennen se net – se sein net von hei – äwer ech möchten doch net in dem Mannsbild sei Maul. Zeih, wit, mit! Eweil gitt et strawättzt!« Und die jüngere Schwester mit sich reißend und ihre Leiter im Stich lassend, huschte Lisa davon, mit der Örtlichkeit wohl vertraut, rasch hinter den Büschen des Gartens verschwindend.
Ammei stand verdutzt: was, wie? Kam denn die ganze Welt heut zum Baume?!
Überall glaubte sie Wispern zu vernehmen und schleichende Tritte von allen Seiten. Unwillkürlich gab auch sie Fersengeld. Mit einem Anlauf sich über das Gitter schwingend, setzte sie an dem erschrockenen Liebespaar vorüber und jagte davon wie ein Wild, das ein Schuß geschreckt hat.
Erst als sie gänzlich zum Ort hinaus war, hielt sie an. Ihren Korb mit den Zweigen fest an die keuchende Brust pressend, sandte sie einen triumphierenden Blick rundum:
»Heilige Maria, Moddergotts, Königin der Jungfrauen auf dem höchsten Thron – eweil gänn ech et quitt! Gelowt seiste!«
* * *
Schon seit Menschengedenken geht in der Gegend die Sage vom Lebensbaum, von der wunderwirkenden Zypresse im Garten der weißen Villa. Aber nicht immer hilft der erlösende Trank; das mußte auch die Katzvey erfahren. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie’s begriff, daß bei ihr das Mittel nicht angeschlagen hatte. Längst zeigten die Leute mit Fingern auf sie, da hoffte sie immer noch – hatte sie sich denn von dem abscheulichen Getränk nicht literweise hinabgezwungen, und waren die Zweige zum Tee nicht in hellster Vollmondnacht gepflückt, wodurch der ganz besonders wirksam werden sollte?!
Ach, nun mußte sie sich’s endlich eingestehn, daß ihr der Baum nicht geholfen hatte, denn – das Kind war da.
Ein kräftiger Junge war es, der die dünnen Wände der baufälligen Hütte so durchdringend anschrie, daß er nicht zu verheimlichen war. Die Tant’ machte zwar zornig: ›Ksch, ksch‹ und bündelte ihn so fest ins Kissen, daß ihm bald der Odem ausging, aber es half nichts, der unerwünschte Gast schrie um so lauter.
Die junge Mutter, die blaß und elend im Bette lag, drehte sich ächzend nach der Wand. Sie mochte das Kind nicht sehen, – nein, nein! Als die Tant’ ihr’s hingehalten hatte: »Hei haste dän Bankert,« hatte sie es weggestoßen mit letzter Kraft: was ging es sie an?! Sie hätte sich die Ohren verstopfen mögen und den Quell ihrer Brust auch – mochte es krepieren! Und war’s nicht das beste, es ging rasch aus der Welt, in die es zu rasch gekommen war?!
Wilde Gedanken durchjagten den Kopf der Wöchnerin. In der Nacht lag sie wie im Fieber. Da sah sie die heilige Jungfrau am Bette stehen; zärtlich blickte die auf das wächserne Jesuskind in ihrem Arm. Aber dann verfinsterte sich plötzlich ihr Gesicht, und sie hob den Finger gegen das Bett – drohte die Heilige?!
In rastloser Unruhe ächzte die Wöchnerin und schlug um sich; das Kind an ihrer Seite schrie gellend, und die Alte humpelte scheltend und verdrossen durch die unwirtliche Stube. – – –
Der kleine Junge – Ambrosius wurde er getauft nach dem Apriltag, an dem er geboren war – schrie noch oft, denn seine Mutter entwöhnte ihn bald, und das Läppchen mit gekautem Brot und ein wenig Zucker, das ihm die Tant’ in den Mund stopfte, ersetzte ihm nicht die Muttermilch. Schon zum Mai war Ammei hinunter ins Bad gezogen. Sie hatte sich vermietet, obgleich ihre Füße noch dick geschwollen waren und so weh taten, daß sie oft kaum gehen konnte. Und sie mußte doch gehen, sogar laufen, treppauf, treppab, den ganzen Tag. Das Haus war voll besetzt, bis unters Dach wohnten die Fremden; und die Küche war unten im Kellergeschoß. Ammei weinte oft nachts in ihrer Kammer vor Schmerz und vor Wut über das böse Andenken, das ihr der Balg hinterlassen hatte.
Kam kaum die Sonne über die Waldberge herauf, so hieß es: Stiefel putzen, Kleider bürsten, Wasser schleppen – jetzt zum Brunnenhaus laufen, um den ersten Becher der Quelle für die Herrschaften zu holen – jetzt zum Bäcker nach Frühstücksbrot eilen – jetzt zur Post rennen, denn die Gäste verlangten ihre Briefschaften beim Morgenkaffee – jetzt in der Küche Kartoffeln schälen, Gemüse putzen und Feuerung zutragen, Teller abwaschen und Spülwasser ausschütten, und dieses und jenes, und wenn am Abend alle andren zur Ruhe waren, dann mußten die Flure gekehrt und die Treppen gescheuert werden. Und wenn die Herrschaften dann endlich abreisten, war das Trinkgeld doch nicht halb so groß als die Mühe gewesen war; das Stubenmädchen freilich hatte sich nicht zu beklagen, aber den Laufpudel, den bäurischen Ungeschick, hatte niemand für voll angesehen. Dann weinte Ammei wieder, und zählte die Markstücke und fluchte dem Balg, für den sie ihr sauer erworbenes Geld nun heimschicken sollte. Gern hätte sie etwas davon zurückbehalten, aber die Alte ließ nicht locker, die preßte ihr den letzten Groschen aus. Wenn sie nicht jeden Monat schickte, gleich kam ein Brief, den die Tant’ dem Lehrer diktiert, oder sie kam gar selber hinunter ins Bad, – ei, da konnte sie noch wacker laufen! – spürte der Nichte nach bis in die Küche und machte ihr da ein beschämendes Aufgebot. Bald war dieses, bald jenes für das Kind nötig – immer für das Kind – mußte denn der Balg es haben wie ein Prinz?!
Verdrossen schlorrte Ammei eines Sonntags, Ende der Saison, hinauf in ihr Dorf. Sie wollte auch fürder drunten im Bad bleiben – die Madam war zufrieden mit ihr und konnte sie auch winters gebrauchen – so wollte sie nur, ehe der erste Schnee kam, noch einmal nach dem Kinde schauen.
Zur Rechten dräute die schwarze Ley; tief zur Linken donnerte der Wildbach in den Schluchten.