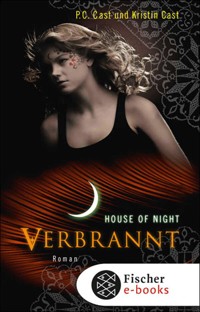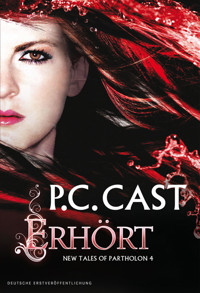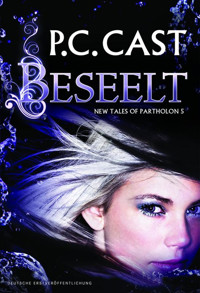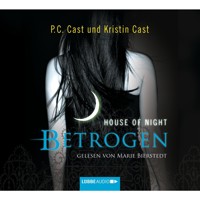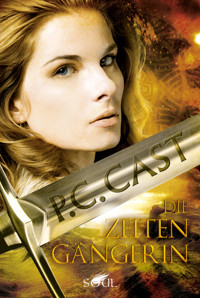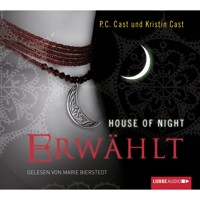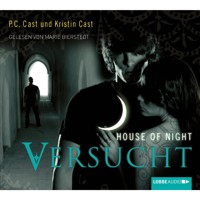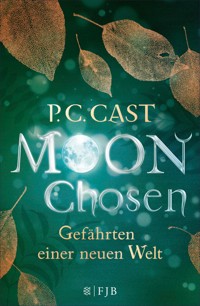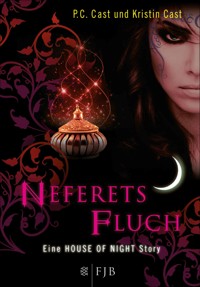
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: House of Night Story
- Sprache: Deutsch
Sie war nicht immer mächtig, aber sie war schon immer schön. Und diese Schönheit wurde ihr zum Verhängnis. In dem Waisenhaus in Chicago, in dem sie aufwuchs, war sie das Opfer vieler Begierden. Die Spuren hinterlassen haben – dunkle Spuren. Erst als sie Gezeichnet wird, kann sie ihren Ärger in Macht verwandeln, und nimmt sich das wieder, was ihr gestohlen wurde. Neferet war ein unschuldiges Opfer, doch sie wurde zu einer mächtigsten, verführerischsten Hohepriesterinnen aller Zeiten... Dies ist ihre Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
P.C. Cast
Neferets Fluch
Impressum
Erschienen bei FISCHER FJB
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel ›Neferet’s Curse‹ bei St. Martin‹ Press, New York, N.Y.
© 2013 by P.C.Cast and Kristin Cast
Umschlagabbildung: Getty Images / Shutterstock
Für die Illustrationen: © 2013 by Kim Doner
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press LLC durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt.
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
ISBN 978-3-10-402384-7
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen
des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402384-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
15. Januar 1893
Emily Wheilers Aufzeichnungen
15. April 1893
Emily Wheilers Aufzeichnungen
19. April 1893
Emily Wheilers Aufzeichnungen
27. April 1893
Emily Wheilers Aufzeichnungen
1. Mai 1893
Emily Wheilers Aufzeichnungen
8. Mai 1893
– Neferets Aufzeichnungen – Erster und letzter Eintrag
Liebe Leser
Danksagung
15. Januar 1893
Emily Wheilers Aufzeichnungen
Dies ist kein Tagebuch. Ich empfinde Abscheu allein bei dem Gedanken, meine Gedanken und Taten in einem Buch zu horten und wegzuschließen, als seien sie kostbare Juwelen.
Ich weiß: Meine Gedanken sind keine kostbaren Juwelen.
Seit einiger Zeit befürchte ich, dass meine Gedanken eher Früchte des Wahnsinns sind.
Aus diesem Grund drängt es mich, sie niederzuschreiben. Mag sein, dass mir irgendwann in der Zukunft beim nochmaligen Durchlesen klarwerden wird, warum mir jene grauenhaften Dinge zugestoßen sind.
Oder mir wird klarwerden, dass ich in der Tat verrückt geworden bin.
Sollte das der Fall sein, so mag dies Büchlein bezeugen, wie mein paranoider Wahn begann, damit auf dieser Grundlage nach einem Heilmittel gesucht werden kann.
Nur – will ich geheilt werden?
Vielleicht sollte diese Frage vorerst zurückgestellt werden.
Ich will mit dem Tag beginnen, an dem alles anders wurde. Es war nicht der heutige, an dem ich diese Niederschrift beginne. Er liegt zweieinhalb Monate zurück – am ersten November des Jahres 1892. Dem Morgen, als meine Mutter starb.
Selbst hier, auf den stummen Seiten dieses Büchleins, zögere ich, mir jenen schrecklichen Morgen ins Gedächtnis zu rufen. Meine Mutter starb in einem Schwall von Blut, der sich aus ihr ergoss, nachdem sie den winzigen, leblosen Körper meines Bruders zur Welt gebracht hatte – Barrett, benannt nach Vater. Schon damals, nicht anders als heute, hatte ich das Gefühl, dass Mutter einfach aufgab, als sie erkannte, dass Barrett nicht leben würde. Es war, als könnte nicht einmal die Lebenskraft, die ihr innewohnte, den Verlust ihres heißersehnten einzigen Sohnes ertragen.
Oder konnte sie es in Wahrheit nicht ertragen, nach dem Verlust des heißersehnten einzigen Sohnes Vater in die Augen zu sehen?
Vor jenem Morgen wäre mir diese Frage niemals gekommen. Bis zu dem Tag, an dem meine Mutter starb, war mein Kopf von Fragen wie jener erfüllt, wie es mir wohl gelingen würde, Mutter zu überreden, mir ein zweites Radfahrkostüm zu kaufen, wie sie derzeit der letzte Schrei sind, oder wie ich es wohl anstellen könnte, dass mein Haar genauso aussah wie das eines Gibson Girls.
Hatte ich vor dem Tag, an dem Mutter starb, an Vater gedacht, so auf eine Weise, wie die meisten meiner Freundinnen an ihre Väter denken – als unnahbaren, etwas einschüchternden Patriarchen. In meinem Fall war es sogar so, dass ich Lob von ihm nur aus Mutters Kommentaren erahnen konnte. Im Grunde schien er mich vor Mutters Tod kaum wahrzunehmen.
Als Mutter starb, war Vater nicht dabei. Der Arzt hatte beschieden, dass der primitive Geburtsvorgang nichts sei, was einem Mann zu sehen anstünde, schon gar nicht einem Mann von solcher Bedeutung wie Barrett H. Wheiler, Präsident der First National Bank von Chicago.
Und ich? Die Tochter von Barrett und Alice Wheiler? Mir gegenüber sagte der Arzt nichts von der Primitivität einer Geburt. Tatsächlich nahm er erst überhaupt Notiz von mir, als Mutter tot war und Vater mich bei ihm in Erinnerung rief.
»Emily, verlasse mich nicht. Warte mit mir, bis der Doktor kommt, und bleib dann hier in der Fensternische sitzen. Du sollst wissen, was es bedeutet, Ehefrau und Mutter zu sein. Du sollst dich nicht blind darauf einlassen, wie ich es tat.« So hatte Mutter mich mit ihrer leisen Stimme gebeten, die bei allen, die sie nicht näher kannten, den Eindruck erweckte, sie sei etwas schlicht im Geiste und lediglich ein hübsches, gefügiges Anhängsel an Vaters Arm.
Ich hatte genickt, »Ja, Mutter« gesagt und getan wie befohlen. Ich erinnere mich, wie ich still wie ein Schatten in der unbeleuchteten Fensternische gegenüber von Mutters Bett in ihrem prächtigen Schlafzimmer gesessen hatte. Ich sah alles mit an. Sie brauchte nicht lange, um zu sterben.
Es war so unvorstellbar viel Blut. Schon Barrett kam in Blut gebadet zur Welt – ein winziges, schlaffes, blutverschmiertes Geschöpf, das aussah wie eine grotesk verkrümmte Puppe. Aber nachdem er in jenem letzten Wehenkrampf aus der Öffnung zwischen den Beinen meiner Mutter ausgestoßen worden war, hörte das Blut nicht auf zu fließen. In immer neuen Wellen trat es aus, während meine Mutter so lautlos weinte, wie ihr Sohn da lag. Dass sie weinte, weiß ich, weil sie das Gesicht abwandte, als der Arzt ihr totes Kind in weiße Tücher wickelte. Und dann sah sie mich an. Da war es mir unmöglich, sitzen zu bleiben. Ich stürzte an ihr Bett, während der Arzt und die Schwester sich vergeblich mühten, den roten Strom aus ihrem Innern zum Versiegen zu bringen. Ich nahm ihre Hand und strich ihr das feuchte Haar aus der Stirn. Angsterfüllt und unter Tränen versuchte ich ihr Trost zuzusprechen, ihr zu versichern, alles werde gut, wenn sie sich nur etwas ausgeruht habe.
Sie hatte meine Hand gedrückt. »Wie schön, dass du am Ende bei mir bist.«
»Nein! Du wirst wieder gesund, Mutter!«, hatte ich protestiert.
»Pssst«, hatte sie sanft gemurmelt. »Halte nur meine Hand.« Und ihre Stimme versagte, doch ihre smaragdfarbenen Augen, von denen jeder sagte, meine sähen ganz genauso aus, blieben auf mich geheftet, während ihr gerötetes Gesicht entsetzlich weiß wurde und ihr Atem abflachte, spärlicher wurde und dann, mit einem Seufzer, ganz erstarb.
Da küsste ich ihre Hand, taumelte zurück in meine Fensternische und weinte bitterlich, unbemerkt von der Schwester, der die grausame Aufgabe zufiel, die blutgetränkten Leintücher fortzuschaffen und Mutter so herzurichten, dass ihr Anblick Vater zuzumuten war. Doch Vater wartete nicht, bis Mutter für ihn bereit war. Ohne dem Protest des Arztes Beachtung zu schenken, stürzte er ins Zimmer.
»Ein Sohn, sagten Sie?« Vater warf nicht einmal einen Blick auf das Bett. Stattdessen eilte er zu der Kinderwiege, in die man Barretts verhüllten Körper gelegt hatte.
»Es war in der Tat ein Knabe«, sagte der Arzt betrübt. »Zu früh geboren, wie ich Ihnen bereits sagte, Sir. Niemand hätte etwas tun können. Seine Lungen waren noch zu schwach, um Atem zu holen. Er gab nicht einen einzigen Schrei von sich.«
»Tot … totgeboren.« Müde rieb Vater sich das Gesicht. »Ich weiß noch, als Emily geboren wurde, schrie sie so herzhaft, dass ich sie unten im Salon hörte und glaubte, es sei ein Sohn.«
»Mr. Wheiler, ich weiß, nach dem Verlust der Gattin und des Sohnes ist es nur ein geringer Trost, aber Sie haben noch eine Tochter, deren Nachkommen die Ihren sein werden.«
»Es war sie, die mir Nachkommen versprach!«, donnerte Vater und sah endlich zu Mutter hinüber.
Da muss ich einen kleinen, wehen Laut von mir gegeben haben, denn sofort richteten sich Vaters Augen auf meine Fensternische. Sie verengten sich, und einen Moment lang schien es, als erkenne er mich nicht. Dann schüttelte er sich, wie um etwas Unangenehmes von sich abzustreifen.
»Emily, was machst du denn hier?« Es klang so zornig, dass es mir schien, als wolle er etwas ganz anderes fragen als nur, warum ich zu jener Stunde in jenem Zimmer sei.
»M-mutter wollte, d-dass ich bleibe«, stotterte ich.
»Deine Mutter ist tot.« Aus dem Zorn wurde der knappe, harte Ton der Wahrheit.
»Und dies ist kein Ort für eine junge Dame.« Errötend wandte sich der Arzt an meinen Vater. »Ich bitte um Verzeihung, Mr. Wheiler. Die Geburt verlangte all meine Aufmerksamkeit. Ich habe das Mädchen schlicht und einfach nicht bemerkt.«
»Sie trifft keine Schuld, Dr. Fisher. Meine Gemahlin tat und sagte oft wunderliche Dinge. Dies war nun wohl das letzte Mal.« Mit einer Geste scheuchte er den Arzt, die Dienstmägde und mich selbst davon. »Lassen Sie mich mit Mrs. Wheiler allein. Alle.«
Ich wollte aus dem Zimmer rennen – alldem so schnell wie möglich entfliehen –, doch von dem langen unbeweglichen Sitzen waren meine Füße kalt und taub geworden. Als ich an Vater vorbeiging, stolperte ich. Seine Hand ergriff mich stützend am Ellbogen. Erschrocken sah ich auf.
Der Blick, mit dem er auf mich herabsah, schien plötzlich viel sanfter. »Du hast die Augen deiner Mutter.«
Alles, was ich schwindelig und außer Atem hervorbrachte, war: »Ja.«
»Warum auch nicht. Schließlich bist nun du die Dame des Hauses Wheiler.«
Damit ließ Vater mich los und trat langsam, schweren Schrittes, an das blutgetränkte Bett.
Während ich die Tür hinter mir schloss, hörte ich, wie er zu weinen begann.
Auch für mich begann nun eine seltsame, einsame Zeit der Trauer. Wie betäubt brachte ich das Begräbnis hinter mich und brach danach zusammen. Es war, als habe der Schlaf die Herrschaft über mich übernommen und ich könne mich nicht befreien. Zwei volle Monate lang verließ ich kaum das Bett. Mich kümmerte nicht, dass ich dünn und blass wurde oder dass die Freundinnen meiner Mutter und ihre Töchter, die sich zu Kondolenzbesuchen anmelden wollten, keine Antwort erhielten. Ich nahm keine Notiz davon, dass ein Weihnachtsfest und ein Neujahrstag heranrückten und vorübergingen. Mary, die Kammerfrau meiner Mutter, die ich geerbt hatte, flehte mich an, sprach mir gut zu oder schalt mich. Es kümmerte mich nicht.
Vater war es, der mich am fünften Januar den Klauen des Schlafs entriss. In meinem Zimmer war es kalt geworden, so kalt, dass ich von meinem eigenen Zittern erwachte. Das Feuer in meinem Kamin war ausgegangen, und so zog ich an dem Band, das mit Marys Glocke in den Dienstbotenquartieren, in den tiefsten Gründen des Hauses, verbunden war. Doch sie kam nicht. Ich weiß noch, wie ich meinen Hausmantel anlegte und dabei flüchtig dachte, wie weit er zu sein schien und wie ich darin versank. Langsam und zitternd stieg ich die breite hölzerne Treppe vom zweiten Stock ins Erdgeschoss hinab, um nach Mary zu suchen. Als ich am Fuß der Treppe anlangte, sah Vater aus seinem Studierzimmer. Zunächst war seine Miene ausdruckslos, dann erschien darauf Überraschung. Gefolgt von etwas, wovon ich recht sicher bin, dass es Ekel war.
»Emily, du siehst jämmerlich aus! So bleich und dünn! Bist du krank?«
Ehe ich antworten konnte, erschien Mary in der Vorhalle und kam auf uns zugeeilt. »Ich hab’s Ihnen doch gesagt, Mr. Wheiler, sie isst kaum noch was. Schläft nur noch. Welkt von Tag zu Tag mehr dahin.« Bei ihrer lebhaften Rede war ihr weicher irischer Akzent stärker zu hören als gewöhnlich.
»Nun, mit diesem Benehmen ist auf der Stelle Schluss«, sagte Vater streng. »Du verlässt ab sofort dein Bett, Emily. Du wirst wieder essen und täglich im Garten spazieren gehen. Ich dulde nicht, dass du so verhungert aussiehst. Immerhin bist du die Dame des Hauses, und Lady Wheiler hat nicht auszusehen wie ein dürres Ding aus der Gosse.«
Sein Blick war hart, und sein Zorn schüchterte mich ein, vor allem nachdem mir bewusst wurde, dass Mutter nicht aus ihrem Salon kommen, mit ihrer Lebhaftigkeit aller Augen auf sich ziehen, mich davonscheuchen und Vater durch eine Berührung und ein Lächeln besänftigen würde.
Automatisch trat ich einen Schritt zurück. Seine Miene wurde nur noch finsterer. »Du magst zwar aussehen wie deine Mutter, aber ihr Schwung fehlt dir. So lästig sie manchmal war, ich bewunderte ihren Schwung. Ich vermisse ihn.«
»Ich – ich vermisse Mutter auch«, entfuhr es mir.
»Ja sicher, Täubchen«, tröstete mich Mary. »Sind ja erst zwei gute Monate.«
Vater ignorierte sie völlig. »Dann haben wir wohl doch etwas gemeinsam«, sagte er, als sei sie nicht vorhanden, tätschelte mir unsicher das Haar und zupfte meinen Hausmantel zurecht. »Der Verlust von Alice Wheiler hat uns zusammengebracht.« Er sah mich an, musterte mich genau. »Jawohl, du siehst genauso aus wie sie.« Vater strich sich über den dunklen Bart. Das Harte, Einschüchternde wich aus seinem Blick. »Wir müssen das Beste aus ihrem Fehlen machen, nicht wahr?«
»Ja, Vater.« Sein zunehmend sanfterer Ton erleichterte mich.
»Gut. Dann erwarte ich, dass du dich wieder jeden Abend zum Dinner zu mir gesellst, wie du und deine Mutter es früher taten. Du wirst dich nicht mehr in deinem Zimmer verkriechen und deine Schönheit weghungern.«
Da lächelte ich – lächelte wahrhaftig. »Gern.«
Er grunzte etwas, klopfte sich mit der Zeitung, die er in der Hand hielt, auf den Arm und nickte. »Dann bis zum Dinner.« Und er ging an mir vorbei in den Westflügel des Hauses.
»Vielleicht habe ich heute Abend sogar ein bisschen Hunger«, sagte ich zu Mary, die mir unter besorgtem Geschnatter die Treppe hinaufhalf.
»Gut zu sehen, dass er Ihnen endlich Beachtung schenkt, o ja«, flüsterte Mary glücklich.
Ich beachtete sie kaum. Mein einziger Gedanke war, dass es zum ersten Mal seit zwei Monaten etwas außer Schlaf und Traurigkeit gab, was mich beschäftigte. Vater und ich hatten etwas gemeinsam!
Zum Dinner kleidete ich mich sehr sorgfältig an. Erst jetzt begriff ich, wie schrecklich dünn ich geworden war, da mein schwarzes Trauerkleid eingenäht werden musste, um nicht hässlich lose an mir zu hängen. Mary steckte mir das Haar zu einem schweren Chignon auf, unter dem mir mein hageres Gesicht viel älter schien, als es meinen fünfzehn Jahren entsprach.
Niemals werde ich vergessen, wie ich zusammenzuckte, als ich das Speisezimmer betrat und die beiden Gedecke auf dem Tisch sah – das von Vater an der Stirnseite, wo er stets gesessen hatte, und meines zu seiner Rechten. Dort, wo bisher das von Mutter gewesen war.
Er stand auf und hielt mir Mutters Stuhl hin. Als ich mich setzte, glaubte ich, noch immer ihr Parfüm zu riechen – ein Hauch Rosenwasser, darüber ein wenig von der Zitronentinktur, mit der sie ihr Haar behandelte, um den kastanienroten Schimmer stärker hervorzubringen.
George, der Neger, der uns bei Tisch bediente, schöpfte uns Suppe in die Teller. Ich hatte mir Sorgen gemacht, ob nicht bedrückende Stille herrschen würde, doch mit dem Essen kam auch Vaters gewohnte Plauderei in Gang. »Das Komitee der World’s Columbian Exposition hat sich geschlossen hinter Burnham gestellt. Wir unterstützen ihn bedingungslos. Zuerst fragte ich mich ja, ob der Mann nicht größenwahnsinnig sei, ob er nicht Unmögliches zu erreichen versuche – aber seine Vision, die Chicagoer Weltausstellung solle selbst den Pariser Glanz in den Schatten stellen, könnte sich doch verwirklichen lassen. Zumindest wirkt sein Entwurf realistisch – extravagant, aber realistisch.« Er hielt inne, um sich einen großen Bissen von dem Steak mit Kartoffeln in den Mund zu stecken, das seinen leeren Suppenteller ersetzt hatte. In diesem kurzen Schweigen konnte ich die Stimme meiner Mutter hören.
»Verlangt heute nicht jeder nach Extravaganz?«
Erst als Vater mich ansah, erkannte ich, dass ich es war, die gesprochen hatte, und nicht Mutters Geist. Unter seinem scharfen, dunkeläugigen Blick erstarrte ich und wünschte, ich wäre stumm geblieben und hätte das Mahl vor mich hin träumend hinter mich gebracht, wie ich es in der Vergangenheit so oft getan hatte.
»Woher willst du denn wissen, wonach die Welt verlangt?« Noch war die Schärfe in seinem Blick, doch seine Mundwinkel hatten sich ganz leicht gehoben, genau dieses halbe Lächeln, mit dem er Mutter so oft bedacht hatte.
Ich weiß noch, wie mich Erleichterung durchströmte und ich das Lächeln freudig erwiderte. Diese Frage hatte ich ihn Mutter öfter stellen hören, als ich zählen konnte. Ich ließ ihre Worte für mich antworten. »Ich weiß, du glaubst, wir Frauen könnten nur schwatzen, aber wir können auch zuhören.« Ich sprach schneller und leiser als Mutter, aber in Vaters Augenwinkeln bildeten sich Fältchen der Zustimmung und Belustigung.
»In der Tat …«, sagte er schmunzelnd, schnitt sich ein großes Stück des blutig roten Fleisches klein, verschlang es, als sei er am Verhungern, und spülte mit mehreren Gläsern Wein nach, der ebenso rot und dick war wie die Flüssigkeit, die aus dem Fleisch austrat. »Aber Burnham und seinem Rudel Architekten muss ich genau auf die Finger schauen, sehr genau. Sie haben ihr Budget schon heillos überzogen, und diese Arbeiter … lauter Scherereien … nichts als Scherereien …«, sagte er mit vollem Mund, und kleine Stückchen seines Essens und Weins tropften ihm in den Bart. Diese Angewohnheit, das wusste ich, hatte Mutter verabscheut und ihn oft dafür ausgeschimpft. Ich tat nichts dergleichen, noch verabscheute ich jene altbekannte Schwäche. Ich zwang mich lediglich, zu essen und passende anerkennende Laute von mir zu geben, während er weiter und weiter über die Notwendigkeit verantwortungsvollen Wirtschaftens und darüber schwadronierte, welche Sorge der fragile Gesundheitszustand eines der führenden Architekten dem Komitee bereitete. Schließlich sei bereits Mr. Root einer Lungenentzündung erlegen, und manche behaupteten, er und nicht Mr. Burnham sei die treibende Kraft hinter dem gesamten Projekt gewesen.
Das Dinner verging wie im Fluge. Schließlich war Vater satt und stand auf, und wie er zahllose Male zu meiner Mutter gesagt hatte, sagte er nun zu mir: »Ich ziehe mich auf einen Whiskey und eine Zigarre in meine Bibliothek zurück. Hab noch einen schönen Abend, meine Liebe. Wir sehen uns bald.« Wie klar erinnere ich mich, welche Wärme ich für ihn empfand und dachte: Er behandelt mich wie eine Erwachsene – wirklich wie die Dame des Hauses!
»Emily«, sprach er weiter, leicht schwankend und sichtlich angetrunken. »Lass uns doch dieses neue Jahr als Neuanfang für uns beide betrachten. Wollen wir versuchen, von jetzt an gemeinsam weiterzugehen, meine Liebe?«
Tränen traten mir in die Augen, und ich sah ängstlich und erwartungsvoll zu ihm auf. »Ja, Vater. Das fände ich schön.«
Da nahm er unerwartet meine schmale Hand in seine große, beugte sich darüber und küsste sie – genau wie er stets die Hand meiner Mutter zum Abschied geküsst hatte. Obgleich seine Lippen und sein Bart feucht von Wein und Essen waren, lächelte ich weiter und fühlte mich ganz als Dame, als er mir über unseren vereinten Händen in die Augen sah.
Da bemerkte ich es zum ersten Mal – das, was ich inzwischen bei mir den brennenden Blick nenne. Sein Blick bohrte sich so intensiv in meinen, dass ich fast glaubte, ich müsse gleich zerspringen. »Du hast ihre Augen«, sagte er verwaschen, und ich konnte seinen stechenden, vom Wein geschwängerten Atem riechen. Ich stellte fest, dass ich kein Wort herausbekam. Zitternd nickte ich. Da ließ Vater meine Hand fallen und verließ mit unstetem Schritt das Zimmer. Ehe George kam, um den Tisch abzuräumen, nahm ich meine Leinenserviette, rieb damit die Nässe von meinem Handrücken und fragte mich, warum mir tief drinnen so unbehaglich zumute war.
Zwei Tage später empfing ich zum ersten Mal zwei Besucherinnen, Madeleine Elcott und ihre Tochter Camille. Mr. Elcott war im Vorstand von Vaters Bank, und Mrs. Elcott war eine gute Freundin von Mutter gewesen, obgleich mir nie ganz klar gewesen war, weshalb. Mutter war wunderschön, charmant und für ihre Gastfreundlichkeit weithin bekannt gewesen. Mrs. Elcott hingegen kam mir scharfzüngig, klatschsüchtig und knauserig vor. Wenn sie und Mutter bei einer Abendgesellschaft nebeneinander saßen, fand ich immer, dass Mrs. Elcott aussah wie ein zerrupftes Huhn neben einer Taube, aber sie besaß die Gabe, Mutter zum Lachen zu bringen, und Mutter hatte ein so zauberhaftes Lachen, dass der Grund dafür völlig unwichtig schien. Einmal hatte ich gehört, wie Vater zu Mutter sagte, sie solle nur so oft wie möglich Gesellschaften bei uns geben, da es auf den Dinnerpartys im Hause Elcott zwar nicht an Klatsch und Tratsch, wohl aber am einen oder anderen Gang des Menüs und an ausreichend geistigen Getränken mangele. Hätte mich jemals jemand nach meiner Meinung gefragt, was natürlich nie geschah, ich hätte Vater aus ganzem Herzen zugestimmt. Das Haus der Elcotts, das keine Meile von unserem entfernt lag, sah von außen durchaus stattlich und schicklich aus, das Innere jedoch war spartanisch und, um ehrlich zu sein, recht trist eingerichtet. Kein Wunder, dass Camille mich so gern besuchte! Camille war meine beste Freundin. Wir waren etwa im gleichen Alter, sie nur sechs Monate jünger. Camille redete viel, doch ohne die boshafte, verleumderische Zunge ihrer Mutter. Dank der engen Freundschaft unserer Eltern waren sie und ich zusammen aufgewachsen und betrachteten uns mehr als Schwestern denn als Freundinnen.
»Oh, meine arme traurige Emily! Wie dünn und schwach du aussiehst«, rief Camille, durcheilte den Salon meiner Mutter und umarmte mich.
»Nun, selbstverständlich sieht sie dünn und schwach aus!« Mrs. Elcott schob ihre Tochter beiseite und nahm steif meine Hände in ihre, ohne auch nur ihre weißen Lederhandschuhe abzunehmen. Wenn ich an ihre Berührung zurückdenke, finde ich sie kalt und gewissermaßen reptilienhaft. »Emily hat ihre Mutter verloren, Camille. Denk nur daran, wie elend dein Leben wäre, wenn ich von dir ginge. Ich behaupte, du sähest nicht besser aus als die arme Emily. Ich bin sicher, die liebe Alice blickt voller Verständnis und Wohlwollen auf ihre Tochter herab.«
Mich schockierte ein wenig, wie freimütig sie von Mutters Tod sprach. Während wir uns voneinander trennten, um uns in der Raumecke auf dem Diwan und den beiden dazu passenden Sesseln niederzulassen, versuchte ich, Camilles Augen zu begegnen, um mit ihr unseren alten Blick zu tauschen, der unsere völlige Einigkeit darüber zum Ausdruck brachte, welch schrecklich peinliche Dinge unsere Mütter manchmal sagten. Doch Camille schien überall hinzusehen, nur nicht in meine Augen. »Ja, Mutter, natürlich. Entschuldigung«, war alles, was sie zerknirscht murmelte.
Unsicher versuchte ich, mich in dieser neuen Welt der Gesellschaft zurechtzufinden, die mir plötzlich sehr fremd vorkam. Es erleichterte mich sehr, als das Hausmädchen mit Tee und Kuchen hereinkam. Ich goss den Tee ein. Mrs. Elcott und Camille musterten mich dabei genau.
»Du bist wirklich sehr dünn«, sagte Camille schließlich.
»Das wird sich schon wieder geben«, sagte ich und lächelte ihr aufmunternd zu. »Zuerst fiel es mir schwer, etwas anderes zu tun, als zu schlafen, aber Vater bestand darauf, dass ich gesund werde. Er erinnerte mich daran, dass ich ja nun die Dame des Hauses bin.«
Camille warf einen flüchtigen Blick auf ihre Mutter. Ich konnte den harten Ausdruck in Mrs. Elcotts Augen nicht lesen, doch er brachte ihre Tochter zum Verstummen.
»Das ist sehr tapfer von dir, Emily«, sagte Mrs. Elcott in die Stille. »Ich bin sicher, dass du deinem Vater eine große Stütze bist.«
»Wir haben all die Zeit versucht, dich zu besuchen, aber du hast uns nie empfangen, nicht einmal an den Feiertagen. Als wärest du verschwunden!«, brach es aus Camille hervor, während ich ihr Tee einschenkte. »Ich dachte schon, du wärst auch gestorben.«
Ihre Worte weckten Reue in mir. »Tut mir leid. Ich wollte dich nicht beunruhigen.«
»Das hast du auch nicht.« Mrs. Elcott sah ihre Tochter finster an. »Camille, Emily war nicht verschwunden. Sie war in Trauer.«
»Das bin ich noch immer«, sagte ich leise. Camille nickte und wischte sich die Augen, aber ihre Mutter war zu sehr damit beschäftigt, sich einen der Teekuchen mit Zuckerguss zu nehmen, um uns Aufmerksamkeit zu schenken.
Das Schweigen schien sich zu dehnen, während wir an unserem Tee nippten und ich den kleinen weißen Kuchen auf meinem Teller hin und her schob. Da fragte Mrs. Elcott plötzlich in höchster Erregung: »Warst du wirklich dort, Emily? Im Zimmer, als Alice starb?«
Ich sah zu Camille, wünschte mir einen Augenblick lang, sie könnte ihre Mutter zum Schweigen bringen, aber das war natürlich ein dummer, vergeblicher Wunsch. Auf dem Gesicht meiner Freundin spiegelte sich mein eigenes Unbehagen, aber sie wirkte nicht schockiert darüber, wie wenig sich ihre Mutter um Anstand und Privatsphäre kümmerte. Da wurde mir klar, dass Camille gewusst hatte, dass ihre Mutter mich derart ausfragen wollte. Ich holte tief Luft und antwortete zögernd, aber wahrheitsgemäß: »Ja. Ich war dort.«
»Das muss grauenhaft gewesen sein«, sagte Camille schnell.
»Ja«, sagte ich und stellte meine Teetasse mit Bedacht auf die Untertasse, ehe eine von ihnen sehen konnte, wie meine Hand zitterte.
»Ich nehme an, alles war voller Blut«, sagte Mrs. Elcott und nickte langsam, als stimme sie schon jetzt meiner Antwort zu.
Ich faltete die Hände fest in meinem Schoß. »Ja.«
»Wir alle hatten solches Mitgefühl mit dir, als wir hörten, dass du mitansehen musstest, wie sie starb«, sagte Camille leise und unsicher.
Ich war so entsetzt, dass ich kein Wort herausbekam, und glaubte fast, meine Mutter schimpfen zu hören: Bedienstete! Über alles müssen sie sich den Mund zerreißen! Es traf mich tief, dass über Mutters Tod geklatscht worden war, aber zugleich wollte ich liebend gern mit Camille reden, ihr erzählen, welche Angst ich gehabt hatte. Doch ehe ich mich wieder so weit in der Gewalt hatte, um etwas zu sagen, kam mir Mrs. Elcotts scharfe Stimme zuvor. »In der Tat, man sprach wochenlang über nichts anderes. Deine arme Mutter wäre empört gewesen. Es ist jammerschade, dass du den Weihnachtsball verpasst hast, aber angesichts dessen, dass deine Anwesenheit bei ihrem grausigen Tod das Thema des Abends war …« Sie schüttelte sich. »Alice hätte es mit Recht entsetzlich gefunden.«